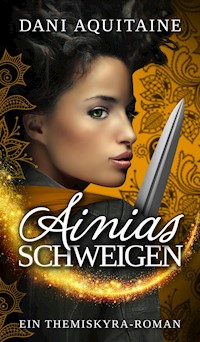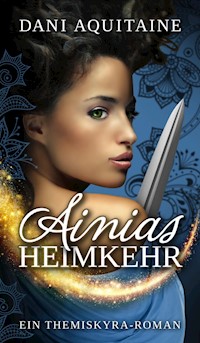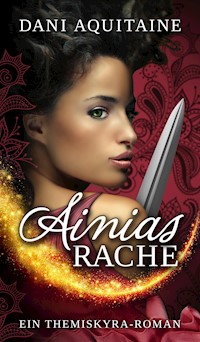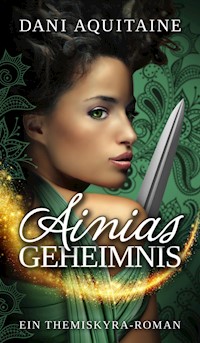
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ainias Geheimnis
- Sprache: Deutsch
"Plötzlich … war da greifbares Glück. Freude. Hoffnung. Vielleicht hatte das Leben doch noch mehr für mich auf Lager als lebenslänglich Themiskyra." Fernab der modernen Gesellschaft, verborgen von dichten, grünen Wäldern liegt Themiskyra, eine Stadt von Frauen, die schon seit Jahrtausenden harmonisch und im Einklang mit der Natur leben: Die Amazonen. Doch der Alltag in Themiskyra ist nicht immer leicht. Die Unabhängigkeit der weltfernen Amazonensiedlung bringt viele Entbehrungen mit sich, und das Leben dort langweilt die 17-jährige Ainia. Viel lieber reitet sie in die nahe Kleinstadt, wo sie schließlich auf den charmanten Kassian trifft, der ihr eine Welt voller Luxus und Glamour zeigt. Im Geheimen setzen sie ihre Treffen fort, denn den Frauen von Themiskyra ist es verboten, sich zu verlieben. Als unerwartet ein kleines Vermögen in Ainias Besitz gelangt, ahnt sie nichts von den schicksalhaften Konsequenzen und dem Unheil, das der Reichtum mit sich bringt. Schon bald muss sie eine Entscheidung treffen, die ihr Leben verändern wird - das möglicherweise mehr für sie bereithält, als sie sich jemals erhofft hatte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Für Hildo,die Nias Geschichte hören wollte.
DANI AQUITAINE
Band 1
Ein Themiskyra-Roman
AUFGEPASST:
Ein Glossar mit Begriffserklärungen befindet sich am Ende des Buches.
WEITERE BÄNDE DIESER REIHE:
Ainias Rache (Band 2)
Ainias Schweigen (Band 3)
Ainias Heimkehr (Band 4)
WEITERE THEMISKYRA-ROMANE:
Themiskyra – DIE BEGEGNUNG (Band 1)
Themiskyra – DAS VERSPRECHEN (Band 2)
Themiskyra – DIE SUCHE (Band 3)
Finger weg! Pollys Aufzeichnungen
© 2018 Dani Aquitaine
Umschlaggestaltung: Dani Aquitaine
Verwendetes Bildmaterial:
Amazone: © Coka, Fotolia
Faltenwurf: © inarik, Fotolia
Goldbogen: © vik_y, Fotolia
Schwert: © Paul Fleet, 123rf.com
Floraler Hintergrund: © mohaafterdark, DeviantArt
Verwendete Schriften:
Liberation Serif unter der SIL Open Font License
La Portenia de la Boca by Diego Giaccone, Angel Koziupa & digitized by Alejandro Paul
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7469-3896-7
Hardcover:
978-3-7469-3897-4
e-Book:
978-3-7469-3898-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
KAPITEL 1
Ich starrte angestrengt in den kleinen Spiegel, der über dem Regal mit den Kosmetikprodukten angebracht war. Beobachtete. Rechts von mir Abschminktücher und Wattepads, davor ein vielleicht siebenjähriges Mädchen in rosa Kleidung, das ganz in den Anblick der ebenfalls rosafarbenen Sonderangebote im untersten Fach vertieft war. Harmlos.
Links von mir: Eine alte Dame mit weißer Pudelfrisur, die mit zusammengekniffenen Augen und langgestrecktem Arm die Inhaltsstoffe auf einem Röhrchen mit Gebissreinigungstabletten studierte. Harmlos.
Und geradeaus: Ich. 17 Jahre, karamellfarbene Haut, grüne Augen, schwarze Locken, den Tester eines dunkelgrünen Eyeliners auf Augenhöhe in meiner Hand. Nicht, dass mir wirklich etwas daran lag, den Stift auszuprobieren – nein, ich wollte nur meine Umgebung im Auge behalten. Kontrollierte sie ein letztes Mal. Die Luft war rein.
Ich atmete tief ein, roch Seife, Waschmittel, Bohnerwachs. Rein. Mein Herz klopfte stärker, und obwohl mir Nervosität durch den Körper fuhr, ließ ich ganz langsam, ganz unauffällig einen dunkelroten Lippenstift im Wert von 14,99 Talern im Ärmel verschwinden. Nichts geschah. Keine Sirenen ertönten, niemand kam auf mich zugestürzt. Mein Puls beruhigte sich. Ich linste zu den Lidschatten, hätte gerne noch etwas eingesteckt, doch dann hörte ich draußen die Turmuhr viermal schlagen. Entschieden legte ich den Eyeliner zurück und drehte mich in Richtung Ausgang um, stolperte – und verschwand in einer riesigen, diamantstaubig-funkelnden Glitzerwolke.
„He!“, sagte das kleine Mädchen, und: „Wow!“
Wow, in der Tat. Starr vor Entsetzen beobachtete ich, wie sich die Glitzerpartikelchen langsam legten. Sie legten sich auf den Boden und auf das Mädchen, das ich wohl übersehen und umgerannt hatte und das nun mit einer geöffneten, leeren Glitzerpuder-Dose auf dem Boden saß. Die Diamantwolke legte sich auf meine Haare, meinen schwarzen Trenchcoat, meine Lederhose, meine Stiefel. Auf meine Hände, mein Gesicht, meine Wimpern, meine Augenbrauen.
Überall. Glitzer. Ich schnappte nach Luft, atmete Glitzer. Hustete. Spürte leichte Panik in mir aufsteigen, während ich versuchte, mir den Puder von der Kleidung zu klopfen. Vergebens. Das kleine, mit Diamantstaub überrieselte Mädchen blickte mich immer noch wie vom Donner gerührt an, verteilte Glitzerwölkchen mit jedem staunenden Wimpernschlag. Also wirklich. Drei Dinge kann ich ehrlich gesagt nicht besonders leiden. Hohe Höhen, tiefe Tiefen und Kinder. Und dass nun jemand aus der letzten Kategorie an meiner Misere schuld war, stimmte mich nicht gerade gewogen.
Warum ich wegen ein bisschen Regenbogenstaub nahe dran war, die Nerven zu verlieren? Weil ich meinen Schwestern nie würde erklären können, weshalb ich so funkelte. Nicht mal, was ich in Goldvelt zu suchen gehabt hatte. Und natürlich am allerwenigsten, dass ich eine meisterliche Diebin von allerlei Kleinzeug geworden war.
Aber, ganz ehrlich – was hatte ich schon für eine Wahl? Ich besaß kein Geld, um mir etwas zu kaufen. Arbeiten durfte ich nicht, nur für Themiskyra, die steinalte Amazonenstadt, die, was Komfort und Technik betraf, größtenteils im Mittelalter feststeckte und sich seit Jahr und Tag selbst versorgte, unabhängig und unbeachtet von Wirtschaft, Ämtern, Regierungen, Grenzen und generell allen anderen Menschen auf der Welt, von den Schwestern in anderen Gemeinschaften abgesehen.
In einem solchen System fließt natürlich kein Geld, alles läuft lediglich mit Tausch und Dankbarkeit. Taler sind da überflüssig. Nur ich war nie flüssig. Und ich war mir sicher: Läden wie die BeautyBase waren gut versichert. Denen konnte ich mal gar nichts anhaben mit meinem wöchentlichen Lippenstiftklau. Mein Gewissen war rein. Doch das Glitzerdesaster, in dem ich nun steckte, war wirklich eine Katastrophe. Mit Mühe löste ich mich aus meiner funkelnden Erstarrung, flüsterte dem Mädchen ein halbherziges „Entschuldigung!“ zu und eilte in Richtung Ausgang.
Kurz vor den Kassen verlangsamte ich meine Schritte nochmal, um nicht aufzufallen, sobald ich jedoch wieder in der Fußgängerzone und außer Sichtweite der Schaufenster war, stopfte ich den gestohlenen Lippenstift in meine Jackentasche und begann zu rennen. Ich lief durch die Straßen der Kleinstadt, bis ich das Ortsschild an der südlichen Stadtgrenze passiert hatte und bei der Wiese ankam, auf der ich meinen Wallach Xanthos zurückgelassen hatte, einen braven Fuchs, der immer auf mich wartete und auf einen Pfiff hin zu mir trabte. Kurz danach saß ich im Sattel und verfluchte mich selbst. Warum hatte ich das kleine Mädchen nur übersehen? Und warum musste es ausgerechnet Glitzerpuder sein? Und warum hatte ich mich nicht im Griff? Warum ließ ich das elende Stehlen nicht einfach?
Doch ich wusste, dass ich das nicht konnte. Der graue, mühselige Alltag in Themiskyra ganz ohne die Vorfreude auf meinen Samstag, auf den Nervenkitzel, auf meine Dinge, war einfach unvorstellbar für mich. So hätte ich nicht leben können.
Mein Versteck befand sich in den dichten Wäldern, die die Amazonensiedlung schützend umgaben und wie ein grüner Schutzwall von der Außenwelt abzuschirmen schienen. Ich quetschte mich durch einen Spalt in der Rinde einer dicken, uralten Esche, schlüpfte in ihren teils hohlen Stamm und tastete zuerst nach meiner Taschenlampe, dann nach einer der Holzkisten, die ich auf einem schmalen Regalboden in Kopfhöhe verstaut hatte.
Obwohl ich wusste, dass mir ihr Inhalt nicht helfen konnte, öffnete ich sie und besah mir meinen Schatz, meine Döschen und Flakons, Lidschatten, Wimperntusche, Ringe und Ketten. Ich brauchte nichts von dem Zeug. Aber irgendwie … konnte ich nicht anders. Die Dinge riefen mich, zogen mich an, zogen mich zu sich, ließen mir keine Ruhe, bis sie mein waren. Und wenn ich dann nach einem Raubzug mit all meinen Schätzen hier im Versteck saß und sie bewunderte, wurde mein Herz ganz warm und friedlich. Ihr Anblick beruhigte mich – normalerweise.
Ich seufzte. Das Einzige, was sich jetzt womöglich als nützlich erweisen könnte, war ein hellrot changierender Schal, der sich zwischen Modeschmuck und Schminke durch die Box wand.
„Okay, Ainia, nachdenken.“ Die Kleidung war ein Problem. Mein Gesicht und die Hand, die ich nicht im Ärmel verborgen gehabt hatte, waren ein Problem. Und meine Haare waren ein Riesenproblem.
Meine Urgroßmutter – die Göttin möge ihre Seele sorgsam in ihren Händen halten – meine geliebte Bisabuela, selbst mit einer schneeweißen, langen Mähne ausgestattet, die zu ihrer kakaobraunen Haut einen starken Kontrast bildete, und die sie in vielen mit Perlen und Federn geschmückten Zöpfen im Zaum hielt – sie hatte mir als Kind gesagt: „Wenn du dir die Haare schneidest, schneidest du dir die Freiheit ab. Lass wachsen, was wachsen soll. Die Natur hat das schon richtig eingerichtet.“
Die Natur hatte wohl nicht mit Glitzerpuder gerechnet, der nun hartnäckig in meinen meterlangen Locken festhing. Nach kurzem Hadern packte ich die Sachen bis auf den Schal wieder weg und marschierte zum Bach. Angeblich war Frühling, fast Sommer schon, aber es hatte die letzten Tage geregnet und das Wasser höchstens 16 Grad. Sorgsam stapelte ich meine Kleidung am Ufer und stieg mit einiger Überwindung ins frostige Nass.
„Was die hier Hama nennen!“, murmelte ich erbost, während ich frierend über die Kieselsteine balancierte. „Und was die hier Bach nennen!“ Ich lebte schon seit Jahren hier, aber meine Kindheit in der feuchten Hitze an den Flüssen hatte mich geprägt. „Ach was soll’s.“
Ich tauchte unter, wusch mein Gesicht und meine Haare aus, immer wieder, so lange, bis ich das Gefühl hatte, jede weitere Sekunde in der Eiseskälte würde mich umbringen. Japsend stieg ich wieder an Land und trocknete mich mit dem Schal notdürftig ab. Meine Lederhose und mein Shirt wendete ich von innen nach außen; mit etwas Glück würde niemand die Nähte bemerken. Dann … die Stiefel. Meine schicken Glitzerstiefel. Bedauernd rieb ich sie mit Schlamm ein, vertrieb das überirdische Funkeln vom groben Leder. Den Trenchcoat brachte ich zurück zur Esche und warf mir stattdessen meinen dunklen Wildlederumhang über. Keine Trenchcoats in Themiskyra. Das wäre ja auch zu cool gewesen. Erschöpft und bibbernd trat ich wieder aus dem Baumversteck und sah an mir herab.
„Gar nicht so schlecht.“ Ich schöpfte Hoffnung. Wenn ich mich beeilte und mich zu Hause sofort wieder umzog, würde keine meinen seltsamen Aufzug bemerken.
„Warum hast du deine Hose falsch rum an?“, ertönte plötzlich eine junge Stimme hinter mir und meine Hoffnung zerfiel. „Was ist mit deinen Stiefeln passiert? Und warum hast du so nasse Haare?“
Ich wirbelte herum. Vor mir stand ein sehniges, elfjähriges Mädchen in hirschlederner Amazonenkluft, mit schulterlangen, hellbraunen Haaren, einem impertinenten Ausdruck im Gesicht und einem Apfelschimmel am Zügel.
„Polly“, knurrte ich. Wer auch sonst! Kleine, lästige Schnüffelnase. Und zu allem Überfluss die Tochter der Chefin. Ich schloss die Augen und versuchte, mich zu sammeln.
Gegenfrage, dachte ich. „Was hast du hier zu suchen!?“
„Spinnst du? Ich suche dich seit zwei Stunden! Glaubst du, ich mache wieder den ganzen Küchendienst alleine?!“
„Verdammt. Der Küchendienst.“ Unser Strafdienst, den Polly aufgebrummt bekommen hatte, weil sie nie ihr Zimmer aufräumte, und ich, weil ich, na ja, immer zu spät zum regulären Küchendienst gekommen war, als ich meinen Arbeitsmonat in der Großküche Themiskyras absolviert hatte.
Ich bemühte mich um eine versöhnliche Miene. „Entschuldige, habe ich ganz vergessen. Reite schon mal zurück, ich komme gleich nach.“
„Ja, von wegen!“ Polly stemmte die Hände in die schmalen Hüften. „Die letzten drei Samstage habe ich quasi im Alleingang Kartoffeln geschält, Besteck poliert und Böden geschrubbt! Ich hab so was von was gut bei dir!“ Ehe ich diesen letzten Satz entschlüsseln konnte, bohrte sie erneut: „Und warum hast du deine Hose falsch rum an?“
Ich dachte nach. Mit Mord würde ich nicht durchkommen. Nicht bei der Diadoka. „Meine Hose ist dreckig geworden und ich dachte, so würde es weniger auffallen.“
Polly sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Amazonen schufteten in Ställen, Schmieden und auf Feldern, ritten durch Wälder, gingen auf die Jagd – und wurden dabei eben bisweilen schmutzig. Kein Grund zum Hosenwenden.
„Ich bin vom Pferd gefallen, ok? Das ist mir peinlich. Deswegen.“
Jetzt nickte sie langsam. „Verstehe. Ich erzähle nichts. Aber deine Haare –“
„Ich habe sie im Bach gewaschen, da sind pflegende Substanzen und wertvolle Mineralien aus den Bergen drin.“ Den Wortlaut lieh ich mir vom Etikett eines Shampoos, das in meiner Kiste lag und traurigerweise nie Verwendung finden würde.
Die kleine Kröte mit ihren freiheitsberaubten Zauselhaaren sah mich nur skeptisch an. Dann wanderte ihr Blick weiter. „Boah, ist der Baum da hohl?!“
„Nein, und jetzt mach dich vom Acker.“ Ich zeigte energisch nach Osten.
„Nur zusammen mit dir!“
„Ich kann nicht, ich brauche noch eine Lösung für mein Hosenproblem.“
„Ich bringe dir eine Hose.“
Ich sah sie misstrauisch an. „Echt?“
„Echt. Logo. Kein Problem.“
Irgendetwas war faul. „Warum?“
„Weil wir Freundinnen sind“, verkündete sie strahlend.
Ich schnaubte nur.
Jetzt wurde ihre Miene listig. „Na gut, weil du mir dafür ein halbes Jahr lang die Schuhe putzt.“
Ich schnappte nach Luft. „Ein halbes Jahr?! Das ist ja … Wucher!“
„Und den Tischdienst für mich übernimmst.“
„Du spinnst.“
„Keineswegs.“
Wucher und Spinnerei hin oder her – Pollys Angebot war zu verlockend. Also trat ich auf sie zu, sah ihr, so böse ich konnte, in die Augen und zischte: „Abgemacht. Ein halbes Jahr Schuhe und Tische. Aber dafür bringst du mir noch einen Pulli mit.“ Ich war nämlich immer noch am Erfrieren.
Sie verschmälerte unbeeindruckt die Augen, schien meine Ehrlichkeit zu prüfen. „Gut. Warte hier.“
Themiskyra. Einst eine stolze Burg voll wehrhafter Frauen in Kleinasien, heute ein stillgelegtes Heizkraftwerk mit gerade mal 65 Amazonen.
Kriege, Naturkatastrophen, Industrialisierung und zuletzt die wachsenden Großstädte zwangen die Amazonen immer wieder, ihre Standorte zu verlegen, um weiterhin fernab der anderen Menschen und im Einklang mit der Natur leben zu können; und so hatten sie im Laufe der letzten sechs Jahrtausende diverse Paläste und Wehranlagen, Gehöfte und Residenzen bewohnt. Das derzeitige Domizil war definitiv ein Abstieg, wenn ich es mit den bisherigen verglich, die ich aus den alten Folianten kannte. Dennoch verliehen ihm die drei Schornsteine eine gewisse Würde, wie ich zugeben musste, als wir schweigend auf den großen, mit einer hohen Mauer umgrenzten Komplex mit all seinen Gebäuden, Produktionsstätten und Pferdestallungen zuritten. Genau genommen war er auch nur ein Teil Themiskyras, zu dem außerdem riesige Ländereien und weitere Ställe, die Gerberei, die Kläranlage und die Falknerei außerhalb der Stadtmauer gehörten. Das einzig halbwegs Neuzeitliche war das große Solarfeld vor der Stadt, durch das Warmwasser und Strom erzeugt wurden. Der war jedoch dem Betrieb der wichtigsten Gerätschaften wie Landmaschinen und Kühlschränken vorbehalten.
Die beiden mit Speeren bewaffneten Frauen, die das Tor in der gut fünf Meter hohen Stahlmauer bewachten, nickten uns nur zu und schienen glücklicherweise keine Notiz von meinen nassen Haaren zu nehmen, genauso wenig wie die paar Amazonen, die derzeit im Innenhof zwischen den schmucklosen Bauten unterwegs waren. In unserem immensen, aber dank der vielen Dachfenster lichten Stallkomplex angekommen, drückte ich die Zügel meines Aspa einfach einem der Stallburschen in die Hände, einem langen, unpassend arrogant wirkenden Kerl mit dunklen Haaren und schwarzen Augen, der etwa in meinem Alter sein mochte.
„Das darfst du nicht“, belehrte mich Polly, die schon am Absatteln war, „du musst dich selbst kümmern.“
„Ich habe keine Zeit, mich selbst zu kümmern“, gab ich wütend zurück. Ich musste mich wieder halbwegs herstellen, vor allem meine Haare, bevor ich mich dem elenden Küchendienst widmen konnte. Knapp nickte ich dem Stallburschen zu. „Na los. Ich mache mein Recht auf Eiligkeit geltend.“
So etwas gab es nicht wirklich; das Stallpersonal hatte nur der Paiti, also unserer Anführerin Atalante zur Hand zu gehen, und wenn es aus strategischen Gründen mal wirklich schnell gehen musste. Bei knapp hundert Pferden hätte das auch gar nicht anders funktioniert. Aber mit solchen Details konnte ich mich jetzt nicht aufhalten. Widerwillig kam der Typ in Gang, nicht ohne mir noch einen zutiefst verächtlichen Blick zuzuwerfen.
Meiner Meinung nach beging die unbeugsame Atalante einen Fehler, indem sie auch Männer für uns arbeiten ließ. Die Paiti berief sich, wie auch ihre beiden Vorgängerinnen, auf die antike Vorgehensweise, gemäß der in Themiskyra nicht nur Frauen gelebt hätten. Amazonensöhne hätten damals als Sklaven gedient, anstatt, wie inzwischen üblich, zu ihren Vätern zurückgeschickt zu werden. Das mochte ja noch angehen, aber die Handvoll ’Shimet, die nun für die Amazonen arbeiteten, waren nicht verwandt, sondern aus eigenem Willen hier – und mir deshalb definitiv suspekt. Wer sollte sich schon freiwillig im hinterletzten Kaff für lediglich Kost und Logis abschuften?
Diese dahergelaufenen Exemplare machten doch wirklich nichts als Ärger und ließen es deutlich an Respekt fehlen. Im Augenwinkel sah ich, wie der Stallbursche irritiert seine Hände anstarrte, nachdem er meinen Sattelknauf angefasst hatte. Restglitzer, keine Frage. Ich gab Fersengeld.
Mein Plan, mich eiligst und unbemerkt in die Kardia, also das Hauptgebäude mit unseren Wohn- und Schlafräumen, zu schleichen, scheiterte. Das wurde mir klar, sobald ich aus dem Stall auf den Hof hinaustrat und das Geschrei vernahm, das aus dem kleinen Klinikgebäude ertönte. Wir waren ein Haufen Frauen – klar, dass es da auch mal Ärger gab. Doch diese Laute klangen nicht nach einem Streit um vernachlässigte Pflichten oder einen ungefragt entliehenen Pfeilköcher, es waren die Schreie höchster Verzweiflung. In kürzester Zeit hatte sich eine Traube schaulustiger Amazonen von fünf bis fünfundneunzig Jahren um den Eingang versammelt, alle in der traditionellen, langweiligen Kleidung aus Hirschleder, Wolle und Leinen. Auch meine Neugier zog mich wider besseren Wissens zu dem Auflauf.
„Lasst mich los! Lasst mich los, verdammt!!! Bitte, bei Artemis, Deianeira, lass mich erklären –“ Von zwei Wächterinnen wurde gerade eine junge Frau herauseskortiert, deren eigentlich fein geschnittenes, hübsches Gesicht völlig verzerrt war. Sie war es, die so nachdrücklich flehte und fluchte. Statt der üblichen, weiten Wolltunika trug sie lediglich ein Unterhemd und sie gebärdete sich so wild, dass ihr langer blonder Zopf durch die Luft peitschte.
Polly tauchte an meiner Seite auf und begann, neben mir auf und ab zu hüpfen, im Versuch, die Köpfe der Frauen vor uns zu überblicken.
„Was ist passiert?“
„Stella wurde festgenommen“, berichtete ich verständnislos.
Mit meinen 1,76 Metern sah ich leicht über die meisten der aufgeregt tuschelnden Frauen hinweg. Ich erkannte die tobende Amazone sofort, schließlich hatte ich vor wenigen Monden meinen Nachmittagsdienst in der Weberei versehen, der sie vorstand. Die Arbeit mit ihr hatte Spaß gemacht und die Zeit war mit Stellas verrückten Geschichten und Anekdoten wie im Fluge vergangen, was mir nur selten so vorkam. Es war mir ein Rätsel, was geschehen sein mochte, denn Stella war bei allen beliebt und immer fröhlich. Zumindest dann, wenn sie nicht gerade von Tawia und Johanna abgeführt wurde.
„Warum?“, rief Polly aus.
Keine Ahnung, wollte ich sagen, da bemerkte ich die Schwellung unter Stellas weißem Hemd, bemerkte die Ärztin Deianeira, die hinter ihr aus dem Krankenhaus getreten war und sie mit grimmiger Miene im Auge behielt.
„Oh“, brachte ich hervor.
„Was? Was?“
Ich blickte auf Polly herab und rang leicht genervt um eine Formulierung. „Es sieht so aus, als habe sie sich unerlaubt fortgepflanzt.“
„Was? Was?“
„Sie ist schwanger.“
„Jetzt noch? Das geht doch gar nicht.“
Ich sah mich nicht in der Pflicht, die Kleine aufzuklären, also wirklich nicht. Unübersehbare Tatsache war: Stella hatte sich mit einem ’Shim eingelassen, entgegen Atalantes Regeln, entgegen den Gesetzen unserer Göttin Artemis, entgegen der äonenalten Traditionen der Amazonen, denen zufolge ausschließlich ausgewählte Frauen ausschließlich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich der Sonnenfeier am längsten Tag des Jahres, ausschließlich zu ausgewählten Männern aus ausgewählten Clans gesandt wurden, um Nachwuchs zu zeugen. Demnach kamen unsere Amazonenkinder immer im Flieder- oder Blütenmond zur Welt, und auch, wenn Stella sich gut gehalten haben mochte, würde dieses Kind nicht vor dem siebten, dem Feuermond das Licht der Welt erblicken. Offenbar war es ihr gelungen, diese Tatsache bis vor Kurzem noch unter losen Gewändern zu verbergen, doch die Ärztin schien sie überführt zu haben.
Dumme, dumme Stella.
Das Mitleid, das ich ihres Elends wegen eben noch empfunden hatte, schwand merklich. Ich begriff nicht, wie sie so unbesonnen sein konnte, und vor allem, warum. Und, ganz ehrlich, ich fühlte auch Ekel in mir aufsteigen bei der Vorstellung, was Stella getan haben musste. Ich hielt mich ja auch nicht an alle Regeln, aber so was war … undenkbar, unfassbar dämlich und daneben.
Ich besann mich wieder auf Polly. „Das geht. Lass es dir von Atalante erklären.“
Wie aufs Stichwort teilte sich die raunende Menge, um sie durchzulassen. Die Paiti war nicht besonders groß, aber sie war mächtig. Und damit meine ich nicht nur die Macht, die sie als Herrscherin der Amazonen in diesem Land de facto innehatte, sondern die Ehrfurcht gebietende Aura, die sie umgab – und der jeder gerne entkommen wollte, dem Atalante nicht so wohlgesonnen war.
Im Augenblick war sie definitiv nicht wohlgesonnen.
Ihre vollen, dunklen Haare, die sie im Gegensatz zu den meisten anderen Amazonen wie immer offen trug, wallten hinter ihr her, genau wie die lange, türkisfarbene Tunika, die an der Taille von dem goldenen Gürtel zusammengehalten wurde, der seit Jahrtausenden als Herrschaftszeichen der Paiti Themiskyras gilt.
Hoch aufgerichtet kam sie vor Stella zum Stehen. Schlagartig verstummte das Protestgeheul der Schwangeren und sie schlug die Augen nieder. Atalante nickte den Wächterinnen zu, und sowie sie Stella losließen, warf sich diese vor der Paiti auf den Boden.
„Atalante, verzeih mir! Du musst wissen, ich –“
„Schweig. Kannst Du mir sagen, was genau hier passiert ist, Deianeira?“
Die Ärztin trat vor. Sie trug einen weißen Kittel über ihrem hellen Leinengewand und die rotblonden Haare zu einem strengen Knoten aufgetürmt. „Stella hat vorhin beim Bogenturnier einen Kreislaufkollaps erlitten. Ich nahm sie mit in die Klinik, um sie zu versorgen und zu untersuchen und …“, sie zögerte, war sichtlich unangenehm berührt, „und stellte eine Schwangerschaft in der 28. Woche fest.“
Atalante wandte sich wieder an Stella. „Sag mir, hast du dich aus freiem Willen mit einem Mashim eingelassen oder hat er sich dir aufgezwungen? Überlege dir deine Antwort gut, denn wir werden keine Gnade walten lassen gegenüber dem, der sich an unseren Schwestern vergeht.“
Mach schon, dachte ich und biss auf meiner Lippe herum, sag, du seist im Wald überfallen worden, sag, du hast keine Ahnung, was passiert ist, sag –
Aber Stella zögerte, und das sagte im Grunde schon alles. Sie hätte den Kindsvater opfern und sich damit retten können, doch offensichtlich kam das nicht infrage. „Freiwillig. Ich …“ Ihre Stimme war kaum mehr als ein Wispern, und alle schienen kollektiv den Atem anzuhalten, um jede Silbe verstehen zu können. „Es geschah aus Liebe.“
Sie appellierte an Atalantes Mitgefühl, und das zu meiner Überraschung mit gewissem Erfolg. Im Blick der Paiti erkannte ich mehr Milde, als ich erwartet hätte. Sie ließ sich in die Hocke nieder und hob mit ihrer Hand das Kinn der Schuldigen an, um sie genau betrachten zu können. Stella hielt ihrem Blick stand, aber ich konnte sehen, dass sich neue Tränen in ihren Augen sammelten. Dann ließ Atalante die Hand sinken und seufzte.
„Töricht. Du hast dich schuldig gemacht, hast die Gesetze unserer Gemeinschaft gebrochen und, schlimmer noch, unsere Göttin missachtet.“
„Nein. Nein. Nein“, stammelte Stella immer wieder. „Bitte verbann mich nicht.“ Sie wurde laut, hysterisch, kopflos. „Ich tu alles, was du willst, aber lass mich hierbleiben. Bitte.“
Die Paiti wich ein wenig zurück.
„Atalante, ich flehe dich an. Ich kann nicht weg. Nicht …“, sie wies hilflos auf ihren Bauch, „… so!“ Da schien ihr eine Idee zu kommen. Panisch klammerte sie sich am Saum von Atalantes Tunika fest. „Lass es Deianeira wegmachen. Schneidet es raus. Macht es ungeschehen. Aber lass mich hierbleiben. Bitte. Ich bereue. Bitte!“ Jetzt kreischte sie wieder.
Atalante stand ruckartig auf und entriss ihr dabei den Stoff. Jegliches Wohlwollen war aus ihrer Miene gewichen, im Gegenteil – sie betrachtete Stella voll fassungsloser Abscheu. „Wie kannst du es über dich bringen, so zu sprechen. Jedes Kind ist ein Geschenk der liebenden Muttergöttin Artemis. Hier jedoch ist es nicht erwünscht, genauso wenig wie du.“ Sie hob ihr Kinn und ließ so deutlich verlauten, dass jede rundum es vernehmen konnte: „Hiermit verbanne ich dich, Stella, aus Themiskyra, der Stadt, und von den zugehörigen Ländereien, und zwar ab sofort und aufgrund der Schwere deines Vergehens und deiner inakzeptablen moralischen Haltung ohne weitere Anhörung. Missachtest du dieses Gebot, gnade dir Artemis. Wir werden es nicht tun.“
„Oje“, flüsterte Polly unglücklich.
Damit wandte sich Atalante abrupt zum Gehen, und die Frauen hatten Mühe, ihr schnell genug Platz zu machen. Es war klar zu erkennen, wie geladen sie war.
Stella heulte auf. Ich konnte ihr Entsetzen wirklich verstehen. Verbannt, ohne jegliches soziales Netz, ohne Taler, ohne Habe, ohne Bleibe, dafür mit unerwünschtem Nachwuchs im Bauch – ganz ehrlich: Ich hätte mich selbst gerichtet an ihrer Stelle.
Sie war wieder zusammengebrochen, umarmte klagend ihre Schultern, ihren Bauch, die Erde ihrer Heimat. Im Gegensatz zu den anderen stillen und schreckstarren Amazonen wäre ich gerne zu ihr gegangen und hätte mich verabschiedet, aber Tawia und Johanna hatten Stella bereits hochgerissen und bugsierten sie in Richtung Tor. In dem Moment bemerkte ich in der Menge mir gegenüber plötzlich Myrto, die Oberköchin, die mir mit einer finsteren Geste klar machte, dass sie mich im Blick hatte – und auch mir mächtiger Ärger drohte.
Ich tauchte schnell in der Menschenmasse ab, sah zu, dass ich vor Myrto in der Küche und am Kartoffelschälen war, was sie jedoch nicht daran hinderte, mich zur Schnecke zu machen.
„Drei Stunden!“, tobte sie. Myrto war eine massive Mittvierzigerin mit großen, zupackenden Händen, die ihre aufwendige Flechtfrisur unter einer weißen Haube verbarg, ihre stets schlechte Laune hingegen immer zur Schau trug. „Seit drei Stunden warte ich auf euch! Faules Pack!“
Ich musste mich allen Ernstes unter einem Kartoffelstampfer wegducken. So etwas war mir noch nie passiert, aber wahrscheinlich lagen nach Stellas Verbannung die Nerven blank. Das geschah wirklich nicht alle Tage. Genau genommen war eine solche Verfehlung in meiner Zeit hier noch kein einziges Mal vorgekommen. Polly wirkte auch ziemlich erschrocken, aber wir arbeiteten einfach stumm, versuchten, die verlorene Zeit wieder hereinzuschälen und -schnippeln. Myrto blieb grantig, sogar noch mehr als sonst, und warf uns immer wieder Blicke zu, die mir ernsthaft Angst machten. Diesmal würde sie es nicht auf sich beruhen lassen, das war gewiss. Sobald sie uns endlich kurz vor der Essenszeit mit einem abschätzigen Grunzen entließ, flohen wir förmlich aus dem Produktionstrakt, wo ich an der Tür mit Phoebe zusammenstieß. Normalerweise hätte ich die braunhaarige Amazone, die den Pferdestallungen vorstand, als das Gegenteil von Myrto beschrieben, feinsinnig und zartgliedrig und immer freundlich, aber jetzt funkelte in ihren sonst so sanften, dunkelblauen Augen unverhohlene Wut.
„Ainia, auf ein Wort.“
Polly nickte mir knapp zu und verdünnisierte sich, bevor sie unverschuldet eine weitere Ladung Zorn streifen konnte.
„Was ist los?“, fragte ich voller Unbehagen, steckte die Hände in die Hosentaschen und zog die Schultern hoch, als ich zu Phoebe vor das Gebäude trat.
„Ich habe dein Gehabe vorhin mitbekommen.“
Gehabe? Im ersten Moment erschrak ich, dachte, sie meinte mit diesem seltsamen Wort meinen kleinen Beutezug durch die BeautyBase. Erst, als sie weitersprach, begriff ich.
„In meinem Stall dulde ich solch asoziales Verhalten nicht, verstanden? Du weißt, dass nur besondere Personen und besondere Ereignisse die Stallarbeiter über ihre übliche Arbeit hinaus verpflichten dürfen. Du bist nichts Besonderes.“
Autsch. Tief in meinem Inneren wusste ich, dass sie das nicht so meinte, nicht so meinen konnte, weil sie eigentlich eine nette Person war, aber ich wusste auch, dass sie recht hatte. Und das tat weh.
„Ich weiß“, brachte ich tonlos hervor. „Ich hab nicht nachgedacht. Tut mir leid.“
„Du hattest die Chance nachzudenken. Polly hat dich auf deinen Fehler aufmerksam gemacht, aber du hast ihren gutgemeinten Ratschlag abgewiesen.“
„Ja. Ich hatte es eilig. Ich hab eben nicht nachgedacht“, wiederholte ich, jetzt aber schon ein wenig pampig.
„Nun, ich schätze, du brauchst eine Beschäftigung, die dir die Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr nachzudenken. Und wenn du früher aufstehst, hast du auch mehr Zeit und musst es nicht immer gar so eilig haben. Für den nächsten Mond wirst du den Frühdienst im Stall übernehmen.“
Ich öffnete den Mund, erst vor Schreck, dann für Protest, doch dann ließ ich einfach den Kopf sinken und nickte.
„Beginnend ab morgen. Verstanden? Hast du verstanden, Ainia?“
Ich beeilte mich, zu versichern: „Ja, Phoebe.“
Sie wies mit einer grimmigen Kopfbewegung in Richtung des Wohngebäudes. „Sieh zu, dass du in die Kardia kommst. Jacintha möchte dich noch vor dem Essen sprechen.“
Na, wunderbar. Eine weitere Moralpredigt war wirklich das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte. Ich spähte vorsichtig am schweren Türflügel vorbei ins Atrium, den großen, mit einer Glaskuppel überdachten Innenhof der Kardia. Sein Zentrum bildete der offene Kamin, vor dem sich die Frauen allabendlich nach dem Essen versammelten und dessen Abzug oben in einem der Schlote des ehemaligen Heizkraftwerks mündete. Rundherum standen, durch üppige Grünpflanzen voneinander getrennt, Ledersofas und Sessel in kleinen, derzeit verlassenen Sitzgruppen beisammen. Fast verlassen. Ich erkannte die Silhouette ihrer schlanken, hoch aufragenden Gestalt sofort und zog mich blitzartig zurück, bevor Jacintha mich in die Mangel nehmen konnte.
Ungesehen würde ich nicht an ihr vorbeikommen, doch ich wusste einen Schleichweg. Dann musste ich zwar auf das Abendessen verzichten, aber so wie Myrto drauf war, war es vermutlich ohnehin kaum zu genießen. Ich huschte über den Hof und betrat durch zwei Schiebetüren das kleine, aber modern ausgestattete Krankenhaus. Im Gegensatz zur Kardia mit ihren rauen, metallenen Wänden aus Kraftwerkszeiten war hier alles glänzend und weiß.
Ich war allein; auch die Ärztinnen hatten sich wohl mittlerweile im Speisesaal eingefunden. Von Stella waren alle Spuren, die sie hinterlassen haben mochte, verschwunden. In nächster Zeit würde niemand offen über sie sprechen, sie war nicht nur verbannt aus Themiskyra, sondern auch von unseren Lippen und aus unseren Gedanken. Nun, theoretisch. Ich konnte mir schon vorstellen, dass die Frauen sich hinter vorgehaltener Hand die Mäuler über die gefallene Amazone zerrissen.
Durch das Klinik-Treppenhaus gelangte ich in den ersten Stock und von dort aus über einen Gang zu der mit Glas und Stahl umbauten Brücke, die mit dem Wohngebäude verbunden war. Ich musste mich ein bisschen ducken, um über die Galerie nicht vom Atrium aus gesehen zu werden, aber dann erreichte ich unser Zimmer, schloss lautlos die Tür hinter mir und ließ mich aufs Bett fallen.
Die schlichten, mit ein paar dunklen Holzmöbeln ausgestatteten Zimmer teilten sich immer zwei, weshalb sich an einer vom Fenster ausgehenden, gedachten Symmetrieachse alles mehr oder weniger spiegelte: die beiden schmalen Betten, an ihren Fußenden die Wäschetruhen, die Regale und Kleiderschränke, dazu ein Paar helle Vorhänge und ein gestreifter Webteppich unter dem Tisch in der Raummitte. Der Unterschied bestand darin, dass in Padminis Zimmerhälfte im Gegensatz zu meiner alle Bücher, Kleidung und Kleinigkeiten wohlgeordnet und staubfrei waren, sogar die Kastanienfigürchen, die wir vor Äonen miteinander gebastelt hatten, standen in Reih und Glied. Aber Padmini war eben perfekt, und ich … nichts Besonderes.
Ich fühlte mich unruhig, und dass ich nachmittags keine Gelegenheit gehabt hatte, mich an meinen Schätzen im hohlen Baum ordnungsgemäß zu erfreuen, machte mir wirklich zu schaffen. Und doch mussten mir irgendwann die Augen zugefallen sein, denn als die Zimmertür ins Schloss fiel, wurde ich aus wirren Träumen voller Glitzer und Drama gerissen.
„Schläfst du?“
„Ja“, brummte ich.
„Ich kann nicht aufhören daran zu denken, was Stella passiert ist.“
Ich wälzte mich zu Padmini herum. „Ich auch nicht.“
Gerade stellte sie ihre Stiefel fein säuberlich an die vorgesehene Stelle neben dem Schrank, dann setzte sie sich mir gegenüber auf ihr Bett. Ihre kinnlangen, schwarzbraunen Haare fielen wie frisch geföhnt um ihr ebenmäßiges Gesicht, ihre Kleidung war wie immer makellos, aber in ihren tiefbraunen Augen sah ich, dass entgegen ihres vollkommenen äußeren Erscheinungsbildes nichts in Ordnung war.
„Ich kann es auch nicht glauben. Sie war doch –“, Padmini rang um Worte, „wie wir!“
„Weißt du, was ich nicht verstehe?“ Ich fasste mir an den Kopf. „Uääh.“ Meine Haare waren eine Katastrophe, ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass ich mich um sie kümmern musste. Schwer und immer noch feucht klebten sie in zerzausten Strähnen an meinem Rücken. Rasch setzte ich mich auf, holte den Kamm aus meinem Nachtkästchen und begann, Strähne um Strähne zu entwirren, während ich weitersprach: „Wieso hat sie sich des Kindes nicht … rechtzeitig entledigt? Ich meine, das musste doch auffliegen!“
Padmini zuckte bekümmert mit den Schultern. „Vielleicht wollte sie sich weiterhin in wallende Gewänder kleiden, das Kind heimlich im Wald zur Welt bringen und dem Kindsvater überlassen. Ich weiß es nicht. Und ich verstehe es nicht.“
Ich schwieg eine Weile, kämmte und kämmte. „Vielleicht war es wie in den Märchen. Erinnerst du dich?“, flüsterte ich schließlich.
„Ich erinnere mich an verzauberte Öllampen und von Rosen überwucherte Schlösser, aber, nein, an eine hirnlose Amazone, die wegen nichts und wieder nichts alles aufs Spiel setzt, erinnere ich mich nicht.“ Padminis Bestürzung machte einer gewissen Wut Platz. Ein Fortschritt, wie ich fand. Ich mochte es nicht, meine beste Freundin traurig zu sehen. Sie war von uns beiden die Starke. Sie kümmerte sich und sorgte dafür, dass alles lief, oder zumindest, dass es von außen so aussah. Sie trat mir in den Hintern, wenn ich mal nicht in Gang kam, hielt mir Ärger vom Leib und mich bei der Stange.
„Vielleicht hat sie sich wirklich verliebt?“, wurde ich deutlicher, während ich mir die Locken zu einem dicken Zopf flocht.
„Einen kurzen hormonellen Aussetzer hätte sie leicht in den Griff bekommen, wenn sie die richtigen Kräuter geschnupft hätte. Wenn sie gewollt hätte. Das friedliche Zusammenleben von Mann und Frau ist eine Utopie. Das sollte Stella wissen. Wenn sie dafür alles wegwirft, was ihr lieb und teuer ist, bitte.“ Mit immer entschiedeneren Bewegungen hatte sich meine Freundin umgezogen und legte nun ihre Kleidung zusammen, was lustig anzusehen war, weil sie so zornig und doch so ordentlich dabei war. Disziplin war alles. Wenn ich hingegen wütend war, flogen die Fetzen. Dennoch wollte ich nicht weiter Öl ins Feuer gießen, denn ich wusste ja, dass Padmini recht hatte.
„Ich verziehe mich schnell ins Bad. Muss morgen früh raus“, wechselte ich deshalb das Thema und stand auf.
„Frühdienst?“, fragte Padmini erstaunt.
„Grauenvollfrühdienst. Im Stall. Von fünf bis sieben. Hab mich daneben benommen.“
Padmini legte tadelnd den Kopf schief. „Warum nur?“, fragte sie, wartete meine Antwort jedoch gar nicht ab, sondern schloss mich mitleidig in die Arme. Ihr typischer Duft von Kardamom und Vanille umhüllte mich tröstend.
An ihrer Reaktion lässt sich erahnen, wie grässlich der Frühdienst wirklich ist.
Um halb fünf schrillte mein Wecker los, ein mechanisches, grausames Monstrum, das ich eiligst zum Schweigen brachte, um Padmini nicht zu stören. Mit schweren Gliedern schlüpfte ich in meine Lederhose und ein unempfindliches Shirt, lief durch die Stille der Amazonenstadt über den Hof in den Stall. Es war noch Nacht; die Einzigen, die auf waren, waren die Frauen von der Wache und, ja, Atalante, in deren Zimmer hoch oben noch, oder wieder, Licht brannte.
Ich öffnete das Stalltor, das zur Weide hinausging, das Gatter dort sowie die ersten Boxen und ließ die Tiere hinauslaufen. Der Wind trug die Kühle der letzten dunklen Stunden über die Felder, doch mir wurde rasch warm, als ich mir Mistgabel, Mistschaufel und Schubkarre schnappte und mich systematisch von einer Box zur nächsten vorarbeitete. Ich entfernte Pferdeäpfel und nasses Heu, verteilte frische Einstreu, reinigte die Tränken und Futtertröge, zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal, bekam nur auf einer meiner gefühlt hundert Schubkarrenfahrten zum Misthaufen mit, dass die regulären Arbeiter am anderen Ende des Gebäudes auch irgendwann mit dem Ausmisten begannen. Bald bereute ich meinen vorschnellen Entschluss, das gestrige Abendessen sausen gelassen zu haben; mein Magen krampfte sich vor Hunger zusammen.
Phoebe würdigte mich und meine Arbeit keines Blickes, auch nicht, als ich gegen sieben Uhr mit schmerzendem Rücken an ihr vorbei- und zurück in die Kardia lief, wo ich mich in der Gemeinschaftsdusche rasch abbrauste. Gerade noch rechtzeitig kam ich zum Frühstück im großen Speisesaal an, um mir zumindest eine Scheibe Brot und etwas Käse zu schnappen, bevor alles abgetragen wurde. Eingeteilt in Altersgruppen saßen die Amazonen hier zu den Mahlzeiten an großen Holztischen beisammen, die meisten hatten den Raum jedoch schon wieder verlassen. Erschöpft lehnte ich also am Türrahmen und kaute meine karge Mahlzeit im Stehen, da mich Irina, die für den Tischdienst eingeteilt war, schon weggescheucht hatte, um zusammenzukehren. Eine Seite des Saales war verglast und gewährte den Blick auf eine Terrasse, eine andere wurde von einem immensen, schwülstigen Gemälde dominiert, Nymphen, Zentauren, Hirschkühe – das volle Programm antiken Erbes.
Was für eine Zumutung, schoss es mir in einer plötzlichen Aufwallung von Wut und Widerspruch durch den Kopf. Das Bild, das frühe Aufstehen, Phoebes Undankbarkeit, der trockene Kanten Brot, einfach alles.
Zu allem Überfluss wurden Polly und ich nach dem Frühstück in Atalantes Studierzimmer im dritten Stock gerufen.
Die Unbeugsame sah uns von ihrem riesigen, mit unzähligen Büchern und Dokumenten überfüllten Schreibtisch entgegen. Auch die Regale rundum bogen sich unter der Last alter Folianten, deren eigentümlicher Geruch von Papier, Staub und Leder den Raum erfüllte und sich mit dem fruchtigen Aroma mischte, das einer Kerze auf dem Couchtisch entströmte. Das einzige Anzeichen, das verriet, dass die Paiti nicht so gelassen war, wie sie uns glauben machen wollte, war das Schwingen der Adlerfeder, die sie an einem Kettchen am Ohr trug.
Wir blieben im Raum stehen, weil sie uns keine Anweisung gab.
„Was soll ich mit euch beiden machen?“, fragte sie uns. Rhetorisch, nahm ich an. Ich hätte mich ohnehin nicht getraut, Vorschläge zu äußern, die alle in Richtung faire Entlohnung und mehr Freizeitvergnügen gingen.
„Wieso?“, fragte Polly aufmüpfig.
„Myrto hat sich bei mir über euch beklagt. Ihr nehmt euren Strafdienst nicht ernst, sagt sie, erscheint zu spät oder gar nicht bei ihr. Das kann ich nur als Auflehnung gegen die Gemeinschaft und ihre Regeln werten.“
Ich erwartete, dass Polly Widerspruch erhob, immerhin war sie abgesehen von gestern immer rechtzeitig dagewesen. Doch sie schwieg, und so nahm ich meinen Mut zusammen und erklärte: „Es war keine Absicht. Ich habe es einfach vergessen.“
„Weil du deine Aufgabe nicht ernst nimmst“, versetzte die Paiti. „Sonst würde dir das nicht passieren.“
„Nein, so ist das nicht, ich –“, begann ich, doch sie schnitt mir mit einer entschiedenen Geste das Wort ab.
„Ihr habt noch eine Chance. Die nächsten drei Mal seid ihr pünktlich und verhaltet euch mustergültig. Höre ich etwas anderes von Myrto, wirst Du, Ainia, in den kommenden Wochen jede freie Minute damit zubringen, die Bibliothek abzustauben.“
Ich schluckte. Das war in meiner Anfangszeit in Themiskyra, kurz nachdem ich mit meiner Mutter hier angekommen war, die Bestrafung dafür gewesen, dass ich immer wieder versucht hatte abzuhauen. Ich hatte immer noch nicht begreifen können, dass meine Bisabuela gestorben war, und gedacht, wenn ich nur nach Hause zurückkehren könnte, würde alles wieder so sein wie früher. Dreimal hatten sie mich im Wald aufgegabelt, zweimal hatte mich die Polizei aufgegriffen, der es seltsam vorkam, dass sich ein kleines Mädchen mit großem Gepäck in Bahnhofsnähe herumdrückte, einmal hatte ich es sogar bis auf den Bahnsteig geschafft, bevor Jacinthas Suchtrupp mich einsammelte.
Irgendwann hatte ich aufgegeben und auf Atalantes Geheiß Bücher abgestaubt. Allein die Erinnerung daran erfüllte mich nun mit Beklemmung. Wenn Padmini mir damals nicht geholfen hätte, wäre ich mit Sicherheit wahnsinnig geworden. Und Asthmatikerin.
So oder so – Atalantes Drohung saß. Ich nickte missmutig. Ich würde meinen Dienst bei Myrto definitiv pünktlich antreten.
„Und du Hippolyta“, jetzt bekam sie eine fiese, tiefe Stirnfalte, „falls ich nochmal höre, dass sich jemand über dich beschwert, werde ich dich für die nächsten Jahre in die Amazonengemeinschaft nach Viesca schicken.“
„Was?“ Polly blickte entsetzt auf.
Auch ich war mir sicher, mich verhört zu haben. Viesca war eine der etwas kleineren Amazonensiedlungen des Landes, die, genau wie wir, abseits der, oder besser, parallel zur restlichen Gesellschaft lebten. Es war nicht so, dass wir uns versteckten – das hatten die Amazonen gar nicht nötig, und ihre Existenz war schon von vielen, vielen Künstlern und Geschichtsschreibern besungen und belegt worden. Es verhielt sich eher so, dass die Amazonen keine Lust auf den Rest der Welt hatten. Und obwohl Globalisierung und Urbanisierung es uns zunehmend schwer machten, noch unberührte Natur zu finden, half uns der moderne Zeitgeist auf der anderen Seite, in den vielfältigen Strömungen verschiedenster Lebensstile unterzutauchen und unbeachtet das Unsere zu tun.
Viesca bildete da keine Ausnahme: Das Dorf war zu Pferde in etwa drei Stunden zu erreichen und lag weitab vom Schuss in einer malerischen, einsamen Berggegend. Für mich wäre es die Hölle, dorthin versetzt zu werden, ohne Aussicht auf die Lichter und das Leben der Stadt, aber selbst Polly, das Naturkind, sah wie vom Donner gerührt aus.
„Ich habe das Gefühl, du denkst, du hättest Narrenfreiheit, weil du die Diadoka bist“, fuhr Atalante fort. „Lerne, dass dem nicht so ist.“
„Das ist nicht dein Ernst“, brachte Polly hervor.
„Polly kann nichts dafür“, hörte ich mich gegen meinen Willen sagen. „Abgesehen von gestern war sie immer pünktlich und hat meine Arbeit sogar mit übernommen.“
„Es ehrt dich, dass du sie in Schutz nehmen möchtest, aber bei Hippolyta geht es ums Prinzip. Die anderen Frauen sollen nicht denken, dass ich sie schone, nur weil sie meine Tochter ist. Und die zukünftige Paiti muss allen ein Vorbild sein. Wir dürfen uns da keine Patzer erlauben.“ Atalante seufzte und setzte milder hinzu: „Sinope, eine Freundin von mir in Viesca, hat eine Tochter in deinem Alter. Du wärst in guter Gesellschaft. Dennoch wünsche ich mir natürlich, dass eine solche Maßnahme unnötig ist und du hier bei mir bleiben kannst. Alles soweit klar?“
Wir nickten nur benommen. Selbst Polly hatte es die Sprache verschlagen.
„Gut.“ Atalante klatschte in die Hände und sprang auf. Sie konnte nie lange still sitzen. Ihre fröhlich hüpfende Adlerfeder schien uns zu verhöhnen, als die Paiti verkündete: „Dann mal hinaus mit euch! Genießt den Tag mit euren Schwestern!“
Für mich war es nicht so schlimm. Ich würde meine Raubzüge einfach auf Sonntag verschieben und ab Samstagmittag in der Küche herumhängen, damit ich bloß meinen Strafdienst nicht verpasste. Aber Polly tat mir seltsamerweise leid. Wie ihre Mutter sie behandelt hatte, war einfach gemein.
Sicher, ich verstand mich mit meiner Mutter auch nicht, doch daran hatte ich mich gewöhnt, denn unsere Beziehung war schon seit Anbeginn der Zeiten … schwierig. Meiner Zeiten, um genau zu sein. Wir waren uns nie wirklich nahe gekommen, weil wir uns in meinen ersten Lebensjahren kaum gesehen hatten. Meine Mutter absolvierte zu der Zeit ihre Ausbildung, und wenn wir dann mal alle paar Wochenenden aufeinander trafen, waren wir uns fremd und die Atmosphäre angespannt. Aufgezogen wurde ich von meiner Uroma. Die jedoch hätte mich nie in eine andere Gemeinschaft geschickt. Patzer, wie Atalante das nannte, hin oder her – meine Bisabuela hatte mich immer verstanden und geliebt. Und das, obwohl sie auch eine Paiti gewesen war.
Mein Mitleid für Polly kam jedoch zu einem abrupten Ende, als ich die kleine Kröte keine Stunde später bei meiner hohlen Esche erwischte.
KAPITEL 2
Das Miststück saß auf der Wiese vor meinem Baum und durchwühlte ungerührt meine Schätze. Den roten Schal hatte sie sich umgehängt, mein Trenchcoat lag quer über ihrem Schoß und an ihren Fingern steckte eine Vielzahl von Ringen. Gerade fischte sie ein orangefarbenes Gerät aus der kleinsten der Boxen. Ich sprintete los.
„Du miese Schnüfflerin, was hast du hier zu suchen!?!“ Ich warf sie fast um, als ich ihr meinen BrazPlayer aus der Hand schlug.
„Du hast dich getäuscht! Der Baum ist doch hohl“, verkündete sie mit unschuldigem Augenaufschlag und rappelte sich wieder auf. „Und voller toller Sachen!“
„Ich weiß, du dämliche Kröte, und das sind meine Sachen!“
„Aber Amazonen haben keine … Mas-ca-ra“, buchstabierte sie. „Und kein … Glow Touch Rouge. Und keinen High Definition Compact Music Player“, las sie weiter von meiner Beute ab.
Ich riss ihr fluchend alles aus der Hand und stopfte es wieder in die Kisten. „Das hier geht dich überhaupt nichts an, ist das klar?“
„Keine Ahnung“, gab sie zurück. „Was ist das alles? Was ist ein High Compact Musikding? Und warum ist es orange?“
„Lässt du mich in Ruhe und kommst nie wieder hierher, wenn ich es dir erkläre?“
„Logo.“
Ich nahm all meine Geduld zusammen und zeigte ihr den BrazPlayer. „Das ist zum Musik hören. Hier ist das Menü und hier siehst du Liedtexte, Coverkunst und Hintergrundinformationen.“ Ich hielt Polly die Kopfhörer hin. „Steck dir die Dinger in die Ohren.“
Sie tat es, wenn auch mit einiger Skepsis. Ich machte mir nicht die Mühe, ein besonderes Lied herauszusuchen. Genau genommen waren ohnehin nur die 30 Beispiellieder darauf, mit denen das Gerät gekommen war. Ohne Geld konnte ich schließlich auch nichts daraufladen. Ich drückte Play und Polly riss die Augen auf. Stocksteif saß sie da und lauschte völlig überfordert, während ich meine Kisten und Kästchen wieder zurück in den Baum schleppte.
Als ich dort alles sicher verstaut hatte, setzte ich mich wieder zu Polly und knuffte sie, bis sie sich bequemte, einen Kopfhörer aus ihrem Ohr zu ziehen.
„Schluss jetzt“, sagte ich. „Gib mir den Player zurück.“
„Keine Chance.“ Polly stöpselte sich wieder ein und studierte weiter die Broschüre, die mit dem BrazPlayer in der Box gewesen war.
„Sofort!“
Sie schüttelte den Kopf. Ließ mir quasi keine andere Wahl. Ich versuchte, ihr das Gerät mit Gewalt zu entreißen. Mit so einer halben Portion sollte ich eigentlich leichtes Spiel haben, aber ihr schien wirklich etwas an dem Player zu liegen und es gab eine ziemliche Balgerei, bis ich das Ding völlig erschöpft und mit zerrupften Haaren zurückerobert hatte.
„Du bist gemein!“, klagte Polly und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Und du bist eine unerträgliche Schnüffelkröte, die sich jetzt sofort verzieht und nie wieder hier blicken lässt“, berief ich mich auf unsere Abmachung.
Da war er plötzlich wieder. Dieser listige Blick, mit dem sie mich schon am Vortag bedacht hatte. „Nein, ich glaube, ich möchte lieber auch so einen Player.“
„Du spinnst.“
„Andernfalls lasse ich dich und dein Versteck auffliegen.“
Mir blieb die Spucke weg. „Das kannst du nicht machen.“ „Doch. Werde ich machen.“ Eigensinnig schob sie ihr Kinn vor.
„Polly, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles“, versuchte ich es auf eine andere Tour. „Es hat mich sehr viel … Mühe gekostet, den BrazPlayer zu bekommen.“
„Oh, den BrazPlayer kannst du behalten.“
„Was?“ Jetzt verstand ich gar nichts mehr.
„Ich will den GemPlayer hier.“ Sie tippte auf die Broschüre.
„Der braucht weniger Strom, hat viel mehr Speicherkapazität und ein …“, sie runzelte die Stirn, entzifferte die Produktbeschreibung, „… sexy Design.“
Ich sprang auf die Beine, konnte nicht mehr stillhalten, weil ich mich zunehmend hilflos fühlte. „Du bist völlig verrückt!“, stammelte ich. „Der ist zu groß. Also zu teuer, meine ich. Den kriege ich nicht. Keine Chance. Nein, Polly.“
Sie biss auf ihrer Unterlippe herum und machte große Augen. „Bitte?“
„Es geht wirklich nicht.“
„Bittebitte? Ich brauche ihn. Echt.“
Ich schüttelte den Kopf, während in mir die Hoffnung aufkeimte, dass ich in dieser Diskussion vielleicht wieder die Oberhand gewinnen würde.
„Wenn sie mich wegschickt, dann habe ich wenigstens Musik dabei“, sagte Polly leise und blickte nach unten. Sie strich mit den Händen durch das Gras und ihre Unterlippe zitterte ein bisschen. Es war herzzerreißend, auch wenn ich ahnte, dass sie nur Theater machte.
„Sie wird dich nicht wegschicken. Es sei denn, du erlaubst dir einen Patzer – und ich sage dir, ein GemPlayer ist ein Mega-Patzer.“
„Ich hebe die Abmachung von gestern auf. Ich putze stattdessen ein halbes Jahr deine Schuhe. Und übernehme deinen Tischdienst. Und den Stalldienst.“
Ich horchte auf. „Auch den Stalldienst? Die Frühschicht?“
„Klar. Und ich verrate dein Versteck hier nicht.“