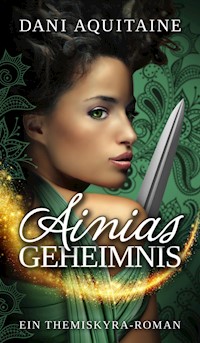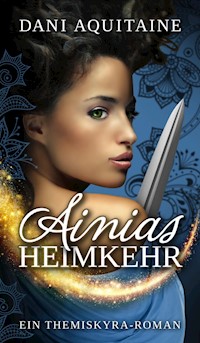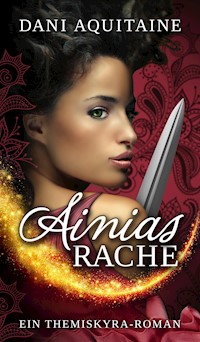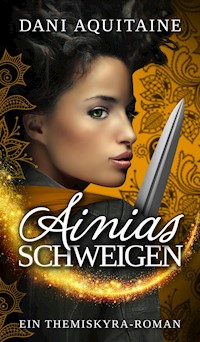
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ainia
- Sprache: Deutsch
"Gewissensbisse plagten mich. Ein paar Mal war ich drauf und dran, meine Pläne über Bord zu werfen und ihr einfach die Wahrheit zu sagen. Aber ich durfte nicht riskieren, Ces zu verlieren…" Die globale Erschöpfung der Erdölvorräte hat die zivilisierte Welt in die Knie gezwungen. Ainia ist bei einer Gruppe von Schwarzhändlern untergekommen, und als sie dort den attraktiven Cesare aus den Clans kennenlernt, verfällt sie ihm sofort. Doch obgleich er ihre Gefühle zu erwidern scheint, kann er ihnen nicht nachgeben, denn er ist seiner Yashta Ell verpflichtet, und diese zu verlassen würde die Existenz seiner Familie aufs Spiel setzen. Auf der Suche nach einer Lösung für ihre verzwickte Lage stößt Ainia auf ein Geheimnis, das ihre gewagtesten Vermutungen übertrifft und ihr ein Druckmittel gegen die mächtigste Amazonenherrscherin des Landes in die Hand gibt. Doch dann wird Ell entführt und die Ereignisse überstürzen sich…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für Tante Inge, die Beste.
DANI AQUITAINE
Band 3
Ein Themiskyra-Roman
AUFGEPASST:
Ein Glossar mit Begriffserklärungen befindet sich am Ende des Buches.
WEITERE BÄNDE DIESER REIHE:
Ainias Geheimnis (Band 1)
Ainias Rache (Band 2)
Ainias Heimkehr (Band 4)
WEITERE THEMISKYRA-ROMANE:
Themiskyra – DIE BEGEGNUNG (Band 1)
Themiskyra – DAS VERSPRECHEN (Band 2)
Themiskyra – DIE SUCHE (Band 3)
Finger weg! Pollys Aufzeichnungen
© 2019 Dani Aquitaine
Umschlaggestaltung: Dani Aquitaine
Verwendetes Bildmaterial:
Amazone: © Coka, Fotolia
Faltenwurf: © inarik, Fotolia
Goldbogen: © vik_y, Fotolia
Schwert: © Paul Fleet, 123rf.com
Floraler Hintergrund: © mohaafterdark, DeviantArt
Verwendete Schriften:
Liberation Serif unter der SIL Open Font License
La Portenia de la Boca by Diego Giaccone, Angel Koziupa & digitized by Alejandro Paul
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7469-5966-5
Hardcover:
978-3-7469-5967-2
e-Book:
978-3-7469-5968-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
KAPITEL 1
„Möchtest du Senf zu deinem Senf? Oder lieber Senf?“ Homer tauchte aus einer der Kisten im Lager auf und hielt in jeder Hand ein identisches Glas hoch.
Ich zog ein Gesicht. „Nein, danke. Ich nehme Senf.“ Dann stellte ich die Kerze ans schmale Fenster, setzte mich auf eine leere Holzkiste und schlug die Hände vor das Gesicht. „So geht’s nicht weiter.“
„He, bleib da, ich brauche Licht“, beschwerte sich Homer.
„Wofür?“, fragte ich sarkastisch. „Es ist nichts mehr da. Außer Senf. Und den erkennst du mittlerweile auch im Dunkeln.“
Der Strom war vor ein paar Monaten ausgegangen und seither nicht wiedergekehrt. Wir hatten zwar zwei riesige Solarplanen auf dem Dach und Marlon forschte nach Möglichkeiten, eine seiner Meinung nach irgendwo unterhalb des Geländes befindliche Heißwasserquelle aufzutun, aber bislang war das nur diffuse Zukunftsmusik. Bis dahin nutzten wir eben Kerzen und Fackeln zur Beleuchtung und wuschen uns kalt mit dem Wasser, das wir aus dem Brunnen vor der Halle pumpten und in Zubern zu den Duschkabinen schleppten. Das Trinkwasser holten wir in großen Fässern von einer Quelle, die fast vierzig Kilometer entfernt lag. Im Zuge des Verfalls hatte es einige unschöne Chemieunfälle gegeben, und mit dem Stromausfall hatten auch die Klärwerke versagt; seither war das Leitungswasser nicht mehr trinkbar.
Der Kühlschrank bestellte nichts mehr und das zugehörige Logistikunternehmen, das uns zuletzt lediglich mit einer Palette Senf bedacht hatte, existierte nicht mehr. Die Feuerstelle war unser Herd. Nur, dass es eben gerade nichts zu kochen gab. Und das musste sich ändern.
„Mir reicht’s!“, knurrte ich und stampfte hinaus.
„Freundlich und diskret“, rief mir Homer noch hinterher.
Als ich Shirokko mal vor allen seinen Mannen rund gemacht hatte, weil seine zunehmend langhaarige Meute es nicht für nötig hielt, die Haare aus dem Abfluss in der Dusche zu ziehen und ich dann die Überschwemmung wegpümpeln musste, hatte er sich mich – nicht wortwörtlich – zur Brust genommen.
„Du untergräbst meine Autorität vor den Männern“, hatte er geschnaubt, nachdem er seine Zimmertür hinter uns zugeworfen hatte.
„Deine Autorität?“, echote ich. „Du hast die Typen überhaupt nicht im Griff! Was ist das hier für ein Kindergarten! Habt ihr schon mal was von Disziplin gehört?“
O Artemis, ich hörte mich an wie meine eigene Mutter. Aber es half nichts, irgendjemand musste ihnen ja mal den Kopf zurechtrücken.
„Ich führe meine Männer, wie ich es für richtig halte“, donnerte er und raufte seine wilde, blonde Mähne.
Ich wich nicht zurück, meine Arme blieben vor der Brust verschränkt. Ich hatte in Themiskyra so viele Donnerwetter von Jacintha und der Paiti einkassiert, ein wütender Wikinger juckte mich nicht die Bohne.
„Sei dankbar, dass du hierbleiben darfst“, schimpfte dieser weiter, „und sieh mal lieber zu, dass du dir ein sinnvolles Betätigungsfeld suchst. Und, nein – ich meine damit nicht die Neuordnung unserer Verhaltensregeln.“
„Schade. Ich hätte einige gute Ideen.“
„Das möchte ich wetten. Klär deine Probleme direkt mit den Männern oder besprich dich in Ruhe mit mir. Sonst fliegst du hier raus! Ist das klar?“
„Klar“, gab ich unbeeindruckt zurück.
Als ich nun die Metallstufen zur Zwischenetage hinaufpolterte, dachte ich mir jedoch: Shirokko kann mich mal. Dann flieg ich eben hier raus, aus der kalten, zugigen Halle, in der es nichts gibt außer Chaoten, ohrenbetäubender Musik und Senf. Warum bemühe ich mich überhaupt?
Weil mir die besagten Chaoten ans Herz gewachsen waren. Nicht als ’Shimet – über die war ich nachhaltig hinweg. Sondern als Menschen, Gefährten, Freunde, teilweise Vertraute. Nur deswegen war ich nicht nach Urba zu Biskaya und den Mädels zurückgekehrt, sondern hing immer noch in Citey fest. Dennoch – ich musste ein ernstes Wort mit Shirokko reden. Freundlich. Und diskret. In seinem Zimmer.
Ich wartete sogar nach dem Anklopfen seine Antwort ab, bevor ich eintrat.
„Wir hungern“, kam ich ohne Umschweife zum Punkt. Shirokko sah auf. Er lag auf einer abgewetzten Ledercouch herum und machte, mit Kugelschreiber und Papier bewehrt, den Anschein, als wolle er ein Gedicht verfassen. Oder einen Brief. Mit etwas Glück eine Einkaufsliste. „Das tut mir leid. Es ist zurzeit schwierig …“
„Unsinn“, unterbrach ich ihn und setzte mich ungefragt auf seinen thronartigen, mit Schnitzereien verzierten Sessel hinter dem leeren Schreibtisch. „Wir hätten locker genug, wenn du nicht das letzte Gold in das letzte Benzin der Stadt gesteckt hättest.“
„Die Männer brauchen ihre Motorräder.“
„Unsinn. Kein Mensch braucht mehr Motorräder. Macht euch unabhängig von den alten Brennstoffen! Ist doch ohnehin nur Verzögerungstaktik.“
Er taxierte mich unwirsch. „Was schlägst du vor?“
„Holt euch Pferde. Baut den Stall aus. Verkauft den Sprit, der noch in den Tanks der Motorräder steckt, und habt ein sorgloses Leben.“
„Unsinn“, erwiderte jetzt Shirokko, legte Papier und Stift beiseite und setzte sich schwungvoll auf. „Die Männer brauchen ihre Maschinen. Das ist wichtig für den … Geist.“
Ich sah ihn vielsagend an.
Er ließ sich nicht provozieren. „Sonst noch was?“
„Ja“, schnappte ich, beleidigt über eine solche Uneinsichtigkeit. „Ich gehe auf die Jagd. Was dagegen?“
„Äh, nein. Natürlich nicht.“
„Gut.“ Ich stand auf und marschierte zur Tür.
„Nimm einen von den Männern mit.“
„Kein Bedarf.“
Die Jagd war nie mein favorisierter Arbeitsbereich in Themiskyra gewesen. Mit Pfeil und Bogen konnte ich halbwegs umgehen, aber ich schoss bei Weitem lieber auf Strohzielscheiben, als auf lebendiges Wild. Warum? Erstens: Das frühe Aufstehen. Die Jagd beginnt in Themiskyra im frühen Morgengrauen. Definitiv nicht meine Zeit. Zweitens: Das Töten.
Gegner niederzustrecken stellt kein Problem für mich dar. Aber ein Tier ist kein Gegner, es hat einfach das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und einer hungrigen Amazone ins Visier zu geraten. Und drittens: Die Plackerei danach. Sprich: Aufbrechen. Herumschleppen. Fell abziehen. Rupfen. Abschuppen. Was auch immer.
Für frühes Aufstehen war es zu spät, aber alles andere war und blieb unerfreulich. Die Fabrikhalle lag im Süden der Stadt; auf dem Rücken meines geliebten, energischen Fuchshengstes Chiimori war ich also weiter Richtung Süden geritten, bis ich auf Wald stieß. Da ich mich nicht auskannte, pirschte ich auf gut Glück durch die Gegend, sammelte nebenher ein, was mir an Essbarem unterkam, und fand nach ein paar Stunden ein Wildschwein. Es durchwühlte den Boden arglos nach Würmern und tat mir in dem Moment leid, als ich es erblickte. Doch ich ließ mir keine Zeit zu zögern, legte an, löste den Pfeil, erlegte das Tier, erledigte den Rest mit einem Messer. Dann sank ich zurück ins Gras und schloss die Augen.
„Danke“, flüsterte ich, „danke dir, Artemis, dass du mir den Weg gewiesen hast, danke dir, Wald, für dein Geschenk, danke dir, Wildschwein, für dein Opfer.“
Ich hatte Glück, es war eine relativ junge, schlanke Bache; dennoch brach ich unter ihrer Last fast zusammen, als ich das ausgeweidete Tier in ein großes Tuch gehüllt auf Chiimoris Rücken schnallte. Da ich dem Aspa nicht noch mehr Gewicht aufbürden wollte, führte ich es am Zügel zurück in die Stadt, wo ich unter großem Hallo von Shirokkos Mannen in Empfang genommen wurde.
„Wolltest du nicht Vegetarierin werden, wenn der Verfall kommt?“, erkundigte sich Homer und seine dunkelbraunen Augen glitzerten spöttisch hinter den schwarz umrandeten Brillengläsern, während die anderen mein Aspa von seiner Bürde erlösten.
„Würde ich sofort.“ Ich warf ihm ein kleines Säcklein entgegen, in dem sich gerade mal eine Handvoll Pilze und ein Dutzend winziger Erdbeeren befanden. „Aber wir haben nicht rechtzeitig angebaut und den stadtnahen Wald haben die hungrigen Städter schon ziemlich kahlgefressen.“
„Warum hast du deine Möhrensamen nicht gesät?“
Die hatte ich mal im Anflug von Panik erworben, als Homer mir klar gemacht hatte, dass der Verfall keine vorübergehende Erscheinung, kein PR-Gag, kein Sommerloch-Füller und kein Polit-Hintertürchen war, sondern bitterer, tödlicher Ernst. Homer war mir der Vertrauteste unter den Mannen und der Einzige, der mir in meiner Anfangszeit bei Shirokko dankenswerterweise nicht den Hof gemacht hatte. Stattdessen hatten wir das Lagerfeuer vor der Halle geteilt und so manches tiefschürfende Gespräch geführt, auch darüber, was uns blühen würde, wenn die Zivilisation demnächst den Bach runterginge. Was sie dann ja auch getan hatte.
„Habe ich ja“, verteidigte ich mich.
„Aber?“, hakte Homer nach.
„Die verdammten Frettchen haben alles weggefressen“, murmelte ich, weil ich nicht zugeben wollte, dass mir die Pflanzen eingegangen waren.
In Themiskyra hatten wir uns komplett selbst versorgt und demnach selbstverständlich auch alles Mögliche angepflanzt, aber da war es mir irgendwie einfacher vorgekommen. Vermutlich, da ich mich nur einer Befehlskette unterordnen musste. Pflanz das. Jäte dieses. Ernte jenes. Profunderes Wissen hatte uns Jacintha zu vermitteln versucht, doch mich hatte das alles im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Bohne interessiert, da Jacintha nicht nur unsere Lehrerin, sondern zufälligerweise auch meine Mutter war.
Gewesen war.
Sie hatte mich ziemlich sicher als Tochter abgeschrieben, nachdem ich mich mit Kassian Devinter eingelassen hatte, einem unglaublich charmanten, unterhaltsamen und wohlhabenden ’Shim, der mir ein paar Wochen meines Lebens das Gefühl gegeben hatte, ein wertvoller, liebenswerter Mensch zu sein. Und nicht nur eine Arbeitsmaschine, die doch nur ungenügende Leistung erbringt, so wie ich mich in der Stadt der Amazonen immer gefühlt hatte. Leider hatte sich der besagte Traumprinz als ziemlicher Albtraum entpuppt. Während ich mit meiner Mutter, meiner Kultur und meiner Heimat gebrochen und alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um ihn zu finden, hatte er nichts Besseres zu tun gehabt, als mit seiner Sandkastenliebe Melissa herumzuknutschen. Zur Strafe hatte ich ihre Glastiersammlung zerstört und seine Bankkonten leergeräumt – das Gold, das nun, in einem Lederbeutel unter meinem Shirt getragen, im Verborgenen meine Zukunft, meine Hoffnung, mein permanent schlechtes Gewissen repräsentierte …
Irgendetwas stimmte nicht. Die Männer scharten sich ratlos um den Tierkadaver.
„Was ist los?“, fragte ich und wedelte mit den Händen, um sie anzutreiben. „Abschwarten. Zerteilen. Feuer machen. Los!“ Mein Magen lief fast Amok vor Hunger.
„Ähm“, sagte Washington und rückte sein bunt gemustertes Haarband über seinen blonden Locken zurecht.
„Carlos schlägt gerade nach“, beruhigte mich Marlon und verschränkte, ansonsten tatenlos, die Arme vor der breiten Brust.
„Er schlägt nach?!“ erkundigte ich mich leise bei Homer und war mir sicher, dass ich mich verhört haben musste.
„Ja.“
„Wo? Hat er ein Buch, Schlachten für Dummies?“
„Nein, er hat das Internet kopiert.“ Erst dachte ich, das sei Sarkasmus, weil meine Frage so blöd gewesen war, aber an seiner Miene erkannte ich, dass Homer es ernst meinte. Ich winkte ab; ich war zu ausgehungert, um nachzudenken oder nachzufragen, zu ungeduldig, um mich mit solchen Details herumzuschlagen. Wütend marschierte ich zu den anderen hinüber.
„Bei Artemis, muss ich mich hier denn wirklich um alles kümmern?!“
„Nein. Lasst mich durch, ich bin Koch.“ Ein weiteres Mal teilte sich die Menge, um Bela Platz zu machen, der seine braunen Locken mit einem albernen Käppi aus dem Gesicht hielt. Lancelot, wie immer mit Kettenhemd und Schwert gerüstet, folgte ihm.
Die restlichen Mannen verzogen sich rasch, um zu vermeiden, selbst zur Arbeit herangezogen zu werden. Auch ich atmete auf. Ich wollte es die anderen nicht merken lassen, doch ich hasste das Zerlegen und war von der Jagd ohnehin erschöpft. Mit Mühe rang ich mir ein letztes bisschen Kaltschnäuzigkeit ab. „Du bist Koch? Warum erfahre ich das erst jetzt? Warum haben wir vor dem Verfall wochenlang Chili con Carne essen müssen? Warum –“
„Nia, halt die Luft an.“ Bela wetzte sein Messer. „Wir haben das Beste aus dem gemacht, was der Kühlschrank bestellt hatte. Und ich bin hier nicht als Koch angestellt.“
„Sondern?“ Obwohl ich die Dienste der Mannen selbst schon in Anspruch genommen hatte, als wir Melissas Schwester Chiara aus den Fängen einer Sekte retten mussten, war mir nicht so ganz klar, was die ’Shimet derzeit eigentlich genau machten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Er grinste mich an. „Als Glücksritter und Söldner, Schatzsucher und Schürzenjäger. Oder so.“ Sein strahlendes Lächeln steckte mich nicht wie gewöhnlich an, denn diese vier Schlagworte hatten schlummernde Areale in meinem Gehirn aktiviert. Abwesend ließ ich sie kreisen und setzte mich zu Homer an unsere Feuerstelle, in der mittlerweile Flammen tanzten.
„Gesetzt den Fall, du hättest Gold –“
„Woher willst du wissen, dass ich keines habe?“
„Dann würdest du nicht mit diesen glücklosen Glücksrittern herumhängen, sondern zu deiner Zirkus-Familie zurückkehren und wieder Schwerter schlucken und Messer werfen.“
„Stimmt.“ Er schichtete mit unbewegter Miene einige Holzscheite auf.
„Also. Stell dir vor, du hättest einen Schatz, den du sicher irgendwo unterbringen müsstest. Nur mal angenommen. Wie würdest du ihn, rein hypothetisch, verstecken?“
„Spar dir die Floskeln. Wir wissen von deinem Gold. Du hast uns schließlich bezahlt.“
Ich rollte mit den Augen. Homer hatte recht, aber keiner von ihnen wusste, wie viel ich wirklich hatte, wie viele von den Tafeln mit den winzigen Goldplättchen, die ich nach Bedarf abtrennen und als Zahlungsmittel einsetzen konnte. Nach der unaufhaltsamen Inflation, die uns im Zuge des Verfalls überrollt hatte, hatte das Papiergeld mittlerweile komplett an Wert verloren. Gold war es, das zählte.
„Nun?“
Er stocherte eine Weile mit einem Ast zwischen den Scheiten herum. „Ich bin, wie du ganz scharfsinnig bemerkt hast, kein Experte, aber ich denke, ich wäre für den Klassiker.“ Er sah auf. „Vergraben. Und nur dem allerbesten Lagerfeuergefährten sagen, wo.“
„Das würde dir so passen.“ Ich dachte nach. Vergraben also. Sollte ich das Gold sicherheitshalber an verschiedenen Plätzen verteilen? Oder lieber alles an einem perfekten Ort verstecken? Aber wo war der? Wahrscheinlich grub derzeit die halbe Stadt irgendwo herum, und sei es nur im Versuch, der Scholle irgendwelches Wurzelgemüse abzuringen. Es musste ein Ort sein, der in ein paar Jahren, wenn nicht Jahrzehnten noch existierte. Ein unauffälliger Ort. Ein Ort, an dem ein zufälliger Besucher nicht gleich sah, dass gegraben worden war. Optimalerweise ein Ort, an dem gar kein Besucher vorbeikam. Aber auch nicht zu weit weg.
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich draufkam, und es war ein anstrengender Ausflug, aber dann war ich zufrieden. Eine Goldtafel hatte ich behalten. Sie würde mich über Wasser halten, wenn es hart auf hart käme, und mich in Ruhe und Sicherheit wiegen, während mich der vergrabene Anteil von der ständigen Sorge befreite, mein gesamtes Vermögen auf einen Schlag zu verlieren, wenn es blöd lief.
Ich hatte schon einmal alles verloren – nein, eigentlich zweimal, doch das erste Mal war eher ideeller Natur gewesen, als ich aus Themiskyra verbannt wurde. Beim zweiten Mal war ich einer Polizeistreife am Bahnhof aufgefallen, als ich mit Chiara nach Urba zurückkehren wollte. Sie hatten mich gefilzt, mein Gold gefunden, jedoch keinen Pass, und das hatte ihnen als Begründung genügt, mich fürs Erste wegzusperren. Duke Ibro, ein geheimnisvoller Typ, halb verdeckter Ermittler, halb Verbrecher, der vagerweise irgendwann mal vielleicht ein bisschen in mich verliebt gewesen war, hatte mich rausgeholt und mir meine Habe wieder besorgt.
So oder so, auf mein Glück oder andere Menschen wollte ich mich zukünftig nicht mehr verlassen, und jetzt war mein Gold in Sicherheit.
Tags darauf rief mich Shirokko zu sich. Ich ließ ihn aus Prinzip ein bisschen warten, bis ich sein Zimmer aufsuchte, alles andere wäre meinem Selbstwertgefühl als Amazone abträglich gewesen. Diesmal wirkte er weniger teilnahmslos als am Tag zuvor, er stand mitten im Raum und schien angestrengt nachzudenken.
„Gut, dass du kommst.“
Ich zuckte mit den Schultern und machte es mir mal wieder auf seinem Wikingerthron bequem.
„Danke für das Fleisch gestern.“
„Irgendjemand muss sich ja darum kümmern“, gab ich knapp zurück. „Wenn deine Mannen nichts mehr zu beißen haben, geben sie nämlich trotz ihrer Motorräder den Geist auf.“
„Nia, ich weiß, du denkst, ich kümmere mich nicht genug. Aber –“
„Du hast Homer ausgelacht!“, unterbrach ich ihn vorwurfsvoll. „Er hat alles vorausgesagt, und du hast ihm nicht den geringsten Glauben geschenkt!“
„Natürlich habe ich das. Nur ein Narr hätte die Anzeichen übersehen können. Und nur deswegen haben wir einen Riesen-Akku hier, an den du deine Solarplane sowie, wohlgemerkt, diejenige, die ich bereits vor Monaten besorgt habe, anschließen kannst. Deswegen haben wir einen Brunnen da draußen. Deswegen haben wir …“
„Senf?“, schlug ich mit einem halben Lächeln vor.
„Schieb mir nicht den Senf in die Schuhe!“, erwiderte er mahnend. „Den hast du vom Lieferanten angenommen.“
„Pff.“
„Deswegen haben wir noch Brennholz“, fuhr er fort. Er war ans Fenster getreten und sah hinaus. Durch das stille Gewerbegebiet waberten Schichten aus Dunst und Rauch, verschleierten den ansonsten sonnigen Frühlingstag. „Deswegen haben wir noch Zahnpasta, Kaffee und eine riesige Datenbank aus Internetfragmenten. Aber du hast recht, das mit dem Essen ist ein Problem. Mein Kontakt auf dem Land hat mich leider im Stich gelassen – beziehungsweise, ich habe seit mehreren Tagen nichts mehr von ihm gehört. Ich werde mich nach neuen Quellen umsehen müssen. Aber bis dahin …“ Er wandte sich mir zu. „Meinst du, du könntest uns ab und zu etwas jagen?“
Ich zuckte gnädig mit den Schultern.
„Und ich habe über deinen Vorschlag nachgedacht. Wie aufwendig ist das mit den Pferden?“
„Das mit den Pferden?“, echote ich. „Was meinst du damit genau? Pferde kaufen, zureiten, Stall auf- und ausbauen, Reitunterricht und dergleichen? Sehr aufwendig.“
Shirokko trommelte mürrisch mit den Fingern auf dem Fensterbrett herum.
„Aber sieh es mal so – Zeit haben wir genug. Und wenn du nicht das letzte Gold in das letzte Benzin der Stadt gesteckt hättest –“
„Wie viel brauchst du?“ Er war zu einem schwarzen Metallschrank gegangen, der die gesamte Raumbreite einnahm, schob jetzt eine der Türen zurück und öffnete mittels eines Zahlencodes einen kleinen Safe.
„Keine Ahnung“, gab ich ehrlich zu. „Mit den derzeitigen Preisen kenne ich mich nicht aus.“
„Schau mal, wie weit du damit kommst.“ Er warf mir eine viertel Goldtafel zu.
Ich fing sie und blickte leicht fassungslos auf das glänzende Metall herab. Eben war ich mein Gold losgeworden und jetzt bekam ich schon wieder neues aufgebürdet?
Das war wahrlich ein Luxusproblem.
„Du hast noch Gold?“, fragte ich entgeistert. „Warum beim Hades hast du dann nichts zu essen gekauft für deine Leute?!“
„Nia, das Problem ist nicht die Bezahlung. Das Problem ist der Mangel an Nachschub. Inzwischen sind den meisten Leuten die Vorräte ausgegangen. Zu viel Nachfrage. Zu wenig Angebot.“
„Hrrrm“, grummelte ich. „Okay. Ich nehme das eine oder andere zurück, leg mich bitte nicht fest, was genau. Um Jagd und Fischerei kümmere ich mich, solange mir jeweils einer von den Mannen beim Schleppen hilft. Erst mal haben wir ja noch genug zu essen.“ Bela hatte das Wildschwein mit Lancelots Hilfe komplett zerlegt und alles, was wir nicht sofort essen konnten, weiterverarbeitet oder haltbar gemacht. „Und was die Pferde anbelangt, muss ich mich erst umsehen.“
Das tat ich. Nach vier Tagen hatte ich einen Bauernhof gefunden, der früher auch eine Reitschule gewesen war, und dessen Inhaber mir junge, gesunde Tiere zu einem vermutlich angemessenen Preis überließ. Zumindest verbrauchte ich nicht das gesamte Gold, das mir Shirokko als Budget zugeteilt hatte.
Den Gedanken, mit der unfreundlichen alten Dame ins Geschäft zu kommen, die mir Chiimori damals verkauft hatte, hatte ich augenblicklich wieder verworfen. Ihr Hof lag zu weit entfernt und ich hatte keine Lust, mit ihr zu schachern.
Ich hätte dem Bauern auch gerne eine Kuh abgekauft, aber Shirokko hatte es mir strikt verboten. „Das ist hier keine Farm, sondern eine Fabrikhalle.“
„Milch im Kaffee?“, versuchte ich ihm meinen Vorschlag schmackhaft zu machen.
„Kuhfladen am Stiefel?“, gab er voller Sarkasmus zurück, und damit war meine Idee abgeschmettert.
Der Landwirt hatte mir die Adresse eines befreundeten Sattlers genannt, der uns für die Tiere passgenaue Sättel fertigte, und von dem wir auch die zusätzliche Ausrüstung erhielten, Decken, Halfter, Zaumzeuge, Stricke und Putzutensilien in großem Stil, sowie der Kontakt zu einem Kraftfutterlieferanten. Heu sollten wir in regelmäßigen Abständen direkt von dem Bauern bekommen, der uns die Pferde verkauft hatte. Mithilfe der Mannen stückelten wir einen weiteren Trakt an den Anbau an, der bisher als Lager und Chiimoris Stall genutzt wurde. Das war eine ziemliche Plackerei, aber es lohnte sich. Wir schufen großzügigen, hellen Platz für zwölf Pferde, bauten das Dach zum Futterlager aus und zogen einen Teil der bisherigen Lagerbestände in den Keller der Haupthalle um, um Raum für eine kleine Sattelkammer und einen Putzplatz zu gewinnen. Den früheren, gekiesten Parkplatz, auf dem das Gras mittlerweile meterhoch stand, zäunten wir als Koppel ein.
Und dann begann erst der eigentliche Spaß – nämlich elf mehr oder weniger begabten bis begeisterten ’Shimet das Reiten beizubringen. Abends war ich entnervt und heiser und sie waren erschöpft und beleidigt. Sogar Homer. An diesem Abend saß ich allein am Feuer vor der Halle. Okay, ich hatte ihn angeschrien. Aber, bei Artemis, ein bisschen Hingabe, Disziplin, Geschick und Begeisterung sind wohl nicht zu viel verlangt?!
Nun, bis zum Herbst lernten sie es alle, und irgendwann kehrte auch Homer ans Lagerfeuer zurück. Shirokko hatte einen neuen Nerista gefunden, einen Händler, der uns mit Obst und Gemüse, mit Klopapier und Seife versorgte, und alle paar Tage ging ich auf die Jagd. Der Ausnahmezustand wurde langsam, aber sicher zur Normalität. Es ging uns gut. Vergleichsweise.
Die Stadt stank. Seit Monaten verrotteten Berge aus Müllsäcken an allen Ecken und Enden. Unruhen im Zuge des Verfalls hatten ganze Wohnblocks zerstört, zigtausende Menschen hausten auf den Straßen, kochten dort, schliefen dort, benutzten dort nicht vorhandene Toiletten. Sozusagen. Bettelnde Kinder. Alkoholisierte Männer. Verzweifelte Frauen. Armut, Krankheit, Fäkalien – ich vermied es tunlichst, mich dort aufzuhalten, kümmerte mich lieber um die Pferde oder ritt hinaus aufs Land.
Im Winter wurde der Gestank besser, aber das Elend schlimmer. Auch für uns wurde es härter: Frisches Obst und Gemüse waren überhaupt nicht mehr aufzutreiben, das höchste der Gefühle war ein wurmstichiger, knautschiger Apfel ab und an. Wir hatten viel Holz gelagert, aber die Halle war so riesig, dass sie sich nicht gut heizen ließ. In den richtig schlimmen Nächten zogen alle Bewohner der unteren Etage ihre Matratzen und Sofas zur Feuerstelle – Ratten und Frettchen ausgenommen – und einer von uns hatte stets dafür zu sorgen, dass das Feuer nie erlosch. Ich trug meine wärmsten Kleidungsstücke übereinander und zitterte dennoch, bis mich endlich der Schlaf davontrug.
Und plötzlich ertappte ich mich bei einem Gedanken. Wenn ich jetzt zurückkehre und Abbitte leiste, werden sie mich nicht abweisen. Ich würde nicht mehr als Amazone in Themiskyra leben dürfen, aber als Arbeiterin würden sie mich wieder aufnehmen. Und egal, wie schwer dort die Arbeit, wie kalt auch dort die Nächte, wie bitter der Verlust meines Stolzes und meiner Selbstachtung sein würde, ich hätte ein Zimmer in einer der kleinen Hütten im Arbeiterviertel, mit einem Holzofen, der mich warmhalten würde. Und dieser winzige Aspekt wuchs sich während der eisigen Nächte zu einer handfesten, fixen Idee aus. Er war eine Art Rettungsanker.
Morgen. Morgen reite ich heim. Ich kann nicht mehr. Die
Kälte bringt mich um. Morgen reite ich heim. Ich halte noch durch, nur noch ein paar Stunden, nur noch bis morgen.
Doch morgens war es um genau so viel Grad wärmer, dass die fixe Idee nie ausreifte. Und dann kam es ganz anders.
Es erwischte mich auf der Jagd. Obwohl es eiskalt war und ich meinen Atem in dichten, weißen Wölkchen vor mir herstieß, war ich in Schweiß gebadet. Ich hatte nach langem Ausharren auf einem zugigen, morschen Hochsitz einen Hirsch erlegt, der uns einige Zeit gut versorgen würde. Aber er war viel zu schwer. Ihn Chiimori allein aufzubürden war undenkbar. Und auch, als Warmit und ich das arme Tier aufgebrochen und zerteilt hatten, gelang es uns fast nicht, die beiden Pferde damit zu beladen. Dann, auf dem Heimweg, begann ich zu schlottern. Um die Aspahet nicht zu überanstrengen, führten wir sie zu Fuß; das dauerte und während dieser Zeit fror ich völlig aus. Kälte kroch mir durch die Handschuhe und Stiefel in die Glieder, bis es schmerzte, ließ meine Locken gefrieren und betäubte meine Wangen.
Heim. Morgen reite ich heim. Nur noch einmal schlafen, einmal ausruhen, dann reite ich heim, dachte ich, „Heim, heim, heim …“
„Wir haben es bald geschafft“, redete mir Warmit zu, und da merkte ich erst, dass ich die Worte nicht nur gedacht hatte.
„Noch lange nicht“, schnaufte ich.
„Es sind nur noch ein paar Kilometer.“ Seine Stimme klang so tröstlich, dass ich mir die Mühe machte, den Blick vom nebligen Weg zu ihm zu heben.
Warmit sah selbst wie die Personifikation des Winters aus mit seiner schneeweißen Haut und dem Raureif, der in seinem Dreitagebart glitzerte. Dunkle, widerspenstige Haarsträhnen schauten unter seiner grobgestrickten Mütze hervor, und in seinen hellen Augen spiegelten sich die Farbe des fahlen Himmels und der Tannen. Und Mitgefühl. Göttin, ich musste ein Wrack sein, wenn selbst der unbekümmerte Warmit mich so ansah.
„Du sprichst nicht von unserem Zuhause, oder?“
„Nein“, brachte ich hervor und stellte entsetzt fest, dass ich mit den Tränen kämpfte. Mit letzter Kraft schaffte ich es, meine Armseligkeit in Wut umzuwandeln. „Ich halt’s einfach nicht mehr aus“, schimpfte ich. „Ich pack’ es nicht mehr. Ist doch auch zum Auswachsen – die ewige Kälte, die Nässe, die Plackerei, der Hunger.“
Den ’Shim konnte ich nicht täuschen. Er blieb stehen, nahm mich in die Arme und drückte mich mit seinen großen, selbstgenähten Fäustlingen an sich. Er roch nach Wildleder, Holzfeuer und auch ein bisschen nach frischem Hirschblut, aber ich versank in der Umarmung und biss mir auf die Zunge, um bloß den Tränen nicht nachzugeben.
„Du hast uns gerettet, vergiss das nicht. Ohne dich wären wir wirklich verhungert oder schon lange in alle Winde zerstreut. Du bist stark. Du schaffst auch das. Den Weg jetzt, und den Weg nach Hause.“
Nach Hause. In meiner Erinnerung war in Themiskyra immer Sommer, ich musste mich jetzt richtig zwingen, mir objektiv ins Gedächtnis zu rufen, dass es im Winter dort auch bisweilen bitterkalt war und wir auch dort im morgengrauen Wald auf der Jagd vor Kälte geschlottert hatten. Nicht an Kälte denken, nicht jetzt, wo Warmits Wärme gerade ein bisschen durch meine Jacke drang.
„Wo bist du zu Hause?“, fragte ich.
„Ursprünglich?“
„Ja.“
„Das spielt keine Rolle. Mich vermisst keiner.“
Ich nahm noch einen tiefen Atemzug Geborgenheit, bevor ich mich von ihm löste. „Es ist nicht so, als ob ich mich nicht zu Hause bei …“, fast hätte ich dir gesagt, „euch fühlte. Nicht ihr seid das Problem, sondern … die Welt. Diese kaputte, erschöpfend anstrengende Welt. Ich weiß einfach nicht, wie lang ich ihr noch trotzen kann.“ Ich straffte meine Haltung, zog unauffällig die Nase hoch. „Entschuldige. Es ist nicht meine Art –“
Er grinste. „Ehrlich zu sein?“
Ich nahm die Zügel meines Aspa und stapfte weiter. Jeder Schritt war so viel mühsamer als der vorhergehende. „Ich bin ehrlich.“
„Du weißt, was ich meine. Keiner verachtet dich, wenn du auch mal jammerst oder Erschöpfung zeigst. Das ist normal.“
Wahrscheinlich war es das. Aber ich musste auf meine Position achten. Ich musste beweisen, dass auch Frauen ein starkes Geschlecht sein konnten. Ich musste … Oh Artemis, war ich müde.
Vielleicht lag es an Warmits Zureden, vielleicht konnte ich auch wirklich einfach nicht mehr: Zuhause überließ ich den anderen die komplette restliche Arbeit, rollte mich nur am Feuer zusammen und fiel in unruhigen Schlummer. Dass es Schüttelfrost war, der mich plagte, und nicht die übliche Kälte, war mir gar nicht bewusst.
Ich weiß nicht, welcher Teufel mich tags darauf ritt, überhaupt aufzustehen. Die Welt schwankte schmerzhaft, wenn ich mich in die Senkrechte begab, aber nach einem Frühstück bestehend aus milchlosem Kaffee und frischem Brot ging es wieder halbwegs.
„Alles okay?“ Homer sah mich prüfend über den gesprungenen Rand seines Kaffeebechers hinweg an.
„Sicher.“ Der Schlaf hatte mich wieder auf Kurs gebracht. Regel Nummer eins: Nie eine Schwäche zugeben. Keine Amazonenregel. Eine Nia-Regel. Immer die Zügel in der Hand behalten. Und niemanden in die Karten schauen lassen. Alles andere wäre viel zu riskant.
Er wirkte nicht überzeugt, fuhr jedoch fort: „Gestern hat jemand nach dir gefragt.“
„Was? Wer? Wo?“, fragte ich alarmiert. „Warum erfahre ich das erst jetzt?“
„Du hast schon geschlafen, als wir heimkamen. Wir waren in der Innenstadt, um mit diesem Nerista die nächste Bier-Lieferung und ein paar andere Kleinigkeiten abzusprechen. Wegen der Kälte fand das Treffen in seiner Wohnung statt, ein völlig vollgestopfter Altbau mit Zeug bis an die Decke –“
„Homer! Bitte!!! Wer hat nach mir gefragt!?“, raunzte ich und musste husten.
„Als wir wieder herauskamen, sprach Lancelot und mich eine Frau an.“
Ein Schauder, der nichts mit der Kälte zu tun hatte, stellte mir die Haare auf den Armen auf. „Weiter“, krächzte ich.
„Sie fragte nach einer Ainia von Themiskyra. Ich wusste gar nicht, dass du adelig bist.“
„Weiter.“
„Sie war so um die fünfzig. Ungefähr so groß. Kurze Haare. Grau meliert. Schlank. Sportlich. Mit einem südasiatischen Einschlag, vielleicht war ein Elternteil aus Indien oder Pakistan. Eher der schlichte Typ. Unauffällig. Auch vom Kleidungsstil her.“
Mein Herz klopfte zum Zerspringen. „Sie sucht mich immer noch?“
„Sieht so aus. Shirokko hatte uns ja vorgewarnt, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie dir immer noch auf den Fersen ist. Ich dachte, mit diesem Typen, diesem … Duke sei inzwischen alles geklärt?“
„Ist es auch. Er hat sie nicht geschickt. Es muss noch jemanden geben, der nach mir sucht.“
„Jemand von zu Hause?“
„Nä.“ Die hatten keinen Grund, mich aufspüren zu wollen. Außerdem passte die Beschreibung auf keine der mir bekannten Amazonen.
„Jemand von deiner Familie?“
Für einen kurzen Moment, der meinen Kopf erst mit einem brennenden Vakuum und dann mit einer Flut von Bildern und Gedanken füllte, zog ich in Betracht, dass Homer recht hatte. Dass es meine Großmutter war, die nach mir fahndete. Eigentlich bereiste sie die Welt ja auf der Suche nach sich selbst, und das schon seit vielen, vielen Jahren – und sie sah völlig anders aus: Meine Oma war fast so groß wie ich, hatte schokoladenbraune Haut und war definitiv nicht der unauffällige Typ. Eher ein bunter, lauter, unzufriedener Papagei. Ich war ihr nie begegnet, aber ich kannte Fotos von ihr, und meine Bisabuela hatte oft von ihr erzählt.
„Menschen verändern sich“, wandte Homer ein.
„Stimmt. Aber nicht so. Außerdem bin ich mit meiner Familie fertig.“
„Ja, aber sie scheint das auch zu sein. Immerhin hat sie wie du das Weite gesucht.“
„Auch wieder wahr.“
„Jedenfalls – sie wirkte weder bösartig noch verrückt oder sonst irgendwie gefährlich. Wir behaupteten natürlich, nichts von dir zu wissen, aber sie bat uns, dir dennoch mitzuteilen, dass sie heute Nachmittag ab etwa 15 Uhr in Pandoras Bar auf dich warte.“
„Sie hat euch nicht geglaubt? Ist sie euch gefolgt?!“ Mein Herz trommelte wieder los und ich unterdrückte den Drang, mich panisch umzusehen.
„Nein. Und ja, sie hat uns geglaubt. Lancelot hat sogar das mit seinen Haaren gemacht, um sie abzulenken. Ich denke, sie greift nach jedem Strohhalm. Immerhin sucht sie jetzt schon ein paar Jahre nach dir.“
„Und was soll das für eine Bar sein?“ Es gab keine Läden und Lokale mehr. Mit dem finalen Stromausfall hatte es die Wirtschaft und damit auch Einzelhandel und Gastronomie endgültig zerlegt. Alles lief über die Schwarzmärkte.
„Die Büchse der Pandora. Auf der Theaterinsel.“
Vage erinnerte ich mich, den Namen schon mal aus den Mündern der Mannen vernommen zu haben. Hatte mich nicht interessiert. So toll wie das Pearl konnte der Laden gar nicht sein, der Club, in dem Kassians Clique und ich uns immer die Nächte um die Ohren geschlagen hatten. Doch was nun diese mysteriöse Verfolgerin anbelangte … Ich überlegte kurz, dann stand ich schwungvoll auf. Die Halle drehte sich ein bisschen, doch das tat meiner Entschlossenheit keinen Abbruch.
„Ich gehe hin. Ich glaube nicht, dass es meine Oma ist. Aber es ist die einzige Möglichkeit, sie zur Rede zu stellen und diesen Spuk ein für allemal zu beenden.“
Bereits, als ich Chiimori den Sattel auflegte, merkte ich, dass mein Vorhaben in diesem Zustand eine Schnapsidee war. Nein, eigentlich brachte mich schon die Satteldecke außer Puste. Aber ich hatte keine Wahl, wenn ich die halbalte, halbgraue Halbinderin abpassen wollte. Es war noch lange nicht 15 Uhr, doch ich musste die Zeit nutzen, um einen guten Standort zu finden, von dem aus ich die fragliche Bar im Auge behalten konnte. Ich würde mich sicher nicht an einen Tisch setzen und darauf warten, dass die Falle gegen drei Uhr zuschnappte. Im Gegenteil. Ich würde die Situation ganz und gar zu meinem Vorteil nutzen und den Spieß umdrehen.
Soweit der Plan. Der Ritt in die Stadt kam einem Albtraum gleich. Die Kälte war noch grausamer als am Vortag; meine Lungen fühlten sich an, als würden sie pures Eis atmen, während mein Kopf glühte. Am Getreidemarkt versuchte eine wilde Horde, bestehend aus vier abgerissenen Andraket, meiner Habe, meines Pferdes oder meiner Unschuld habhaft zu werden. Ich ließ es nicht darauf ankommen, worauf sie genau aus waren. Zwei ritt ich einfach über den Haufen, einen erledigte Chiimori mit einem Tritt, einem verpasste ich einen Schwertstreich, der mich beinahe selbst aus dem Sattel kippen ließ. Zitternd vor Anstrengung klammerte ich mich am Zügel fest, den Weg, das Ziel, die Büchse der Pandora vor meinem inneren Auge. An den Rückweg durfte ich gar nicht denken. Nein, ein Schritt nach dem anderen.
„Weiter“, flüsterte ich meinem Aspa, flüsterte ich mir selbst zu, schaute mich nicht um nach den ’Shimet, ob sie lebten oder nicht.
Endlich erreichte ich die Eiserne Brücke, von deren Mitte aus steinerne Stufen zur Insel hinabführten, die im Grunde nichts anderes als eine befestigte Sandbank war, die die Awin rauschend umspülte. Chiimori war nicht geübt im Treppensteigen, aber die Stufen waren breit genug, dass ich ihn mit viel gutem Zureden am Zügel hinunterlotsen konnte. Ein Holzsteg führte über Kiesel direkt zu dem kleinen ehemaligen Theatergebäude, in dem die Büchse der Pandora untergebracht war. Ich wandte mich jedoch in die entgegengesetzte Richtung.
Ich hatte mir eine löchrige Isomatte aus dem Fundus der Mannen mitgenommen und verkroch mich nun unter einem Gebüsch bei einem Brückenpfeiler. Chiimori zupfte ein Stück hinter mir lustlos graues Gras zwischen den Steinen heraus. Wenn die Frau auftauchte und in die Bar ging, wäre ich innerhalb weniger Sekunden auch dort. Ich ließ das Haus nicht aus den Augen. Ehemals farbige Stuckornamente verzierten die Fassade, an der die Leuchtschrift Büchse der Pandora angebracht war, zusammengestückelt aus Buchstaben verschiedener Leuchtreklamen, die natürlich allesamt nicht mehr leuchteten. Darunter der Eingang. Davor ein paar leere Stehtische. Leere Blumenkübel. Erloschene Fackeln.
Das Warten im feuchten Dunst des Flusses, obgleich ich nichts zu tun hatte, als die beiden Schwingtüren zur Bar zu beobachten und dabei nicht zu erfrieren, gab mir den Rest. In meinen Ohren sauste es und meine Augen tränten. Nur einen Moment die Lider schließen … Nein. Ich durfte meine Verfolgerin nicht verpassen. Ich durfte der bleiernen Müdigkeit nicht nachgeben. Wenn ich ihr erlag, würde ich vielleicht nicht mehr aufwachen. Ich denke, mir wurde erst in diesem Moment klar, dass ich ernsthaft krank geworden war. Die permanente Erschöpfung, die kräftezehrenden Arbeiten, die bittere Kälte hatten die Anzeichen verborgen, die ich schon seit dem gestrigen Abend eigentlich nicht hätte übersehen dürfen. Klar. War kein Beinbruch. Wahrscheinlich nur eine Erkältung. Bloß – was, wenn nicht? Das war das postapokalyptische Citey. Die Menschen gingen wie die Fliegen an irgendwelchen Seuchen ein, gegen die zuvor eine Spritze und paar Pillen geholfen hätten. Nur leider gab es mittlerweile keine medizinische Versorgung mehr, Krankenhäuser und Praxen waren schon lange dem stromlosen Chaos erlegen, und Arzneimittel konnten ohne Energie und Erdöl weder produziert, noch transportiert werden.
Ich schluckte. Und das tat höllisch weh.
Nein, ich konnte mich nicht angesteckt haben. Ich war fast nie in der Stadt gewesen. Hatte nichts angefasst. Und wenn doch, sofort zu Hause die Hände gewaschen. Und die Jungs hatten auch nichts heimgeschleppt … Obwohl. Warmit war morgens blass gewesen und hatte ziemlich gehustet.
Also hör mal, sagte meine Bisabuela und ihre typische, raue Stimme klang richtiggehend wütend. Der Knabe ist immer blass. Und hast du mal gesehen, was der allabendlich für ein Kraut raucht? Da würde jeder husten. Mach dich nicht verrückt. Es ist eine Erkältung, nichts weiter. Augen auf! Sieh zum Eingang, sonst ist alles umsonst.
Meine Uroma hatte gut reden. Sie war ja nicht hier draußen, sondern in meinem Kopf, in meinem warmen, wattig weichen Kopf … Dennoch, sie hatte sicherlich recht.
Die Zeit kroch dahin. Stunden vergingen, zerrten an meiner Geduld und meiner Aufmerksamkeit. Dann und wann kam Chiimori angetrabt und stupste mich an. Ich denke, ihm war auch kalt, doch ich schickte ihn wieder zum Grasen, damit er mich nicht in meinem Versteck verriet. Niemand ging in die Bar hinein, niemand kam aus der Bar heraus. Langsam zog sich das Licht zurück und die Dämmerung glitt übers Land. Irgendwann hätte ich am liebsten geweint. Ich weine eigentlich nicht, denn ich weiß, dass es nichts bringt, aber mir war so verdammt kalt …
Ich gehe nach Hause. Dieser plötzliche Gedanke streifte mich wie eine warme Brise, hauchte mir schlagartig Hoffnung ein. Nicht morgen. Nicht übermorgen. Nein, heute. Ich halte es keine Sekunde länger aus. In Themiskyra würde ich einen Ofen haben. Und eine Klinik, in der sie mich heilen konnten. Eine Freundin, Padmini, die für mich da sein würde. Pfeif auf die halbgraue, halbalte Halbinderin – in Themiskyra würde sie mir nicht mehr zusetzen können. In Themiskyra, da war ich mir auf einmal ganz sicher, würde alles gut werden. Mit vorletzter Kraft rappelte ich mich auf, ignorierte meinen schmerzenden Kopf und die schwankende Welt, rollte die Isomatte halbherzig zusammen und pfiff Chiimori mit spröden Lippen zu mir. Jetzt war eher er es, der mich stützte, als ich es, die ihn führte, als wir die Treppe zur Brücke erklommen. Mit letzter Kraft kam ich oben an. In meinen Ohren sauste es, daher hörte ich es zu spät, und als ich die Worte auseinanderklamüsert hatte, war ich zu benommen, um sie gleich zu begreifen:
„Da ist die dumme Schlampe!“
Ehe ich wusste, wie mir geschah, hatte mich schon jemand zu Boden gerissen, eine übel riechende, schmutzige Gestalt in abgerissener Kleidung, ein Andrakor voller Wut und Rache, mit dem ich normalerweise binnen eines Atemzugs aufgeräumt hätte. Jedoch nicht heute. Mein Kopf schlug hart auf dem Pflaster auf, ich schmeckte Blut auf meiner Zunge.
„Warum? Warum???“ Der Typ rüttelte an meinen Schultern, dann schlug er mir mit dem Handrücken ins Gesicht. „Das ist für Sam. Er ist tot. Und das für Gregori. Er wird nie wieder laufen können.“ Er schien zu weinen. Meine Wangen waren zu taub vor Kälte, um den Schmerz richtig fühlen zu können, doch die Tränen des Angreifers spürte ich nass auf meiner Haut aufschlagen.
Chiimori wieherte, ich sah ihn als Schemen gegen den sternklaren Himmel der Winternacht aufsteigen. Er schien sich auch gegen einen oder mehrere Angreifer zu wehren. Zu spät wurde mir klar, dass es wohl die Vatwaka sein mussten, die mir schon am Getreidemarkt aufgelauert hatten, und denen ich nun per Zufall oder weil sie mich gesucht hatten, wieder ins Netz geraten war. So oder so – eine Situation wie diese war kein Problem für eine Kämpferin wie mich. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen … aber da war keine mehr. Meine Hände, meine Arme, meine Beine, alles war zu kalt, zu schwer, zu gefühllos, um gegen den ’Shim anzukommen. Ich hob meine Faust an … und das allein war unendlich anstrengend … und ließ sie nutzlos wieder fallen. Und als noch ein zweiter Andrakor über meinem Kopf auftauchte und mir ins Gesicht boxte, floh ich fast dankbar in die heranwogende, unvermeidliche Ohnmacht. Mein letzter Gedanke galt Themiskyra. Festung, Stadt, Heimat. Würde ich dich jemals wiedersehen?
KAPITEL 2
Eine kühle Hand strich mir über die heiße Stirn und meine Wangen. Ich drehte mich weg, wollte tausendmal lieber zurück in die Bewusstlosigkeit, als eine Männerhand auf meiner Haut spüren.
„Ainia? Hörst du mich? Kannst du aufstehen?“
Eine Frauenstimme! Ich hörte auf, mich zu winden, und öffnete voller Erleichterung die Augen. Sie brauchten einige Sekunden, um sich scharf zu stellen. Über mich beugte sich eine halbgraue, halbalte Halbinderin in beigefarbener Kleidung.
Ich schrie auf und kickte sie weg und brachte mich in Sicherheit und fuhr sie an: Wer bist du und woher, beim Hades, weißt du meinen Namen?! – theoretisch. In Wirklichkeit murmelte ich nur überrascht: „Huh!“ und wurde erneut bewusstlos.
Als ich das nächste Mal erwachte, befand ich mich in einer Höhle. Es war still und warm und dunkel, nur ein paar Meter entfernt flackerte ein kleines Feuer. Mein Kopf war zu heiß, viel zu heiß, und meine Augen brannten. Ich bemühte sie dennoch. Die Höhle verschwamm, wurde zu einem dunkel getäfelten Raum, darin ein weiß überzogenes Bett, darin ich. Gegenüber ein Tisch mit Kerze, dahinter ein Kamin, darüber ein Bild, ein düsteres Stillleben mit kubistisch anmutendem Obst … Ich zwinkerte. Das Obst wurde nicht rund. Die Hand war zurück, hielt mir ein Glas Wasser an die Lippen. Obwohl ich endlos durstig war, drehte ich den Kopf weg. Ich hatte Angst vor dem Wasser, es war bestimmt vergammelt, vergiftet, verseucht, wie alles in der Stadt.
„Trink“, sagte die Halbinderin, die ich nur als grauen Schemen zu meiner Seite wahrnahm. „Es ist sicher. Quellwasser. Gefiltert.“
Also trank ich. Was hatte ich schon für eine Wahl? Ob ich starb, weil ich etwas trank, oder ob ich starb, weil ich nichts trank, was spielte es noch für eine Rolle? Die Äpfel und Aprikosen blieben dennoch eckig, bis sie mir vor den Augen verschwammen.
Mein Fieber stieg an. Ich merkte es selbst, weil ich es kaum noch an die Oberfläche der Realität schaffte. Ich atmete und schlief, phantasierte und starrte das Bild an, trank, wenn ich etwas hingehalten bekam, und bereits das war so kräftezehrend, dass ich gleich darauf wieder wegdämmerte. Dabei wollte ich die Frau fragen, warum sie mich suchte. Und ihr sagen, dass sie es sein lassen sollte. Doch daran war nicht mal zu denken.
Irgendwann tauchte ein anderes Gesicht auf. Ein ’Shim, aber keiner von den Vatwaka, die mich überfallen hatten. Er war etwas jünger als meine Retterin, aber ebenso schlank, hatte grau melierte Schläfen und eine große Nase. Die Sorge in seinen freundlichen, dunklen Augen bemerkte selbst ich in meinem benebelten Zustand. Ich erinnere mich, dass ich sogar darüber nachsann, ob er der Tod sei. Eigentlich holte uns, wenn wir starben, Artemis ab, die Gebieterin über Leben und Tod, aber vielleicht hatte sie sich gerade eine kleine Auszeit genommen. Oder einfach keine Lust mehr. Genau wie ich. Ich wollte auch nicht mehr. Es war so unendlich anstrengend, dieses Leben. Das Sein, das Atmen, das Leid, der Schmerz, es hörte nicht auf, in mir und um mich herum, die Seuchen, der Hass, eckige Orangen, eckige Kiwis … Ich döste weg, doch der fremde ’Shim weckte mich, indem er mir eine kleine, weiße Kugel zwischen die spröden Lippen schob … eine Tablette. Eine Tablette? Er gab mir Wasser zu trinken und ich spülte sie hinunter. Aufmunternd lächelte er mir zu und ging zurück zum Tisch, wo er im Kerzenlicht in einer Ledertasche herumwühlte.
Die Halbinderin trat zu mir ans Bett und strich mir verschwitzte Locken aus dem Gesicht. „Halt durch.“
„Themiskyra“, flüsterte ich. „Nach Hause.“
Im Augenwinkel bemerkte ich, wie der Tablettenmann mit einer ruckartigen Bewegung zu mir sah. „Was hast du gesagt?“
„Sie phantasiert“, erklärte die Frau schnell.
„Nein.“ Er eilte auf die andere Seite meines Bettes und nahm meine heiße, trockene Hand in seine kühle, große.
„Themiskyra. Nicht wahr? Bist du von dort? Kannst du … kannst du einen Kontakt herstellen?“
Ich runzelte die Stirn, verstand nicht, was der ’Shim mit den verzweifelten Augen von mir wollte.
„Gehen Sie jetzt, Herr Apotheker. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.“
Die Halbinderin schob ihn resolut beiseite und drückte ihm seine Tasche sowie eine Goldmünze in die Hand. Für einen Moment widersetzte er sich, blieb stehen, suchte nach Worten, ließ dann aber die Schultern sinken.
„Gute Besserung“, wünschte er mir mit einer Stimme, die rauer klang als meine, dann verließ er das kleine Zimmer.
„Was …?“, begann ich, doch meine Retterin ließ mich gar nicht zu Wort kommen:
„Ich habe keine Ahnung, was er wollte. Aber wir müssen auf der Hut sein. Schlaf dich jetzt gesund.“
Das wollte ich unendlich gerne; ich konnte meine Augen kaum noch offenhalten. Eine Frage brannte mir jedoch schon so lange auf der Seele: „Wer bist du?“
Sie zog mir die Decke wieder über die Schultern. „Mein Name ist Fenrael.“
Fenrael … Fenrael … Fenrael … Mein Gehirn beschäftigte sich während meines erschöpften Schlafes in den folgenden Stunden wohl ununterbrochen mit der Frage, wo ich diesen Namen schon einmal gehört hatte. Er war mir auf eine vage Art vertraut. Ich kannte ihn, aber hatte kein Gesicht dazu, und es war sehr, sehr lange her …
Ich schlug die Augen auf und wusste es.
„Fenrael“, sagte ich. Meine Kopfschmerzen waren abgeklungen und meine Augen brannten nicht mehr.
„Ja?“ Sie saß am Tisch, ein Buch vor sich, und hob den Kopf.
„Du bist Atalantes Agentin. Du hast ihre Geldgeschäfte in Urba erledigt. Du bist schuld an der ganzen Misere mit dem Riesendiamanten und der Tasche voller Taler.“ Die ich entwendet hatte, nebenbei bemerkt.
Sie lächelte schräg. „Ich habe den Deal eingefädelt, ja. Aber du hast ihn platzen lassen.“
„Wünschte auch, das wäre anders gelaufen.“ Ich musste husten. Es klang übel, doch ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass es mir dabei die Lunge aus dem Leib riss. „Wo ist Chiimori?“
„Dein Pferd? Grast im Hinterhof.“
„In Sicherheit?“
„Sicher.“
„Wo sind wir hier überhaupt?“
„In einem ehemaligen Studentenwohnheim. Nicht weit von der Eisernen Brücke entfernt.“
Ich beäugte misstrauisch den Kamin mit dem flackernden Feuer darin. „Feudale Verhältnisse für Studenten.“ Ich mochte gar nicht daran denken, wie es anderen ging, die krank geworden waren und weder Hilfe, noch eine Unterkunft hatten.
„Juristische Fakultät. Und das hier war das gemeinschaftliche Wohnzimmer. Ich habe nur das Bett hierher geschoben, denn die anderen Räume haben keine Heizmöglichkeiten.“
„Was ist mit den Typen passiert? Die mich angegriffen haben?“
„Um die musst du dir keine Sorgen mehr machen.“
Ich beäugte sie neugierig. „Bist du eine Amazone?“