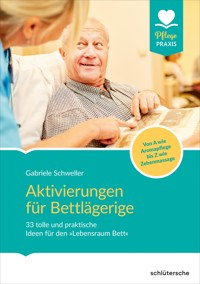
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Pflege und Betreuung von Bettlägerigen erfordert ein hohes Maß an Wissen, Empathie und Kreativität, um den Betroffenen bestmögliche Unterstützung und Lebensqualität zu bieten. Gerade hinsichtlich kreativer, motivierender Beschäftigungsmöglichkeiten stoßen Pflege- und Betreuungskräfte oft an ihre Grenzen – gilt es doch sinnvolle und individuelle Aktivierungen mit engen Zeitkorridoren und wenig Personalaufwand zu verknüpfen. Das Buch erweitert den Blickwinkel im Umgang mit Bettlägerigen und bietet eine Fülle von einfachen, aber effektiven Maßnahmen. Pflege- und Betreuungskräfte erhalten einen Fundus unterschiedlicher Ideen und Anleitungen für sinnvolle Aktivierungen. Diese können zum Teil sogar in die grundpflegerische Versorgung integriert werden. Abbildungen veranschaulichen die vorgestellten Ansätze und Formen – sie können Eins zu Eins übernommen oder an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Schweller arbeitet seit über 20 Jahren in der Altenhilfe – als Altenpflegerin, als QMB und Auditorin, als Praxisanleiterin und stellvertretende PDL. Schließlich studierte sie erfolgreich Pflegepädagogik. Aktuell arbeitet sie als freiberufliche Organisationsberaterin sowie als Dozentin.
»Erweitern Sie den Lebensraum einer sehr sensiblen Personengruppe gezielt mit einfachen Mitteln.«
GABRIELE SCHWELLER
pflegebrief
– die schnelle Information zwischendurchAnmeldung zum Newsletter unter www.pflegen-online.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8426-0836-8 (Print)ISBN 978-3-8426-9051-6 (PDF)ISBN 978-3-8426-9052-3 (EPUB)
© 2020 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden. Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autoren und des Verlages. Für Änderungen und Fehler, die trotz der sorgfältigen Überprüfung aller Angaben nicht völlig auszuschließen sind, kann keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen werden. Die im Folgenden verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen stehen immer gleichwertig für alle Geschlechter, auch wenn sie nur in einer Form benannt sind. Ein Markenzeichen kann warenrechtlich geschützt sein, ohne dass dieses besonders gekennzeichnet wurde.
Titelbild: Robert Kneschke – stock.adobe.comCovergestaltung und Reihenlayout: Lichten, Hamburg
Inhalt
Einleitung
1Grundlagen der Bettlägerigkeit
1.1Immobilität
1.2Bettlägerigkeit
1.3Lebensraum
2Umgangsformen
2.1Der kleine Ausflug
2.1.1Den Besuch ankündigen
2.1.2Die Anrede
3Körper-, Sinneswahrnehmungen und Bewegung
3.1Musik hören
3.1.1Musik aus der »Box«
3.1.2Live-Musik
3.1.3Tanzen im Bett
3.2Aromapflege
3.2.1Arbeit mit Duftölen
3.2.2Aromapflege bei der Körperpflege
3.2.3Aromapflege bei der Hautpflege
3.2.4Aromapflege mit verschiedenen Materialien
3.3Füße spüren und Spuren hinterlassen
3.4»Ich fühle was, …« – taktile Wahrnehmung mit den Händen
3.5Kuscheln im »Nest«
3.6Massagen
3.6.1Handmassage in fünf Schritten
3.6.2Fußmassage in zwölf Schritten
3.6.3Kopfmassage in sechs Schritten
3.7Kochen am Bett
3.8Backen am Bett
3.9Kaffeeklatsch am Bett
3.10Teatime
3.11Malen im Bett
3.11.1Malen mit den Fingern
3.11.2Malen mit Schwämmen
3.11.3Malen mal anders
3.12Verwöhnprogramm Haarpflege
3.13Gartenarbeit im Bett
3.14Fühlschnur
3.15Tastdecke
3.16Das Wetter genießen
3.17Fernsehen
4Biografiearbeit, Selbstbestimmtheit und Spiritualität
4.1Biografie- und Erinnerungsarbeit – das »täglich Brot« in der Pflege
4.1.1Das Berufsleben – ritualisierte Alltagsbegegnung mit viel Routine
4.1.2Hobbys – ritualisierte Alltagsbegegnung mit Abwechslung
4.2Imaginäres Fenster
4.3Fotoalbum
4.4Fantasiereise/Traumreise
4.5Umgebungsgestaltung – Milieugestaltung
4.6Die individuelle Schatzkiste – Erinnerungskiste/Ritualkoffer
4.7Snoezelen – die besondere Art der Entspannung
4.8Märchen: »Es war einmal …«
4.9Glaubensrituale und Spiritualität
4.9.1Die Weltreligionen
4.9.2Kultursensible Sterbebegleitung – religiöse Rituale
Schlussworte
Literatur
Bildnachweis
Register
Einleitung
Wie leitet man in ein Thema ein, das wir Pflege- und Betreuungskräfte zwar kennen und mit dem wir im Beruf täglich konfrontiert sind, uns aber in seiner Dimension dennoch oft unvorstellbar ist? Wie kann ich die sogenannte Problematik verdeutlichen und Sie als Lesende für die Sache sensibilisieren und »mitnehmen«?
Ich habe mich entschlossen, diese Fragen weniger mit »harten Fakten«, Zahlen oder wissenschaftlichen Studienergebnissen zu beantworten. Vielmehr möchte ich Sie, die Lesende dieses Buches, auf einen Ausflug und eine Reise mitnehmen: einen kleinen Ausflug zu drei Seniorinnen, die bereit waren, mir einen Einblick in ihren Lebensraum zu gewähren. Und uns dann gemeinsam auf den Weg zu machen, den »Lebensraum Bett« besser kennenzulernen. Bitte folgen Sie mir!
BeispieleFrau Schulte, Frau Bruns und Frau Weller
»Wie geht es Ihnen? Gut! Das ist schön– ich freue mich für Sie. Wie wohnen Sie eigentlich, Frau Schulte? Aha, in einem schönen Haus mit Garten. Und Sie, Frau Bruns, wenn ich fragen darf? Sie wohnen in einer kleinen Stadtwohnung von 65Quadratmetern mit Loggia. Prima, das hört sich nett an.
Dann wollen wir mal unsere kurzen Rundgänge durch Ihr jeweiliges Zuhause starten, ich bin schon ganz gespannt. Starten wir mit dem Haus von Ihnen, Frau Schulte: Die Einfahrt verspricht einiges– alles wirkt sehr einladend. Die Haustür ebenso ... und diese Garderobe, sehr geschmackvoll. Hier fühlt man sich sichtlich gut empfangen. Oh, und der offene Wohnbereich ist großzügig gestaltet. Diese hellen ansprechenden Farben und diese Aussicht. Bitte entschuldigen Sie, dass ich jetzt bitte unbedingt den Garten sehen möchte. Diese Aussicht zieht mich magisch an! Sie haben sich hier ja ein kleines Paradies geschaffen. Dieser Teich mit Springbrunnen und der Bachlauf. Und der Kräuter- und Gemüsegarten inmitten der herrlichen Blumenpracht. Ja, Sie wohnen hier in einem kleinen Idyll. Darf ich nun die verbleibenden Räumlichkeiten sehen? Das ist Ihr Schlafzimmer? Wunderschön. Sehr modern gehalten und doch schon seniorengerecht. Was, Sie haben einen barrierefreien begehbaren Schrank und ein barrierefreies Multifunktionsbad en suite? Da haben Sie wirklich sehr vorausschauend gedacht. Wie viel Wohn- und Gartenfläche stehen Ihnen zur Verfügung? Aha, 120Quadratmetern Wohnfläche und 300Quadratmetern Garten. Eine stattliche Größe– da haben Sie viel Lebensraum zum Entfalten.
Nun freue ich mich aber auf Ihre kleine Stadtwohnung, Frau Bruns. Ach, Ihre Wohnung befindet sich im fünften Stock, und das Haus besitzt einen Aufzug. Das macht vieles leichter, das kann ich nachvollziehen. Wo ist die Tür? Ah, hier, sie ist schlicht aber hübsch mit einer jahreszeitlichen Dekoration und einem handgefertigtem Namenschild versehen. Das macht sie gleich individueller und einladend. Ja, stimmt, Ihre Garderobe ist klein, jedoch sehr stilvoll und sie hat offensichtlich mehr Stauraum als man vermutet. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Das Bad. Die ebenerdige Dusche haben Sie selbst einbauen lassen! Das ist prima und viel bequemer, meine Hochachtung. Der zur Verfügung stehende Raum ist wirklich perfekt genutzt. Wo geht’s hier hin? Ins Schlafzimmer … hier haben Sie ausreichend Platz für alles, oder? Und es gibt ein weiteres Zimmer, das Sie als Büro und Gästezimmer nutzen. Und nun kommt das Highlight: die Wohnküche mit Loggia. Herrlich! Ist das schön gemütlich hier. Was haben Sie einen großartigen Ausblick, da ahne ich doch direkt, welches Ihr Lieblingsplatz ist. Diese schönen Balkonblumen vor diesem Panorama. Ihr Zuhause ist wahrlich ein kleiner Luxus-Lebensraum in luftiger Höhe.
Nun muss ich Sie aber verlassen. Ich begebe mich nun auf die nächste Etappe meiner Reise durch Lebensräume. Wohin ich nun gehe? Jetzt besuche ich einen lieben Menschen in einem kleinen und beschaulichen Lebensraum. Er ist 1,9 Quadratmeter groß und die Person, Frau Weller, die sich darin befindet, ist hilfe- und pflegebedürftig und auf ›fremde‹ Personen angewiesen.
Ich freue mich sehr, dass ich auf diesem Ausflug weiter begleitet werde! Meine Begleitung sagt, sie sei neugierig, da sie sich das gar nicht vorstellen könne, nur knapp 2Quadratmeter als Lebensraum zur Verfügung zu haben… Das konnte sich Frau Weller, die diesen minimalen Lebensraum hat, sicherlich auch nicht vorstellen. Doch nun ist es so, und sie hat nur 1,9Quadratmeter– ihr Bett, an das sie quasi ›gefesselt‹ ist. Das Bett, das ihre ganze Privatsphäre darstellt und ihre Intimsphäre mehr schlecht als recht schützt. Es ist der Ort, der ihr Zuhause darstellt und ihr die einzige Rückzugsmöglichkeit bietet, die sie hat. Da bleibt kein Platz für eine gemütliche Einrichtung, für Entfaltungsmöglichkeiten und meistens noch nicht einmal für eine schöne Aussicht...«
Wichtig Voraussetzungen
Die in die Pflege und Betreuung eingebundenen Personen müssen die Möglichkeiten haben sowie gewillt und geschult sein, diesen »Lebensraum Bett« für die Betroffenen bestmöglich zu vergrößern, zu individualisieren und zu einem lebenswerten Ort zu machen!
Daher möchte ich Sie einladen, sich mit mir gemeinsam auf die Tour zu begeben und Möglichkeiten zu schaffen, die den hilfe- und pflegebedürftigen, bettlägerigen Personen den Lebensraum vergrößern. Denn der »Lebensraum Bett« bedeutet für die Betroffenen auf kleinstem Raum zu leben – nicht selten eingegrenzt von einem »Zaun« (Bettgitter) in unmittelbarer Nähe, über dessen Sinnhaftigkeit man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein kann. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie man diesen Mini-Lebensraum abwechslungsreicher und attraktiver gestalten und somit »vergrößern« kann – zum Wohle der Betroffenen.
Ehe wir uns jedoch auf dieser Reise weiter fortbewegen, machen wir erst einmal eine kurze Rast im »Gasthaus zur Theorie«. Denn ein kleines bisschen geistige Nahrung schadet nicht. Schließlich ist es wichtig, dass wir auf unserem Ausflug dieselbe Sprache sprechen und uns so auf gemeinsame Routen und Ziele einigen. Denn was bedeuten Bettlägerigkeit und Immobilität im Grunde? Was macht den Lebensraum Bett de facto aus? Diese Fragen klären wir kurz und knapp im Folgekapitel, bevor wir uns im Anschluss daran praktisch mit 1,9 Quadratmeter Lebensraum auseinandersetzen. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt!
1 Grundlagen der Bettlägerigkeit
Vorab – in der Einleitung – und im Folgenden tauch(t)en immer wieder Begriffe auf, mit denen die körperlichen Zustände, Befindlichkeiten, Umstände und die Umgebung der Betroffenen beschrieben werden:
• Immobilität
• Bettlägerigkeit
• Lebensraum
Damit wir bei der Verwendung der Begriffe annähernd die gleichen Vorstellungen und Voraussetzungen haben, möchte ich diese kurz erläutern und definieren.
1.1Immobilität
DefinitionImmobilität
Der Duden definiert die Bedeutung von Immobilität* als »einen Zustand der Unbeweglichkeit«. Das Pflegiothek Fachwörterbuchbuch** sagt: »Unfähigkeit zur Bewegung«.
Fakt ist, dass sich immobile Menschen nicht durch eigene Anstrengungen körperlich bewegen und fortbewegen können – sie sind unbeweglich aus eigenem Antrieb. Die Ausprägungen variieren dabei.
*https://www.duden.de/rechtschreibung/Immobilitaet, abgerufen am 06.11.2019
** Fachwörter in der Pflege für die Aus- und Weiterbildung (2007). Pflegiothek, Cornelsen, Berlin.
Die Immobilität ist die stärkste Form der Bewegungseinschränkung. Sie ist neben der Instabilität, Inkontinenz und dem intellektuellem Abbau eine der bedeutendsten Funktionsstörungen im Alter. Betrachtet man die Immobilität jedoch nur (definitionsgemäß) als eine Einschränkung der körperlichen Bewegungsfähigkeit, ist das sehr einseitig. Denn von Immobilität können ebenfalls kognitive, emotionale als auch soziale Fähigkeiten betroffen sein. Dauerhafte Immobilität führt nicht nur zum Abbau der Muskeln und damit der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern schränkt die Betroffenen massiv in ihrer persönlichen Handlungsfähigkeit und Autonomie ein. Die Folgen sind ein hoher Pflegebedarf und soziale Isolation1.
Entsprechend der Studien nach Frau Prof Dr. Abt-Zegelin2 durchläuft die Immobilität fünf Phasen.
Die fünf Phasen der Immobilität
1.Phase: Die Instabilität tritt hervor.
Eine ältere Person hat eine zunehmende Gangunsicherheit (Ursachen können Arthrosen, Zustand nach Apoplex oder andere Erkrankungen sein). Diese und andere gesundheitlichen Probleme stellen die Person vor eine enorme Herausforderung. Die ältere Person benötigt im Grunde ein Hilfsmittel, beispielsweise einen Gehwagen (im Fachjargon Rollator). Oft steht dieser aber nicht zur Verfügung, weil er noch nicht beantragt oder besorgt wurde. Eine etwaige, zunehmende Blasenschwäche (Inkontinenz) trägt dazu bei, sich bei Toilettengängen unwohl, gehetzt und unsicher zu fühlen. Sehr häufig leiden Frauen am meisten darunter. Sie beginnen weniger zu trinken, damit sie nicht so häufig zur Toilette müssen. Damit schreitet aber ihre körperliche Instabilität voran. Durch weniger Mobilität und körperliche Aktivität sowie zu wenig Flüssigkeitsaufnahme können zudem Kreislaufschwierigkeiten auftreten.
2.Phase: Ein Ereignis findet statt.
Eine ältere, vielleicht sogar schon etwas hilfe- und pflegebedürftige Person erleidet beispielsweise einen Sturz mit und ohne Klinikaufenthalt. Oder sie muss einen Klinikaufenthalt aus anderen Gründen durchleben und ist daher für eine gewisse Zeit eingeschränkt und weniger mobil. Nach diesem Ereignis ist die Person umso mehr auf Hilfsmittel angewiesen, benötigt u. U. einen Rollstuhl.
3.Phase: Eine Immobilität im Raum entwickelt sich.
Die Bewegungseinschränkung erhöht sich. Die Betroffenen verweilen lange an einem Ort. Der Transfer Bett/Rollstuhl wird mühsamer, ist nur noch mit Unterstützung möglich. Dazu kommt, dass der Transfer oft als unsicher erlebt wird: Es wird gezerrt, gehoben und/oder geschoben. Die Betroffenen reagieren mit Vermeidung als Vorsichtsmaßnahme, wollen dieser Unsicherheit »entkommen«. So kann sich ein erhöhtes Liegebedürfnis zeigen, was gelegentlich von einer unzureichend angepassten Möblierung der näheren Umgebung verstärkt wird.
4.Phase: Die Ortsfixierung rückt in den Vordergrund
Ein selbstständiger Ortswechsel ist für die Betroffenen nicht mehr möglich; die Hilfsbedürftigkeit wächst. Dazu gehört oft ein In-Kauf-Nehmen langer Wartezeiten als »Rücksichtnahme« auf andere Pflegebedürftige zum Lebensalltag. Viele hilfe- und pflegebedürftige Personen beginnen so, sich beispielsweise auf dem Sofa »gemütlich einzurichten« und alles in greifbarer Nähe liegen zu haben. Langeweile wird mit einem Nickerchen vertrieben. Die Ruhe- und Schlafphasen nehmen deutlich zu, die Person wieder sichtlich immobiler.
5.Phase: Strikte Bettlägerigkeit tritt ein
Das Bett wird zum zentralen Lebensort. Es wird nicht mehr verlassen – weder zur Grundpflege noch zum Toilettengang oder zum Einnehmen der Mahlzeiten. Damit tritt eine völlige Abhängigkeit von Hilfe ein, zudem wird der weitere Verlust von Privatsphäre offensichtlich.
1.2Bettlägerigkeit
DefinitionBettlägerigkeit
Unter Bettlägerigkeit versteht man das Unvermögen, über längere Zeit zu sitzen oder zu stehen. Vor allem ältere, kranke, hilfe- und pflegebedürftige Menschen sind davon betroffen. Bettlägerigkeit beginnt, wenn sich ein Mensch nicht mehr ohne personelle Hilfe von einem Ort zum nächsten bewegen kann.
Bettlägerigkeit ist mit einer maximalen motorischen funktionellen Einschränkung aller körperlichen Gliedmaßen verbunden. Der betroffene Mensch hat aufgrund enormer gesundheitlicher Einschnitte das Unvermögen, einen längeren Zeitraum im Sitzen oder im Stehen zu verbringen.
Bettlägerigkeit ist ein langfristiger Daseinszustand, bei dem sich der Mensch die überwiegende Zeit des Tages und in der Nacht im Bett oder anderen Liegemöbeln aufhält. Hierbei ist es egal, ob man sich liegend, halbsitzend oder aufrecht befindet. Entscheidend ist, dass »die Beine oben« sind.
Diese auf Dauer ausgelegte körperliche Inaktivität wirkt sich unvermeidlich ganzheitlich auf den Körper aus. Es entsteht ein sogenanntes Immobilitätssyndrom. Die Folgen davon können sein:
• Obstipationsgefahr (Verstopfungsneigung)
• Infektionsgefahr (anfällig für infektiöse Erkrankungen wie grippale Infekte, Harnwegsinfekte etc.)
• Thrombosegefahr (Verstopfungsgefahr der Gefäße)
• veränderte Atmung (bezogen auf Atemrhythmus, Atemtiefe, Atemfrequenz)
• Verwirrtheitszustände (unabhängig von einer demenziellen Erkrankung!)
• Körperbildstörungen (Verlust der Körperwahrnehmung, der Körperorientierung, des Körperbewusstseins, des Körperschemas etc.)
• Dekubitusgefahr (lokale Hautschädigung aufgrund längerer Druckbelastung, welche die Durchblutung der Haut stört)
• Machtlosigkeit (Gefühl der Hilflosigkeit, Verlust von Einflussmöglichkeiten auf eigene Wünsche, Bedürfnisse und Bedarfe)
• körperliche, seelische und soziale Beeinträchtigungen, die oft in der Deprivation oder Isolation enden
Dieses »Anderssein« kann zu einer Qual werden – erst verliert die bettlägerige Person ihren sozialen und biografischen Raum. Später schwindet auch noch der Schutz der Privat- und Intimsphäre dahin. Die hilfe- und pflegebedürftige, bettlägerige Person wird unbeabsichtigter Weise auch ihres natürlichen Schamgefühls beraubt. Ganz am Ende der Auswirkungen steht dann nicht selten der Verlust des Lebensmutes der betroffenen Personen.
1.3Lebensraum
DefinitionLebensraum
Der Duden definiert Lebensraum als »Raum, Umkreis, in dem sich jemand oder eine Gemeinschaft [frei] bewegen und entfalten kann.«*
*https://www.duden.de/rechtschreibung/Lebensraum, abgerufen am 11.11.2019
Der Lebensraum ist auch abhängig von der Lebenswelt, in der sich eine Person befindet. Diese Anschauung hat ihre Wurzeln im philosophischen sowie soziologischen Bereich. Denn unter Lebenswelt wird ein grundlegendes Gefüge von natürlichen und sozialen Gegebenheiten verstanden, welches uns Menschen so vertraut und selbstverständlich ist, dass wir es kaum mehr wahrnehmen und wertzuschätzen wissen. Die Selbstverständlichkeit der eigenen Lebenswelt zu erahnen ist nur möglich, wenn man in eine Lebenssituation gerät und in neue Lebensumstände stürzt3.
Der hilfe- und pflegebedürftige, bettlägerige Mensch verspürt das Verändern seiner Lebenswelt, seines Lebensraumes entweder langsam fortschreitend oder – aufgrund eines plötzlich auftretenden schwerwiegenden gesundheitseischränkenden Ereignisses –als rasant einschneidend.
Wichtig Fakt ist!
Dem hilfe- und pflegebedürftigen, bettlägerigen Menschen verbleiben als Folge nur noch rund 1,9 Quadratmeter »Wohnfläche« für seine verbleibende Lebenszeit. An diesem Ort spielt sich nun alles ab: Wohnen, Essen, Waschen und oft auch der »Toilettengang«. Das Bett wird zum allumfassenden Lebensraum, der – auf ein Minimum verkleinert bzw. beschränkt – von Abhängigkeit geprägt ist. Die individuelle Lebenswelt wird winzig klein.
Führt man sich diesen Fakt einmal bildlich vor Augen, ist es umso wichtiger, den Betroffenen ihren verbleibenden Raum so angenehm und so lebenswert wie möglich zu machen – so lautet ja auch die Grundintention dieses Buches. Dazu gehört aber vor aller Aktivierung eine spezielle Zugewandheit! Eine Haltung, die sich in Ihrem Verhalten als pflegende und/oder betreuende Person widerspiegeln muss. Daher erfahren Sie im nächsten Kapitel, auf welche Umgangsformen zu achten sind und was Sie in Ihrer Haltung den Betroffenen gegenüber unbedingt berücksichtigen sollten.
_________________
1Mamerrow R, Schäffler A (2017): Immobilität. Verfügbar unter: https://www.apotheken.de/krankheiten/5811-immobilitaet, abgerufen am 20.04.2019.
2Zegelin A (2013): Festgenagelt sein. Der Prozess des Bettlägerigwerdens. Hogrefe AG, Bern.
3Kesselring A (1996): Einführung: Die Lebenswelt der Patienten In: Kesselring A (Hrsg.): Die Lebenswelt der Patienten, Verlag Hans Huber, Bern
2 Umgangsformen
2.1Der kleine Ausflug
So, nach einigen Begriffserläuterungen können Sie mich nun weiter auf Reisen begleiten. An dieser Stelle schlage ich einen Ausflug ins »Ich« vor: Beispielhaft stellen Sie sich vor, dass ich Sie in Ihrem Zuhause besuche. Dabei gehe ich, na ja, etwas »unkonventionell« vor. Doch lassen Sie sich doch einfach mal auf meinen Besuch ein!
BeispielMein Besuch bei Ihnen …
erfolgt unangemeldet, natürlich. Er soll doch eine Überraschung sein, obwohl wir uns völlig fremd sind. Okay. Ich steige ins Auto, fahre zu Ihnen und trete, ohne mich vorher anzukündigen, in Ihr Haus / Ihre Wohnung ein. Weder habe ich angeklopft noch geläutet oder mich sonst wie bemerkbar gemacht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich verfolge sie wortlos und unangekündigt bis in Ihr Badezimmer oder Schlafzimmer. Und ohne Ihre Bitte oder Zustimmung beginne ich, Sie zu berühren, nestele an Ihrer Kleidung herum und fange an, Sie komplett zu entkleiden. Schließlich wische ich Ihnen noch mit einem lauwarmen, nassen Lappen übers Gesicht.
Was Sie jetzt denken, kann ich mir absolut vorstellen. Ja, richtig. Sie sagen sich laut oder in Gedanken: »Die hat sich doch nicht mehr alle!« oder »Das ist ja eine Frechheit!«, »Spinnt die!?«etc. So, und genau diesen Gedanken behalten Sie nun. Prägen Sie ihn sich ganz fest ein!
Fokussieren wir nun wieder die pflegebedürftige und bettlägerige Person und übertragen den Ausflug bei Ihnen auf diesen Menschen: Wie würde es ihm gehen, wenn Sie ohne Vorwarnung sein Zimmer betreten, sich direkt an das Bett stellen, vielleicht noch etwas unsanft dagegen stoßen und der Person einfach mal die Bettdecke wegnehmen, sie ins Gesicht fassen oder andere Dinge tun? Richtig, es ist erschreckend und kann mit meinem Besuch bei Ihnen verglichen werden. So, wie ich Grenzen Ihrer Privatsphäre und Entscheidungshoheit überschritten habe, werden diese nun von Ihnen in Bezug auf die bettlägerige Person übertreten.
2.1.1Den Besuch ankündigen
Ausnahmslos sollte es daher zum guten Umgang gehören, gewisse Regeln im Umgang mit den Betroffenen einzuhalten. Dazu gehört zuerst, sich bei einer hilfe- und pflegebedürftigen, bettlägerigen Person entsprechend anzukündigen. Wie das im Detail aussehen kann, empfehle ich in den folgenden fünf Schritten ( Kasten).
Wichtig Wie kündige ich mich an? – 5 Schritte
1. Anklopfen an der Zimmertür (auch und besonders im familiären Umfeld)
2. Verbale Begrüßung beim Betreten des Zimmers: »Guten Tag, Herr …«
3. Anklopfen am Fußende des Bettes
4. Begrüßen durch die Stimme (etwas gedämpft): »Hallo, Herr …, jetzt bin ich bei Ihnen, …«
5. Begrüßen durch eine Initialberührung, z. B. an der Schulter
Nachfolgend werden die einzelnen Schritte noch etwas genauer erläutert:
zu 1: Das Anklopfen an der Zimmertür ist mit dem Betätigen der Haustür- bzw. Wohnungsglocke zu vergleichen. Sie sind stets Gast beim Pflegebedürftigen und kündigen sich entsprechend an. Vielleicht kann Ihnen die pflegebedürftige Person ja noch antworten. Dies kann dann mit dem Öffnen der Haus- bzw. Wohnungstür gleichgesetzt werden. Wenn nicht, warten Sie kurz vor der Tür, bevor Sie eintreten.
zu 2: Das Begrüßen sollte beim Eintreten in ein Zimmer eine Selbstverständlichkeit darstellen. Auch dient dieser stimmliche Gruß als Ankündigung. Der Betroffenen kann registrieren: »Es verändert sich etwas. Da ist jetzt jemand. Es kann etwas auf mich zukommen.«
zu 3: Das Anklopfen am Fußende des Bettes entspricht dem Anklopfen an die Zimmertür vorm Betreten des Raumes. Als Pflege- oder Betreuungskraft sind Sie an dieser Stelle im Begriff, die Privatsphäre der hilfe- und pflegebedürftigen, bettlägerigen Person zu »betreten«.
zu 4: Das Begrüßen am Bett mit gedämpfter Stimme dient dazu, den Pflegebedürftigen darauf hinzuweisen, dass Sie sich ihm nähern und er aber keine Angst verspüren soll. Wenn Sie in ein Zimmer eintreten, sagen Sie doch auch »Guten Tag«, oder!?
zu 5: Die Initialberührung ist ein Element aus der Basalen Stimulation® nach Bienstein und Fröhlich4. Sie teilt dem Betroffenen mit »Jetzt bin ich bei dir«. Viele hilfe- und pflegebedürftige, bettlägerige Menschen nehmen andere Personen erst wahr, wenn ein sanfter und bewusster Körperkontakt stattgefunden hat.
Info
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich eine hilfe- und pflegebedürftige, bettlägerige Person im Hier und Jetzt befindet. Es mag den Anschein haben, dass sie sich gedanklich in einem »Paralleluniversum« befindet und so wirkt, als wäre sie dieser Welt entrückt. Vielleicht liegt es an der bereits fortgeschrittenen Erkrankung, die der zu pflegenden Person die Möglichkeit nimmt, sich offensichtlich in der Gegenwart aufzuhalten. Doch ob und wie das genau ist, wissen wir als Außenstehende nicht genau. Daher ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich der Mensch in der Gegenwart befindet und dies nur nicht adäquat zeigen kann. Einer hilfe- und pflegebedürftigen, bettlägerigen Person sollte man deswegen stets respektvoll und behutsam gegenübertreten.
Ein unvermitteltes Ansprechen, Berühren oder gar gröberes Vorgehen dieser Person gegenüber, kann sie erschrecken lassen. Dieses Erschrecken zeigt sich in der Regel als Zusammenzucken, als kleiner Aufschrei, als ein körperliches Verkrampfen oder einfach nur als ängstlicher und angespannter Ausdruck in den Augen.
2.1.2Die Anrede
Im Bereich der professionellen Pflege erfolgt die Anrede der zu Pflegenden grundsätzlich mit »Sie« und »Herr« oder »Frau«.
In den heute älteren Generationen war und ist das allgemeine Duzen eher nicht gebräuchlich und war nur im Familienkreis oder unter Freunden, Bekannten und vielleicht Kollegen üblich. Daher fassen viele ältere Menschen das unaufgeforderte und unautorisierte Duzen als Beleidigung auf.
Die Kommunikation, egal ob verbal oder nonverbal sollte stets auf Augenhöhe – das heißt in der Erwachsen-Ich-Ebene nach Eric Berne erfolgen. Pflegende haben nicht das Anrecht sich auf die Eltern-Ich-Ebene zu begeben und es ist unprofessionell, sich auf die Kind-Ich-Ebene zu begeben.
Info
Eltern-Ich-Ebene
In der Eltern-Ich-Ebene ist die Kommunikation oftmals von Bestimmungen und Maßregelungen geprägt. Ein Beispielsatz für diese Art der Kommunikation wäre: »Jetzt bleib’ doch endlich liegen und häng’ die Beine nicht ständig über das Bettgitter!«
Kind-Ich-Ebene
Die Kind-Ich-Ebene zeugt von Unreife und Respektlosigkeit der zu versorgenden Person gegenüber. Ein Beispielsatz für diese Art der Kommunikation wäre: »So, nun schauen wir mal was in der Windel ist und dann gehen wir schön auf’s Töpfchen, gell?!«
Jedoch sind Ausnahmen zu beachten! Bei einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz, kann es sein, dass die zu pflegende Person keinen Bezug mehr zu ihrem Familiennamen hat und nur mehr den Rufnamen kennt. Dann ist im Rahmen einer pflegefachlichen Einschätzung festzulegen, ob ausnahmsweise ein Duzen erfolgen soll.
Ein weiterer Aspekt, der zu beachten ist, betrifft die Lautstärke der Stimme. Nur weil eine Person alt, demenziell verändert, bettlägerig oder immobil ist, bedeutet es nicht, dass diese Person schlecht hört. Die Anrede sollte daher immer in einer normalen Lautstärke erfolgen. Ferner sind kindliche Sprache und gebrochenes Deutsch absolute No-Gos und diskriminierend. Sie sind absolut zu vermeiden!
Nachdem Sie nun gut in Kontakt getreten sind, schauen wir, wie sich der Lebensraum Bett praktisch attraktiver gestalten lässt.
_________________
4Bienstein CH, Fröhlich A (2016): Basale Stimulation in der Pflege. 8. A. Hogrefe AG, Bern.
3 Körper-, Sinneswahrnehmungen und Bewegung
3.1Musik hören
Mögen Sie Musik? Ja?! Das geht nahezu jedem so – doch je nach Geschmack, Stimmungslage, Tagesverfassung, Tageszeit oder der aktuellen Situation bevorzugt man unterschiedliche Musik: Mal muss sie anregen, fetzen und einem förmlich »in die Beine gehen«, mal liebt man eher ruhige Musik und ab und zu lauscht man den Texten besonders intensiv. Von Klassik über Jazz bis hin zu Rock, Schlagern und vielleicht auch Techno – alles ist erlaubt. Auch hilfe- und pflegebedürftige Menschen haben ihre musikalischen Vorlieben.
Lassen Sie uns das Medium Musik nutzen, um den Betroffenen eine Freude zu machen, sie zu aktivieren und den Lebensraum Bett attraktiver zu gestalten. Denn Musik zu hören, kann etwas Experimentelles, Neues sein. Es kann ein Fest sein, Traditionen folgen, den Alltag versüßen, Erinnerungen hervorrufen, zum Träumen verleiten. Musik zu hören sollte auf jeden Fall nicht langweilig sein.
Tipp
Die Musik zur Aktivierung von Bettlägerigen muss gezielt und über-legt eingesetzt werden. Es genügt keinesfalls, einfach nur das Radio anzustellen und einen möglicherweise passenden Sender zu suchen!





























