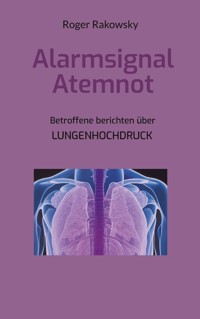
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Obwohl viele Menschen über Kurzatmigkeit und geringe Belastbarkeit klagen, wird meist nicht der Druck im Lungenkreislauf gemessen. Daher kann man Lungenhochdruck - genannt pulmonale Hypertonie - leicht übersehen. Mit ganz dramatischen Folgen für das weitere Leben. Zu Beginn ist pulmonale Hypertonie am besten zu behandeln, jedoch noch nicht heilbar. Ohne Behandlung endet sie immer in wenigen Jahren mit Herzversagen. Daher leistet der selbst erkrankte Autor mit 13 Mitautor:innen hier Aufklärung über Symptome, Diagnose, Behandlung und Chancen mit dieser Krankheit lange zu leben. Die Berichte der Betroffenen machen Mut. Der Verkaufserlös fließt in Vereine und Stiftungen in Deutschland und benachbarten Ländern, die die Forschung und Betroffene unterstützen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Sabine
im Gedenken an eine wundervolle
positive Persönlichkeit, die allen mit ihrer Herzlichkeit
Mut machte und nach dem Geschenk der neuen Lunge
leider viel zu früh abberufen wurde
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Grundwissen zu IPAH und CTEPH
Mit der Krankheit arrangieren - Sabines Geschichte
Wir sind stolz auf uns! - Walthers und Susannes Geschichte
Austausch mit Betroffenen ist wichtig - Isoldes Geschichte
Ich nehme es nicht hin ohne Zukunft zu sein - Amys Geschichte
Mein zweites Leben - Brunos Geschichte
Man hätte es wissen können - Christophs Geschichte
Todkrank auf einen Schlag - Michaelas Geschichte
Der Hulk in mir - Caros Geschichte
Mein holpriger Start ins Leben - Saras Geschichte
Ohne Hoffnung gibt es keinen Morgen - Oksanas Geschichte
Die Krankheit annehmen - Theresas Geschichte
An das Unmögliche glauben - Monikas Geschichte
Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt - Helgas Geschichte
Ich wachse an meinen Krankheiten - Rogers Geschichte
Vorwort
Dieses Werk richtet sich an alle Menschen, jedoch insbesondere an von Lungenhochdruck Betroffene, die bereits oder auch noch nicht diagnostiziert wurden, an deren Angehörige und an Ärzte. Jeden kann eine so selten und oft spät erkannte Krankheit treffen in jedem Lebensalter ohne Vorerkrankungen. 14 Betroffene erzählen hier ihre ganz persönliche (Über-)Lebensgeschichte mit dieser seltenen Erkrankung, die meist lange oder auch für immer unentdeckt bleibt. Meinen Mitautor:innen gebührt mein großer Dank und mein großer Respekt, dass sie sich mit ihrer Geschichte so öffnen. Ohne das Engagement dieser lieben, starken und tapferen Menschen wäre dieses Buch nicht zustande gekommen und es ist nicht mein Buch sondern das aller meiner Mitautor:innen.
Unbehandelt kann Lungenhochdruck in relativ kurzer Zeit zum Tode durch (Rechts-)Herzversagen führen. Die meisten Menschen denken bei Atemnot nicht daran, weil sie diese Krankheit nicht kennen und sehr viele Ärzte haben davon auch noch nie etwas gehört. Hunderttausende Menschen weltweit sind daran schon gestorben in den letzten Dekaden und haben von ihrer Lungenkrankheit nicht gewußt, sind allenfalls am Herzen behandelt worden, obwohl die Lunge Ursache ihrer Beschwerden war. Hunderttausende werden dieses Schicksal wohl noch erleiden müssen, da diese Krankheit auch deswegen selten erscheint, weil sie schwer zu diagnostizieren ist und man nicht daran denkt, den Druck in der Lunge zu messen. Aufklärung tut daher bitter Not, um Lungenhochdruck in allen seinen Formen frühzeitig diagnostizieren und behandeln zu können. Daher sollte jeder die Symptome, die Diagnostikverfahren und die Behandlungsmöglichkeiten kennen, die mittlerweile in vielen Fällen zunehmend zu einem relativ langen Überleben führen, wenn die Krankheit eben früh erkannt und konsequent durch Spezialisten behandelt wird.
Die Krankheit Lungenhochdruck wird in der Medizin als pulmonale Hypertonie (PH) bzw. pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH) bezeichnet und diese Bezeichnungen werden auch ab nun verwendet.
Eine sehr seltene Form der PH/PAH ist die idiopathische (= ohne eine fassbare Ursache entstandene) pulmonal-arterielle Hypertonie, kurz IPAH. Sie lässt sich nach momentanem Stand der Medizin noch nicht auf eine Erkrankung zurückführen, allenfalls bei der heritablen (= vererbbaren) pulmonal-arteriellen Hypertonie (HPAH), bei der eine genetische Analyse vorgenommen wurde und von der oftmals auch Familienmitglieder betroffen sind oder waren, lassen sich auslösende Faktoren mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Vererbung zurückführen. Den genauen Ursachen ist man noch auf der Spur.
IPAH und HPAH sind also noch nicht heilbar, jedoch mittlerweile meist so behandelbar, dass das Fortschreiten mit der tödlichen Konsequenz Rechtsherzversagen verlangsamt oder sogar aufgehalten werden kann. Es gibt erste Ansätze, die auch hier auf die Möglichkeit einer Heilung im Sinne von dauerhafter Rückbildung der Gefäßveränderungen des Lungengewebes in bestimmten Fällen hindeuten. Doch hierzu sind noch Forschungsarbeiten in erheblichem Umfang erforderlich, für die leider kaum öffentliche Gelder zur Verfügung stehen. Dabei lohnt sich die Forschung, wie man bei der häufigsten der seltenen Erkrankungen - auch „rare diseases“ genannt - sieht, der Mukoviszidose. Diese Lungenkrankheit ist dank jahrzehntelanger intensiver Forschung mittlerweile so gut behandelbar, dass die Überlebenszeit ohne oder vor eventueller Lungentransplantation in vielen Fällen extrem steigt und ebenso die Lebensqualität.
Die Forschungen zur PH finanzieren sich weltweit momentan nur durch eine Handvoll größere Pharmaunternehmen, die durch weltweiten Vertrieb trotz der relativ wenigen Betroffenen noch Profitchancen aus ihrem Engagement sehen. Auch Spendengelder fließen in die Forschung ein. So gibt es in Deutschland u. a. die René-Baumgart-Stiftung, die Forschungspreise für herausragende Fortschritte im Kampf gegen die PH vergibt. Es gibt eine europäische Organisation und Vereine in der Schweiz und in Österreich. Der Reinerlös aus dem Verkauf dieses Buches geht in voller Höhe an solche Organisationen, die sich für die Belange der von der Krankheit Betroffenen einsetzen. Die zunächst von den Verkaufserlösen bedachte René-Baumgart-Stiftung wurde am 31. März 2001 durch den gemeinnützigen Verein PULMONALE HYPERTONIE E.V. gegründet. Sie hat den Zweck, die medizinische Forschung im Bereich des Lungenhochdrucks bei Kindern und Erwachsenen zu fördern. René Baumgart war ein junger Mann, der mit 19 Jahren mit IPAH diagnostiziert wurde und mit 23 Jahren an dieser tückischen Krankheit verstarb.
Damals – vor 25 Jahren - gab es noch keine wirksame Behandlung und ohne Lungentransplantation hatte man kaum eine Chance. Renés Onkel, Bruno Kopp, einer der Gründer des PULMONALE HYPERTONIE E.V., verstarb im Februar 2012 selbst an dieser Krankheit. Sein Gedanke war mit der René Baumgart-Stiftung dem frühzeitigen Tod von René eine Bedeutung zu geben. Hier findet man alle Infos über die Stiftung, die jede:r Leser:in mit dem Kaufpreis nach Erscheinen des Buches neben anderen Organisationen unterstützt:
www.rene-baumgart-stiftung.de
In diesem Buch geht es ausschließlich um zwei seltene Formen der bereits an sich seltenen PAH. Es geht um die IPAH ohne bekannten Auslöser sowie die CTEPH mit einer Lungenthrombose als auslösendes Ereignis. Die pulmonalen Hypertonien, die auf Grunderkrankungen zurückzuführen sind, werden hier nicht betrachtet, da hierbei die Behandlung der diversen Grunderkrankungen des Herz-Kreislaufsystems im Vordergrund steht. Gerade weil die Erkrankung IPAH so selten ist, wird sie leider oft erst nach vielen Jahren der Atemnot und anderer Beschwerden diagnostiziert. In den meisten Fällen wird sie erst zu einem Zeitpunkt erkannt, bei dem die Krankheitsfolgen so fortgeschritten sind, dass das Herz bereits vergrößert und geschwächt ist. Ein solches Herz kann sich dann kaum mehr von der Belastung erholen und die Rechtsherzschwäche kann auch nicht mit den gleichen Medikamenten behandelt werden, die bei der Linksherzschwäche zur Anwendung kommen.
Auch wenn im Sinne der bis 2019 geltenden leitlinienbasierten Definition der Erkrankung nur eine geringe Anzahl von geschätzt ca. 4000 bis 5000 Einwohner in Deutschland mit IPAH diagnostiziert waren, kann man davon ausgehen, dass in Deutschland noch zigtausend Menschen weiterhin unentdeckt mit der Krankheit leben und daran versterben. Diese Menschen können ohne Behandlung innerhalb weniger Jahre an plötzlichem Herzversagen versterben.
Lungenhochdruck / pulmonale Hypertonie ist nicht nur den meisten Menschen gänzlich unbekannt, sondern leider immer noch auch den meisten Ärzten, die während ihrer Ausbildung davon nur am Rande - wenn überhaupt - etwas gehört haben. Ganz sicher existiert eine hohe Dunkelziffer an verstorbenen Patienten, bei denen der Lungenhochdruck unerkannt blieb. Denn ohne Behandlung schreitet die PAH unweigerlich weiter fort und das Herz versagt statistisch betrachtet nach drei bis sechs Jahren.
Als bei mir Anfang 2019 IPAH diagnostiziert wurde, habe ich nach dem ersten Schock sofort beschlossen mit einem Buch dazu beizutragen, dass diese seltene Erkrankung, die jeden in jedem Alter treffen kann, früher diagnostiziert wird und den Betroffenen die Angst davor genommen wird. Dazu ist es erforderlich die Bevölkerung insgesamt aufzuklären und nicht nur die Ärzte. Es gibt Zentren, die auf die Diagnose und Behandlung der PH spezialisiert sind. Eine Liste der deutschen Zentren findet sich auf der Homepage des Vereins PULMONALE HYPERTONIE E.V. unter phev.de. Betroffene und Interessierte aus Deutschland können dort seriöse Informationen, Anlaufstellen und Adressen örtlicher Gruppen erhalten.
Im Internetforum forum.phev.de können sich Betroffene austauschen.
Für Österreich ist die Anlaufstelle
www.lungenhochdruck.at
und für die Schweiz
www.lungenhochdruck.ch.
Meine Mitautor:innen und ich erteilen in diesem Werk keine Ratschläge, außer dem einen, sich an einen Spezialisten zu wenden, wenn man Symptome verspürt, die hier geschildert werden. Ich bin freier Autor und es findet sich in diesem Werk keine Werbung für irgendein Medikament oder eine Therapie. Markennamen werden nicht genannt, abgesehen von Medikamenten, die nur unter diesem Namen bekannt sind, wie Aspirin z. B., ansonsten lediglich Wirkstoffe, die zur Anwendung kommen können. Über deren Anwendung muss immer ein Arzt entscheiden. Es ist also kein Selbsthilfebuch oder Ratgeber, sondern vielmehr werden höchstpersönliche Erfahrungen ohne irgendeine Bewertung geschildert. Bei den Grundinformation, die ich im nächsten Kapitel gebe, habe ich frei zugängliche Quellen zur Recherche genutzt, die Erkenntnisse daraus extrahiert, jedoch wissentlich kein Fremdmaterial übernommen, welches zitierpflichtig wäre. Ich habe mir ein umfangreiches Wissen über PH in mittlerweile vier Jahren intensiven Selbststudiums angeeignet und gebe es nun in diesem Buch wieder. Umfangreiches Wissen über die eigenen Krankheiten halte ich im eigenen Interesse übrigens für wichtig, auch wenn es bei vielen behandelnden Ärzten nicht so gern gesehen wird, wenn man bei ihnen besser informiert erscheint als sie selbst es oft sind.
Mein fachlicher Beitrag im nächsten Kapitel entstand nach monatelanger Recherche in allgemein zugänglichen, veröffentlichten, Publikationen und Studien sowie Gesprächen mit Experten. Vieles davon findet sich in den Leitlinien zur PH und ich habe die darin enthaltenen Informationen im nächsten Kapitel lediglich in allgemeinverständlicher Weise aufbereitet. Es handelt sich hier folglich nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, die einen Anspruch auf Detailtreue erhebt, sondern lediglich um eine Übersicht des derzeitigen allgemein gültigen wissenschaftlichen Standes, über den – auch durch Aufnahme in die Leitlinien - allgemeiner wissenschaftlicher Konsens besteht und der sich überall im Netz findet.
Aus den in diesem Werk angeführten Behandlungsmöglichkeiten und Forschungsergebnissen ergibt sich weder ein Anspruch auf Vollständigkeit, noch handelt es sich um Handlungs- oder Therapieempfehlungen. Dies gilt im übrigen für alles was in diesem Werk zu Therapien und Vorgehensweisen geschildert wird. Es handelt sich – wie schon erwähnt - nicht um Empfehlungen oder Ratschläge und es können keinerlei Haftungsansprüche daraus hergeleitet oder geltend gemacht werden. Jegliche Therapie- oder Verhaltensempfehlung kann nur und ausschließlich ein behandelnder Arzt abgeben.
Mein Ziel ist es, dass irgendwann jeder weiß, was Lungenhochdruck bzw. pulmonale Hypertonie ist, welche Symptome sie verursacht und nicht zuletzt wie und wo man sie diagnostizieren und behandeln lassen kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass nun jeder, der einmal unter Atemnot oder Erschöpfung leidet, gleich zu einem PHZentrum eilen soll. Es bleibt äußerst unwahrscheinlich, dass es die Krankheit PH bzw. die hier behandelten Unterform IPAH oder CTEPH ist, doch es kann eben sein, dass diese Erkrankungen hinter den Symptomen stecken. Sollte sich also erstmal keine Ursache finden, ist das Aufsuchen eines Spezialisten immer eine Option.
Es gibt natürlich eine Reihe seltener Erkrankungen und keiner ist davor geschützt. Daher sollte jeder die Symptome auch dieser Krankheiten kennen. Wie man die Krankheit diagnostiziert und welche modernen Behandlungsmethoden zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches für die verschiedenen Formen und Ausprägungen der IPAH sowie der CTEPH zur Verfügung stehen, wird in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich erörtert und durch die 14 Erfahrungsberichte auch sehr plastisch gemacht.
Wenn man gerade erst erfahren hat dass man selbst betroffen ist oder wenn man den Verdacht hat, wird man aus den nachfolgenden Berichten der Erkrankten, die damit relativ gut und teils auch schon sehr lange leb(t)en, sicherlich Zuversicht gewinnen können, aber auch realistisch einschätzen können, was auf ihn oder sie zukommt. Jeder, ob Betroffener, Angehöriger oder interessierter Laie, wird eine Fülle an Informationen in kompakter Form gewinnen können. Zu bedenken ist jedoch, dass jeder Fall anders ist.
Wer auf Facebook ist, findet auf meiner Seite „PH Roger Rako“ aktuelle Informationen über IPAH und CTEPH, die ich dort verlinke.
Mein behandelnder Professor im Zentrum für pulmonale Hypertonie bestärkte mich ausdrücklich darin das Buch mit meinem populärwissenschaftlichen Beitrag darin zu veröffentlichen und fand Lob für mein Projekt. Ich bedanke mich hier auch ausdrücklich für seine moralische Unterstützung. Darüber, dass ich wieder in der Lage bin das Buch nach der Verzögerung durch die Pandemie und einen schweren Unfall, den ich im Sommer 22 erlitt das Buch abschließen und erstmals bei BOD veröffentlichen zu können, freue ich mich sehr.
Roger Rakowsky im September 2023
Grundwissen zu IPAH und CTEPH
Um die Berichte der Betroffenen richtig einordnen zu können und zu wissen über was diese im Folgenden schreiben, ist ein gewisses Hintergrundwissen erforderlich. Ich bemühe mich dies so wenig wissenschaftlich und so allgemein verständlich wie möglich rüberzubringen. Trotzdem sind einige Fachbegriffe hier notwendig, die ich jeweils erläutere. Mein Hintergrundwissen stammt u.a. aus den Leitlinien, aus Lexika, Studien, Artikeln in Fachzeitschriften, Seminaren und Gesprächen mit Fachleuten.
Der Hochdruck in der Lunge, also im kleinen Blutkreislauf, wurde laut eines Eintrages in Wikipedia erst vor etwa 130 Jahren als Krankheit erkannt. 1891 maß der Internist Ernst von Romberg erstmals einen Anstieg des Blutdrucks im Lungenkreislauf, den pulmonalarteriellen Druck. Er stellte fest, dass dieser meist mit einem Anstieg des Gefäßwiderstandes in den Lungenarterien verbunden ist. Dieser führt neben belastungsabhängiger Luftnot und Schmerzen in der Brust zu Müdigkeit und Kreislaufstörungen bis hin zu Ohnmachten, die medizinisch Synkopen genannt werden. Die körperliche Leistungsfähigkeit wird zunehmend eingeschränkt. Je länger die Erkrankung nicht oder nicht optimal behandelt wird, desto mehr vergrößert sich die rechte Herzkammer, da sie dem hohen Druck immer schwerer standhält. Im Endstadium versagt das Herz, wenn nicht rechtzeitig eine neue Lunge transplantiert werden kann oder wenn - bei vorliegender Grunderkrankung - diese nicht erfolgreich behandelt wird. In den meisten Fällen ist eine Grunderkrankung nämlich Ursache der PH, beispielsweise eine Linksherzschwäche. Diese Form erfordert in der Regel nur dann eine gesonderte Behandlung, wenn eine schwere Rechtsherzbelastung besteht.
Eine Lungenembolie hat manchmal auch pulmonale Hypertonie zur Folge. Man nennt diese Sonderform chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie, kurz CTEPH. In vielen Fällen lässt sich die CTEPH durch eine - wegen der Komplikationsrate relativ riskante - operative pulmonale Endarteriektomie (PEA), bei der die Blutgerinnsel in der Lunge entfernt werden, behandeln. Damit kann man diese Krankheit als bisher einzige Form der PH auch heilen oder zumindest die Prognose deutlich verbessern. In dafür spezialisierten Zentren ist die Operation mittlerweile auch recht sicher und die Sterberate nach einem solchen Eingriff wird von Jahr zu Jahr geringer. Nichtoperable CTEPH-Patienten und Patienten, die sich nicht operieren lassen wollen, werden ebenso medikamentös therapiert.
Die chronisch verlaufende idiopathische pulmonal-arterielle Hypertonie, kurz IPAH, führt zu einer bislang kaum rückgängig zu machenden Verdickung der Gefäßmuskulatur sowie zu einer fortschreitenden Wucherung des Bindegewebes, die zur Verengung der pulmonalen Adern führt. Durch den Umbau der Lungenarterien wird immer weniger Sauerstoff über die Lunge aufgenommen, während sich durch den erhöhten pulmonal-arteriellen Widerstand gleichzeitig die Herzauswurfleistung verringert. Das Herz muss immer stärker pumpen, um die Sauerstoffversorgung der Organe aufrechterhalten zu können. Bei der CTEPH geschieht die Blockade der Lungengefäße aufgrund von Blutgerinnseln, den Thromben, die sich nach einer Lungenembolie nicht mehr auflösen, sondern die Lungenarterien verstopfen. Die aussagekräftigste Messung des pulmonal-arteriellen Blutdrucks geschieht durch eine Rechts-Herzkatheteruntersuchung, am besten in einem Zentrum für pulmonale Hypertonie. Diese zwar invasive aber sehr komplikationsarme Untersuchung ist derzeit der Goldstandard und nur sie sichert die Diagnose.
Ab einem mit Rechtsherzkatheter gemessenen mittleren pulmonal-arteriellen Druck (mPAP) von größer oder gleich 20 mmHg sowie einem pulmonal-vaskulären Widerstand (PVR) von größer als 3 Wood-Einheiten handelt es sich den aktuellen Leitlinien zufolge gesichert um eine pulmonale Hypertonie, die spätestens ab dem Auftreten von Beschwerden behandlungsbedürftig wird. Bei einem gesunden Menschen liegt der Druck zwischen 15 und 19 mmHg. Dieser Druck hat nichts mit dem normalen Blutdruck zu tun, da die Lunge einen eigenen Blutkreislauf mit geringerem Blutdruck aufweist. Vor dem minimalen Eingriff in den Körper durch den Katheter kann man einen Verdacht mittels Herzultraschall, der Echokardiografie, erhärten. Dabei wird oft schon eine Rechtsherzschwäche bzw. eine Schwäche der Trikuspidalklappe und der Mitralklappe im Herz festgestellt, neben dem pulmonal-arteriellen systolischen (= oberen) Druck, der aus dem Echosignal im Ultraschallgerät abgeschätzt wird. Die Veränderungen der Herzklappen sind eine Folge des hohen Drucks in den Lungenarterien, gegen die das Herz pumpen muss. Die Herzklappen sind dabei meist leicht geschwächt und setzen dem Blutfluss weniger Widerstand entgegen, was hier jedoch nicht durch einen speziellen Eingriff gesondert behandelt werden muss. Eine Rechtsherzschwäche kommt nach Jahren der Erkrankung hinzu, wenn nicht rechtzeitig optimal und erfolgreich behandelt wird. Bei einem Herzecho sind natürlich auch Fehlabschätzungen möglich. Manchmal ist der im Rechtsherzkatheter invasiv und genau gemessene Druck geringer als der aus dem Herzecho abgeleitete. In Einzelfällen kann er auch höher sein.
Sollten zu einem per Ultraschall festgestellten systolischen PAPWert von über 20 mmHg andere Parameter, wie zu hohe herzspezifi sche Marker in der Blutuntersuchung, z. B. der NT-proBNP-Wert oder ein auffälliges EKG mit z.B. einem sogenannten „Rechts-Schenkelblock“ oder auch unspezifische Lungengeräusche hinzukommen, ist es angezeigt, baldmöglichst ein Zentrum für pulmonale Hypertonie in einer Klinik aufzusuchen. Dort wird vor einer Rechtsherzkatheteruntersuchung erst eine Lungenfunktionstestung einschließlich einer Spiroergometrie, also ein kombinierter Herzbelastungs- und Lungenfunktionstest auf dem Ergometer, vorgenommen. Nur wenn sich dort der Verdacht erhärtet kommt es zum Kathetereingriff. Ansonsten empfehlen die Spezialisten meist, dass die Werte vom Internisten oder Kardiologen in etwa dreimonatigen Abständen durch ein Herzecho (Herzultraschall) kontrolliert werden.
Bei einer Steigerung des oberen systolischen Drucks (sPAP) im Ultraschall, insbesondere wenn der sPAP dort bereits über 50 mmHg liegt, ist das Aufsuchen eines Zentrums für pulmonale Hypertonie in einer Klinik unerlässlich! Denn es gilt bei dieser Krankheit möglichst wenig Zeit zu verlieren mit dem Beginn der Behandlung. Dies setzt eine genaue Feststellung voraus, um welche Art der PH es sich handelt. Wenn eine zur PH führende Grunderkrankung gut behandelt werden kann, kann auch die pulmonale Hypertonie günstig beeinflusst werden. Beispielsweise kann die Linksherzinsuffizienz als Grunderkrankung oft sehr gut behandelt werden. Auch Kleinkinder mit angeborenen Herzfehlern werden möglichst so frühzeitig operiert, dass sich eine pulmonale Hypertonie gar nicht entwickeln kann.
Fachkundig angeleitetes mäßiges körperliches Training ist entgegen früherer Aussagen auch bei Lungenhochdruck von Fachärzten ausdrücklich empfohlen. Nikotinverzicht, weitgehende Alkoholabstinenz sowie eine Reduzierung eines evtl. vorhandenen Übergewichtes auf Normalgewicht sind ebenfalls dringend empfohlen.
Die spezielle medikamentöse Therapie der IPAH ist schwierig und individuell sehr unterschiedlich. Man sollte hierfür auf jeden Fall die Spezialisten bei den Zentren für pulmonale Hypertonie aufsuchen. Während bis zur Jahrtausendwende im Wesentlichen nur die Lungentransplantation als letzte Maßnahme nach Jahren des Fortschreitens zur Verfügung stand, sind inzwischen einige Arzneistoffe für die Therapie zugelassen und es kommen alle paar Jahre neue hinzu. Bei CTEPH ist dies in erster Linie der Wirkstoff Riociguat. Die Prognose wird immer besser zugunsten eines langen Überlebens in stabilem Zustand, sofern man sich an die verordnete Medikation hält und die Kontrolltermine wahrnimmt.
Wenn die Verdachtsdiagnose gesichert ist, wird diese zunächst mittels Rechts-Herzkatheter entweder bestätigt oder auch ausgeschlossen. Hierbei wird auch gleich herausgefunden, ob man zu den etwa zehn Prozent der sogenannten „Vasoresponder“ (= Ansprecher auf gefäßerweiternde Kalziumantagonisten) gehört, bei denen der Druck im Lungenkreislauf mit nur einem Medikament (meist Amlodipin oder Lercanidipin in hohen Dosen) bestenfalls auf Normalmaß gesenkt werden kann. Etwas mehr als die Hälfte dieser Vasoresponder behält diese lebensrettende Eigenschaft auch auf Dauer bei und muss nicht später auf andere Medikamente wechseln. Betroffene, die keine Vasoresponder sind, können oft für viele Jahre mit anderen Wirkstoffen stabil gehalten werden, oftmals mit zusätzlicher Zufuhr von Sauerstoff, der sogenannten Langzeitsauerstofftherapie (LTOT).
Eine pulmonale Hypertonie gilt als idiopathisch bzw. primär, wenn die Ursache der Erkrankung (noch) unbekannt ist. In einigen Fällen liegt ein Defekt des Endothels der Lunge vor, also der Zellschicht an der Innenfläche der Blut- und Lymphgefäße. Dieser macht die Lunge anfällig für Gefäßschäden und kann zu einer sogenannten endothelialen Dysfunktion sowie in Folge zu abnormer Proliferation, also unkontrollierter Zellteilung und Zellwachstum, führen.
Neuesten Veröffentlichungen aus Studien zufolge kann in bis zu 20 Prozent der Fälle ein genetischer Defekt ermittelt werden. Hierbei kann es sich um eine Mutation des BMPR-II-Gens oder einiger anderer Gene handeln, die auf eine Erbkrankheit schließen lässt und die Diagnose HPAH wahrscheinlich macht. Es werden ständig weitere Genmutationen entdeckt, denen man eine Rolle bei der Entstehung der Erkrankung zuschreibt. Hier will man künftig Hebel zur Behandlung ansetzen.
Während pulmonale Hypertonie insgesamt, also inklusive der Fälle mit anderer Grunderkrankung, etwa 1 Prozent der globalen Bevölkerung betrifft und bei über 65-Jährigen sogar etwa 10 Prozent, litten an der seltenen Form IPAH in Deutschland laut einer Erhebung aus dem Jahr 2014 zu diesem Zeitpunkt nur 25,9 pro 1 Million Erwachsener, mit einer jährlichen Rate neu Diagnostizierter von 3,9 pro 1 Million Erwachsener. Bei der CTEPH waren es im gleichen Jahr 4 pro 1 Million Erwachsener.
Dies erscheint zunächst extrem wenig, doch die Zahlen fußen noch auf der Definition der IPAH und CTEPH aufgrund des Grenzwertes des Lungendruckes, der bis 2019 noch bei 25 mmHg lag und seitdem bei 20 mmHg. Nun zählen also die vielen tausend Getesteten mit bisherigen Vorstufen oder latenter nicht fixierter PH dazu, die oft noch keine Symptome haben und daher keiner Behandlung bedürfen, sondern bei denen lediglich der Druck immer wieder zu kontrollieren ist. Zudem ist die Dunkelziffer unerkannter Erkrankungen erfahrungsgemäß bis zu zehnmal so hoch und nicht zuletzt kann jeder jederzeit zum Betroffenen werden, da keine speziellen Risikofaktoren, abgesehen von einer genetischen Veranlagung oder in Einzelfällen dem übermässigen Konsum von bestimmten Appetitzüglern, bekannt sind.
Das durchschnittliche Alter bei Diagnosestellung ist über die letzten Jahre kontinuierlich angestiegen und liegt Fachartikeln zufolge nun bei 65 Jahren. Bei manchen Patienten, die unter Luftnot leiden, wird durch verbesserte Diagnostik nun eine pulmonal arterielle Hypertonie diagnostiziert, die vor Jahren allenfalls als Herzinsuffizienz eingeordnet und als solche auch behandelt worden wäre. Dazu kommt, dass viele der älteren Patienten, bei denen eine IPAH diagnostiziert wird, Begleiterkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder der Lunge haben, was eine exakte Diagnosestellung oft schwierig macht.
Die Lebenserwartung von Patienten mit pulmonal-arterieller Hypertonie hat seit Beginn dieses Jahrhunderts durch verbesserte Behandlung kontinuierlich zugenommen. So liegt die statistische Rate der Patienten, die mehr als drei Jahre ab der Diagnosestellung IPAH noch leben, mittlerweile bei 70 bis 80 Prozent, während noch in den 1980er Jahren nur etwa 40 Prozent drei Jahre überlebt haben. Auch die Überlebensraten von Patienten mit CTEPH haben sich mit einer Rate von 90 Prozent nach drei Jahren deutlich verbessert. Angesichts des meist höheren Lebensalters und der Nebenerkrankungen der Patienten deren Daten hier einfließen sind solche statischen Daten als Mittelwerte allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Man kann mit und an PH versterben. Ein/e heute neu diagnostizierte/r 30jährige/r hat dank der Forschung und optimierter Therapie wohl gute Chancen auf eine annähernd normale Lebenserwartung bei optimaler Behandlung und frühzeitiger Diagnose. Ziel bleibt immer eine Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung der Belastungsfähigkeit.
Das führende Symptom ist die zunehmende Atemnot bzw. Kurzatmigkeit bei Belastung, die man als Belastungsdyspnoe bezeichnet. Oft kommen Müdigkeit und Abgeschlagenheit hinzu. Da die Symptome so unspezifisch sind, vergehen häufig Jahre zwischen dem Auftreten erster Beschwerden und der Diagnose. Bei Fortschreiten der Erkrankung nehmen die Beschwerden zu, und weitere Symptome können hinzukommen, unter anderem eine Kurzatmigkeit bereits beim Bücken und Ohnmachten (Synkopen) während und nach Belastung. Sollten Synkopen schon bei geringer körperlicher Aktivität und zahlreich auftreten, ist dies ein gravierendes Warnzeichen, bei dem man unverzüglich sein PH-Zentrum aufsuchen sollte. Dieses Symptom zeigt einen potentiell lebensbedrohlichen Zustand an, bei dem das Herz dekompensiert sein kann. Das bedeutet, dass alle Fähigkeiten des Körpers, die durch den Lungenhochdruck entstandene Herzschwäche auszugleichen, erschöpft sind. Die Leistung des Herzens reicht dann bald nicht mehr aus, um genügend Blut aufzunehmen und in den Körper auszuwerfen. Es droht akutes Herzversagen. Bei solchen Fällen, die in WHO-Funktionsklasse IV eingestuft werden, ist oft die kontinuierliche Versorgung mit dem Wirkstoff Remodulin mittels einer Pumpe angezeigt. Diese Pumpe kann auch implantiert und durch die Haut aufgefüllt werden. Es wird daran geforscht, die ständige Zufuhr dieses stark gefäßerweiternden Wirkstoffes oder ähnlicher Substanzen künftig statt über eine Pumpe über einen Inhalator durch die Nase sicherzustellen oder sogar mittels einer Tablette.
Die IPAH ist im Gegensatz zur CTEPH (sofern operabel) bis dato keine heilbare Erkrankung. So ist es das Ziel jeder ärztlichen Therapie zumindest die Krankheit zu kontrollieren, also die Patienten sind auf einem guten klinischen Niveau zu stabilisieren. Dabei hilft die Einteilung in Schweregrade, die an der NYHA-Klassifikation bei Herzschwäche angelehnt sind und in vier sogenannten WHO-Funktionsklassen aufgeteilt werden. Hierbei ist die WHO-Funktionsklasse I oder II u. a. dadurch gekennzeichnet, dass noch keine oder nur geringe Symptome auftreten und ein rasches Fortschreiten der Krankheit im Kontrollzeitraum nicht auftritt. Unter einer anfänglichen Kombinationstherapie mit zwei bis drei verschiedenen Medikamenten ließ sich dieses Therapieziel in einer Studie bei bis zu 40 Prozent der Patienten erreichen.
Die Wahl der Medikamente hängt unter anderem vom Schweregrad der Erkrankung unter Berücksichtigung der WHO-Funktionsklasse ab. Die aktuelle Leitlinie empfiehlt hierbei eine Einstufung des Sterblichkeitsrisikos in Ampelform als niedriges (grün), mittleres (gelb) und hohes (rot) Risiko, basierend auf der erwarteten EinjahresSterblichkeit. Patienten mit neu diagnostizierter IPAH und niedrigem beziehungsweise mittlerem Risiko in den WHO-Funktionsklassen I und II erhalten derzeit zunächst eine zweifache Kombinationstherapie mit einem Endothelin-Rezeptor-Antagonisten (ERA), wie Ambrisentan, der den pulmonalen und den systemischen Gefäßwiderstand verringert. Dazu kommt ein Phosphodiesterase-5(PDE5)-Inhibitor in Form von Sildenafil oder Tadalafil („Viagra“) beziehungsweise dem löslichen Guanylatcyclase (sGC)-Stimulator Riociguat, der sich als Enzym an Stickstoffmonoxid bindet und damit auch die Blutgefäße der Lunge erweitert. Für Hochrisikopatienten in den WHO-Funktionsklassen III und IV wird eine initiale dreifache Kombinationstherapie, bestehend aus ERA, PDE5-Inhibitor beziehungsweise sGC-Stimulator und einem intravenös verabreichten Prostazyklin-Analogon empfohlen, wie Treprostinil oder Iloprost, die gefäßerweiternd wirken sowie Selexipag, das zusätzlich die Vermehrung des Gewebes hemmt. Auch Remodulin kommt über eine Pumpe zum Einsatz. Bei den wenigen Vasorespondern, die auf Kalziumkanalblocker ansprechen, reicht die Gabe eines solchen in hohen Dosen i.d.R. aus.
Verlaufskontrollen nach Therapieeinleitung sind anfangs nach vier bis zwölf Wochen angezeigt und im weiteren Verlauf meist in drei- bis sechsmonatigen Intervallen. Ein invasiver Rechtsherzaktether ist hierbei nicht jedesmal erforderlich. Das weitere therapeutische Vorgehen hängt vom individuellen Therapieansprechen ab. Wenn Patienten das Erreichen oder Verbleiben in dem grünen Ampelbereich mit niedrigem Risiko als Therapieziel nicht erreichen, wird die Medikation entweder erweitert oder eines der Medikamente ausgewechselt.





























