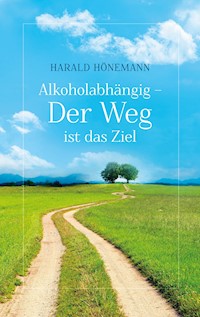
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Harald Hönemann ist trockener Alkoholiker. "Alkoholabhängig - Der Weg ist das Ziel" beschreibt den Weg, den er gegangen ist, um ein Leben in Abstinenz zu leben. Er schreibt über seine Aufenthalte in Suchtkliniken, seine Erfahrungen mit Mitpatienten und Klinikpersonal und Fragen, die er sich stellen musste, um zu Einsichten hinsichtlich der Sucht und seiner selbst zu kommen. Ich habe in nassen Zeiten nicht nur getrunken, nein, ich habe gesoffen. In diesem Buch möchte ich meinen Weg aus der Sucht schildern, mit dem Wissen, dass ich jederzeit einen Rückfall erleiden kann. Schon als Kind wurde ich an Alkohol herangeführt. Später folgten Aufenthalte in zwei Suchtkliniken. Diese Erfahrung sowie die Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, möchte ich mit Ihnen teilen. Zudem möchte ich aufzeigen, dass man in einer solchen Einrichtung nicht alles hinnehmen muss, dass man auch als Alkoholiker eine Meinung haben darf. Nicht zuletzt möchte ich von meinen Schicksalsschlägen berichten, die mich einem Rückfall nahe gebracht haben, um zu zeigen, dass wir trockenen Alkoholiker es trotzdem schaffen können, in Abstinenz zu leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Vorgeschichte
Aufenthalt in der Soteria Klinik in Leipzig
Aufenthalt im psychiatrischen Fachkrankenhaus in Wermsdorf
Aufenthalt in der christlichen Rehabilitationsklinik nahe Moritzburg
Zeit nach der Langzeittherapie und weiterführende Gedanken
Schlusswort
Danksagung
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
mein Mann ist seit dem 20. April 2004 trockener Alkoholiker. Er hat in der Zeit, als er noch getrunken hat, sowie in den Reha-Einrichtungen, in denen er stationär war, einiges erlebt. Nach der zweiten Reha hat er sich hingesetzt und dieses Buch geschrieben. Im Jahr 2007 hat er mit diesem Buch einen Manuskriptwettbewerb gewonnen. Der Preis beinhaltete die anfallenden Herstellungskosten wie die Druck- und Buchbindungskosten, das Lektorat sowie die Erteilung einer ISBN. Aus unbekannten Gründen lief der Prozess nicht so, wie er hätte sein sollen. Die Zusammenarbeit im Lektorat war nicht so, wie mein Mann es sich vorgestellt hatte. Es wurden ohne sein Einverständnis einhundert Bücher gedruckt, von denen er nur ein einziges Exemplar bekommen hat. Dieses hat er einige Male verliehen. Selbst seine Hausärztin, Frau Dr. Fischer, hat es gelesen. Von allen Lesern kam eine positive Rückmeldung. Daher habe ich mich als seine Frau daran gemacht, das Buch abzuschreiben, um es erneut zu veröffentlichen.
Vorgeschichte
Eines möchte ich gleich zu Beginn festhalten: Ich habe nicht getrunken, nein, ich habe gesoffen.
Aber ich habe es geschafft, liebe Leserin und lieber Leser! Wenigstens bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich an diesem Buch schreibe. Seit dem 20. April 2004 bin ich trocken.
In diesem Buch möchte ich meinen Weg dorthin mit allen Höhen und Tiefen beschreiben. Es wird für jede Leserin und jeden Leser etwas dabei sein und wenn das Buch nur hilft, weniger zu verurteilen oder sich mehr zu engagieren. Vielleicht kann es auch eine kleine Hilfe sein, um abstinent zu leben. Sich als Alkoholiker die ein oder andere Frage zu stellen. Zu hinterfragen, wie es so weit kommen konnte, nicht mehr ohne Alkohol leben zu können. Ich schreibe dieses Buch in der Hoffnung, dass der ein oder andere Abhängige sich hinterfragt. Sich vielleicht outet, um endlich Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich möchte Angehörigen zeigen, dass es geht: Suchtkranke können trocken leben. Vielleicht hilft es auch dabei, dass Angehörige ihre eigene Co-Abhängigkeit erkennen können.
Ich möchte dieses Buch der Reihenfolge nach schreiben, indem ich mit meiner nassen Zeit beginne, danach die zwei Langzeittherapien und den Psychiatrie-Aufenthalt schildere, um schließlich zu den Fragen zu kommen, die sich mir gestellt haben, und um zu Antworten zu gelangen. Zuletzt werde ich Ereignisse beschreiben, die mich an den Rand eines Beinahe-Rückfalls gebracht haben. Diese Ereignisse passierten zum Teil erst, nachdem ich das Buch zum ersten Mal geschrieben hatte.
Mein Name ist Harald Hönemann, ich bin dreiundvierzig Jahre alt und lebe mit meiner Frau und meinen Kindern in der Nähe von Bad Düben. Ich habe mich entschieden, meine Geschichte von dem Zeitpunkt an zu erzählen, in dem ich aus meinem ›dahin schlummernden Suchtschlaf‹ nicht wach geküsst, sondern gebissen wurde. Im Grunde genommen verdanke ich mein jetziges Leben in Abstinenz einem mittelgroßen Hund.
Es war Freitag, der 28. November 2003. Wie so oft nach Feierabend war ich alkoholisiert. Meine Frau und meine Tochter wollten unseren Sohn in Eilenburg vom Bahnhof abholen. Normalerweise vermied ich es immer, im alkoholisierten Zustand mitzufahren, aber wahrscheinlich war mein Pegel an diesem Tag noch nicht erreicht und mein Vorrat an Alkohol war erschöpft. Die Sucht macht ja pfiffig: Ich belauschte also eine Unterhaltung meiner Frau und meiner Tochter. Sie planten einen kleinen Einkauf in einem am Bahnhof gelegenen Discountmarkt. Ich musste zusehen, dass ich mitfahren konnte, um Nachschub zu kaufen. Üblicherweise hatte ich in der Zeit, in der ich allein zu Hause war, meine Ruhe, um meinen Stoff zu trinken oder in die Kneipe zu fahren. Heute jedoch fuhr ich mit.
Vor dem Markt sahen wir einen Hund sitzen, ordentlich angeleint – wie es sich gehört. Da wir selbst einen Hund hatten und mein Übermut groß war, wagte ich es, mich diesem vierbeinigen Gesellen zu nähern. Dieser war ganz und gar nicht damit einverstanden. Er knurrte, was ich natürlich ignorierte, genauso wie die mahnenden Worte meiner Tochter. Dass er mit meinen Annäherungen nicht einverstanden war, zeigte er mir dann, indem er seine Zähne in mein linkes Schienbein rammte.
Das erzählte ich meiner Familie zunächst nicht, musste es aber später eingestehen, da mein Bein schon auf dem Bahnsteig anschwoll.
Zu Hause gab es dann eine große Aufregung. Meine Familie machte mir Vorwürfe und hatte alle möglichen Bedenken, was den Gesundheitszustand des Hundes betraf. Tollwut oder Ähnliches standen zur Debatte.
Also begab ich mich noch am selben Abend in medizinische Behandlung in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Die ersten Fragen waren – wie nicht anders zu erwarten: Ist der Hund gegen Tollwut geimpft? Wer ist der Halter? Ist der Hund versichert? Ich konnte keine Antwort geben. Woher auch? Ich kannte weder den Hund noch das Herrchen. Als die behandelnde Ärztin dann auch noch verlangte, dass ich einen Nachweis darüber zu erbringen habe, dass dieser Hund gegen Tollwut geimpft war, war ich ganz schön verdattert. An so etwas hatte ich überhaupt nicht gedacht.
In dieser Nacht ging mir manches durch den Kopf. Tollwut brachte ich mit unangenehmen Spritzen in den Bauchraum in Verbindung. Selbst die Vorstellung, einem qualvollen Tod zu erliegen, durchfuhr mein Gehirn, das langsam nicht mehr vom Alkohol benebelt war. Die Frage, wie ich den Hund nebst Herrchen finden sollte, drängte sich mir auf. Die Nacht wollte einfach nicht vergehen, die Stunden schleppten sich endlos dahin.
Ich war froh, als der Morgen anbrach und endlich alle aufgestanden waren, vor allem meine Tochter. Sie war die Einzige, die den Hund auch gesehen hatte. Am Frühstückstisch fragte ich sie verlegen, wie der Hund ausgesehen hatte. Sie konnte sich kaum daran erinnern, da sie dem Hund wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Ich kam mir meiner Familie gegenüber ganz schön dumm vor. Es war nicht mehr zu leugnen, dass ich am Vorabend unter einem enormen Alkoholeinfluss gestanden hatte.
Wir machten uns also auf die Suche nach dem Hundebesitzer samt Hund. Nach langem Suchen und Durchfragen im und in der Nähe des Discounters fanden wir die zwei. Sie sahen nicht gerade vertrauenserweckend aus, was meine nächtlichen Befürchtungen wieder auf den Plan rief. Das Herrchen konnte sich einen Tierarztbesuch nicht leisten, meine Ärztin bestand aber auf eine tierärztliche Bescheinigung, dass der Hund keine Tollwut hatte. Es kostete schließlich einiges an Mühe, das Herrchen zu einem Besuch beim Tierarzt zu bewegen. Diese Hürde war erst dann genommen, als ich mich dazu bereit erklärte, die Rechnung zu übernehmen.
Der Hund war gesund und das Herrchen hatte einen frisch geimpften Vierbeiner, was mich einiges an Geld gekostet hatte. Ich hatte nun meine Bescheinigung und war für den Moment beruhigt.
Es war Samstag und – nicht dass Sie denken, ich hätte aus dieser Geschichte irgendetwas gelernt – ich brauchte meinen Alkohol und den beschaffte ich mir. Die Freude über den gesunden Hund musste ja begossen werden.
Am Montag marschierte ich stolz mit der Bescheinigung zu meiner Hausärztin, doch sie hatte gleich den nächsten Schlag für mich parat. Sie wolle gern ein paar Bluttests machen, meinte sie. Ich ahnte, was dabei herauskommen würde.
Sie machte ihre Tests und es dauerte einige Tage, bis die Auswertung kam, in denen ich mir meinen Kopf darüber zerbrach, was sie wohl sagen würde.
Der Tag kam: Der Blick meiner Hausärztin verriet eine Menge. Innerlich hatte ich mich schon auf schlechte Nachrichten eingestellt. Als sie meine Blutwerte vor sich liegen hatte, sagte sie – und ich werde diese Worte nie vergessen – in einem ernsten Tonfall: »Sie begehen Selbstmord mit Messer und Gabel und wahrscheinlich auch noch mit Alkohol.« Da waren sie das erste Mal, die Gedanken an Leberzirrhose, und sie sollten mich noch lange verfolgen. Ich hatte einen Leberwert von 442 GPT. Normal ist ein Wert von 10 bis 70 GPT.
Ich trat dementsprechend etwas kürzer mit dem Alkoholkonsum. Das hielt allerdings nur ein, zwei Tage an.
Dann stand Weihnachten vor der Tür und ich hatte nun genügend Zeit, um mir Gedanken zu machen. Viele Dinge kreisten durch meinen Kopf. Da waren sie wieder, die Erinnerungen an ehemalige Kollegen, die sich im Grunde genommen ›totgesoffen‹ hatten. Innerlich hatte ich mir schon länger eingestanden, ein Suchtproblem zu haben. Bisher hatte ich es aber nie geschafft, länger als eine Woche ohne Alkohol auszukommen. Selbst Stürze und Verwundungen, die ich mir im Suff zugezogen hatte, konnten mich damals nicht davon abhalten, mein Quantum an Alkohol zu trinken.
Aber jetzt war mein Kopf wie ein Betonmischer. Alles drehte sich immer und immer wieder um eine Frage: Willst du so weitermachen oder willst du etwas ändern? Mir saß schließlich schon jemand im Nacken, wie meine Hausärztin prophezeit hatte: Gevatter Tod. Nach langen und harten Verhandlungen mit mir selbst sagte ich mir: Mensch, wie dumm bist du eigentlich? Sitzt den Winter über zu Hause und hast eh keine Arbeit, mach was!
Es bedurfte einiges an Überwindung, aber ich nahm meinen ganzen Mut zusammen. Gleich Anfang Januar 2004 sprach ich bei meiner Hausärztin vor.
Wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, sich in der Materie Alkoholabhängigkeit etwas auskennen, muss ich Ihnen nicht erklären, dass es nur sehr wenige selbst schaffen, davon loszukommen. Wenn man es versucht und der Versuch schiefgeht, erhöht sich die Menge des täglichen Alkoholkonsums zusehends. Das hatte ich bereits am eigenen Leib erfahren, so soff ich nach gelegentlichen Pausen von wenigen Tagen immer mehr.
Meine Hausärztin, die eine Ärztin ist, wie sie im Buch steht, war erfreut, als ich ihr mein Alkoholproblem gestand. Sie sagte, dass ich den ersten großen Schritt, der am schwierigsten ist, getan habe. Das Eingestehen der Abhängigkeit hatte ich geschafft und mich geoutet. Sie war sichtlich froh, dass ihre mahnenden Worte so einen schnellen Erfolg herbeigeführt hatten. Sie hätte mich am liebsten sofort in eine Klinik geschickt. Sie wollte die Einweisungspapiere gleich fertig machen. Doch ich musste auf die Enthusiasmus-Bremse treten, da ich den Ärger mit meiner Krankenkasse schon witterte. Dennoch stand mein Entschluss fest. Ich musste etwas tun: eine Langzeittherapie!
Meinen Entschluss verkündete ich dann meiner Familie. Ich kann Ihnen sagen, die Zweifel waren nicht nur groß, sondern riesengroß. Meine Frau wollte es nicht so recht glauben, erst mit der Zeit, als ich mich wirklich intensiv um einen Reha-Platz bemühte, merkte sie, dass ich es ernst meinte. Warum hätte sie mir auch gleich Glauben schenken sollen? Schließlich hatte ich ihr schon des Öfteren versprochen, nichts mehr zu trinken, und es hatte jedes Mal in einer Enttäuschung für sie geendet.
Es sollte ein ewiger Schriftverkehr mit der Krankenkasse folgen – wie ich bereits geahnt hatte. Schließlich bekam ich von meinen Sachbearbeitern den Tipp, bei der Rentenversicherung nachzufragen, ob sie mir eine Reha genehmigen und die Kosten übernehmen würde. Ja, es war eine Zeit der Enttäuschungen, weil ich mich schon seelisch und moralisch auf die Therapie eingestellt hatte. Doch weil mein Entschluss feststand, machte ich mich auf den Weg, um alle nötigen Dinge in die Wege zu leiten. Außerdem saß ich einige Male in Eilenburg in der Suchtberatung, beschämt von meiner Sucht.
Nachdem mir alle Unterlagen von der Rentenversicherung und der Suchtberatung vorlagen, bekam ich den 20. April 2004 als Termin, an dem ich in die Soteria Klinik in Leipzig einmarschieren konnte.
Im Laufe der Zeit bin ich zu der Auffassung gelangt, dass ich mein Quantum an Alkohol in meinem Leben erreicht habe. Ich habe genug gesoffen. Wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, dass mir bewusst geworden ist, dass das Spiel mit dem ›Teufel Alkohol‹ aus ist. Finito! Aber wird es jemals richtig aus sein?
Ich hatte mich als Alkoholiker geoutet und brauchte meinen Stoff nicht mehr zu verstecken. Es ist nicht ratsam, ohne ärztliche Begleitung einen kalten Entzug zu machen. Denken Sie also nicht, dass ich in der Zeit von Jahresanfang bis zu diesem Zeitpunkt meinen Alkoholverbrauch reduziert hätte. Im Gegenteil! Es war eine – auch wenn es für manche unglaubhaft klingen mag – Art Abschiedssaufen. Ich habe jeden Tag mein Quantum meiner Familie gegenüber getrunken. Die Flasche Schnaps stand jetzt sichtbar in der Küche. Ich habe Alkoholiker kennengelernt, die mir dies bestätigten und denen es genauso erging. Andere haben sich am letzten Abend vor der Langzeittherapie noch einmal richtig die Sinne benebelt. Ob diese Variante zu einem sicheren Therapieerfolg beiträgt, ist sicherlich noch nicht erforscht worden. Selbst Therapeuten fanden diese Form des Abschiednehmens nicht verkehrt, denn getrunken hat man ja so oder so.
Jedenfalls bin ich diesem Hund heute noch dafür dankbar, dass er mir meine Grenzen aufgezeigt hat. Mein Leben wäre sicherlich anders verlaufen oder schon beendet, wenn ich so weitergemacht hätte.
Aufenthalt in der Soteria Klinik in Leipzig
Auf der Entgiftungsstation
Der erste trockene Tag sollte der 20. April 2004 sein. Ein Datum, das ich sicherlich nicht so schnell vergessen werde. Es war der Antritt meiner Entgiftung und anschließenden Langzeittherapie. Diese Therapie sollte sechzehn Wochen dauern. Ich brach sie am 18. Juni 2004 ab, weil mir der psychische Druck zu groß geworden war. Dennoch möchte ich meine Erlebnisse schildern. Ich möchte schildern, was ich erlebte und warum ich zu der Meinung gekommen bin, dass gerade eine Langzeittherapie von Vorteil ist.
Ich denke, wenn man die feste Absicht hat, sein Leben in Abstinenz zu verbringen, sollte man mit einer solchen Therapie beginnen. Man sollte sich aber bewusst machen, dass es wirklich nicht einfach ist. Ich durfte mir einige abfällige Bemerkungen anhören. Manche Leute sind der Meinung, eine Langzeittherapie sei ein schöner Kuraufenthalt. Diesen Leuten möchte ich gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Es ist harte Arbeit.
Wie erwähnt dauert diese Therapie sechzehn Wochen – nach neuestem Stand sind zwölf Wochen ausreichend – im Einzelfall kann die Therapie auf Antrag der Klinik beim Kostenträger verlängert werden. Es gibt ambulante Therapien, über die ich nicht urteilen kann, da sie mir nicht angeboten wurden. Ich lernte jedoch während meiner Therapie eine junge Frau kennen, die diese Form der Therapie begonnen hatte, sich nicht stabilisieren konnte und rückfällig wurde. Sie entschied sich nach dem ersten gescheiterten Versuch für eine vierwöchige Therapie in der christlichen Rehabilitationsklinik für Suchterkrankungen, in der auch ich später meine zweite Langzeittherapie absolvieren sollte. Diese Klinik heißt im Volksmund ›Punica Oase‹. Auch diese Maßnahme konnte ihr nicht helfen, sodass sie sich dann für eine weitere sechzehnwöchige Therapie entschied. Nach meinem Kenntnisstand ist sie seit einigen Monaten abstinent. Ich habe auch Alkoholiker kennengelernt, die es auf fünf Langzeittherapien gebracht haben. Wer weiß, ob sie es jemals schaffen, abstinent zu leben?
Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, was während meiner ersten Langzeittherapie schiefgelaufen ist. Es lag nicht an der Therapie oder den Therapeuten, denn diese waren in Ordnung. Ich konnte mich nicht richtig auf die Therapie einlassen, obwohl ich es wollte, und so brach ich sie ab.
Ich möchte erwähnen, dass sich die nachfolgenden Schilderungen auf Kliniken beziehen, in denen ich meine Erfahrungen sammelte. Was ich damit sagen möchte, ist: Was ich gut finde, muss einem anderen noch lange nicht gefallen.
Die Soteria Klinik in Leipzig hat den Ruf, dass dort sehr strenge Regeln gelten. Darum reißen sich auch nicht viele Alkoholiker um einen Therapieplatz in dieser Klinik. Meine zweite Langzeittherapie, die ich regulär beendete, verbrachte ich in einer christlichen Rehabilitationsklinik für Suchterkrankungen in der Nähe von Moritzburg. In dieser Klinik war der Therapieablauf vollkommen anders. Dort gab es auch Regeln, aber diese wurden nicht so streng gehandhabt. Es gibt Kliniken, in denen es noch deutlich gelassener zugeht als in dieser Klinik. Solche Informationen erhält man von den Patienten, die schon öfters eine Langzeitreha gemacht haben.
Über die Rückfallquote während und nach der Therapie in diesen Einrichtungen kann ich nur spekulieren. Für Außenstehende mag das schwer nachzuvollziehen sein.
Bevor ich mit meinen ausführlichen Schilderungen beginne, möchte ich noch erwähnen, dass einige Abläufe in den Kliniken im Nachhinein in einem anderen Licht gesehen werden müssen. Das ist bei mir der Fall, wenn ich an meine Erlebnisse in der Soteria Klinik zurückdenke. Meine Meinung über die christliche Rehabilitationsklinik werde ich wohl nicht ändern, da kann noch so viel Zeit vergehen.
Nun möchte ich aber meine erste Langzeittherapie schildern.
Es war also der 20. April 2004. Das Taxi war für 7.30 Uhr bestellt. Das Wetter passte zu meiner Stimmung: Es war nasskalt mit ein wenig Nieselregen. In mir herrschte eine Unruhe, die schwer zu beschreiben ist. Was erwartete mich? Ich hatte schlecht geschlafen, wie es sich für einen Alkoholiker wie mich, der in den letzten drei Monaten mindestens eine Flasche Klaren pro Tag in sich hineingeschüttet hatte, gehört. Ich zitterte und war nervös. Der Taxifahrer war nett, sodass wenigstens der Ansatz einer Unterhaltung zustande kam, was meiner Unruhe guttat. Er wusste genau, was los war, denn er kannte diese Klinik. Es war nicht das erste Mal, dass er jemanden dorthin brachte. Sicherlich hat er es mir auch angesehen. Ich weiß noch, dass er sagte: »Hinbringen darf ich euch, aber abholen nie.« Für die Heimreise wählte ich übrigens den Bus.
Da stand ich nun mit meinem Koffer und meiner Reisetasche. Ich war niedergeschlagen und hatte Angst. Angst vor dem Ungewissen.
Zuerst kam die Aufnahme, alle Formalitäten wurden geklärt. Das dauerte und meine Nervosität legte sich etwas. Mein Ausweis und das Bewilligungsschreiben wurden überprüft. Dann ging es auf die Entgiftungsstation. Empfangen wurde ich mit: »Einmal pusten, bitte!« Dann durfte ich erst einmal auf dem Flur Platz nehmen.
Ich hatte das volle Programm gebucht – sozusagen alles inklusive. Warum betone ich das? Ich hätte zuerst nur die Entgiftung machen können und nach einer Woche – so lange dauert in der Regel eine Entgiftungsbehandlung – noch einmal nach Hause fahren können, denn die Entgiftung gehört nicht zur Langzeittherapie. Als ich meine Therapie gebucht hatte, hatte ich mir jedoch gesagt: »Das musst du hintereinander durchziehen! Wenn es dir besser geht und du für eine Woche zu Hause bist, machst du möglicherweise doch noch einen Rückzieher.«
Heute kann ich sagen, dass diese Entscheidung, obwohl mein Kopf ganz schön benebelt war, die einzig richtige war. Das, was man schon während der Entgiftung von der Langzeittherapie mitbekam, hätte mich nur ermutigt, einen Rückzieher zu machen.
Nun war ich da und hatte einen Restalkohol von 0,5 Promille. Nachdem ich die Fragen nach Alter, Familienstand und so weiter beantwortet hatte, durfte ich mein Krankenzimmer betreten. Es war hell und sauber. Ein Pfleger begleitete mich. Nicht ohne Grund, wie sich schnell herausstellte, denn er startete eine intensive Taschenkontrolle. Oh, war der Mensch mir gleich unsympathisch. Er wühlte alles durch, bis zur letzten Ecke. Meinen ersten Eindruck von ihm musste ich aber bald korrigieren, denn der junge Mann war sehr nett wie das gesamte Pflegepersonal. Als nasser Alkoholiker sah ich viele Sachen ganz anders und hatte schnell Vorurteile. Der Pfleger machte ja nur seine Arbeit. Es gibt nun einmal Vorschriften in solch einer Klinik und diese müssen eingehalten werden. Ich machte die Erfahrung, dass es sich in der Entgiftungsstation um tolle Menschen handelte.
Jetzt saß ich da auf meinem Bett, mutterseelenallein, kein Mensch war mit mir in meinem Zimmer. Gegen Mittag lugte die Sonne hinter den Wolken hervor und es wurde schön. Mir kamen die ersten wehmütigen Gedanken, als ich aus dem Fenster schaute. Ich fragte mich, was ich hier machte. Im selben Atemzug kam mir aber die Erkenntnis, dass ich mir das alles selbst eingebrockt hatte. Ich sagte mir, dass ich ganz allein an dieser Situation schuld war. Mir wurde bewusst, dass ich es mit der Sauferei übertrieben hatte. Alle Gedanken daran, was ich jetzt zu Hause machen könnte oder würde, halfen nichts. Sicher hätte ich zu Hause wieder an der Flasche gehangen.
Dann war Mittag. Das Essen gab es auf dem Flur, wo ich zum ersten Mal mit anderen Patienten Kontakt hatte. Gegessen wurde jedoch auf dem Zimmer. Ich hatte keinen richtigen Appetit, ich weiß noch, es gab Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln. Ein Trost für mich war, dass es ein Telefon am Bett gab. Ich konnte Kontakt zu meiner Familie aufnehmen. Bevor ich mir eine Telefonkarte holen konnte, war allerdings wieder Pusten angesagt. Nur mit 0,0 Promille durfte man die Entgiftungsstation verlassen, um an den Kartenautomaten zu gelangen.
Ich war froh, als ich meine Karte hatte. Es war eigenartig: Ich war noch keine vierundzwanzig Stunden von zu Hause weg und schon tat sich in mir eine Gefühlswelt auf, die ich schon lange nicht mehr erlebt hatte. Ich fühlte mich einsam und verlassen. Oder war es nur das Verlangen nach alten Gewohnheiten? Nach Alkohol, den ich zu dieser Tageszeit schon zur Genüge in mir gehabt hätte? Mit ihm wäre ich sicher nicht in diese Gefühlsduselei verfallen.
Am späten Nachmittag konnte ich dann endlich telefonieren und freute mich, die Stimmen meiner Frau und meiner Tochter zu hören. Das Telefonat heiterte mich auf.
Dann kam der Abend und die Nacht und ich vermisste die Personen, die sich am häufigsten über mein Trinkverhalten geärgert hatten. Die Menschen, deren Gefühle ich mit Füßen getreten hatte. Es war eine schlaflose Nacht, was aber nicht weiter schlimm war, denn am nächsten Tag war noch genug Zeit zum Schlafen. Außer der ärztlichen Untersuchung lag nichts weiter an.
Auch den zweiten Tag ohne Alkohol schaffte ich. Komisch, auch ohne Alkohol ging das Leben weiter und ich fühlte mich körperlich nicht einmal so schlecht. Ja, im Gegensatz zu anderen Patienten ging es mir sehr gut, das war offensichtlich.
Heute stand eine Ultraschalluntersuchung an. Wieder hatte ich eine schlaflose Nacht durchlebt, in der mir alle möglichen Untersuchungsergebnisse durch den Kopf gegangen waren. Bis zur Untersuchung war ich so nervös, dass ich nichts mit mir anzufangen wusste. Ich hatte mich im Vorfeld über Schäden, die das Saufen – und ja, ich hatte in letzter Zeit besonders viel gesoffen – anrichten konnte, informiert. Leberzirrhose, dieses Wort hatte sich besonders in meinen Gedanken festgesetzt. Genau wie damals nach dem Bluttest bei meiner Hausärztin.
Ich hatte das Wort Leberzirrhose so oft gehört, aber dennoch hatte es mich nie vom Alkoholmissbrauch abgehalten. War Leberzirrhose mit dem sicheren Tod in absehbarer Zeit gleichzustellen? Eine Spenderleber zu bekommen, war nach Informationen aus Presse und Rundfunk hoffnungslos. Die Wartelisten waren schon zum Brechen voll. Und wenn ja, würde mein Körper diese Leber annehmen? Das alles waren Fragen, die durch meinen Kopf schossen. Je näher der Termin kam, umso mehr Angstschweiß machte sich auf meiner Stirn breit. Abhauen oder Wegrennen würde nichts helfen. Die Tatsachen würden sich nicht ändern.
Der Untersuchungstermin kam. Ein innerliches Aufatmen nach der Diagnose: Fettleber. Das war nicht so bedenklich und für mein Übergewicht normal, sagte mir der Arzt. Ich schaute auf einmal viel glücklicher in die Welt.
Im Laufe des Nachmittags kam dann der Pfleger in mein Zimmer. Ich war noch immer allein und in Gedanken zu Hause. Er machte seinen Rundgang und so kamen wir ins Gespräch. Am Ende unseres Gesprächs – das weiß ich noch genau – sagte er: »Mensch, Sie sind doch kein Dummer. Denken Sie über Ihre Sucht nach. Da hinten auf dem Flur steht ein Hometrainer, machen Sie sich da drauf und bewegen Sie sich etwas, dabei kann man gut nachdenken!« Der Mensch, der mir vor zwei Tagen durch seine Taschenkontrolle unangenehm geworden war, wurde mir sympathisch. Das Pflegepersonal auf dieser Station hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, was wirklich über den einen oder anderen seelischen Schmerz hinweggeholfen hat. Noch heute frage ich mich, wie sie es schafften, so freundlich und hilfsbereit zu bleiben. Man muss diese Leistung erst erkennen, um sie wertschätzen zu können.
Im Laufe meines Aufenthaltes entwickelte sich ein angenehmes, freundliches Miteinander, das bis heute anhält. Die Bestätigung erhalte ich durch meine Besuche in der Klinik, die ich dann und wann, wenn ich einmal wieder in Leipzig bin, gern mache.
Am Freitag sollte ich auf die Aufnahmestation des Langzeitbereiches verlegt werden. Das lehnte ich ab. Ich wollte am Wochenende Besuch empfangen können. Ich trug meinen Wunsch der Ärztin vor und durfte noch über das Wochenende auf der Entgiftungsstation bleiben. So änderte sich das: Auf einmal wollte ich die Menschen wiedersehen, die vor noch nicht allzu langer Zeit, wenn wieder einmal dicke Luft gewesen war, doch nur ›Schlechtes‹ in meinen Augen gewollt hatten. Ich freute mich auf den Besuch und sah dem Sonntag voller Erwartung entgegen.
Der Sonntag kam und aus welchen Gründen auch immer sollte nicht die richtige Stimmung aufkommen. Es waren Kleinigkeiten, die dazu führten, dass eine gewisse Spannung entstand. Es ging um Kleidungsstücke und Handtücher, die ich dabehalten sollte, aber nicht wollte – also um Nichtigkeiten. Erst später erkannte ich die Ursachen dafür. Auf beiden Seiten hatte sich eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut, die an die Zeit zu Hause erinnerte. Die Besucherseite war natürlich enttäuscht, war sie doch in der Hoffnung angereist, einen schon veränderten Menschen anzutreffen, der nun doch gefälligst erkennen sollte, dass das alles nur gut gemeint gewesen war. Der Suchtkranke hingegen sah es aus einem anderen Blickwinkel. Er sah sich als ›schwarzes Schaf‹, das wieder in die Enge getrieben werden sollte. Das seine eigenen Ansichten nicht vertreten durfte und gefälligst machen sollte, wie ihm geheißen wurde. Wenn man in so eine Situation gerät, empfehle ich, die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen, um dann lieber einige Momente der Ruhe zu genießen. Denn auch Ruhe kann angenehm sein, gerade weil auf Seiten des Alkoholikers ein Schamgefühl vorhanden ist. Insbesondere jetzt, da er nüchtern ist. Er hat keine Möglichkeit, Zuflucht im Alkohol zu suchen, um dieses Gefühl zu umgehen, ja abzutöten, sozusagen wegzusaufen. Das hatte er in der Vergangenheit ja schon getan und es hatte gut funktioniert.
Bedenken Sie bitte: Der Alkoholiker in der Klinik muss wieder lernen, mit Gefühlen umzugehen, die ihm im Laufe seiner Trinkerkarriere verloren gegangen sind. So war es nicht gerade eine schöne Besuchszeit, das empfanden wir alle so. Meine Frau fuhr sichtlich enttäuscht mit den Kindern weg. Ich war mir sicher, dass sie sich wieder über mich ärgerten. Ich suchte nach einem Vorwand, um meine Frau auf dem Handy meiner Tochter anzurufen. Sie waren noch nicht so weit weg, sodass sie wendeten und noch einmal kurz zurückkamen. Wir wechselten einige Worte, um den verunglückten Abschied etwas geradezurücken. So konnten wir den Sonntagnachmittag doch noch retten.
Ich hatte noch nie zuvor in meinem Leben auf einem Hometrainer gesessen. Doch hier schlossen das unbewegliche Fahrrad und ich Freundschaft für den Rest meines Klinikaufenthaltes. In den Tagen auf der Entgiftungsstation quälte ich den Hometrainer regelmäßig. Durch meine längeren Aufenthalte auf dem Flur sah ich meine Mitpatienten nun genauer. Vorher hatte ich sie immer nur flüchtig bei den Mahlzeiten gesehen, sodass ich die weitreichenden Ausmaße ihrer Alkoholabhängigkeit noch nicht erkannt hatte.
Es wurde mir wieder einmal klar, dass es mit meinem Gesundheitszustand viel, viel schlimmer hätte kommen können. Wenn man diese Menschen als Außenstehender mit eigenen Augen sehen könnte, würde man wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Man kann sich kaum ausmalen, welche Ausmaße der Missbrauch von Alkohol annehmen kann. Wie der Alkohol einen Menschen zum Wrack werden lässt. Während ich auf dem Hometrainer radelte, huschte einmal eine Frau mit einem Veilchen schamhaft über den Flur ins Raucherzimmer, das nur zu festgelegten Zeiten geöffnet war. Ich habe Frauen und Männer gesehen, die sich an der Wand festhalten mussten, um mit kleinen, seitlichen Trippelschritten in das Raucherzimmer zu gelangen. Ich habe in ihre von Sturzwunden gezeichneten Gesichter mit Hautabschürfungen blicken müssen. Wunden, die mit Pflastern und Binden versorgt waren, waren noch das Geringste.
Da ich den Hometrainer auch nach meinem Aufenthalt auf der Entgiftungsstation weiter benutzen durfte, stellte ich fest, dass es oft dieselben Gesichter waren, in die ich blicken durfte. Sie hatten ihren Aufenthalt für ein oder zwei Wochen unterbrochen.
Auf dem Hometrainer war ich auch des Öfteren Augenzeuge, wenn ein Patient mit dem Rettungsdienst eingeliefert wurde. Für Menschen, die noch nie gesehen haben, welches menschliche Elend auf solch einer Station herrscht, ist es unvorstellbar. Erwachsene Männer und Frauen sind fertig mit der Welt, hilflos, am Ende. Einige dieser Menschen mussten zum Teil am Bett fixiert werden. Sie hatten Krampfanfälle. Andere mussten gewindelt werden. Sie konnten die normalsten Körperfunktionen nicht mehr steuern. Durch die fortgeschrittene Leberschädigung war ihre Hautfarbe dunkelgelb und die Augen gelb. Ich konnte diesen Menschen nicht in die Augen blicken, denn mir kamen dabei die Tränen. Es ist schwer für mich, dieses Elend zu beschreiben. Man muss es gesehen haben, um die abschreckende Wirkung zu verstehen. Vielleicht würde es Sinn machen, wenn Schüler der neunten und zehnten Klassen einen Abstecher in solch eine Einrichtung machen, um mit eigenen Augen zu sehen, was der Alkohol aus einem Menschen machen kann. Vielleicht würde das etwas bewirken.
Das Elend, das ich beschreibe, habe ich nicht nur in der Soteria Klinik gesehen. Auch in der Psychiatrie in Wermsdorf gab es eine Entgiftungsstation. Jeden Montag gingen wir dort zum Suchtseminar. Auch wenn es nicht zu den Erlebnissen während meiner Langzeittherapien gehört, möchte ich es dennoch kurz schildern. Diese Suchtseminare haben mir persönlich sehr viel gegeben.
Das Seminar hielt ein junger Stationsarzt. Dieser Arzt konnte jedem Patienten alles über Symptome von Folgeerkrankungen der Sucht und was sich genau im Körper abspielte erklären. Er strahlte dabei eine tiefe Ruhe aus und erläuterte die Sachverhalte so bildlich, dass man sie genau verstand. Er erklärte uns auch die Leberzirrhose, die für zwei Patienten, die ich kennengelernt hatte, Wirklichkeit war.
Wie entsteht diese Erkrankung? Ich möchte versuchen, mit meinen eigenen Worten wiederzugeben, was uns dieser junge Arzt erklärt hat. Die Leber ist das Organ in unserem Körper, das die Giftstoffe – also auch den Alkohol – aus unserem Blut wäscht. Durch übermäßigen Alkoholkonsum schwillt die Leber an und auf ihrer Oberseite entstehen Risse. Diese verheilen wieder und bilden Narben. Um diese Narben herum entsteht ein festes Gewebe. Durch den anhaltenden Alkoholmissbrauch entstehen immer mehr dieser Narben und es kommt zu einem Narbengeflecht auf der Leber. An diesen Stellen der Leber können die Leberzellen nicht mehr arbeiten, um zur Entgiftung beizutragen. Weitere Schäden in unserem Körper sind vorprogrammiert. Durch das Zusammenziehen der vernarbenden Wunden auf der Leber wird aus der angeschwollenen Leber eine Schrumpfleber (Leberzirrhose). Die Oberfläche der Leber wird dadurch im Laufe der Zeit immer fester und kleiner. Ein weiteres Übel ist, dass die Leber selbst keine Schmerzsignale an unser Gehirn sendet, sodass wir eine Lebererkrankung schlecht erkennen können. Ein Erkennungsmerkmal sind mögliche Schmerzen durch direkten Druck auf die geschwollene Leber. Diese Schmerzen spürt man unter dem rechten Rippenbogen. Ein weiteres Indiz für Leberfunktionsstörungen ist die Verfärbung der Haut und der Augen ins Gelbliche.
Ich lernte zwei Patienten mit Leberzirrhose in der Soteria Klinik kennen. Einer von ihnen sollte mit der Auflage, im Vorfeld eine Langzeittherapie durchzuführen, eine Spenderleber bekommen. Die Therapie brach er nach drei Wochen hoffnungslos ab. Er hatte den Kampf aufgegeben. Das machte mich nachdenklich, denn in der ersten Zeit war er sehr zuversichtlich gewesen, was die geplante Lebertransplantation betraf. Er verabschiedete sich mit Tränen in den Augen und den Worten: »Ich schaff es nicht mehr!«
Bei der zweiten Person handelte es sich um eine Frau, die Leberzirrhose im Anfangsstadium hatte. Da ich meine Therapie vorzeitig abbrach, verlor ich sie aus den Augen und kann nur hoffen, dass es ihr gut geht.
Diese Menschen taten mir leid, aber hatten sie sich nicht auch selbst dahin gebracht? Genau wie ich! Zumindest sagte ich mir das damals.
Ja, ich muss sagen ›damals‹, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich bei Weitem noch nicht so mit der Alkoholsucht auseinandergesetzt, wie ich es danach tat. Jeder muss sein eigenes Leben betrachten. Es war mir damals noch nicht bewusst, aber genau das war ja die Aufgabe während der Therapie. Sich über sein eigenes Leben Gedanken zu machen. Was war? Und was sollte noch kommen? Mit diesen Fragen sollte ich mich auseinandersetzen, anstatt mir Gedanken über andere Patienten zu machen.
Auch die Patienten, denen es viel schlechter ging als mir, erholten sich mit der Zeit, sodass sie wieder halbwegs normal laufen konnten. Wieso halbwegs? Es gibt Alkoholiker, bei denen die Nerven in den Beinen oder Händen abgestorben sind. Da die Nerven schon so in Mitleidenschaft gezogen sind, dauert es sehr lange, bis sie sich wieder regeneriert haben. So können diese Patienten schlecht ihr Gleichgewicht halten. Das erkennt man an dem breit gesetzten Schritt, die Füße zeigen auffällig nach außen. Dem nassen Alkoholiker fällt dies kaum auf. Sicher wird er eine Veränderung feststellen, diese aber durch seinen immer wiederkehrenden Rausch nicht mehr richtig einordnen können. Er betäubt seine körperlichen Schmerzen mit Alkohol. Spürt die langsam dahin schleichende Veränderung im Körper nicht. Hinzu kommt die medizinische Unwissenheit darüber, was sich da im Laufe der Zeit in seinem Körper abspielt. Es ist seinem körperlichen Desinteresse geschuldet, dass er in diesem Suchtstadium nicht mehr registrieren will, was sich da mit der Zeit verschlechtert. Es kann sogar so weit kommen, dass der Alkoholiker nicht mehr laufen kann. Wenn der Alkoholiker dann einige Zeit trocken lebt, beginnen sich diese feinen Nervenbahnen zu regenerieren. Dies ist mit Schmerzen verbunden. Die Nervenbahnen bauen sich langsam wieder auf. Alkoholiker, die diese Erfahrung durchmachen mussten, beschreiben dieses Gefühl unterschiedlich. Es kann als Kribbeln, Stechen, Ziehen oder Brennen wahrgenommen werden.
Auf der Aufnahmestation der Langzeittherapie
Kommen wir aber zurück zu meinem Aufenthalt in der Soteria Klinik. Der Montag kam und ich durfte in die Aufnahmestation für die Langzeittherapie einziehen. Diesmal hatte ich einen Zimmerpartner – auch Raumteiler genannt – der am Mittwoch in den Langzeitbereich wechselte. Ich sollte dann gleich wieder einen neuen Raumteiler bekommen. Er hieß Reiner und wir freundeten uns schnell an.
Da ich mich gut an das Pflegepersonal auf der Entgiftungsstation gewöhnt hatte, fiel mir der Umzug schwer. Am ersten Tag war wieder alles neu: neue Pfleger, neue Ärzte, neue Mitpatienten. Der einzige Vorteil war, dass die Mitpatienten alle aus demselben Grund hier waren wie ich. Sie alle waren Alkoholiker oder Mehrfachabhängige – Mehrfachabhängige wurden in der Soteria Klinik die Patienten genannt, die alkohol- und medikamentenabhängig waren.
Ich hatte diese Langzeittherapie aus eigenem Antrieb begonnen. Einige andere hatten diese Maßnahme unter Auflage antreten müssen. Hier konnte ich also schon Unterschiede bei der Einstellung zur Therapie sowie beim Gesundheitszustand erkennen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal war die Anzahl der bereits absolvierten Therapien. Einige Mitpatienten waren die ›alten Hasen‹, die ›Erfahrenen‹, von denen ich einige schon auf der Entgiftungsstation kennengelernt hatte.
Auf der Aufnahmestation begann dann die kontaktarme Zeit. Sicher werden Sie sich jetzt fragen, wieso es eine kontaktarme Zeit gab. Bis man von der Aufnahmestation in den Rehabereich wechseln konnte, bestand der Kontakt zu Familie und Freunden nur schriftlich. Vielleicht denken sich einige Leser nun, dass man ja immer noch sein Handy hatte. Nichts da! Das Handy wurde einem bereits bei der ersten Taschenkontrolle abgenommen.





























