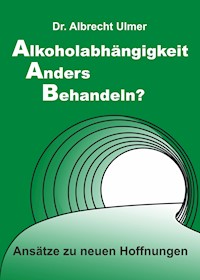
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alkoholabhängigkeit gehört weltweit zu den schwersten chronischen Krankheiten. Die Behandlungsmöglichkeiten sind oft enttäuschend - seit Jahrzehnten wenig Fortschritte. Dabei gibt es vielversprechende Ansätze. Für Dr. Ulmer, von 1984 bis Ende 2018 mit mehreren Kollegen in eigener Praxis in Stuttgart, wurde die schlimme Realität zum Impuls, Neues zu erproben. Er wurde Gründungsmitglied und langjähriges Vorstandsmitglied der Dt. Gesellschaft für Suchtmedizin, gleichzeitig aktives Mitglied mehrerer internationaler Fachgesellschaften im Bereich Suchtforschung. Heute verfügt er über eine der größten, systematischen Praxisdokumentation der Welt. Zusammen mit seinem Team ist es ihm über Jahrzehnte gelungen, Ansätze für eine viel effektivere Behandlung von Alkoholabhängigen zu entwickeln. Eine Reihe verzweifelter Schicksale konnten so gewendet werden. Das Buch stellt diese Ansätze vor - nicht zur direkten Nachahmung, dafür sind sie noch nicht genug entwickelt und dann zu gefährlich. Aber zur Anregung der Diskussion und natürlich als Beitrag zur weiteren Entwicklung. Dafür steht auch das Institut für Suchtforschung am Ort seiner früheren Praxis. Basierend auf langjähriger, praktischer Erfahrung blickt das Buch auf vielfältige Aspekte der Sucht, ihrer Therapie und der Forschung - eine wahre Fundgrube. Es wird Ihren Blick auf die Alkoholabhängigkeit wahrscheinlich ein Stück verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Albrecht Ulmer
Alkoholabhängigkeit
Anders
Behandeln?
Ansätze zu neuen Hoffnungen
Im Text und vielen Abbildungen werden die Geschichten von Menschen vorgestellt, die sich uns mit ihrer Alkoholabhängigkeit anvertraut haben. Sie alle haben ein selbstverständliches Recht darauf, dass ihre Geschichte vertraulich bleibt. Darauf haben sie vertraut, und das habe ich auch zugesichert. Als Arzt unterliegt man ja der Pflicht zu schweigen. Ich habe deshalb für die Sache unwesentliche Details wie z.B. die Initialen und unverwechselbare Kleinigkeiten um des Datenschutzes willen minimal verändert. Einzelne Patienten haben einer Schilderung und z.B. ihrer Abbildung dezidiert zugestimmt.
Insgesamt gebührt allen, die in diesem Buch beschrieben werden, von vornherein eine besondere Achtung. Sie waren ausnahmslos mit ihrer Krankheit schwer belastet. Praktisch alle haben einen Kampf führen müssen, den man sich ohne diese Krankheitslast kaum vorstellen kann, haben endlos Vorwürfe, Zurückweisungen und eigene Schuldgefühle ertragen müssen. Ihr Selbstbewusstsein konnte selten das eines Menschen ohne Suchtkrankheit sein. Aber mit ihrer bewundernswerten Offenheit und Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, haben sie wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Buch viele neue Perspektiven aufzeigen kann. Deshalb sollte das Buch auch mit einer ständigen Dankbarkeit diesen Suchtkranken gegenüber gelesen werden.
Copyright: © 2021 Dr. med. Albrecht Ulmer – [email protected] – 01743133525 Lektorat: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlag & Satz: Erik Kinting
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-38380-7 (Paperback)
978-3-347-38381-4 (Hardcover)
978-3-347-38382-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Buch soll allen gewidmet sein, die von Problemen durch den Genuss von Alkohol betroffen sind. Insbesondere meinen Patientinnen und Patienten, von denen viele hier vorgestellt werden, Verzweifelten wie Erfolgreichen. Einigen konnte ich helfen, viel zu vielen auch nicht, oder nur teils. Zu den stark Betroffenen gehören auch alle Angehörigen. Ihnen sei dieses Buch ausdrücklich genauso gewidmet.
In großer Dankbarkeit möchte ich dieses Buch schließlich allen MitstreiterInnen, Kolleginnen und Kollegen widmen, von denen ich entscheidende Anregungen für die hier vorgestellten Ansätze erhalten habe.
Inhaltsverzeichnis
1 Zusammenfassung des ganzen Buches
1.1 Verrücktes?
1.2 Die Bedeutung der Alkoholabhängigkeit
1.3 Alkoholabhängigkeit als chronische Krankheit
1.4 Ganz andere Behandlung als bei anderen chronischen Krankheiten
1.5 FASD – Schlimme Folgen von Alkohol während der Schwangerschaft
1.6 Unterschiedliche Wahrnehmung in Praxis und Forschung?
1.7 Fehlende medikamentöse Einstellung
1.8 Genau hinschauen, Erfahrungen und Publiziertes nutzen
1.9 Stimmt es? Ist es wissenschaftlich? Das muss es werden
1.10 Auf die Art des Einsatzes kommt es an
1.11 Kein Geld für Studien über „billige“ Ideen aus der Praxis?
1.12 Ein Forschungssystem für Ideen und Fragen aus der Praxis?
1.13 Ambulante Alkoholentzüge
1.14 Agonistische Substanzen
1.15 Clomethiazol im ambulanten Alkoholentzug
1.16 Clomethiazol längere Zeit
1.17 Einnahme nach Plan statt nach Bedarf
1.18 Dihydrocodein (DHC)
1.19 Weitere Opioide
1.20 Baclofen
1.21 Weitere Substanzen
1.22 Alkoholabhängigkeit bei agonistischen Opioidabhängigkeitstherapien
1.23 Agonistische Therapieansätze während der Schwangerschaft
1.24 Organisation und Haltung
1.25 Unterm Strich
2 Einleitung
2.1. Die Dimension
2.2. Einzelschicksale
3 Therapeutischer Standard
3.1. Was die Leitlinie sagt
3.2. Medikamente?
3.2.1 Acamprosat
3.2.2 Disulfiram
3.2.3 Naltrexon und Nalmefen
3.2.4 Baclofen
4 Kleiner Blick in die Forschungslandschaft
4.1 Forschung in unterschiedlichen Dimensionen – am Beispiel HIV / AIDS und Alkoholabhängigkeit
4.1.1 Forschung und Vernetzung bei HIV / AIDS
4.1.2 Forschung und Vernetzung für Suchtkranke
4.2 Nicht nur Suchtkranke sind abhängig – die Forschung ist es auch
4.3 Forschung aus der Praxis
5 Forschung in der Praxis? Möglichkeiten der Dokumentation
5.1 Anamnese
5.2 Körperliches
5.3 Buchführungen
5.4 Therapeutische Einschätzung
5.5 Grafische Darstellung
5.6 Vernetzung
5.7 Was wir dokumentieren konnten
6 Das Erschließen neuer Dimensionen
6.1 W A R N U N G
6.2 Ambulante Entzüge
6.2.1 Warum erschließt das neue Dimensionen?
6.2.2 Strukturell – organisatorische Fragen
6.2.3 Sorgfältiges Abwägen
6.2.4 Ein leicht zu lernendes Schema
6.2.5 Fünf Sprechstunden in acht Tagen
6.2.6 Zuteilung der Medikamente
6.2.7 Die Rolle der Apotheke bei diesem Vorgehen
6.2.8 Welche Medikamente? Ausgezeichnete Erfahrungen mit Clomethiazol
6.2.9 Eigene Zahlen
6.2.10 Fazit
6.3 Clomethiazol
6.3.1 Vor Jahrzehnten Entscheidendes versäumt worden
6.3.2 Bedenken bei ExpertInnen
6.3.3 Richtig eingeführt und verordnet eine unverzichtbare Substanz
6.3.4 Nach dem Entzug weiterbehandeln
6.3.5 Möglichen Gefahren mit einer Gewissenhaftigkeitsstruktur vorbeugen
6.3.6 Nach Plan statt nach Bedarf
6.3.7 Behandlung mit agonistischen Substanzen
6.3.8 Langfristiger Clomethiazol-Einsatz
6.3.9 Clomethiazol als Kombinationssubstanz
6.3.10 Zusammenfassung
6.4 Dihydrocodein
6.4.1 Einiges, was vorweg bedacht sein muss
6.4.2 Wie kommen wir auf DHC?
6.4.3 Was wir rezeptieren
6.4.4 Einzelne Patienten
6.4.5 Praktische Hinweise
6.4.6 Statistiken
6.5 Buprenorphin
6.5.1 Eigene Erfahrungen – Kleiner statistischer Überblick
6.5.2 Drei mit der Buprenorphinbehandlung erfolgreiche PatientInnen
6.6 Baclofen
6.6.1 Was es schon an wissenschaftlichen Publikationen gibt
6.6.2 Eigene Erfahrungen
6.6.3 Einzelne PatientInnen
6.6.4 Erste Zwischenbilanz
6.6.5 Nicht immer hatten wir so schöne Buchführungen
6.6.6 Kleiner Überblick über unsere Gesamterfahrungen mit Baclofen
6.6.7 Unser persönliches Baclofen-Fazit
6.7 Cannabis
6.7.1 Der Patient, dem wahrscheinlich Cannabis geholfen hat, vom Alkohol wegzukommen
6.7.2 Cannabis als mögliches Mittel, um vom Alkohol wegzukommen?
6.7.3 Gibt es denn schon Hinweise aus der Literatur ?
6.7.4 Unser persönliches Cannabis-Fazit für eine Behandlung der Alkoholabhängigkeit
6.8 Weitere Substanzen
6.8.1 GHB
6.8.2 Amphetamine
6.8.3 Benzodiazepine ?
6.9 Spezialproblem: Alkoholabhängigkeit bei agonistischer Opioidabhängigkeitstherapie (AOT, Substitutionsbehandlung)
6.10 Alkoholabhängigkeit und Schwangerschaft
6.11 Fehler vermeiden
6.11.1 Vernetzung statt Alleingang
6.11.2 Süchtige PatientInnen nie allein lassen
6.11.3 Vorzeigbarkeit
6.11.4 Ernsthaftigkeit
7 Wie wird eine realistische Hoffnung daraus?
7.1 Forschung
7.2 Standardisierung
7.3 Struktur
7.3.1 Rahmenbedingungen
7.3.2 Behandlungsstruktur
7.3.3 Finanzielle Investitionen
7.4 Unsere Haltung
7.4.1 Ärztliche Selbstverpflichtung
8 Literatur
9 Stichwortverzeichnis
10 Abbildungsverzeichnis
1 Zusammenfassung des ganzen Buches
Das Buch ist umfangreich, aber Sie wollen sich schnell orientieren. Dafür fasse ich hier alles Wesentliche zusammen. Sollten Sie dann denken: Das scheint interessant, so möchte ich Sie einladen, es nicht allein bei dieser Zusammenfassung zu belassen. Sie wissen dann zwar das Wesentliche, aber der eigentliche Text ist natürlich ungleich eingehender und facettenreicher. Er verweist auch auf die Quellen für die Aussagen und ist eine Fundgrube für zahllose Anregungen aus jahrzehntelanger Praxis. Es geht nicht nur um ein Anders Behandeln, sondern auch um eine neue Sicht auf die Krankheit. Lassen Sie sich also mit diesen ersten Seiten zum Weiterlesen anregen.
Falls Sie dann das ein oder andere Kapitel nur orientierend lesen wollen, finden Sie in jedem Kapitel ein paar Kern- oder Merksätze. So können Sie, wenn Sie wollen, manches schneller lesen oder auch Stellen leichter wiederfinden.
1.1 Verrücktes?
Manches in diesem Buch werden Sie vielleicht erstmal verrückt finden. Aber bleiben Sie trotzdem dran. Dann werden Sie bald zum Schluss kommen, dass es – gerade umgekehrt – verrückt ist, das als verrückt abzutun.
1.2 Die Bedeutung der Alkoholabhängigkeit
Alkoholabhängigkeit ist eine der verbreitetsten und bedeutendsten Krankheiten weltweit, mit mehr als drei Millionen Toten jedes Jahr eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt. Viele Betroffene und ihre Angehörigen können ein Lied davon singen, wie furchtbar diese Krankheit zuschlagen und wie viel Leben sie zerstören kann. Dieses Buch stellt etliche Einzelschicksale mit bedrückend schlimmem Verlauf vor.
1.3 Alkoholabhängigkeit als chronische Krankheit
In ihrer Schwere und ihrem Verlauf ist die Alkoholabhängigkeit mit anderen großen chronischen Krankheiten wie z.B. Diabetes und hohem Blutdruck vergleichbar. Sie hat meist einen schleichenden Beginn, eine unscharfe Grenze zwischen „noch normal“ oder „schon krankhaft“, der Verlauf weist phasenweise Verschlimmerungen auf, und in vielen Fällen gibt es akute, krisenhafte Zuspitzungen. Auch darin, dass man die Krankheit eher selten wieder loswird, und in der schweren Beeinträchtigung der Lebenserwartung kann man Parallelen zu den anderen chronischen Krankheiten sehen.
1.4 Ganz andere Behandlung als bei anderen chronischen Krankheiten
Es gibt aber einen fundamentalen Unterschied: Die Art der Behandlung. Das Gros der Menschen mit Diabetes und Hypertonie wird kontinuierlich medizinisch betreut. Solange es noch keiner Medikamente bedarf, beschränkt man sich auf Modifikationen von Ess- und Lebensgewohnheiten, und kontrolliert die Entwicklung regelmäßig. Die meisten brauchen aber über kurz oder lang eine medikamentöse Einstellung. Dann sind sie kontinuierlich bei ihrer Hausärztin / ihrem Hausarzt in Betreuung, oft im Verbund mit einem Facharzt (w/m). Der Erfolg ist beeindruckend. Es gelingt weitgehend, Lebensqualität und Lebenserwartung der von Nicht-Erkrankten anzugleichen. Den meisten Erkrankten merkt man ihre Erkrankung nicht an. Sie können „wie normal“ leben und arbeiten, und genauso alt werden wie andere.
Für die Krankheit von Alkoholabhängigen dagegen gibt es praktisch keine medikamentöse Einstellung und damit auch keine kontinuierliche medizinische Betreuung. Sie bleiben die allermeiste Krankheitszeit ohne therapeutische Hilfe. Bei unseren PatientInnen waren das, bevor sie zu uns kamen, etwa 97% der Verlaufszeit. Normalerweise muss die Behandlungsintensität ja zunehmen, wenn die Krankheit sich verschlimmert. Aber je mehr jemand schon ein zwei drei „Therapien“ hinter sich hat und vielleicht schon wiederholt zum Alkoholentzug in der Klinik war, desto mehr wird sie/er zum „aufgegebenen Fall“. Das Gros der Entlassungen nach einem stationären Entzug erfolgt de facto in die Nichtbehandlung. Keine medikamentöse Einstellung, keine weitere Betreuung, die der / dem Abhängigen zu einer effektiven Linderung oder Überwindung hilft wie bei den anderen chronischen Krankheiten. Kein Wunder, dass sich furchtbar schwere Verläufe häufen und die Lebenserwartung immer noch um 20 Jahre verkürzt ist, unabhängig davon, ob eine „Therapie“ mitgemacht wurde oder nicht.
1.5 FASD – Schlimme Folgen von Alkohol während der Schwangerschaft
Ganz schlimm sind die Folgen von Alkohol während der Schwangerschaft. Die dadurch bewirkte, lebenslange, schwere Behinderung mit der Abkürzung FASD ist weltweit die häufigste Entwicklungsstörung.
1.6 Unterschiedliche Wahrnehmung in Praxis und Forschung?
Das alles sind skandalöse Fakten und Schicksale. Es darf nicht so bleiben. Dass sich dringend etwas ändern muss, sieht man möglicherweise mehr in einer spezialisierten Praxis, wo man aus der konkreten Not heraus mit neuen Behandlungsansätzen experimentiert, als an spezialisierten, forschenden Zentren, die sich an hochrangig publizierten Studien orientieren. In der Leitlinie zur Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen, die das wissenschaftliche Wissen der Zeit zusammenfasst, zeichnet sich keine power für entsprechende, durchgreifende Verbesserungen ab.
Wenn man sich in der Praxis auf die Behandlung von Alkoholabhängigen spezialisiert wie andere ÄrztInnen z.B. für Menschen mit Diabetes oder Herzkrankheiten, dann wird man geradezu davon erdrückt, wie schlecht diese Krankheit zu behandeln ist. Es gibt wenige zugelassene Medikamente zur medikamentösen Behandlung der Alkoholabhängigkeit. Sie sind alle wenig effektiv und spielen in der Praxis so gut wie keine Rolle. Kaum einer unserer 539 PatientInnen war in über 18 Jahren Vorgeschichte je damit behandelt worden!
1.7 Fehlende medikamentöse Einstellung
Halten wir also fest: DiabetikerInnen und Menschen mit hohem Blutdruck können dank einer kontinierlichen medikamentösen Einstellung weithin wie Gesunde leben. Alkoholabhängige aber, bei denen keine medikamentöse Einstellung erfolgt, leiden vielfach unter gravierenden Abweichungen. Offensichtlich bedingt gerade das Fehlen einer medikamentösen Einstellung diesen Unterschied. Die Ergebnisse unserer Behandlungsansätze, die ich in diesem Buch vorstelle, bestätigen genau das. Das heißt umgekehrt: Mit einer effektiven medikamentösen Einstellung können wir die Lebensqualität und die Lebenserwartung vieler sonst verzweifelter Alkoholabhängiger der von Gesunden ähnlich annähern wie bei anderen chronischen Krankheiten. Wir können also die Effektivität der Behandlung erheblich steigern.
Wie das gehen kann, wollen wir hier aufzeigen.
1.8 Genau hinschauen, Erfahrungen und Publiziertes nutzen
Prinzipiell kommt man schon entscheidend weiter, wenn man sehr genau hinschaut, was Suchtkranke äußern, was sie bewegt, quält und was sie brauchen. Allein daraus lässt sich viel lernen. Bringt man das zusammen mit eigener Erfahrung und der von Suchtspezialisten (w/m) in aller Welt sowie mit einer Menge an bereits Publiziertem, so ergeben sich ganz neue Ansätze. Mit denen kann man, wenn man sie behutsam und systematisch verfolgt, das Tor zu einer ungleich effektiveren Behandlung aufstoßen.
Das will näher erläutert sein. Unsere Praxis hat auf diese Weise eine Reihe von ersten Ansätzen für eine Behandlung von Alkoholabhängigen entwickeln können, die sich bei vielen als ungleich effektiver erwiesen hat als der etablierte Behandlungsstandard.
1.9 Stimmt es? Ist es wissenschaftlich? Das muss es werden
Ein berechtiger, ständiger Einwand dagegen lautet: Da war keinerlei wissenschaftliche Studie – fehlt noch jede Evidenz. Nur so aus einer Praxis heraus zusammendokumentiert – man könnte sogar sagen: behauptet, fehlt noch jede Sicherheit.
Deshalb muss auch betont werden: Was hier zusammengetragen wird, wird vorgestellt, damit es solide weiterentwickelt wird, vor allem wissenschaftlich. Es ist noch nicht dazu geeignet, als Anregung oder Vorlage benutzt zu werden, um es in eigener Praxis ausprobierend nachzumachen. Dafür ist es zu gefährlich!
1.10 Auf die Art des Einsatzes kommt es an
Mehrere wichtige Substanzen, die sich in unserer Behandlung als sehr erfolgreich erwiesen haben, können bei falscher Handhabung mit eigener, schlimmer Suchtentwicklung einhergehen oder haben sogar schon Menschen umgebracht. Werden Anregungen, wie sie in diesem Buch stehen, weniger strukturiert umgesetzt, kann das schnell solche Folgen haben. Dadurch haben die Substanzen schon unnötig und völlig falsch einen schlechten Ruf und sind teils verboten. Substanzen sind aber nicht schlecht oder gut – die Art des Einsatzes ist entscheidend.
Unsere Erfahrungen zeigen mit faszinierender Sicherheit: Substanzen, die als viel zu gefährlich und „süchtig machend“ gelten, sind doch ausgesprochen segensreich einsetzbar. Sie können die Medizin und vor allem die Menschen entscheidend voranbringen. Es muss nur der richtige Einsatz garantiert werden. Das braucht Standardisierungen, die wir nur über eine wissenschaftliche Sicherung in Studien und dann ein umfassendes Schulungs- und Qualitätssicherungsprogramm für ÄrztInnen erreichen.
1.11 Kein Geld für Studien über „billige“ Ideen aus der Praxis?
Hier wird es schwierig. Studien kosten Geld. Die allermeisten Medikamentenstudien werden von der pharmazeutischen Industrie finanziert, die anschließend mit dem Verkauf der erforschten Medikamente Geld verdient. Medizin und Gesellschaft haben sich daran gewöhnt, dass so ein wesentlicher Motor medizinischer Innovation funktioniert.
Das hat die medizinische Forschung aber weitgehend von Umsatzerwartungen und Aktionärsinteressen abhängig gemacht. Forschungsansätze, die die Medizin billiger machen und mit denen primär niemand direkt Geld verdienen kann, haben es schwer oder sind sogar chancenlos, angemessen weiterentwickelt zu werden. Dasselbe gilt für neue Einsatzmöglichkeiten von altbewährten Medikamenten, die es längst als Generika, also von Nachahmerfirmen gibt. Überall da fällt der normale Studienfinanzierer, die pharmazeutische Industrie, aus.
Es braucht also eine andere Finanzierung, andere Sponsoren. Auch dafür entsteht dieses Buch. Bei der eklatanten Not und, soweit wir jetzt schon sagen können, augenscheinlich erheblichen Verbesserungsmöglichkeiten wäre es doch schier unglaublich, wenn das nicht gelingen sollte.
1.12 Ein Forschungssystem für Ideen und Fragen aus der Praxis?
Überhaupt brauchen wir andere Antennen und Hilfstrukturen für Ideen und Fragen aus der Praxis, um sie viel schneller und effektiver wissenschaftlich aufzunehmen. Es kann doch nicht sein, dass wir jährlich Millionen von Todesfällen, neuen FASD-Behinderungen und noch viel mehr furchtbares Leiden unter Alkoholabhängigkeiten hinnehmen, wie wenn es keine Idee einer wirksameren Behandlung gäbe. Gleichzeitig aber ignorieren wir über Jahre klare Hinweise aus der Praxis zu einer viel besseren Behandelbarkeit, weil es keine Idee gibt, dafür Studienfinanzierungen zu finden! Es seien ja nur Praxisbeobachtungen. Die jährlichen Schäden durch Alkohol werden allein in Deutschland auf 26,7 bis 40 Milliarden Euro geschätzt, jedes Jahr neu! Aber Studien, die vielleicht ein bis vier Millionen kosten, also weniger als ein Tausendstel, sollen nicht finanzierbar sein?
Was ist verrückt? Das so zu fragen, oder den Missstand ein ums andere Jahr weiter zu treiben? Wo ist der Wille, wirklich engagiert bestmöglich zu helfen?
1.13 Ambulante Alkoholentzüge
Die Innovationen, die dieses Buch vorstellt, haben sich ganz pragmatisch ergeben. Alkoholabhängige brauchen immer wieder einen Entzug. Das Gros der medizinisch, also mit Medikamenten und einer Überwachung gestützten Entzüge findet stationär, in Krankenhäusern statt. Dort lernen die meisten ÄrztInnen diese Entzüge während ihrer klinischen Weiterbildung nach dem Studium kennen.
Später in der eigenen Praxis habe ich gesehen, dass sich diese Entzüge bei den meisten auch hervorragend ambulant durchführen lassen. Unsere Praxis verfügt über eine Erfahrung mit mehr als 1000 ambulanten Entzügen. Wir konnten diese Entzüge quasi standardisieren und können heute sicher sagen, dass man das Gros an Alkoholentzügen ambulant durchführen kann. Kliniken bräuchten wir für die Entzüge eigentlich nur in speziellen Sonderfällen. Wenn wir bedenken, dass ein stationärer Entzug um ein Vielfaches teurer ist als ein ambulanter, und dass die Hemmschwelle, einen Entzug durchführen zu lassen, natürlich viel höher ist, wenn man dafür in ein Krankenhaus gehen muss, ist es dann nicht schon wieder „verrückt“, wenn wir das Gros der Entzüge doch weiter stationär durchführen? Allein mit den Geldern, die man hier ohne Qualitätsund Sicherheitsverlust sparen könnte, wäre schnell eine Studie finanziert, die das angemessen evaluieren könnte.
Man könnte damit auch locker gute finanzielle Anreize für die ÄrztInnen schaffen, solche Entzüge auch wirklich anzubieten. Bisher ist es für sie ein unzumutbares Draufzahlgeschäft. Mit ambulanten Entzügen würde man auch erreichen, dass sich der ein oder andere Arzt (w/m) als zuständiger Ansprechpartner (w/m) für die Alkoholabhängigkeit seiner PatientInnen erleben würde – eine win-win-Situation für alle. Es wäre der erste Schritt dazu, dass die Behandlung der Alkoholabhängigkeit Eingang in die normale, haus- oder fachärztliche Medizin findet, wo sie genauso hingehört wie die Behandlung aller anderen, chronischen Krankheiten.
Niemandem soll das etwas wegnehmen. Aber wir müssen aufhören, „verrückte“ Gewohnheiten zu perpetuieren. Und viele Kliniken wären froh, wenn sie von den ständigen Alkoholentzügen entlastet würden.
1.14 Agonistische Substanzen
Beim medizinisch unterstützten Alkoholentzug werden Medikamente eingesetzt. Die beiden wichtigsten, auch in der Leitlinie genannten sind Benzodiazepine und das Clomethiazol. Beide ersetzen den Alkohol ein wenig. Sie schenken den Abhängigen etwas von der beruhigenden, enstpannenden Wirkung des Alkohols. Weil sie also irgendwie ähnlich wie der Alkohol selbst agieren, sprechen wir auch von agonistischen Substanzen, im Gegensatz zu antagonistischen Substanzen, die etwas blockieren.
All unsere und schon viele historische Erfahrung deutet darauf hin, dass ein gut strukturierter Einsatz agonistischer Substanzen dann auch das Tor zu einer völlig neuen, viel effektiveren langfristigen Behandlung der Alkoholabhängigkeit aufstößt.
Süchtig ist man, weil man etwas braucht. In unserer Praxis hat es sich als viel weiterführender erwiesen, dieses „Brauchen“ mit einer agonistischen Substanz zu bedienen, als zu versuchen, es jemandem abzugewöhnen oder auszutreiben. Bei richtiger Handhabung kann man mit diesen agonistischen Substanzen viel weiter kommen und viel gesünder leben als mit dem Alkohol – und (!) häufiger auch als in der Abstinenz. Im Buch wird das durch das Bild einer Hand und den Wechsel von einem Finger in einen anderen veranschaulicht (Abbildung 14). Ohne Behandlung mit agonistischen Substanzen haben Alkoholabhängige nur die Wahl
• zwischen weitgehendem bzw. völligem Verzicht auf Alkohol oder
• der fortgesetzten Ausgeliefertheit gegenüber dem Alkohol mit all seinem Zerstörungspotential.
Das Verzichten gelingt mehrheitlich nicht. Deshalb ist die fortgesetzte Ausgeliefertheit gegenüber der denkbar schlimmsten Substanz, dem Alkohol, die Regel. Agonistische Substanzen anbieten zu können, bedeutet dazu eine entscheidende Alternative: Viel bessere Steuerbarkeit, viel weniger Zerstörungskraft bei planmäßiger Einnahme, und damit ein ganz anderes Niveau an Gesundheit und Lebensqualität.
1.15 Clomethiazol im ambulanten Alkoholentzug
Bei beiden genannten agonistischen Substanzen zur Abfederung eines Alkoholentzugs muss man einiges bedenken. Benzodiazepine gehen im Dauergebrauch und v.a. in höheren Dosierungen mit nennenswerten Persönlichkeitsveränderungen einher, bis hin zu schweren Störungen, und Benzodiazepin-Abhängige sind nur schwer und mit großer Geduld wieder von Benzodiazepinen wegzubringen. Deshalb ist ihr Einsatz nicht ganz unproblematisch.
Mit Clomethiazol gibt es bei falscher Handhabung so schlimme Entgleisungen, bis zu Todesfällen, dass dieser Substanz 2005 die Zulassung für ambulante Suchtbehandlungen entzogen wurde. Unsere eigenen Erfahrungen mit Clomethiazol reichten schon viel weiter zurück und waren insgesamt ausgezeichnet. Deshalb sind wir bewusst dabei geblieben, und die PatientInnen haben unschätzbar davon profitiert – eine Frage der richtigen Handhabung.
1.16 Clomethiazol längere Zeit
Nach einem Entzug sind die meisten Menschen nicht sofort 100%-ig stabil. Es macht Sinn, ihnen das leicht agonistische Clomethiazol mindestens noch ein paar Wochen weiter zu verordnen. Wie das gut strukturiert wird und wie wir mit einer Zuteilung begrenzter Mengen arbeiten, wird im ausführlichen Text erläutert.
Tatsächlich können wir damit, bei Verordnungen von bis zu mehreren Jahren, immer wieder Anfangsphasen anderer Behandlungen und Krisenzeiten überbrücken und zu deutlich mehr Gesamtstabilität beitragen. Clomethiazol ist in dieser Funktion aus unserer Behandlungspalette nicht mehr wegzudenken.
In der Fachwelt gibt es Bedenken wegen sehr gefährlicher Mischintoxikationen mit Alkohol. Bei guter Strukturierung der Behandlung haben wir solche Mischintoxikationen überhaupt nicht erlebt. Es wird auch vor einem hohen Suchtpotential von Clomethiazol gewarnt. Auch das lässt sich bei gut strukturierter Clomethiazolbehandlung klar widerlegen. Es ist beeindruckend, wie problemlos man fast immer aus einer wochen- bis jahrelangen Clomethiazolbehandlung wieder aussteigen kann. Die PatientInnen hängen ungleich weniger darauf als auf den Benzodiazepinen. Aber es gab sehr wenige Ausnahmen. Im ausführlichen Text beschreiben wir sie eingehend. Wegen dieser Ausnahmen streben wir eine Beendigung einer Clomethiazolbehandlung jetzt spätestens nach ein paar Monaten an und haben damit nur gute Erfahrungen gemacht. Mehrfache Wiederholungen eines Clomethiazoleinsatzes sind gut möglich und haben sich bei uns immer wieder bewährt.
1.17 Einnahme nach Plan statt nach Bedarf
Der wichtigste Unterschied zwischen gut strukturierter und falscher Handhabung ist eine Einnahme nach Plan statt nach Bedarf. Alle agonistischen Medikamente müssen verlässlich nach Plan eingenommen werden. Das lässt sich mit klaren Plänen und regelmäßigen, eingehenden Gesprächen, in denen diese Pläne immer auch aktualisiert werden, praktisch sicher gewährleisten.
1.18 Dihydrocodein (DHC)
Der bei weitem überzeugendste Ersatz von Alkohol durch eine andere, agonistische Substanz ist uns bisher mit DHC gelungen. Das ist ein Opioid und löst bei fast allen, wenn sie es zum ersten Mal hören, zunächst einen Schrecken aus: Alkoholabhängige opioidabhängig zu machen? Ist das nicht eine Verschlimmerung? Die Praxis lehrt uns das genaue Gegenteil.
Die induzierte Abhängigkeit erweist sich in unserer Art der Behandlungsstrukturierung fast durchgängig als problemlos. Wer vom DHC nicht profitiert, es nicht mag oder nicht verträgt, verlässt die DHC-Behandlung meist innerhalb von Tagen bis Monaten, selten nach wenigen Jahren wieder, ohne dass wir Rückmeldungen erhalten haben, wie schwer das gewesen sei. Diese medizinisch herbeigeführte Opioidabhängigkeit ist also nichts, aus dem es nicht einen gangbaren Ausweg gäbe.
Und wer von einer DHC-Behandlung profitiert, tut gut daran, diese Behandlung gewissenhaft geduldig weiterzuführen und mit einem Wunsch nach einem Ausstieg sehr vorsichtig umzugehen. Trotzdem: Auch erfolgreiche PatientInnen können eine DHC-Behandlung beenden. Das kommt dann einem erfolgreichen Behandlungsende gleich.
Solange man in Behandlung ist, hat es für Alkoholabhängige entscheidende Vorteile, mit DHC eingestellt zu sein: Eine viel bessere Steuerbarkeit, viel weniger Giftigkeit und keine Symptomatik, die an Rausch oder Trunkenheit erinnert. Damit kann man wie ein Gesunder leben, lernen und studieren. Frauen bringen gesunde Kinder zur Welt. Gegenüber dem Leben unter Alkohol vielfach wie ein Unterschied von Nacht zu Tag.
Für eine Reihe unserer Patienten hat das das Leben gewendet. Die ganze Suchtkrankheitssymptomatik hat sich aufgelöst, und unter jahrelanger Behandlung findet bei vielen PatientInnen ein guter Reifungsprozess statt, weg vom suchtgeprägten alkoholischen Leben zu einer immer umfassenderen Normalität. Da kommen wir dem Ideal eines möglichst gesunden, normalen Lebens wie bei anderen, chronischen Krankheiten sehr nahe. Statistische Angaben finden sich im ausführlichen Text.
Ähnlich wie beim Clomethiazol ist eine DHC-Behandlung auf eine gute Strukturierung angewiesen. Auch hier besteht bei unsachgemäßer Handhabung Lebensgefahr, und es gibt eine ähnliche ExpertInnen-Skepsis. Aber bei guter Behandlungsstrukturierung können wir eine praktisch gefahrlose, zuverlässige Einnahme ähnlich sicher garantieren, wie wenn wir Menschen Insulin anvertrauen.
Wir haben mit keiner anderen Substanz so viel überzeugende Verbesserung selbst bei sehr fortgeschrittener Alkoholabhängigkeit erlebt wie mit DHC.
1.19 Weitere Opioide
Ähnliche Effekte lassen sich im Prinzip auch mit anderen Opioiden erzielen. Details zu Buprenorphin, oralem Morphin, Methadon und Diamorphin werden im ausführlichen Text beschrieben. Opioide sind alle bei falscher Handhabung schnell gefährlich – siehe die Opioidkrise in den USA. Aber bei richtigem, gut strukturiertem Einsatz sind sie wahrscheinlich die beste Substanzgruppe, um Alkoholabhängige mit einer guten Einstellung vom Joch ihrer Alkoholabhängigkeit zu befreien.
1.20 Baclofen
In den letzten Jahren wurde Baclofen zur gefragtesten Substanz, insbesondere nachdem ein Arzt in New York veröffentlicht hatte, dass er sich damit im Selbstversuch von einer eigenen, schweren Alkoholabhängigkeit befreien konnte. Baclofen ist ebenfalls agonistisch wirksam, macht etwas müde und häufig auch etwas entspannt. Vorteile sind, dass es nicht, wie Clomethiazol und DHC, mit eigener Abhängigkeit verbunden ist und man einfach mit einer Baclofeneindosierung beginnen kann, während noch getrunken wird.
Aber langfristig ist der Preis dieser Vorteile doch relativ hoch. Die agonistische Kraft von Baclofen ist vergleichsweise gering. Von den 60 PatientInnen, die wir mit Baclofen behandelt haben, haben nur 10% davon im Sinne einer nachhaltigen Wende profitiert, viel weniger als beim DHC, aber immerhin. Es gehört auf jeden Fall in unser Spektrum.
1.21 Weitere Substanzen
Vieles spricht dafür, dass sich das Spektrum hilfreicher agonistischer Substanzen noch erheblich erweitern lässt, wenn dieser Ansatz systematisch weiterentwickelt wird. Infrage kommen insbesondere Cannabis, Amphetamine und das in Italien zugelassene GHB. Mit all diesen Substanzen gibt es bereits erste Bewährungen, die wir angesichts der Schwere der Alkoholproblematik alle systematisch ernst nehmen und weiter studieren müssen.
1.22 Alkoholabhängigkeit bei agonistischen Opioidabhängigkeitstherapien
Wer den Alltag sogenannter Substitutionsbehandlungen für Heroinabhängige kennt, ist vielleicht irritiert. Dort gibt es doch gerade unter den verschiedensten Opioiden erhebliche Alkoholprobleme. Wenn wir aber genau hinschauen, sehen wir, dass das mit einer nicht optimalen und damit falsch durchgeführten Opioidbehandlung zusammenhängt. Es lässt sich sehr viel machen. Wir stehen diesem Problem nicht ohnmächtig gegenüber. Als das Effektivste haben sich in unserer eigenen Praxis das Splitten und eine allmähliche, kräftige Anhebung der täglichen Dosis erwiesen. Für die PatientInnen kann das ganz entscheidend für das Gelingen der ganzen Behandlung und damit ihres Lebens sein.
1.23 Agonistische Therapieansätze während der Schwangerschaft
Angesichts der FASD-Problematik dürfen wir bei Schwangeren oder Frauen, die schwanger werden wollen, bei weitem nicht so viel wie bisher zuschauen, wenn es ihnen nicht sicher gelingt, die Alkoholschädigung ihrer werdenden Kinder zu vermeiden. Menschen mit gut strukturierter Opioidbehandlung geht es im Vergleich zu dem hier angerichteten Schaden so gut, dass sich daraus auch die Frage ergibt, diese Ansätze bei diesen Patientinnen zu erproben.
1.24 Organisation und Haltung
Eingangs hatte ich eingeräumt, dass Sie vieles, was Sie hier lesen, vielleicht erstmal „verrückt“ finden werden. Es ist auf jeden Fall ungewohnt, entspricht einem Umdenken. Wir haben das bei unseren PatientInnen als Behandlungsmöglichkeit in ganz neuer Größenordnung erlebt und sind sicher, dass man so vielen verzweifelten Menschen entscheidend weiterhelfen kann.
Aber die Bedenken sind zu Recht noch riesig. Zu viele Gefahren, schwere süchtige Fehlentwicklungen und Todesfälle. Gefahren sind jedoch dazu da, gemeistert zu werden. Wir meistern auch die Gefahren vom Fliegen und vielem anderen.
Als Basis muss es eine angemessene, wissenschaftliche Sicherung in Studien geben. Die Kosten dafür aufzuwenden, ist nach allem, was wir jetzt sehen, mit Sicherheit lohnend. Sie sind im Vergleich zu den Kosten, die die Schäden jedes Jahr verursachen, minimal.
Sobald das agonistische Behandlungsprinzip bestätigt ist, muss daran gearbeitet werden, die notwendige Qualität und Sicherheit mit einer dezentralen Behandlungsstruktur über HausärztInnen zu gewährleisten.
Wie bei vielem anderen, das bei falscher Organisation und Handhabung hochgefährlich ist, geht es entscheidend darum, grundlegende Fehler zu vermeiden, was eigentlich nicht schwer ist. Eine gewissenhafte Einnahme nach Plan muss genauso gewährleistet werden wie eine individuelle, ärztliche Betreuung mit regelmäßig eingehenden Gesprächen.
Unsere Region und unsere Praxis haben bereits zeigen können, dass das gut möglich ist und die PatientInnen dann sehr profitieren. Aber in einer weiteren Entwicklung muss das organisatorisch strukturell festgeschrieben werden.
Bei einer agonistischen Behandlung werden die PatientInnen abhängig vom Arzt (w/m), seinem Team und der Art, wie alles da organisiert ist. Das kann auch sehr unangenehm werden. Die Haltung, mit der wir die gesamte Behandlung gestalten, ist mitentscheidend, ob alles gut erträglich und dann viel erfolgreicher wird. Deshalb macht es Sinn, dass wir uns auch grundlegende Gedanken darüber machen, mit welcher Haltung wir unseren suchtkranken PatientInnen begegnen – ein wertvoller Lernprozess ohne Ende.
1.25 Unterm Strich
Mit einem agonistischen Behandlungsansatz bietet sich uns eine neue Möglichkeit, Menschen mit Alkoholabhängigkeit ganz anders zu behandeln. Endlich können wir sie ähnlich medikamentös einstellen wie Menschen mit anderen chronischen Krankheiten und ihnen in viel größerer Zahl ein Leben ermöglichen, das dem von Gesunden entspricht. Endlich eine effektive Hilfe für viel mehr Betroffene. Wer das einmal erlebt hat, möchte nicht mehr auf ein Behandlungsniveau ohne verfügbare Medikamente zurück. Aus der Behandlung der Alkoholabhängigkeit sind medikamentöse Einstellungen nicht mehr wegzudenken.
Mitnichten geht es aber nur um Medikamente. Es geht immer darum, jemandem umfassend gerecht zu werden. Nirgendwo mehr als bei Suchtkrankheiten ergeben gerade medikamentöse Behandlungen Fragen nach unserer Haltung Menschen gegenüber, die im Zusammenhang mit einer Krankheit tief gefallen sind. Je mehr diese Haltung sich auf tiefe menschliche Grundwerte besinnt, desto größer sind alle Chancen, in einer Gesundung sehr weit zu kommen. Desto selbstverständlicher gehören aber auch Medikamente in den Strauß unserer Möglichkeiten, wenn sie alles wirksam unterstützen können.
2 Einleitung
2.1 Die Dimension
Alkoholabhängigkeit verkürzt die Lebenserwartung um 20 Jahre [1]. Weltweit übersteigt die Sterblichkeit durch Alkohol die durch Tuberkulose, HIV/AIDS und Diabetes (WHO [2]). In Deutschland ist Alkohol bei Männern der zweit- [3] oder dritthäufigste [5] Grund für eine Krankenhauseinweisung. Die jährlichen Schäden werden hier auf 26,7 [6] bis 40 [8] Milliarden Euro geschätzt. Damit allein ist klar: Wir haben es mit einer der verbreitetsten und bedeutendsten Krankheiten weltweit zu tun. Eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt [9]. Die WHO macht auch auf das weite Spektrum alkoholbedingter Folgeprobleme aufmerksam und zitiert dabei Rehm et al. [10]. Dieses „et al.“ ist eine übliche, aus dem Lateinischen kommende Abkürzung beim wissenschaftlichen Zitieren. Sie weist darauf hin, dass die Arbeit weitere Autoren hat. Rehm et al. haben formuliert: Alcohol consumption is a unique risk factor for population health as it affects the risks of approximately 230 threedigit disease and injury codes in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10th Revision (ICD-10, including infectious diseases, noncommunicable diseases (NCDs) and injuries. Alcohol consumption contributes to more than 3 million deaths globally every year [11], und die WHO rechnet dabei um: Alle 10 Sekunden stirbt jemand vorzeitig an den Folgen des Alkohols. Grund genug, alles nur Erdenkliche zu unternehmen, diese Menschheitsgeißel mit allen zur Verfügung stehenden Kräften einzudämmen, soweit es irgend geht.
Aber wo sind die entsprechenden Fortschritte? Welche Summen wurden seit 2020 weltweit praktisch fraglos im Kampf gegen das Covid-19-(Corona)-Virus zur Verfügung gestellt! Überall finden Patienten ÄrztInnen, die als Diabetologen, Rheumatologen, Kardiologen, PsychiaterInnen und und und in eigener Praxis arbeiten. Fragt man aber eine(n) davon, ob sie/er einen spezialisierten Arzt (w/m) für Alkoholabhängige kennt, antworten die meisten: Nein, keinen.
Es gibt die Beratungsstellen und Suchtambulanzen, aber keine ÄrztInnen, die sich vergleichbar auf die Dauerbetreuung von Alkoholabhängigen spezialisiert haben. Für 1,8 Mio Alkoholabhängige (Dt. Hauptstelle gegen die Suchtgefahren) kann man in ganz Deutschland vielleicht eine Handvoll nennen – also praktisch nichts! Es gibt auch keine Standards für eine solche Spezialisierung. Also: Weder Definitionen eines Spezialistentums noch Spezialisten. Ein für die Betroffenen entscheidendes Manko.
Für Alkoholabhängige gibt es keine, auf die notwendige Dauerbetreuung spezialisierten Ärzte wie bei anderen chronischen Krankheiten.
Eine ärztliche Dauerbetreuung bei chronischen Krankheiten hängt originär mit dem Einsatz von Medikamenten zusammen. So versorgen laut der Deutschen Diabetes-Gesellschaft etwa 4.340 DiabetologInnen die etwa 6,7 Mio DiabetikerInnen, zusammen mit den etwa 55.000 HausärztInnen. Sie sorgen dafür, dass beim Diabetes weit bessere Zahlen als die eingangs für Alkoholabhängige genannten gelten, weniger Lebensverkürzung, weniger Hospitalisierungen, mehr Lebensqualität. Und – gleich mit zu beachten: Dass die Behandlung von DiabetikerInnen ein in Medizin und Gesellschaft normal integriertes Phänomen ist. Wenig Sonderstatus, wenig Ausgrenzung. Hat jemand einen Diabetes, ist sie/er trotzdem der Mensch, der sie/er sonst auch ist, kann ein normales Leben leben. Niemand distanziert sich. Wollen wir gleich festhalten: Das ist der Maßstab. Wenn eine chronische Krankheit schon mehrheitlich nicht vollständig heilbar ist – und das gilt beeindruckend für das Gros der Suchtkrankheiten – dann soll das Leben trotzdem so wenig wie möglich durch diese Krankheit beeinträchtigt werden. Alle Möglichkeiten, die ein Leben ohne diese Krankheit bieten würde, sollen auch diesem Leben möglichst uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Bei DiabetikerInnen ist das zu einem hohen Prozentsatz Realität. Aber für Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit?
Es wird ein Kern dieses Buches, das alles näher anzuschauen. Bisher gibt es keine Medikamente, die in der Behandlung von Alkoholabhängigen eine nennenswerte Rolle spielen. Keine/r der PatientInnen, die unsere Praxis wegen Alkoholabhängigkeit aufgesucht haben, kam mit einer medikamentösen Einstellung für die Alkoholabhängigkeit zu uns, und so gut wie niemand hatte je eine medikamentöse Behandlung für ihre / seine Abhängigkeit über einen längeren Zeitraum erlebt. De facto kamen die meisten aus jahrelanger Unbehandeltheit zu uns, und es kann als sicher angesehen werden, dass die weithin katastrophalen Verhältnisse damit zusammenhängen.
Wenn wir also immer wieder denken, wie schlimm Süchtige sind, müssen wir auch den Blick darauf richten, wie katastrophal insuffizient das Behandlungsangebot ist. Aber es lässt sich erheblich verbessern. Ansätze dazu will dieses Buch aufzeigen.
Alkoholabhängigkeit ist eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt. Grund genug, alles nur Erdenkliche zu unternehmen, diese Menschheitsgeißel mit allen zur Verfügung stehenden Kräften einzudämmen. Aber das ärztliche Angebot entspricht dem nicht.
Wenn eine chronische Krankheit nicht vollständig heilbar ist, dann sollen die Menschen trotzdem so weit wie möglich ein Leben wie ohne diese Krankheit führen können.
2.2 Einzelschicksale
Die Heftigkeit und Tragweite der Diagnose Alkoholabhängigkeit geht einem aus den nackten, statistischen Zahlen meist nicht wirklich nahe, wohl aber aus der Begegnung mit betroffenen Menschen und ihren Angehörigen. Vor allem, wenn wir es aus der Perspektive sehen, dass sich hier Kranke an uns wenden, die von ihrer Krankheit unmäßig geschunden werden. Das ganze Leben wird ihnen zerstört, und wie viele suchen händeringend nach einer passenden, effektiven Hilfe, ohne sie zu finden! In jeder Einzelgeschichte spiegeln sich tiefgründige, allgemeingültige Gesichtspunkte. Dadurch wird jede Begegnung, jedes Einzelschicksal auch lehrreich.
- Ich denke z.B. an einen 62-jährigen Lehrer, dessen Frau sagte, er habe sich die letzten Jahre zunehmend verändert. Eine Mischung aus immer mehr Depression und Alkohol sei letztlich unerträglich geworden. So gehe das Zusammenleben nicht mehr. Eine „Therapie“, ein Entzug in einer Klinik und verschiedene Antidepressiva hätten alle wenig nachhaltigen Effekt gehabt. Die Familie sage jetzt: „Entweder der Alkohol oder wir.“
Gleich sehen wir, was die Krankheit alles kaputt macht. Die Frau sagt: Das Zusammenleben geht so nicht mehr. Die Tochter will nichts mehr wissen und erhebt etwas, was auch typisch ist für die Krankheit: Vorwürfe. Er schilderte den Beginn der Krankheit mit: „Es überkam mich.“ In höherem Alter ist die Entwicklung einer Suchtkrankheit besonders häufig mit einer Depression gekoppelt. Dann hat sie eine schwarzseherische, verzweifelte Komponente, in die sich Vorwürfe und Schuldgefühle verweben. Das macht das Dagegen-Ankämpfen noch schwerer. Dann waren sowohl die Sucht als auch die Depression immer wieder stärker als alle rationale Gegenwehr, die er als besonders differenzierter Mensch und seine Familie dagegen setzten. Gegen viele Krankheiten kämpft man an, aber wenige erschüttern das Selbstverständnis in solcher Weise. Was bin ich für ein Mensch, was für ein Versager?
„Entweder der Alkohol oder wir. “ Suchtkrankheit – Depression – Vorwürfe – Schuldgefühle – ständiger Kampf, in dem man weite Strecken alleine bleibt. Wenige Krankheiten erschüttern das Selbstverständnis in solcher Weise.
- Und ich denke an einen 49-jährigen Mann, dessen Vater und mehrere Verwandte ebenfalls schwer von Alkoholabhängigkeit betroffen waren, er selbst seit ca. 30 Jahren. Seine Krankheitsgeschichte ging, soweit ich mitzählen konnte, mit 37 medizinisch gestützten Entzügen, einher, davon 35 stationär, plus drei „Therapien“, einem Gefängnisaufenthalt von 2 Monaten, etlichen cerebralen (epileptischen) Anfällen, wiederholten Armbrüchen bei Trunkenheitsstürzen und bereits zehn Jahren Arbeitslosigkeit. Was für eine Krankheit! Was für ein Leben! Und keine greifende Therapie!
37 medizinisch gestützte Entzüge, drei „Therapien“, ein Gefängnisaufenthalt von 2 Monaten, etliche cerebrale Anfälle, wiederholte Armbrüche bei Trunkenheitsstürzen, 10 Jahre Arbeitslosigkeit. Was für eine Krankheit! Was für ein Leben! Und keine greifende Therapie!
- Als nächstes denke ich an eine 33-jährige Frau, die über eine Suchtberatungsstelle zu uns kam. Sie war bei der Arbeit wegen Tremor (Zittern), Unpünktlichkeiten und vieler Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aufgefallen, wahrscheinlich auch wegen nachlassender Leistung und echten Fehlleistungen. Es habe eine Abmahnung gegeben. Auch sie war familiär vorbelastet: Ihr Vater sei Alkoholiker gewesen. Das habe ihn aggressiv gemacht. Er habe die Familie geschlagen und sich erhängt, als sie in der 5. Klasse war. Danach habe sie sich um die „zerbröselte“ Mutter kümmern müssen.
Welche Belastung brachte auch sie mit! Seit 8 Jahren kämpfe sie gegen den Alkohol, der sie längst im Griff habe, wie sie sagte. Anfang der 2000-er Jahre behandelten wir nach einem ambulanten Entzug zunächst mit Acamprosat. Das schien erst 9 Monate erfolgreich, aber nach dem ersten Rückfall zeigte sich keine neue Wirkung, und wir beantragten eine „Therapie“. In den Wartezeiten darauf brauchte sie noch dreimal einen stationären Entzug (also einen Entzug in einer Klinik). In der „Therapie“ sei ihr eher abgeraten worden, anschließend wieder zu mir zu gehen. So kam sie erst ein halbes Jahr später, im Zusammenhang mit zwei Noteinweisungen wegen schwerer Alkoholintoxikationen, wieder zu mir, aber es kam zu keiner weiteren Behandlung. Ich habe ihr mit den damaligen Mitteln nicht wirklich helfen können.
Dieses verzweifelte Suchen nach irgendeiner Hilfe, mal dies und das zu probieren, ist auch typisch für viele Suchtkrankheitsverläufe. Immer wieder machen die Betroffenen die Erfahrung, dass es wieder nichts gebracht hat und die Krankheit doch wieder in ganzer Wucht da ist, auch bei uns. Also wechseln sie und versuchen wieder etwas Neues oder geben auf, für eine Weile oder dauerhaft. Dieses Abbrechen kennzeichnet auch bei uns viele Verläufe. Es ist auch ein Zeichen, dass wir noch weit davon entfernt sind, wirklich gut behandeln zu können, etwa wie bei anderen Krankheiten, dem erwähnten Diabetes oder einer HIV-Infektion zum Beispiel.
Ich habe ihr nicht helfen können. Das verzweifelte Suchen nach irgendeiner Hilfe, mal dies und das zu probieren, ist typisch für viele Suchtkrankheitsverläufe. Immer wieder machen die Betroffenen die Erfahrung, dass es wieder nichts gebracht hat.
- Als nächstes möchte ich eine 46-jährige Frau vorstellen, die mir von einer Suchtberatungsstelle als verzweifelter Fall angemeldet wurde. Schon 70-mal habe sie „entgiftet“, davon 60-mal stationär. Auch drei vollständige stationäre „Therapien“ hatte sie hinter sich. Das krankhafte Trinken gehe, seit sie 15 war, also seit 31 Jahren. Nach einem Entzug halte sie es höchstens ein paar Tage lang aus, dann müsse sie wieder weitertrinken. Warum? „Weil ich den Geschmack so mag – den brauche ich. Und dann kann ich nicht mehr aufhören.“ Wollen Sie denn aufhören? „Eigentlich unbedingt. Ich geh‘ ja kaputt am Trinken.“ Sie berichtete von schon mehreren epileptischen Anfällen, GGT-Leberwerten von über 1.000 (normal bis 39) U/l, zwei vorangegangenen Suizidversuchen. Man habe eine Borderline-Störung bei ihr diagnostiziert. Zur Mutter habe sie keinen Kontakt mehr, der Vater sei von Alkohol und Valium abhängig. Auch dessen Brüder seien alle alkoholabhängig.
Welche Chance hat ein Leben mit einer solchen Krankheitsbelastung? Wir kümmerten uns ein Jahr lang intensiv um sie. Immer wieder habe ich notiert, dass ihre Mitarbeit vorbildlich war. Die wollte mitarbeiten, wollte die Krankheit überwinden oder wenigstens in den Griff bekommen. Aber unsere Behandlung war zu schwach, die Krankheit stärker. Sie brauchte in diesem Jahr acht weitere Entzüge und kam dann nicht wieder: Dieser Doktor kann mir auch nicht helfen.
Ich geh‘ kaputt am Trinken. Schon mehrere epileptische Anfälle. Zwei Suizidversuche. Der Vater und seine Brüder auch alkoholabhängig. Nach acht weiteren Entzügen in einem Jahr kam sie nicht mehr wieder: Dieser Doktor kann mir auch nicht helfen.
- Erwähnt sie auch eine 49-jährige Frau, die wegen zunehmender Gelbfärbung, medizinisch Ikterus genannt, von einer Suchtberatungsstelle zu mir geschickt wurde. Ikterus zeigt ein zunehmendes Leberversagen bei Alkoholbedingter Leberzirrhose an. Wenn es jetzt nicht gelingt, das Steuer radikal herumzureißen und vom Alkohol wegzukommen, ist die Prognose schlecht, und es droht der Tod innerhalb von Monaten bis wenigen Jahren. Außerdem beginnt in einer solchen Phase eine immer schlimmere Schwäche. Eine medikamentöse Einstellung wie bei anderen, chronischen Erkrankungen war noch nie versucht worden – in 35 Jahren ihrer Abhängigkeitsgeschichte! Fünf stationäre Entzüge, zwei „Therapien“ – alles quasi ohne Effekt.
Zunehmende Gelbfärbung bei alkoholischer Leberzirrhose. Es droht der Tod innerhalb von Monaten bis wenigen Jahren. Und eine immer schlimmere Schwäche. Eine medikamentöse Einstellung wie bei anderen, chronischen Erkrankungen war noch nie versucht worden.
Dieser Patientin konnten wir nachhaltig helfen und das fatale Schicksal damit abwenden. Das werden wir später beschreiben.
- Mehrere Patienten kommen mit einer gezielten Frage nach einer medikamentösen Einstellung. So auch ein 57-jähriger Patient, der gleich von seiner Erfahrung berichtete, dass wiederholte Entzüge und schon drei „Therapien“ keinen Durchbruch gebracht hatten. Er spürte, es würde weitere Rückfälle geben. Immerhin hatte die Krankheit schon zu einem Krebs, drei Rippenbrüchen und jetzt zum Verlust des Arbeitsplatzes geführt. Auch privat erlebe er lauter Vorhaltungen, Distanzierungen und Drohungen. Was für eine Krankheit!
Er spürte, es würde weitere Rückfälle geben. Immerhin hatte die Krankheit schon zu einem Krebs, drei Rippenbrüchen und jetzt zum Verlust des Arbeitsplatzes geführt. Wiederholte Entzüge und schon drei „ Therapien“ hatten keinen Durchbruch gebracht.
- Erwähnt sei auch ein 49-jähriger Mann, der nach etlichen Entzügen und vier „Therapien“ zu mir kam. Er selbst trinke seit etwa 25 Jahren viel bis zu viel, und ihm sei schon ganz viel kaputt gegangen. Ein selbständiges Handwerksunternehmen habe er wegen der Sauferei aufgeben müssen. Immer wenn er trank, konnte er es nicht steuern. Und in Phasen ohne Alkohol kam ihm das Leben unerträglich minderwertig vor.
Er kam etwa 20 Jahre lang zu uns, und wir versuchten alles, was wir konnten, einschließlich einer weiteren „Therapie“. Doch auch bei ihm erwies sich die Krankheit als stärker. Wir konnten nicht verhindern, dass die Trunkenheiten immer schlimmer wurden. Zuletzt lief er wochenlang, nur mit einer Unterhose bekleidet, durch die Wohnung und verrichtete seine Notdurft auf dem Küchenboden. Er kommandierte brüllend seine alte, wehrlose Mutter und wurde zum Tier, wie er selbst sagte, wenn er wieder in einer nüchternen Phase war. Einweisungen verweigerte er, bis es nicht mehr ging, oft erst nach etlichen Wochen. In seiner letzten, über Monate andauernden Trinkphase verkam er regelrecht. Schließlich wurde er tot in seinen Ausscheidungen liegend aufgefunden. Bis dahin hatten wir 26 stationäre, zehn ambulante Entzüge, fünf „Therapien“, jahrelange Selbsthilfegruppenbesuche gezählt und unendliche Versuche unsererseits, ihm irgendwie aus seiner Sucht herauszuhelfen. Vielleicht hatten wir einen Anteil an den längeren Abstinenzzeiten, die gelungen sind, vielleicht auch daran, dass er immerhin siebzig geworden ist. Aber insgesamt ist doch festzuhalten, wie ohnmächtig wir alle im Vergleich zur Macht dieser Krankheit waren.
Was für ein Mangel an wirklich effektiver Behandlung! Was für eine Krankheit! Was für ein Leben!
26 stationäre, 10 ambulante Entzüge, 5 „ Therapien“, jahrelange Selbsthilfegruppenbesuche und unendliche Versuche unsererseits, ihm irgendwie aus seiner Sucht herauszuhelfen. Aber wie ohnmächtig waren wir alle im Vergleich zur Macht dieser Krankheit.
- Eine Patientin, die uns ähnlich jahrelang besonders intensiv beschäftigt hat und bei der wir auch letztlich den Kampf gegen die Suchtkrankheit verloren haben, kam als 28-Jährige über eine Frauen-Suchtberatungsstelle zu uns. Bei ihr war eine Kindheit voller fürchterlicher Traumata und Missbrauch bekannt. Natürlich versuchten wir alles, was wir konnten und was dann noch als große Hoffnung beschrieben wird. Aber nichts greift bei allen. Bei ihr griff letzten Endes nichts wirklich, einschließlich einer klassischen „Therapie“ und mehrerer psychotherapeutischer Versuche. Dass uns nur eine zeitweilige Verminderung der Rückfall-Häufigkeit gelungen ist, war zu wenig. Wenn sie hochprozentig trank, kam es immer mehr zur Speiseröhren-Verätzung. Obwohl sie also spürte, dass jeder nächste Rückfall ein Wahnsinn ist und jetzt eine unerträglich schmerzhafte Entzündung mitten im Brustraum verursacht, konnte sie keinen Rückfall verhindern. Sie hasste diese Rückfälle, und doch kamen und kamen sie. So entwickelte sich eine völlig verätzte Speiseröhre, die nicht mehr für die Nahrungsaufnahme zu gebrauchen war. Im letzten Jahr ihres Lebens musste sie zweimal pro Woche für eine Bougierung in Kurznarkose in die Klinik. Schließlich verstarb sie 48-jährig an den Folgen dieser unbeschreiblich schmerzhaften Speiseröhrenentzündung, aber eigentlich an den Folgen ihrer Suchtkrankheit, für die wir keine suffiziente Behandlung gefunden haben.
Immer wieder: Was für eine Krankheit! Was für ein Leben!
Sie hasste diese Rückfälle, wollte sie überhaupt nicht. Und doch kamen und kamen sie. So entwickelte sich eine völlig verätzte Speiseröhre, die nicht mehr für die Nahrungsaufnahme zu gebrauchen war. Sie wurde darüber immer kränker und verzweifelter.
- Vorgestellt sei noch eine heute 26-jährige Patientin, die unter schwierigen Bedingungen auf die Welt kam. Von der Mutter zur Adoption freigegeben, fiel sie gleich mit unaufhörlichem Schreien und schweren, epileptischen Anfällen in den ersten Tagen auf. Damit war von Anfang an ein Lebenslauf voller Probleme vorgezeichnet. Ein Nicht-Zurechtkommen im Kindergarten und allen Schulen, Schulschwänzprobleme, Jugendpsychiatrie, schließlich doch das Erreichen eines Abschlusses als einfache Gärtnerin (Gartenbaufachwerkerin) an einem Berufsbildungswerk für Menschen mit einem handicap. Aber die Hoffnung, dass sie jetzt mit diesem Berufsabschluss eine Arbeit finden würde, ging nicht auf.
Sie hatte nämlich eine Diagnose, bei der es nur 12% der Betroffenen auf einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt schaffen [13]: FASD, englisch für Fetal alcohol spectrum disorder oder deutsch: Fetale Alkoholspektrumsstörung oder Fetales Alkoholsyndrom. Die Mutter hatte während der Schwangerschaft Alkohol getrunken und hat ihr damit einen schweren, bleibenden Schaden fürs ganze Leben zugefügt. Das erklärt auch das Schreien und die epileptischen Anfälle in den ersten Lebenstagen, die als Entzugskrämpfe und das Ganze als schweres Entzugs-Syndrom einzuordnen sind. Auch alle weiteren Schwierigkeiten der jungen Frau erklären sich mit der Diagnose. FASD ist eine lebenslange, irreversible Behinderung, die in der Gesamtschwere einem Down-Syndrom vergleichbar ist.
Aber vielen FASD-Betroffenen sieht man die Behinderung nicht an, und es ist auch typisch, dass sie sich gut und sehr differenziert darstellen können. Auch in den normalen Intelligenztesten fallen sie häufig nicht auf. Daher vertut man sich in ihrer Einschätzung, und ihr Problem ist regelmäßig, dass man zu hohe und bei ihnen eben unrealistische Erwartungen an sie hat. Regelmäßig sind aber wichtige Verschaltungen im Gehirn nicht richtig angelegt, die vor allem die sogenannten Exekutivfunktionen betreffen. So tun sich die Betroffenen häufig unverhältnismäßig schwer in der Einschätzung, wie sie auf andere wirken und was das Handeln und Reden anderer mit ihnen zu tun hat. Soziale Integration und soziales Taktieren fällt ihnen oft richtig schwer. Es entwickeln sich unzählige Lebensprobleme, und fast immer besteht ein lebenslanger Betreuungsbedarf.
Ein hoher Prozentsatz wird auch selbst wieder suchtkrank. Unter Suchtkranken gibt es mit Sicherheit eine große Zahl übersehener Menschen mit FASD. Das zu bearbeiten, wird in Zukunft noch wichtig sein. Denn wenn man sich dieser Diagnose nicht bewusst ist, richtet man irreale Erwartungen an die Betroffenen und behandelt letztlich nicht richtig.
Fazit: FASD – eine weitere, unsagbar schlimme Folge schädigenden Alkoholkonsums – und auch daraus ein dringendes Plädoyer, neue Ansätze zu verfolgen.
Die Mutter hatte während der Schwangerschaft Alkohol getrunken und ihr damit einen schweren, bleibenden Schaden fürs ganze Leben zugefügt. Das Wissen, dass jeglicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft tabu ist, ist noch viel zu wenig verbreitet.
- Um das näher zu erläutern, sei hier eine schwangere Heroinabhängige vorgestellt, die dreißigjährig in Behandlung kam. Auch sie mit einer fürchterlichen Kindheit und Jugend, schwersten Misshandlungen bis hin zum Missbrauch. Immer wieder etwas zum Innehalten: Wie viel unvorstellbar Schlimmes Menschen einander antun, und wie viel davon im familiären Umkreis passiert! Die Menschen, die dann psychisch- und / oder suchtkrank daraus hervorgehen, werden so oft als „selber schuld“ verurteilt und ein Leben lang weiter erniedrigt, obwohl sie eigentlich eine Anerkennung als Opfer verdient hätten, an dem man jede Menge Gutes nachholen muss. Unsere Patientin war darüber regelrecht in die Sucht getrieben worden.
Als sie zu uns kam, war der spätere Behandlungsstandard, Methadon, auf den Rat der meisten SuchtexpertInnen hin in Deutschland noch verboten. Nur in der Schwangerschaft war es schon zugelassen, aber danach war keine Weiterbehandlung mit Methadon möglich. Die Schwangere wurde also mit Methadon behandelt. Sie war darunter eine fröhliche und super verlässliche Patientin.
Tatsächlich hatte ihre Neugeborene im Gegensatz zum vorher beschriebenen Kind keine oder kaum Entzugsbeschwerden. Sie selbst aber konnte wegen des damals noch bestehenden Verbots nicht weiter mit Methadon behandelt werden, sondern war gezwungen, zu entziehen. Heute wissen wir, dass das ein von der Fachwelt diktierter Fehler war. Er bedeutete ihr Todesurteil.
Ein erzwungener Methadonentzug war unmittelbar nach der Geburt einfach nicht auszuhalten. Sie behalf sich mit Alkohol. Das war ungleich schlechter als das Methadon zuvor. Fortan war sie permanent betrunken, unzuverlässig, auch wir konnten sie kaum noch erreichen, geschweige denn betreuen. Sie verkam immer mehr, wurde immer verzweifelter. Nach acht Monaten setzte sie ihrem Leben mit einem „goldenen Schuss“ ein Ende.
Diese Geschichte zeigt, insbesondere in der Zusammenschau mit der vorherigen (FASD-) Patientin, wie Alkohol alles zerstören kann. Gerade für Schwangere ist nichts schlimmer als Alkohol. Unserer Patientin ging es mit Methadon gut. Die damals Neugeborene kam ohne Entzugserscheinungen und irgendwelche Defizite auf die Welt, konnte später erfolgreich studieren und steht heute attraktiv und normal gefestigt im Leben. Aber die Pläne ihrer leiblichen Mutter, unserer Patientin, ihr selbst eine gute Mutter zu sein, wurden durch den erzwungenen Methadonentzug und dann durch den Alkohol zerstört.
Erneut müssen wir bedenken, dass hier fast weniger die Sucht als eine fragwürdige Behandlung ein Leben zerstört hat. Es sind die damaligen SuchtexpertInnen, die das Methadonverbot, ihr Todesurteil, zu verantworten haben.
Ein Methadonentzug unmittelbar nach Entbindung würde heute als Kunstfehler verurteilt. Da sind wir also schon besser. Aber die wenigen geschilderten Schicksale zeigen doch, dass wir noch viel, viel besser werden müssen. Die großen, entscheidenden Verbesserungen, die es bei so vielen anderen Krankheiten bereits beeindruckend gegeben hat, sind für die Behandlung von Suchtkranken noch weitgehend Zukunftsmusik. Immerhin zeigen sich erste Ansätze, und wir konnten schon ein bisschen davon in der Behandlung eigener Patienten umsetzen.
Die Pläne, ihrer Tochter eine gute Mutter zu sein, wurden durch den erzwungenen Methadonentzug nach der Entbindung und dann durch den Alkohol zerstört. Mit Methadon war es ihr gut gegangen.
3 Therapeutischer Standard
3.1 Was die Leitlinie sagt
Leitlinien repräsentieren, quasi als Meilensteine, den Stand des Wissens. Sie werden mit höchstem Aufwand anhand der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur zusammengetragen. Das gilt grundsätzlich auch für die S3-Leitlinie Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen. Von ihr erschien im Dezember 2020 eine Neufassung, als dieses Buchmanuskript schon praktisch fertig war [17, 19]. Gerade konnte ich noch aktuell darauf eingehen.
Es ist immer beeindruckend, wie viele Fachgesellschaften und wissenschaftliche Institutionen für dieses Werk von über 400 Seiten einbezogen werden. Das allein scheint schon zu gewährleisten, dass quasi alle Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Es bedeutet zweifellos einen immensen Aufwand. Daher verwundert es nicht, dass es nicht schon zum 30.07.2019, dem offiziellen Gültigkeitsverfall der 2015/2016 herausgegebenen Fassung [19], gelungen ist, eine aktualisierte Version zusammenzustellen, sondern erst eineinhalb Jahre später.
Es ist auch beeindruckend, in wie vielen Details sich differenzierte Weiterentwicklungen zeigen. So gibt es beispielsweise jetzt – endlich – Hinweise auf das FASD, die 2015/16 noch gefehlt hatten. Zu vielen therapeutischen Ansätzen und Settings ist die Sicht klarer und vielfältiger geworden. Auch die Rolle von HausärztInnen und Medikamenten wird jetzt beginnend differenzierter behandelt. Die Auseinandersetzung mit der Rolle von Medikamenten erscheint eingehender und weniger ablehnend. Das 2015 noch nicht behandelte Baclofen wird jetzt mit behandelt.
Ich erschrecke aber wieder beim Lesen und Durcharbeiten dieser Leitlinie. Vieles von den Erfahrungen und den Fragen, die sich mir aus der Betreuung meiner Patienten stellen, finde ich in dieser Leitlinie nicht wieder [21]. Vielleicht wird es auch Ihnen so gehen. Wenn Sie im vorigen Kapitel die Einzelschicksale gelesen haben, die ja nur eine ganz kleine und fürs erste typische Auswahl wiedergaben, und im ersten Kapitel etwas von den statistischen Dimensionen, wird Ihnen sicher der riesige Druck nahe gehen, der auf dem ganzen Feld lastet: Das muss viel, viel besser werden, offensichtlich auch grundsätzlich. Aber die Leitlinie beklagt nur „erhebliche Unsicherheiten und Wissenslücken gegenüber Suchtpatienten“, mangelnde „Abstimmung, z. B. zwischen“ „Akutmedizin und Rehabilitation“, „ein eklatantes Defizit in Lehre und Ausbildung“ und „einen weit verbreiteten therapeutischen Nihilismus“, während „das Versorgungssystem … in Deutschland sehr differenziert“ sei. Wir müssen uns fragen: Sind die Defizite, unter denen unsere PatientInnen leiden, damit richtig beschrieben? Steht Alkoholabhängigen wirklich ein gutes Versorgungssystem zur Verfügung?
Zumindest waren fast alle Patienten mit ihrer Alkoholabhängigkeit de facto die meiste Zeit unbehandelt. Wurden sie aus einer stationären Behandlung entlassen, erhielten sie den Rat, zu einer Beratungsstelle zu gehen, und ihre Antwort war: Da war ich schon, oder da bin ich schon. Aber sie wurden in der Regel nicht in eine direkte, therapeutische Weiterbetreuung übergeben. Alle Abhängigen hatten ihre Abhängigkeit über Jahre, also einen chronischen Verlauf. Wird bei einer anderen, schweren chronischen Krankheit eine stationäre Behandlung notwendig, erfolgt in der Klinik in der Regel eine neue Einstellung, mit der die PatientInnen zu ihrem Haus- oder Facharzt (w/m) geschickt werden. In der Regel übernehmen die ÄrztInnen draußen diese Einstellung zunächst mal, um sie eventuell im weiteren Verlauf, oder weil sie die/den Patienten schon länger kennen, zu modifizieren. So bleiben die PatientInnen mit ihrer chronischen Krankheit in kontinuierlicher Betreuung, und es gibt unzählige Dokumentationen, dass es ihnen so viel besser geht als wenn sie unbehandelt blieben. Immer wieder bieten sich die Vergleiche mit dem Diabetes und – weil unsere Praxis darauf besonders spezialisiert war – mit der HIV-Infektion an. Wieviel allein gelassener sind Alkoholabhängige in diesem Vergleich!
In unserem ersten Kapitel, auf S. 26, war schon darauf hingewiesen worden, dass es praktisch keine auf Alkoholabhängigkeit spezialisierten, niedergelassenen ÄrztInnen gibt. Die Leitlinie sieht auch keinen Bedarf. Medikamente für eine mögliche Dauereinstellung werden sehr zurückhaltend beurteilt, das was wir vorschlagen und womit wir erstaunliche Erfolge publiziert haben, gar nicht diskutiert. Naltrexon und Acamprosat-Verordnungen werden in der aktuellen Version befürwortet, aber es gibt eine offensichtliche Diskrepanz zur Praxis. Während in anderen Fächern leitliniengerecht verordnet wird, wird Acamprosat und Naltrexon in der Praxis praktisch gar nicht verordnet. Wenn wir keine zu verordnenden Medikamente haben, wofür dann ÄrztInnen? Alkoholabhängigkeit ist in seiner potentiellen Dauerbetreuung eine Domäne von PsychologInnen und psychosozialen BetreuerInnen. Aber auch die Perspektive einer Dauerbetreuung findet sich in der Leitlinie nicht. Ständig wird eine Postakutbehandlung genannt. Doch geht dieser Begriff bei einer chronischen, häufig lebenslangen Krankheit nicht an dem vorbei, was die Kranken brauchen?
Wenn wir nach einer Dauerbetreuung durch ÄrztInnen fragen, könnten die anerkannten SuchtexpertInnen mutmaßen, dass die Medizin den Partnerdisziplinen Psychologie und Sozialarbeit etwas wegnehmen will. Diese Überlegungen haben schon bei der Einführung medizinischer Dauerbehandlungen für Opioidabhängige – sprich Methadon-Behandlungen – eine Rolle gespielt.
Tatsächlich brauchen wir uns aber alle gegenseitig sehr. Je mehr Psychologisches eine Rolle spielt, desto mehr brauchen wir PsychologInnen. Dezidiert PsychotherapeutInnen gibt es für Suchtkranke viel zu wenig. Ich habe einmal eine Befragung von Suchtkranken durchgeführt, was ihnen an einer sogenannten psychosozialen Betreuung am wichtigsten ist. Das Ergebnis war auch hier: Die Gespräche – jemanden zum Reden zu haben, wo man sich vertrauensvoll aussprechen kann [22].
Das legt gleich eine innehaltende Extra-Betrachtung nahe. Wer die Therapie von Suchtkranken nicht zentral auf eingehenden, hörenden, vertrauensvollen Gesprächen aufbaut, wird wohl immer an entscheidenden Fortschritten vorbei agieren. Egal ob Arzt, Psychologe oder Sozialarbeiter (w/m) – wir werden unseren Anvertrauten nie gerecht, wenn wir nicht eingehend ihre Vorgeschichte aufgenommen haben, wie sie sie uns persönlich mitgeteilt haben. Und wenn wir nicht drückende Probleme in ihrer aktuellen Situation kennen, behandeln wir mit einiger Wahrscheinlichkeit am Eigentlichen vorbei. Dazu gehört auch ein Bild vom Umfeld. Mit wem teilen sie ihr Leben? Wer und was spielt in der Sucht eine wichtige Rolle? Wo und wie wohnen sie? Kann auf eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz zurückgegriffen werden? Was gibt es an positiven Ressourcen? Gute Beziehungen? Gute Vorerfahrungen? Grundsätze?
Wer die Therapie von Suchtkranken nicht zentral auf eingehenden, hörenden, vertrauensvollen Gesprächen aufbaut, wird wohl immer an entscheidenden Fortschritten vorbei agieren.
Das Teilen all dieser Gesichtspunkte bedeutet zugleich den Aufbau einer tiefen Beziehung. Das ist nichts für nur mal ein paar Wochen oder Monate. Mancher Arzt (w/m) wird einwenden: Genau das will ich gar nicht. Tiefe Beziehungen mit meinen PatientInnen, das ist nichts für mich. Auch das will respektiert sein. Aber allzu schnell sollten wir nicht darüber hinweggehen. Suchtkrankheiten schreien sozusagen nicht nur nach einer Versorgung und Regelungen aller Art. Sie sind immer auch ein zutiefst menschlicher Notschrei. Suchtkranke brauchen eher mehr als alle, die von schwerer Krankheit bedrückt sind, menschliche Zuwendung. Und wir sind gefragt, diese Zuwendung, das aktive Interesse, als wichtiges therapeutisches Instrument einzusetzen.
Nehmen wir das ernst, wird ein jahrelanger, intensiv gemeinsamer Weg daraus, der auch uns selbst viel gibt. Zu dem gehört auch, immer wieder Kapazitäten für schnelle adhoc-Gespräche bereit zu halten. Wie oft drückt der Schuh ganz akut! Und wie wichtig ist es, Entgleisungen zeitnah besprechen zu können, bevor sie zur großen Fehlentwicklung werden! In unserer Praxis hat uns dafür immer ein kleines Räumchen oder zumindest so etwas wie ein Stehpult gefehlt. Wir mussten uns oft damit behelfen, derartige Adhoc-Besprechungen allzu sehr zwischen Tür und Angel am Flur durchzuführen. Besser wäre ein Rahmen gewesen, der signalisiert hätte: Hier sind wir unter uns, und es herrscht eine vertraulich – diskrete Atmosphäre. Wir können reden.
Aber selbstverständlich sehen wir beim ernsthaften Einlassen auf unsere PatientInnen unzählige Nöte, wo unsere eigene Kapazität viel zu begrenzt für die nötige Hilfe ist. Überall da sind wir froh um eine gute Vernetzung mit PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen und allen, die sich mit viel größerer Kompetenz hilfreich anbieten.
Wer, wie man sagt, auf „Therapie“ geht, das klassische Angebot einer standardisierten Suchtbehandlung, erlebt dort in der Regel ein umfassendes Angebot, zu dem zentral auch Gespräche gehören, sowohl in Einzelsitzungen, aber auch in Gruppen und in allen Aktivitäten sowieso. Nicht umsonst ist das ein Weg, der einen Teil der Betroffenen aus der manifesten Phase der Suchtkrankheit befreien kann. Die Leitlinie sieht dieses Angebot nach wie vor als das zentrale Element.
Generell gilt, dass Menschen viel daran weiterarbeiten, wenn sie in ermutigender Weise angesprochen werden. Wer verächtlich angesprochen wird, neigt viel eher zur Gegenwehr, und sei es nur in seiner inneren Position. Wer aber spürt, dass sich in den Worten / Handlungen der oder des anderen etwas Anerkennendes für sie/ihn widerspiegelt, ist viel motivierter, die Impulse der/des anderen ernsthaft aufzunehmen und etwas daraus zu machen.
Das betrifft schon die sogenannte Kurzintervention, der die Leitlinie wieder ein eingehendes Kapitel widmet. Sie ist weitgehend identisch mit dem sogenannten „motivational interviewing“ (MI), das mehr ein kurzes Interesse-Zeigen bedeutet als (auf keinen Fall) einen erhobenen Zeigefinger. Es signalisiert auf jeden Fall Bereitschaft, Ansprechpartner zu sein und ein Stück weit vorurteilsfrei pragmatisch über die Angelegenheit zu sprechen.
In der Praxis habe ich dieses Element wirklich als wichtig erlebt. Es ist in allen möglichen Problemsituationen einsetzbar, einer kurzfristigen Konfliktsituation, einer drohenden oder erkennbaren Fehlentwicklung, aber auch besonders in Situationen, wo eine gute Entwicklung anzuerkennen ist. Für uns hat sich das als besonders erfolgreich in der Ansprache von RaucherInnen gezeigt. Wir hatten einfach möglichst dreimal im Jahr kurz dokumentiert, wie es ums Rauchen steht, ob die Zigarettenzahl pro Tag noch gleich sei. Das ergab meistens ein ganz kurzes Gespräch übers Rauchen, bei dem ich den PatientInnen gegenüber immer betonen konnte, dass ich keinen Zeigefinger erheben will. Dass es schädlich ist, wissen wir ja gemeinsam. „Haben Sie für sich irgendeine Strategie, wie Sie damit umgehen?“ Immerhin: Ohne dass wir eine konkrete Therapie angeboten hatten, waren nach 6 Jahren 20% NichtraucherInnen. Bei denen, die zu Beginn weniger als 10 Zigaretten pro Tag rauchten, waren es nach 2 Jahren schon 30%.
Das geht parallel zu Studiendaten beim Alkohol. Die Leitlinie fasst zusammen, dass die Kurzintervention am erfolgreichsten bei denen ist, die erst am Eingang in eine schwerere Problematik stehen, also lediglich einen riskanten Konsum betreiben. Beispiel in eigener Praxis war ein Pfarrer, der nur nebenbei mitteilte, er trinke jeden Abend eine Flasche Wein zum Entspannen. Ein kurzes „Meinen Sie, dass das o.k. ist?“, verbunden mit wenigen pragmatischen Tipps genügte, dass er sich selbst eine Strategie zurechtlegte, um – seinen Angaben nach – in den nächsten Jahren stabil mit ein bis zwei Flaschen pro Woche auszukommen. Natürlich ist das nur die Kurzfassung einer umfassenderen Geschichte. Tatsächlich ging es auch um tiefer eingeschliffene Gewohnheiten, eine Lebenskrise, das entstandene Übergewicht, sprich: um einen Gesamtprozess, von dem das Trinken nur ein Teil war. Das gilt häufig. Aber wir müssen nicht immer alles wissen und berücksichtigen. Eine kleine Stellschraube wie das Trinken anzutasten, löst immer wieder Ungeahntes aus. So bin ich manchmal fast erschrocken, wenn Patienten einige Zeit, z.B. zwei Jahre später meinten, sie hätten etwas Grundlegendes geändert, weil ich damals doch etwas gesagt hätte.
Als Therapeut oder Arzt (w/m) ist man sich oft nicht bewusst, welche Worte wie hängen bleiben. Sagt einem jemand z.B. nach 20 Jahren: „Sie haben mir damals gesagt…“, staunt man. Meist kann man sich selbst gar nicht an diese eigenen Worte erinnern. Aber das Erzählte erinnert einen daran, welche Verantwortung man auch mit seinen Nebenbemerkungen hat. Sie bleiben im Gegenüber oft ein Leben lang präsent und einflussreich.
Keine Frage: Kurzinterventionen und speziell das MI, motivational interviewing, sind ein wichtiges, wirksames Instrument, nicht nur dem Alkohol gegenüber, sondern auch in vielen anderen Konstellationen.
In diese Richtung gehen auch die Erfahrungen in Selbsthilfegruppen. Dort findet eine Ansprache unter der Überschrift des – gegenseitigen – Verstehens statt. Betroffene, die angeben, von Gruppenbesuchen oder auch von meetings wie bei den Anonymen Alkoholikern zu profitieren, kann man nur bestärken. Immer wieder hört man beeindruckend, wie unersetzlich das sei.





























