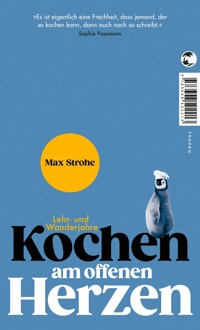13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
»Kulinarische Popliteratur.« Denis Scheck All you can eat? All you can read! Das Buch zur Spiegel-Kolumne. Der bekannte Sternekoch Max Strohe führt durch die Klassiker der kulinarischen Welt: Egal ob Clubsandwich, Trüffel oder Austern – hier verrät er seine Geheimtipps, erklärt, was eigentlich zu welchem Anlass passt, und schaut dabei hinter die Kulissen der Gourmetküche. Es ist angerichtet! Kloß mit Soß' oder Perigord Wintertrüffel. Seeigel im berühmten César in New York oder ein Selbstversuch mit Iglo Fischfilet á la Bordelaise in der heimischen Küche. Max Strohe schreibt nicht nur erfolgreiche Kolumnen für den Spiegel, sondern ist vor allem ein Sternekoch mit Bodenhaftung. Ausgesuchte Gaumenfreuden und Normale-Leute-Küche sind für ihn kein Gegensatz. Stattdessen findet er genau darin immer wieder neue Inspiration. Rheinischer Mutterwitz trifft auf kulinarische Noblesse – in dieser Sterneküche ist für jeden etwas dabei. Lassen Sie es sich schmecken. »Es ist eigentlich eine Frechheit, dass jemand, der so kochen kann, dann auch noch so schreibt.« Sophie Passmann »Ich kann nicht kochen. Aber ich weiß, dass dieser Mann schreiben kann. Meinen Respekt.« Moritz von Uslar »Einer der außergewöhnlichsten Köche Deutschlands.« Tim Raue
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Max Strohe
All You Can Eat
Die kulinarische Kolumne
Tropen Sachbuch
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Tropen
www.tropen.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München unter Verwendung eines Fotos von © Foto: www.robert-schlesinger.com
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-50289-3
E-Book ISBN 978-3-608-12467-5
Inhalt
Pastis, Champagner, Gin – Auster und Sprit passen zusammen. Isso
Das Club-Sandwich – Renken Sie Ihren Kiefer aus, genießen Sie die Sauerei
Hummer, Hummer, Hummer, Täterä!
Der Käsewagen ist mein Lieblingsauto
Kartoffelsalat – Ein Plastikeimerchen vom Discounter grenzt an Gotteslästerung
Wat Butt, dat mutt
Pizza – So muss sie sein, knusprig, sauheiß und mit fast verbrannten Rändern
Instant Noodles – Wir Köche lieben versaute Kombinationen
Bun, Beef, Butter – Die drei Säulen der Glückseligkeit
Das Geheimnis von Gyros Pita? In Olivenöl gebackene Fritten
Gans – Zart as fuck
Das »Ernst« – Deutschland hatte dieses Restaurant nicht verdient
Steak frites – Hier werden alle niederen kulinarischen Bedürfnisse befriedigt
Und zack, da fragt meine 15-jährige Tochter: »Papa, haben wir Kaviar?«
Filet Wellington – Der Blätterteig bringt uns Köche zum Schwitzen
Chickenwings – Ein Biss, und Ihre Seele verlässt den Körper
Pasta al Ragù – Wehe, ihr nennt es »Bolo«
Raclette – Schmelzende Liebe
Sauce Bordelaise – Wiedersehen mit Käpt’n Iglo
Kloß mit Soß’, mehr braucht es nicht
Fine Dining in New York – Schmatzen neben den Ozempic-Hipstern
Trüffel – Fast aristokratisch im Aroma
Bouillabaisse – Ein Teller »Abfall«, der locker einhundert Euro kosten kann
Eggs Benedict – Diese Eier sind das Versprechen, es geschafft zu haben
Hipsterklitschen – »hand picked« und »sustainable«
Foodblogging – Kulinarischer Voyeurismus
Buletten – Star ohne Allüren
Das »L’Ambroisie« – Ich schwelge und schmecke
Paris – Sechs Austern, fünf Seeigel und dann auf zum zweiten Dinner!
Ceviche – Fast noch lebendig in die Limette
Chinatowns – Je mehr Innereien auf der Speisekarte, desto besser das Restaurant
Asiamärkte – Man kauft sich auch ein bisschen Sorglosigkeit und einen Happen Ignoranz
Wahlmenü – Naschen, bis alle Stimmen ausgezählt sind
Spargelzeit – It’s the most wonderful time of the year
Ein Cheesecake, der die ganze Welt durchdrehen lässt
Angrillen – Der Thermomix des Sommers
Coq au Vin – Die Mutter des Slowfood
München ist das neue Berlin
Beilagensalat – Der Endgegner: Dosenmais, schleimige Kidneybohnen, Blattsalat und »Hausdressing«
Das große Fressen durch New York – in 15 Stationen
McDoof – I’m lovin’ it
Bis zur Ankunft des Lieferanten heize ich den Ofen vor, um dann die Pizza zu reanimieren
Pastis, Champagner, Gin – Auster und Sprit passen zusammen. Isso
Austern sind so etwas wie eine Chanel-Tasche. Ein französisch gelesenes Edelprodukt mit der Patina der Tradition, zeitlos und gut kombinierbar.
Egal, ob in der Sylter Sansibar oder der New Yorker Oysterbar: Die Ultras degustieren sich durch die Austernkarten wie Sommeliers durch Weinkeller. Fine de Claire, Tsarskaya, Gillardeau, Austern sind in aller Munde. Die, die sie nicht mögen, zerreißen sich das Maul über sie. Das wohl bekannteste natürliche Aphrodisiakum soll schon Casanova zur Steigerung seiner sexuellen Performance verholfen haben.
Frische und Qualität stehen an allererster Stelle. Ist eine Auster verdorben, dann riecht man das manchmal, man schmeckt es aber immer deutlich. Dann gilt: schnell raus damit; scheiß’ auf Etikette – ab in die Serviette.
Man bestellt ein halbes Dutzend, oder ein ganzes, in Gruppen auch gerne zwei oder drei.
Klassisch werden die Austern serviert mit Zitrone zum Akzentuieren des Aromas, einer süß-sauren Rotwein-Schalotten-Vinaigrette und Chesterbrot, einem Sandwich aus Pumpernickel, kalter Butter und dem Schnittkäse. Auf Nachfrage gibt es gemahlenen Pfeffer und Tabasco. Ich selbst liebe es, sie mit Maggi zu veredeln.
Austern »schlürft« man mal so nebenbei bei einem Glas Champagner, mal genießt man sie bewusst zu besonderen Anlässen. Sie sind ein Symbol für die Simplizität des kulinarischen Luxus. Das Öffnen, es hat etwas Brutales, etwas Archaisches, man braucht Kraft und Willen. Auf privaten Partys findet sich immer ein profilierungswilliges Arschloch, das damit glänzen möchte, seine Erfahrung im Knacken der Weichtiere unter Beweis zu stellen. Die Verwegensten unter ihnen wagen sich ganz ohne Schutz an das Öffnen heran. Veteranen, die zeigen wollen, dass sie sich des Verletzungsrisikos bewusst sind, prahlen mit Narben und dem Wissen darüber, wie unverzichtbar ein Kettenhandschuh sei.
Austern lassen sich sehr einfach öffnen, wenn man sie kurz über Wasser dämpft oder über dem Grill räuchert. FYI.
Klar und gekühlt liegt das herausfordernde Stück Protein in Salzwasser auf reflektierenden Crushed-Ice-Diamanten und schreit danach, inhaliert zu werden. Nach hinten raus schmeckt das reiche Fleisch subtil nach Mandelmilch. Der geschmackliche Verlauf, wie ein fein austariertes Gericht eines Spitzenkoches, unterstreicht die kompositorische Kochkunst der Natur; ein dish made in heaven. Die Aromen transportieren das Meer auf die Zunge und lindern und erzeugen Fernweh gleichermaßen.
In der Küche pürieren wir die Auster zu einer Emulsion. Das Protein ersetzt das Ei, einfach ein bisschen Salz dazu, ein Spritzer Zitrone, und mit Pflanzenöl hochgezogen entsteht eine Mayonnaise, die uns dabei unterstützt, Meeresaroma in Gerichte zu transportieren. Und das Verfahren dient auch der Unkenntlichmachung der Auster. Das Auge isst ja mit.
Die gratinierte »Auster Rockefeller Art« gehört zu den internationalen Klassikern. Die antiquierte Kraft, die in dem Namen »Rockefeller« mitschwingt, ist Sinnbild für Reichtum und Fülle, wie ein kulinarisches Selbstporträt. Sautierter Blattspinat vereint Eisen mit dem Jod. Pernod, Butter, Parmesan, Kräuter für die grüne Farbe wie die eines samtenen Vorhangs, und Semmelbrösel für die Textur, heiß serviert. Im Berliner Kaufhaus KaDeWe serviert man eine gratinierte Auster mit Nordseekrabben und Blattspinat, abgeschmeckt mit zu viel Weißwein und überbacken mit Sauce Hollandaise.
Nicht selten werden Austern in den Kontext alkoholhaltiger Mischgetränke gesetzt: Der »Mexikaner«, ein pikantes Getränk aus Tomatensaft und Wodka, so was wie die Bloody Mary des kleinen Mannes, erfährt durch die Auster ein erschwingliches Upgrade in die Business-Class.
Ob Pastis, Champagner oder Gin: Auster und Sprit passen zusammen. Isso.
Der dreifach besternte Clemens Rambichler im Sonnora serviert die Auster in der Aromenwelt eines Mojitos: mit Minze und einem Hauch von Holunderblüte. Die Frische des Krauts verleiht dem Gericht etwas nahezu Karibisches. Das Chlorophyll lindert die Süße der Blüte, und das Salz der Auster kontrastiert den Cocktail in die Deftigkeit.
Bei Klassikern, wie einem Steinbutt mit Beurre Blanc, geben Austern oft den speziellen Kick, heben die Kreation in eine andere Dimension, geben Tiefe, Länge und Abwechslung.
Oft ist das Zusammenkommen an einer Austernbar der Startschuss für eine ausschweifende Nacht. Als gute Grundlage für den unmäßigen Konsum von Alkohol dienen Austern nicht. Aber sie gelten als die alkoholfreie Alternative zum Konterbier am nächsten Morgen. Sie sind sehr gut gegen den Kater.
Das Club-Sandwich – Renken Sie Ihren Kiefer aus, genießen Sie die Sauerei
Wann immer ich in den Genuss komme, in einem Hotel zu übernachten, das Roomservice anbietet, bestelle ich mir neben zahlreichen anderen Dingen den absoluten Klassiker des In-Room-Dinings, das Club-Sandwich. Das hat nicht nur Tradition. Es ist eine Lebenseinstellung.
Denn sich durch die wiederkehrenden Enttäuschungen durchzuprobieren und den Glauben nicht zu verlieren, das bedarf sowohl der Disziplin als auch des unbedingten Willens. Es bedarf der Gewissheit, dass sich eine kulinarische Genugtuung allererster Güte einstellt, wenn mal wieder ein »Clubbi« dabei ist, welches für sich alleine schon den Aufenthalt im Hotel wert gewesen wäre.
Unverwechselbar und ganz zwingend notwendig sind drei Scheiben Toastbrot, übereinander angerichtet, diagonal halbiert und unter Zuhilfenahme von Cocktailspießen oder Zahnstochern fixiert. Finden Sie nur zwei Scheiben vor, lassen Sie es postwendend zurückgehen. Ist das Brot nicht goldbraun getoastet und erfreut sich hierdurch nicht einer Veredelung durch den champagnerfarbenen Geschmackston, ist das leider ein schlechtes Zeichen: Die faden Teiglinge absorbieren die Dressings, verlieren jegliche Struktur und erinnern stark an die dreieckigen Sandwiches mit saccharinhaltigen Diätmayonnaisen, Atom-Salami und Dosenmais als Füllmaterial. Diese »Dinger« in transparenten Hartplastik-Einweg-Verpackungen in Tankstellen auf Autobahnraststätten.
Toastbrot ist also zum Toasten da. Schocker.
Ein weiteres schlechtes Zeichen ist, wenn statt saftig und mit Röstaromen gegrillter Hähnchenbrust die Reste des Putenbrust-Aufschnittes vom Frühstücksbuffet verwendet werden. Es bringt zum Ausdruck, mit welcher Einstellung man hier dem Club-Sandwich gegenübersteht: Es ist etwas, das so nebenbei passiert. Ein Mittel zur Resteverwertung, ein Essen-gewordener Klotz am Bein der Kochenden, etwas, wofür man nicht extra aufwendig Ware vorhält, sondern wofür man aus dem Warenkorb schöpft, der eh vorhanden ist.
Zwar ist der vorgegarte Aufschnitt nicht selten saftiger als nachlässig gebratenes Fleisch, doch erzeugt er stets eine Art Frühstücks-Assoziation, die beim Club-Sandwich nicht erwünscht ist. Denn der Klassiker ist zeitlos. Ist nicht gebunden an Raum und flüchtige Stunden. 24 Stunden ist seine Zeit. Er nennt das Uhrenrund sein Zuhause. Man clubbt dazwischen und davor oder danach, und vor allem währenddessen. Im Dunklen und im Morgengrauen trägt das Sandwich die Schirmherrschaft des Roomservice und ist Weltenwandler, thront über beiden Menüs und regiert Tages- und Nachtkarte. Availability: always forever.
Kommen wir also zur für mich idealen Besetzung des Klassikers:
Drei Scheiben rösches Weißbrot, nach dem Toasten von der Rinde befreit. Tomatenscheiben, verschwenderisch gesalzen, leicht gezuckert, überpfeffert. Romanasalat gezupft. Im Ganzen saftig gegrillte Hähnchenbrust, anschließend tranchiert. Bacon, kross, aber mit einem Rest zähen Fettes. Ein gebratenes Ei, wachsweich. Eine wunderbare Sauce Mayonnaise.
Fertig.
Manchmal werden Pommes frites dazu serviert. Manchmal Chips. Beides ist fein. Wichtig ist in beiden Fällen die inflationäre Verwendung sogenannter Dips. Im Besonderen aber rate ich für den Fall, dass es Chips geben sollte, unbedingt dazu, diese Teil des Sandwiches werden zu lassen.
Verzehrempfehlung: Renken Sie ihren Kiefer aus. Essen Sie behutsam, aber wolllüstig drauflos. Beißen Sie sich vorsichtig vom Rand hin ins Innere vor. Lösen Sie die Spieße erst, wenn es nicht mehr anders geht. Während Sie sich Richtung Zentrum in Ekstase degustieren, achten Sie darauf, das Eigelb nicht zu zerstören. Ignorieren Sie unbedingt den austretenden Saft der Tomaten, der sich unter die Mayonnaise mischt und Ihr Gesicht besudelt. Vergessen Sie die Serviette. Genießen Sie die Sauerei. Nutzen Sie die Kartoffel-Beigabe, um Ihren Gaumen zu erfrischen, wie Ingwer beim Sushi.
Und wenn es dann endlich so weit ist, liegt vor Ihnen nun der sogenannte »Meisterbeiß«, auch »Megabite« genannt. Halten Sie kurz inne, bevor Sie mit zwei Bissen den Dotter-Teil des Club-Sandwiches inhalieren. Ihre Lippen glänzen. Und Ihre Augen auch: Strass.
Kommt man in den Genuss eines sehr guten Club-Sandwiches, hat man keine weiteren Fragen.
Ach doch, eine: Warum ist kein Käse drauf?
Hummer, Hummer, Hummer, Täterä!
Hummer, Hummer, Hummer, Täterä! Diese Delikatesse ist so etwas wie ein Symbol antiquierter kulinarischer Macht. Allseits präsent in den Auslagen der Edelbistros und Feinkostabteilungen sind Exemplare von amerikanischer, beziehungsweise kanadischer Herkunft. Als absoluter Ober-Luxus gilt allerdings der europäische Hummer aus Schottland oder gar der Bretagne.
Königlich behäbig mäandern die Krebstiere in den kühlen Tiefen des Atlantiks an der Küste vor Loctudy umher, ihre gemusterten Panzer strahlen in herrschaftlichem Kobaltblau. Werden sie nicht in Käfigen gefangen, werden sie fünfzig Jahre alt oder hundert. Hummer werden fruchtbarer und stärker, je älter sie werden: Just like a Rolling Stone.
Fast in Vergessenheit geraten sind die Hummerbecken in Restaurants, in denen die Krustentiere wie Goldfische ausgestellt werden, bevor man sich, ultra-herrschaftlich, das Exemplar seiner Begierde auswählt, und über dessen Tod entscheidet wie der römische Imperator Cäsar.
Im Berliner Grill Royal serviert man also folgerichtig den Salat à la César Cardini, eine Version des Roomservice-Klassikers Caesar Salat, eben sehr royal interpretiert, mit einem halben Hummer.
Ein weiterer, absoluter Klassiker von Welt, der Hummer Thermidor, erstmals erwähnt 1908 im Kontext französischer Bistroküche, präsentiert sich schön zugänglich. Die Rezepturen variieren je nach Region und Überlieferung. Meist mit sautierten Champignons und Spinat kombiniert, reicht man den Hummer in der eigenen, längshalbierten Schale, mit einer Sauce Hollandaise gratiniert. Die Butter der Hollandaise passt perfekt zur nussigen Note des Fleisches, die Säure der Reduktion und die feine, ja hintergründige Anis-Note des unsichtbaren Estragons unterstreicht dezent die hoheitsvolle Subtilität. Der Hummer ist ja der Spargel des Meeres.
Hummer im öffentlichen Raum zu bestellen, ist nicht weniger als eine verwegene Tat großen Mutes. Er gilt als so etwas wie der Endgegner der Emporkömmlinge. Die Bestecke, ja Werkzeuge, die zu seinem Sezieren eingedeckt werden, erinnern an die Instrumente auf den Edelstahl-Tabletts eines Zahnarztes. Entsetzte Blicke treffen sich in der Mitte über der gedeckten Tafel; man hat Angst, erwischt zu werden, so, wie wenn man beim Theaterbesuch nicht weiß, was gegeben wird.
Übertrieben wirkt das Gehabe, künstlich das Zeremoniell. Als Koch weiß ich zwar, wie ich einen Hummer fachgerecht und schnell und rücksichtslos auseinanderbaue, aber Etikette zu Tisch, we don’t know her. Unter der Beobachtung hochnäsiger Kellner, die es vermeintlich besser können, wird die Degustation erst mal zur Nebensache: Lästig ist das Öffnen der Scheren, und überhaupt ist es ist eine wahnsinnige Sauerei. Für den Aufwand entschädigt das kostbare Fleisch. Es schmeckt süß und sanft nach Meer, ist saftig und von buttrigem Schmelz.
In der Küche tragen wir nicht selten zugeschnittene Müllbeutel zum Schutze der regulären Berufsbekleidung. Der Arbeitsplatz gleicht bei der Zubereitung von Hummer dem Schauplatz eines Massakers ohne Blut: Messerrücken sinken mit Wucht auf die Krustentiere herab und spalten sie in zwei Hälften. Scheren durchschneiden Panzer, und Därme werden gezogen. Wasser fließt ständig: aus den Karkassen und aus dem Hahn. Proteine werden abgespült, die Chinin-Platten vorsichtig gezogen; Gelenke geknackt, und Köpfe gespalten. Selten kommt man im Alltag eines Koches näher heran an den »circle of life«.
Die Verarbeitung von Hummer ist also gar nicht so leicht. Sie ist zeitintensiv, logistisch und wirtschaftlich herausfordernd. Aber das Volk wollte den Hummer. Ein Convenience-Produkt musste her: Die »High-Pressure-Lobster« aus dem Tiefkühlregal der Großhändler eroberten mit Hochdruck den Markt; kalkulierbar und frei von Arbeitszeit. Es war also angerichtet: Hummer für alle. Die Kunst der Zubereitung verkam dabei zum Abziehbild des Aufwärmens eines Mikrowellengerichtes. Textur und Geschmack litten empfindlich: Meist widerstandslos und gleichzeitig zäh ersetzte eine eindimensional wässrige Salznote die Güte des edlen Geschmacks. Hummer auf einer Speisekarte zu entdecken, war auf einmal so ähnlich, wie Coldplay als Headliner auf einem Festival-Plakat zu erspähen: kein Grund für einen Besuch.
Einst Berlins einziger Zweisternekoch, kochte Christian Lohse im Fischers Fritz am Gendarmenmarkt eine lupenreine Haute Cuisine. Ein Highlight war nicht nur der stets perfekt zubereitete bretonische Hummer, sondern auch die augenscheinlich dazugehörige Hummerpresse von Christofle und die dadurch gewonnene Sauce – durch ein Gerät aus Sterlingsilber, das weltweit nur dreimal existiert. Mit dem aus den flambierten Karkassen gewonnenen Elixier verfeinert man den Krustentierfond hin in unermessliche Tiefe. Das Protein bindet die Sauce, die Flüssigkeit zieht sämig an, Butter tut den Rest.
Durch eine Sauce à la Presse würzt man letztlich das Produkt mit sich selbst. Hummer hoch zwei.
Am Fuße der Brooklyn Bridge, mit Blick auf die Skyline Manhattans, findet man die amerikanische Interpretation von Hummer auf die Hand, die Lobster Roll.
Längliche, gülden getoastete Brioche-Buns sind die Unterlage für die Delikatesse. Gewürzt wird nur mit flüssiger Butter, einem Spritzer Zitrone und Fleur de sel. Und das ist auch gut so. Denn ein Produkt allererster Güte serviert man am besten pur.
Der Käsewagen ist mein Lieblingsauto
Die drei Säulen des Autoquartetts: Hubraum, Pferdestärke, Höchstgeschwindigkeit.
Die drei Säulen des Käsewagens: Hartkäse, Blauschimmel, Ziegenkäse.
Von null auf hundert auf der Skala der Glückseligkeit in fünf oder sieben Sorten. Endspurt sozusagen, denn Käse schließt den Magen und ein Käsewagen entschädigt für vieles, übernimmt die Verantwortung, wie gestandene Spieler bei großen Turnieren, die als Joker von der Bank kommen und den spielentscheidenden »Unterschied« machen können.
Die Reifen rollen lautlos und behäbig, aber komfortabel Richtung Gast. Schwer gleitet die Limousine unter der Last ihrer fetten Fracht über Böden jeder Art. Sie wirkt wie tiefer gelegt. Käsewagen haben immer Vorfahrt: VIP on board.
Wie ein Security-Mitarbeiter, oder vielmehr wie Kevin Costner als Bodyguard, flankiert ein befrackter Maître das wertvolle Gut, sichert die Ausgänge und die Route zwischen den einzelnen Tischen, deren Gäste dem Wagen mit Blicken folgen, ihm hinterherstarren.
Die Stimmung im Gastraum ändert sich schlagartig, wenn der Wagen das erste Mal den Motor aufheulen lässt. Es ist, als würde das Licht gedimmt, als wechsele die Musik oder die Lautstärke, und als passe sich der Rhythmus des Restaurants der Gemächlichkeit eines dahinscheidenden Abends an; wie bei einer ausgelassenen Beerdigung, falls es so etwas gibt.
Edler Gestank macht die Luft zum Schneiden dick. Die Reife der Vergangenheit gebietet dem Trubel im Gastraum Einhalt, das Zeremoniell der Präsentation ist eine Reminiszenz an längst vergangene Tage herrschaftlicher Opulenz. Alter Port wird in kleinen Schlücken serviert.
Der Wagen ist also vorgefahren. Es beginnt. Oft lautet die Frage, wie kräftig es denn sein soll, ob es lieber was Gereiftes sein darf? Ja, gerne, voll aufs Maul, bitte! Ob man das wirklich wolle? Ja, Mann, man will! Motiviert zieht der Käsekellner die Braue hoch und nickt anerkennend. Er wird zeigen, was er kann. Er wird die PS auf die Straße bringen.
Ein Käseteller folgt einer Dramaturgie. Es beginnt subtil und endet dramatisch abrupt, wie ein unvorhersehbarer Cliffhanger einer gut konzipierten Serie mit Suchtfaktor. Die süßen Beigaben dienen dem Kontrastieren und den Verschnaufpausen, die nachsichtige Konsumenten ihrem beanspruchten Gaumen gönnen. Der Feigensenf ist der Sushi-Ingwer der Käsedegustation.
Die Käsewagen-Beauftragten, ja die Chauffeure, sie haben ein fast ehrfürchtig geprägtes Verhältnis zu den Affineuren, denen sie treu verpflichtet sind. Es wird angerichtet. Ein Stück perfekt temperierter, cremiger Selles-sur-Cher räkelt sich da wie ein Pin-up-Girl auf der Karosserie eines senfgelben Porsche Targa. Ein Ziegenkäse aus dem Loire-Tal, in Asche und Salz gereift. Fein und intensiv.
Ein Comté aus dem Gebiet um das Jura herum: Lediglich zwei Kuhrassen dürfen hierfür ihre Milch geben, zwei Jahre gereift, feine Salzbildung durch die Proteine.
Ein absoluter Klassiker, der polarisiert, ist der Époisses, ein unverkennbarer Rotschmier-Käse, gewaschen mit Marc de Bourgogne, einem Tresterbrand aus dem Burgund; sehr kräftig und sehr cremig.
Der Gruyére, der Schweizer Comté, wenn man so möchte, direkt aus den Alpen, 22 Monate auf 2000 Metern Höhe gereift. Die Schweizer reifen ihre Käse bei höheren Temperaturen; sie sind also fortgeschrittener, sind kräftiger und intensiver. Und zum Finale Fourme d’Ambert aus der Auvergne, täglich mit Sauternes veredelt, zuerst zurückhaltend, dann kraftvoll und sehr lange am Gaumen.
Das Reinigen der Käsemesser durch den Käsewagen-Beauftragten ähnelt den Szenen aus Fantasy-Serien, in denen ein Oberhaupt einen Abtrünnigen mit einem Schwert enthauptet und dann das Blut an der Klinge ungerührt, aber dennoch theatralisch mit einem Lappen säubert, um sicherzustellen, dass beim nächsten Kampf die Schneidekraft nicht unter den Unebenheiten angetrockneter Reste leidet.