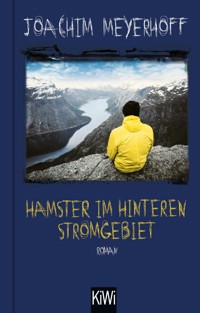9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alle Toten fliegen hoch
- Sprache: Deutsch
Der äußerst unterhaltsame Aufbruch eines Jungen ins Leben – der Auftakt der Romanreihe »Alle Toten fliegen hoch« von Joachim Meyerhoff Von der ersten Seite an folgt der Leser gebannt Meyerhoffs jugendlichem Helden, der sich aufmacht, einen der begehrten Plätze in einer amerikanischen Gastfamilie zu ergattern. Aber schon beim Auswahlgespräch in Hamburg werden ihm die Unterschiede zu den weltläufigen Großstadt-Jugendlichen schmerzlich bewusst. Konsequent gibt er sich im alles entscheidenden Fragebogen als genügsamer, naturbegeisterter und streng religiöser Kleinstädter aus – und findet sich bald darauf in Laramie, Wyoming, wieder, mit Blick auf die Prärie, Pferde und die Rocky Mountains. Der drohende Kulturschock bleibt erst mal aus, der Stundenplan ist abwechslungsreich, die Basketballsaison steht bevor, doch dann reißt ein Anruf aus der Heimat ihn wieder zurück in seine Familie nach Norddeutschland – und in eine Trauer, der er nur mit einem erneuten Aufbruch nach Amerika begegnen kann. Mit diesem hochgelobten Debüt eröffnet Joachim Meyerhoff eine große Romanreihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Joachim Meyerhoff
Alle Toten fliegen hoch
Teil 1: Amerika
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joachim Meyerhoff
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joachim Meyerhoff
Joachim Meyerhoff, geboren 1967 in Homburg/Saar, aufgewachsen in Schleswig, hat als Schauspieler an verschiedenen Theatern gespielt, unter anderem am Burgtheater in Wien, am Schauspielhaus in Hamburg, an der Berliner Schaubühne und den Münchner Kammerspielen. Dreimal wurde er für seine Arbeit zum Schauspieler des Jahres gewählt. 2011 begann er mit der Veröffentlichung seines mehrteiligen Zyklus »Alle Toten fliegen hoch«. Seine Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt 2024 mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor.
Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch
»Alle Toten fliegen hoch. Amerika«, »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war«, »Die Zweisamkeit der Einzelgänger«, »Hamster im hinteren Stromgebiet«
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Joachim Meyerhoff erzählt von der Sehnsucht eines Teenagers nach einem Neuanfang, ganz weit weg und auf sich gestellt, und von einem Verlust, der alles zunichtezumachen droht. Der Leser ist sofort an der Seite des jugendlichen Helden, der sich Mitte der Achtzigerjahre aufmacht, einen der begehrten Plätze in einer amerikanischen Gastfamilie zu ergattern. Aber beim Auswahlgespräch werden ihm die Unterschiede zu den weltläufigen Großstadt-Jugendlichen schmerzlich bewusst. Konsequent gibt er sich als genügsamer, naturbegeisterter und streng religiöser Kleinstädter aus – und findet sich bald darauf in Laramie, Wyoming wieder, mit Blick auf die Prärie, Pferde und die Rocky Mountains. Der drohende ›Kulturschock‹ bleibt aus, die Basketballsaison steht bevor, doch dann reißt ein Anruf aus der Heimat ihn wieder zurück in seine Familie nach Norddeutschland – und in eine Trauer, der er nur mit einem erneuten Aufbruch nach Amerika begegnen kann.
Dieser mitreißende Entwicklungsroman erzählt von Liebe, Fremde, Verlust und Selbstbehauptung und begeistert durch Sensibilität, Selbstironie und Witz.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2011, 2013, 2015, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © privat
Karte: Oliver Wetterauer, Stuttgart
ISBN978-3-462-30225-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Karte von Wyoming
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Für Alberta
1. Kapitel
Mit achtzehn ging ich für ein Jahr nach Amerika. Noch heute erzähle ich oft, dass es ein Basketballstipendium war, aber das stimmt nicht. Meine Großeltern haben den Austausch bezahlt.
Von der norddeutschen Kleinstadt, in der ich nicht geboren, aber aufgewachsen bin, braucht der Eilzug nach Hamburg keine zwei Stunden. In diesen Zug stieg ich ein und suchte mir einen Sitzplatz.
Geboren bin ich seltsamerweise in Homburg im Saarland, von wo aus wir nach nur drei Jahren nach Norddeutschland umgezogen waren. Da ich leider nicht zu den genialischen Menschen gehöre, deren Erinnerung mit pränatalen Fruchtwassererlebnissen oder Mozartschallwellen einsetzt, oder zu denen, die gestochen scharfe Bilder ihrer frühesten Lebensjahre in wohlbehüteten Gehirnkammern aufbewahren, zum Beispiel, wie sie mit anderthalb gegen eine geschlossene Glasschiebetür geknallt sind, habe ich an Homburg im Saarland nicht die geringste Erinnerung. Ganz verschwommen sehe ich hin und wieder eine Elster, eine saarländische Elster, die auf der Schiebestange meines Kinderwagens sitzt und mich anstarrt.
Das mit der Glasschiebetür ist mir selbst widerfahren. Ich konnte gerade laufen. Mein ältester Bruder setzte mich in einen Sessel und ging auf die Terrasse hinaus. Erst wenn er meinen Namen rief, durfte ich vom durchgesessenen Blumenmustersessel hinunterkrabbeln und auf meinen noch wackeligen Beinen durch das Zimmer hinaus ins Freie, in seine Arme rennen. Über die Bodenschienen der Schiebetür hinweg hätte ich jedes Mal einen niedlichen Hopser gemacht. Angeblich konnte ich von diesem Im-Sessel-Sitzen und Auf-Kommando-ins-Freie-Laufen im Gegensatz zu meinem Bruder nicht genug bekommen. Schon in seinen Armen, den Bruderarmen, hätte ich »Noch mal! Noch mal!« gerufen. Nach dem zwanzigsten oder fünfundzwanzigsten »Noch mal! Noch mal!« setzte mich mein Bruder wieder in den Sessel und zog die Schiebetür zu, um herauszufinden, ob ich schon wüsste, dass man nicht durch Glas gehen kann. Ich wusste es nicht und donnerte mit solcher Wucht gegen die Scheibe, dass meiner Mutter vor Schreck das Buch bis an die Zimmerdecke flog und mein Vater in der Küche dachte, jemand hätte mit voll Karacho einen Fußball gegen die Schiebetür geschossen. Wie eine unsichtbare Faust hatte mich die Scheibe auf dem Weg in die weit geöffneten Arme meines Bruders niedergestreckt. Mein Vater kam und wollte den Übeltäter schimpfen, fand aber nur mich. Vor der Tür liegend, benommen, wie eine gegen das Fenster geknallte Amsel. Mein Bruder wurde ermahnt, keine Experimente mit mir zu machen, und in sein Zimmer geschickt. Auf der Scheibe waren in geringem Abstand ein Speichel- und ein Fettfleck. Ich soll nach dieser Kollision mit dem Nichts mehrere Tage lang beim Umhergehen verängstigt mit vorgestreckten Händen die Luft abgetastet und nach unsichtbaren Mauern gesucht haben. Das, so mein Vater, wäre ihm damals sehr zu Herzen gegangen. Ich hätte mit meiner riesigen, grün-blauen Beule auf der Stirn, den weit aufgerissenen Augen und den suchenden Fingerchen wie ein kleinwüchsiges, fremdartiges Wesen von sehr, sehr weit her ausgesehen. Jahre später sagte mein Vater zu mir: »Es sah aus, als würdest du auf einer unsichtbaren Schreibmaschine geheime Botschaften in die Luft tippen.«
An etwas anderes erinnere ich mich selbst noch ganz genau. Ich rollte mit dem Fahrrad eine Straße entlang und sank plötzlich ein. Mitten in der Stadt. Der Asphalt gab nach und mein Vorderrad versank knapp einen halben Meter tief. Als sich die Straße auftat, wusste ich noch nicht, dass es nur einen halben Meter tief hinabgehen würde. Es fühlte sich so an, als ob ich gleich kopfüber ins Erdinnere fallen würde. Gut, dass mir das erst später, mit ungefähr vierzehn, und nicht schon damals in meiner Geburtsstadt, diesem Homburg im Saarland, mit zwei Jahren auf einem Dreirad widerfahren ist. Kein Vertrauen in die Festigkeit der Erdoberfläche und brutale Schläge aus dem Nichts hätten vielleicht doch zu nachhaltigeren Verunsicherungen führen können.
Manche frühen Erinnerungen sind auch deshalb so stark, weil sie wie Wunder daherkommen, unerklärlich und hinterrücks über einen hereinbrechen:
Ich bin ungefähr zehn, knie auf dem Gehsteig und male mit Straßenkreide eine Kuh. Bis heute kann ich keine Kuh malen, kein einziges Tier kann ich malen. Ich kann es wirklich nicht. Ich würde es so gerne können. Mir eine Kuh vorstellen, die Kreide zücken und malen. Mit wenigen lockeren Linien den Umriss skizzieren und schon liegt da eine Kuh auf dem Gehweg. Doch selbst unter Androhung der schlimmsten Folter könnte ich es nicht. Das habe ich mir damals oft überlegt, ob ich etwas besser können würde, wenn mir etwas Grauenhaftes angedroht würde: »Los! Löse diese Rechnung, oder wir erschießen euren Hund!« Hätte das genützt? Vor Schwimmwettkämpfen habe ich mir immer vorgestellt, dass es um mein Leben oder das meiner Brüder oder Eltern gehen würde: »Los! Schwimm, so schnell du kannst! Nur wenn du Kreismeister wirst, sagen wir dir, wo wir die Kiste mit deinen Eltern im Wald vergraben haben.« Ich hatte von meinem ältesten Bruder erzählt bekommen, dass eine Mutter, deren Kind unter die Kette einer Schneeraupe gerutscht war, diese Schneeraupe hochgewuchtet und umgekippt hatte. Schlummerten solche Kräfte auch in mir? Und was musste geschehen, um sie zu entfesseln? Mit solchen Fragestellungen konnte ich mich stundenlang beschäftigen!
Ich knie auf dem Gehsteig und versuche, eine Kuh zu malen. Da kommt ein Mann, bleibt vor mir stehen, packt mich mit der einen Hand am Fußgelenk, mit der anderen am Handgelenk, schleudert mich einmal im Kreis herum und wirft mich über eine hohe Hecke. Einfach so! Ich fliege durch die Luft und lande bei fremden Leuten im Garten, die gerade feierlich Tomaten ernten und jede Tomate in die Sonne halten. Die Frau stürzt auf mich zu. »Was fällt dir denn ein? Du spinnst wohl. Steh sofort auf! Mach, dass du aus unserem Garten kommst!« Sie packt mich am T-Shirt und zerrt mich zu einem Gartentörchen. Der Mann brüllt: »Du unverschämter Bengel! Hau ab, sonst knallt’s!« Der Kopf des Mannes wird vom Brüllen so schön rot wie die Tomate in seiner Hand. Er droht mir mit einer grünen Schaufel und sabbert vor Zorn auf sein verschwitztes Unterhemd. Die Frau öffnet das Törchen, greift mir in die Haare, reißt an meinen blonden Locken, schüttelt mich, kreischt immer wieder »Das ist unser Garten! Ist das so schwer zu verstehen? Das ist unser Garten! Hau ab! Das ist unser Garten!«, und schubst mich mit solcher Gewalt auf den Gehweg, dass ich stolpere und mir ein Knie blutig schlage. Ich sitze da und fange an zu weinen. Eine andere Frau kommt den Gehweg entlang, zeigt auf meine halb fertige Kuh und sagt: »Warum weinst du denn? Das wird doch ein schönes Pferd!«
Diese Begebenheit hat höchstens vierzig Sekunden gedauert und ist eine Erinnerung von unanfechtbarer Größe. Als ich am Abendbrottisch erzählte, dass mich ein Mann über eine Hecke geworfen habe, bekamen meine beiden Brüder einen Lachanfall und sagten abwechselnd Dinge wie »Ja, und mich hat gestern einer über die Straße geworfen!« oder »Der wird überall gesucht. Da hast du aber noch mal Glück gehabt! Eigentlich beißt er Kindern, bevor er sie über die Hecke wirft, den Kopf ab!«. Sie lachten dabei so sehr, dass ihnen der Schinken vom Brot fiel. Ich wurde böse, stellte mich auf den Stuhl und krempelte mein Hosenbein hoch. »Und was ist das hier?«, rief ich verzweifelt. Meine Mutter fragte mich: »Was hast du denn mit deinem Knie gemacht, mein Lieber?« Ich antwortete: »In dem Garten, wo ich gelandet bin …«, meine Brüder brüllten »Gelandet!!!« und rutschten vor Lachen von ihren Stühlen unter den Tisch.
Der Zug knallte mit den Türen und setzte sich in Bewegung Richtung Hamburg. Ein letzter frühkindlicher Schicksalsschlag, der mit Hamburg, meinem Reiseziel an diesem Tag, zu tun hatte: In der zweiten Klasse machte ich einmal einen Schulausflug zu einer Rutschenausstellung. Wir kamen mit dem Bus an, und vor uns ragten unglaubliche Rutschen in die Höhe. Hubbelrutschen, Röhrenrutschen, Rutschen mit Steilkurven und sogar eine Riesenrutsche, auf die, das hatte unsere Lehrerin feierlich angekündigt, eine Rolltreppe hinaufführen würde. Sie rief damals mit Abenteuerpathos in der Stimme von ihrem Platz neben dem Fahrer in den Bus hinein: »Diese Rutsche ist der Mount Everest unter den Riesenrutschen!« Noch ehe der Bus gehalten hatte, drängten sich alle auf die eine Seite – ein Schiff wäre gekentert –, und zig Finger zeigten auf die alle anderen überragende Riesenrutsche. Wir wollten so schnell wie möglich aus dem Bus raus und loslaufen. Nur mit Mühe, immer wieder von vor Rutschdrang entfesselten Schreien unterbrochen, gab die Grundschullehrerin ihre Anweisungen: »Fasst euch bitte an den Händen!« In einer gebändigten, zum Losspurten bereiten, energiegeladenen Zweierreihenformation quälten wir uns über den Parkplatz zu den Kassen. Jeder bekam an einem Band eine Eintrittskarte um den Hals gehängt. Man durfte rutschen, so oft man wollte. So oft man wollte! Ein Rutschenparadies.
Nachdem wir einzeln durch die Drehkreuze geschleust worden waren, konnten wir endlich losstürmen. Ich war schnell und überholte einige meiner Mitschüler auf dem Weg zum Eingang der Riesenrutsche. Am Fuß der Rutsche legte ich meinen Kopf in den Nacken. Sie war viel höher, als ich es für möglich gehalten hatte. Ich stellte mich in die Schlange und betrat die Rolltreppe, die eher eine Art Förderband war mit einem sich in die Höhe schiebenden Handlauf. Nach knapp fünf Metern erreichte man eine umgitterte Plattform, musste um die Ecke gehen und sich auf das nächste Förderband stellen. So ging es viele Male, bis man oben war. Windig war es, dachte ich, ganz klar andere thermische Bedingungen als unter mir im Flachland. Man konnte weit sehen. Bis zum Hafen. Eine Ampel sprang alle paar Sekunden von Rot auf Grün und regelte so den Rutschfluss. Ich stellte mich an. Ich schubste und drängelte, da ich von hinten geschubst und gedrängelt wurde. Nur noch zwei vor mir. Grün! Wie von einem Strudel erfasst, wurde das Kind, das an der Reihe war, in die Tiefe gesogen, verschwand im leuchtenden Plastikmaul. Die Ampel sprang auf: Rot! Dann wieder: Grün! Das Mädchen vor mir zögerte, drehte sich kurz um und sah, dass es kein Zurück mehr gab. Die geballte, vorwärtspulsierende Sehnsucht der nachdrängenden Kinder ließ ihr keine Wahl. Sie setzte sich, wollte vorsichtig rutschen, doch das Gefälle interessierte sich nicht für ihre Bedenken und strudelte auch sie hinab.
Jetzt war ich an der Reihe. Rot! Warum war es so ewig lange Rot? Dann: Grün! Mutig, mit zwei kräftigen Schritten Anlauf, warf ich mich in den Rutschkanal. Ich warf mich hinein und – blieb am Boden kleben! Mit einem quietschenden Bremsgeräusch saugte sich meine Hose an der Rutsche fest. Ich gab mir Schwung mit den Händen, doch ich kam nicht von der Stelle. Obwohl es so steil war. Sobald meine Hose die spiegelglatte Plastikabfahrt berührte: Stillstand. Ich begriff nichts. Ich kam auf die Füße und lief im Krebsgang die nächste Windung hinunter. Setzte mich, stieß mich, wie ein versehrter Leprakranker mit umwickelten Stümpfen, mit den Händen voran. Nichts, einfach nichts. Ich rutschte keinen Millimeter.
Genau in dem Moment, als mir klar wurde, warum ich ein Aussätziger war, warum mich der große Rutschenfluch ereilt hatte, als mir dämmerte, dass es keine Strafe Gottes war, sondern dass es eine ganz und gar nicht weniger schlimme Erklärung gab, genau in diesem Moment, als mir klar wurde, dass die Hose, die kurze Hose, die ich mir am Morgen völlig sorglos, ja heiter herausgesucht hatte, eine von mir geliebte mit Hosenträgern und Hirschhornhirsch verzierte Lederhose, der Grund für meine vollkommene Rutschuntauglichkeit war, genau in diesem Moment, als mir dies alles klar wurde und mich mit großem Kummer, ja Entsetzen überschwemmte, traf mich mit voller Wucht, Schuhe voran, der nächste rasende Rutscher wie ein Projektil im Rücken. Er schrie mich an: »Rutsch, Mensch, rutsch!« Ich brüllte zurück: »Ja, wie denn? Wie denn? Ich kann nicht. Ich kann doch nicht!« »Mensch, los! Der Nächste kommt gleich!« Ich versuchte, mich hinzustellen, kam auf die Füße und stieß mir den Kopf. Gebückt stolperte ich ein Stück den abschüssigen Tunnel hinunter. Ich fiel nach vorne und landete auf dem Bauch. Der Lederlatz quietschte, das handgeschnitzte Hirschkopfemblem darauf knirschte übers Plastik. Ich war eine einzige Vollbremsung. Nichts an mir rutschte. Meine nackten Oberschenkel bremsten, meine Schuhe, meine Hände. Da rauschte das nächste Kind in das Kind hinter mir, prallte mit dem Gesicht gegen die Röhre und brüllte los: »Ahhhhhhh!« Durch die Enge verdoppelte und verdreifachte sich das Gebrüll. Eine Sandale traf mich am Hals, direkt in mein Ohr schrie es: »Setz dich hin, du Idiot! Jetzt rutsch doch endlich, du Spasti!« Auch meine eigenen Verzweiflungsschreie türmten sich auf, Hall und Widerhall, und gellten mir in den Ohren. Panik ergriff mich. Ich rannte und fiel, quietschte und stieß mich die Riesenrutsche hinunter. Nach jeder Serpentine erwartete ich den rettenden Ausgang, Licht am Ende des Rutschentunnels. Doch es nahm und nahm kein Ende. Hinter mir staute sich eine keifende minderjährige Meute, und ich kämpfte mich Windung für Windung weiter hinab durch diese Spirale der Demütigung. Mein Bein knickte weg, verhedderte sich mit anderen Beinen, verhakte sich mit anderen Armen. Wir wurden langsamer, und schließlich standen wir still. Ein in sich verkeilter Haufen schreiender Kinder verstopfte die Rutsche. Mit den Füßen voran prallten die nächsten Rutscher in den Pfropfen und drückten ihn Meter für Meter durch den roten Plastikdarm. Da hörten die Kurven plötzlich auf, es ging noch steiler bergab, fast im freien Fall, und das Kinderknäuel wurde auseinandergerissen. Mit letzter Kraft schoss ich, ein völlig verstörter Korken, aus der Röhrenöffnung heraus und kopfüber in den Sand. Auf mich drauf zornige, heulende, um sich tretende und schlagende Bestien. Der Haufen entwirrte sich rasch, sie klopften sich den Sand von den Hosenbeinen, wischten sich die Tränen ab und rannten zum Fuß der Rutsche, um sich vom Förderband für einen zweiten, sicherlich glücklicheren Versuch hinauftragen zu lassen.
Ich stand auf. Im Sand sah ich meinen Abdruck. Klar umrissen, wie in einem Krimi, wo die Erschossenen mit Kreide ummalt werden. Ich hatte Sand im Mund. Viel Sand. So, als hätte mir jemand eine gehäufte Schaufel hineingeschippt. Ich schleppte mich ein Stück weiter, setzte mich auf den Rasen. Diese scheiß Lederhose! Meine Mutter war schuld. Keiner in der Schule trug Lederhosen. Nur ich. Wie hatte ich ihr nur glauben können, dass man stolz darauf sein müsse, etwas anzuziehen, was sonst keiner anzieht. Ein Kleidungsstück, das nichts weiter war als eine nostalgische Verklärung, eine sentimentale Reminiszenz an ihre ach so idyllische Kindheit in Bayern, die ich jetzt im Norden auszubaden hatte. Immer hatte ich diese Lederhose geliebt, jetzt hasste ich sie.
Die Lehrerin kam zu mir, und auf ihre Frage »Was ist denn? Warum rutschst du denn nicht?«, antwortete ich: »Ich kann nicht!« Der Sand knirschte zwischen meinen Zähnen. »Wie, du kannst nicht? Das ist doch ganz einfach!«, lachte sie, »rutschen kann doch jeder!« Ich trampelte mit den Schuhen auf dem Rasen herum und warf mich nach hinten. »Eben nicht! Eben nicht! Eben nicht!« Die Lehrerin kannte meine Zornattacken, deren Auslöser oft kaum zu durchschauen waren. Sie sagte: »Na, dann kann ich dir auch nicht helfen. Guck mal da, da sind auch noch liebere Rutschen!« Dieses »liebere Rutschen!« gab mir den Rest. Ich sprang auf und rannte davon. Ich versuchte, mir die Du-darfst-so-oft-rutschen-wie-du-willst-Karte vom Hals zu reißen. Ich weiß noch, wie ich zornig an ihr zerrte, sie aber eben nicht riss. Ich sie mir über den Kopf ziehen musste und durch mein unkontrolliertes Rupfen mit dem Band mein eines Ohr schmerzhaft umklappte. Ich warf sie weg und rannte zum Bus. Der Busfahrer hatte die Bustür offen und lag ausgestreckt in einem Liegestuhl. »He, was ist denn los? Was vergessen?« Ich log: »Ich bin krank und soll mich ausruhen!« »Na, dann geh mal rein!« Ich ging zu meinem Platz. Da lag noch das Papier meines Lieblingsschokoriegels. Ich warf mich in meinen Sitz. Von meinem Platz aus sah ich den Gipfel der Riesenrutsche und Kinderköpfe, Finger im Maschendraht der Gipfelplattform.
Auf der Rückfahrt schwärmten und johlten alle durcheinander, prahlten und übertrumpften sich gegenseitig mit den wildesten Rutscherlebnissen: »Ich bin die Riesenrutsche auf dem Bauch …«, »Ich dachte, ich flieg voll aus der Kurve!«, »Und wie wir dann alle zusammen …!«. Meine Mitschüler aßen ihren Proviant. Drehten die Wurst- und Schinkenbrote mit ihren geschickten Fingerchen hin und her und knabberten das Weiche von der Rinde. Und dann schlief die ganze Horde einfach ein. Erlebnisgesättigte Stille. Dem Jungen neben mir entglitt die halb geschälte Banane, wurde nach und nach bräunlich, während der Bus gemächlich Richtung Heimatstadt fuhr. Die Lehrerin plauderte mit dem einhändig fahrenden, sonnenverbrannten Busfahrer, lachte so komisch, wie ich sie noch nie lachen gehört hatte, und meine Mitschüler zuckten in ihren Träumen. Die rutschen, dachte ich, wahrscheinlich immer noch. Gedurft hätten sie. Denn das Tagesticket hing jedem von ihnen wie eine Medaille um den Hals.
Auf der Zugfahrt von der Stadt, in der ich nicht geboren, aber aufgewachsen bin, nach Hamburg gibt es erst auf den zweiten Blick einiges zu sehen. Nach fünf Minuten kam ein kleiner See, der sogenannte Hinterteich, in dem mein ältester Bruder oft mit lebenden Köderfischen angelte. Das war eigentlich verboten, aber darum kümmerte er sich nicht. Den Angelhaken stieß er ihnen einfach um die Wirbelsäule herum durch den Rücken. Mehrere so präparierte Fischlein hingen wie an einem Mobile im Wasser und sollten durch ihre sanfte, dem Tode geweihte Agonie die Hechte anlocken.
Mein Bruder war nicht nur ein passionierter Angler, sondern auch stolzer Besitzer mehrerer 300-Liter-Aquarien. Es war noch gar nicht lange her, dass er zusammen mit seinen Freunden in seinem abgedunkelten Zimmer Kampffischturniere veranstaltet hatte. Die Freunde trugen in mit Wasser gefüllten Plastiksäckchen ihre besten Kämpfer in sein Zimmer. Mit einem Taschenspiegel wurden die Kampffische aggressiv gemacht. »Nichts«, sagte meine Bruder, »hasst ein Kampffisch so sehr wie sich selbst!« Voller Zorn, mit aufgefächerten Flossen, attackierten sie ihr Spiegelbild. Wenn sie nach Expertenmeinung genug Angriffslust aufgebaut hatten, wenn sie »richtig heiß« waren, kamen zwei von ihnen in das pflanzenlose Kampfbecken. Mein Bruder und seine Freunde hockten darum herum und feuerten die Fische an. Durch Flehen, Handlangerdienste und unter auf Knien gegebenen Schwüren hatte ich das Herz meines Bruders erweicht und durfte hin und wieder zusehen. Die Kampffische stürzten sich aufeinander, jagten sich, bissen sich. Sie hörten nicht eher auf, bis einer von ihnen tot war und von seinem Besitzer enttäuscht herausgefischt wurde. »Mein Gott, was für ne nasse Null!« Die Sieger waren allerdings keine strahlenden. Bisswunden und eingerissene Flossen waren die Insignien ihres Mutes. Häufig verstarben die schillernden Helden schon kurze Zeit später, überlebten die Besiegten nur um eine lächerliche Stunde, und folgten ihnen durchs Klo ins Kampffischjenseits. Mein Bruder und seine Freunde erzählten gerne Veteranengeschichten. Erzählten von Fischen, die zehn, ach was, fünfzehn Kämpfe überstanden hatten und noch als schwanz- und flossenlose, mit Narben übersäte Krüppel verbissen weiter angegriffen hätten. Im Garten hatten wir einen kleinen Friedhof. Hier lagen Meerschweinchen und Zebrafinken. Eine extra Sektion war der Heldenfriedhof. Hier wurden die Kampffische, die zu Ruhm gekommen waren, die wenigen wahren Sieger, zur letzten Ruhe gebettet. Brettchen mit klangvollen Namen schmückten die Gräber: »Diamond Dog«, »Major Tom« oder »Ziggy Stardust«. Gewettet wurde um kleine Geldbeträge, die rund ums Aquarium auf der Tischplatte lagen. Als mein Vater von den Kampffischwettkämpfen erfuhr – er hatte ein arg zerrupftes Exemplar in der Kloschüssel entdeckt –, war er sprachlos, verbot sie strengstens und hielt meinem ältesten Bruder eine Moralpredigt über die Achtung vor der Kreatur. Ich wurde verdächtigt, ihm alles gepetzt zu haben. In einem halbstündigen Schwitzkastenverhör versuchte mir mein Bruder die Wahrheit abzupressen. »Los, Verräter, gib zu, dass du uns verpfiffen hast!« Das war das Ende der Wettkämpfe, und die in Bundeswehrparkas herbeischlurfenden Freunde mit ihren Plastikbeutelgladiatoren verschwanden. Worüber ich noch oft nachgedacht hatte, war Folgendes: Warum sanken einige der getöteten Kampffische zum Grund und warum trieben andere an der Oberfläche? Wen machte der Tod leicht und wen schwer?
Nach zehn Minuten Zugfahrt erschien ein hundert mal hundert Meter großer Baggersee mit einer automatischen Wasserskianlage. Wo ich immer, immer mal hinwollte. An einer Art Schlepplift kann man sich dort im Karree über das Wasser ziehen lassen. Nach fünfzehn Minuten gab es einen Blick auf die weit entfernten Hüttener Berge und die Kuppeln dreier in der Sonne glänzender, kugelförmiger Radaranlagen. Angeblich waren dort auch mehrere Langstreckenraketen im Boden versenkt. Unter automatischen Luken, in Schächten verborgen, jederzeit bereit, in nur sechsunddreißig Minuten nach Moskau zu zischen. Kurz sah ich die Kuppe des höchsten Bergs Schleswig-Holsteins: den Bungsberg. Mit 168 Metern eine Vollkatastrophe von Berg. Aufgrund der lächerlichen Höhe ist ein Datum der Erstbesteigung nicht bekannt.
Ich war ein wenig aufgeregt, denn der Grund für meine Reise nach Hamburg war ein besonderer. Ich hatte in der Schule einen Tag freibekommen und sollte am Mittag an einem Ausscheidungsverfahren teilnehmen, das darüber entscheiden würde, ob ich nächstes Schuljahr für ein Jahr nach Amerika gehen könnte. Die Organisation, mit der ich den Austausch plante, hatte mir mehrere Briefe geschrieben und immer den Eindruck erweckt, als wäre es ein riesiges Glück, wenn sie ausgerechnet mich auswählen würden. Dabei sollten meine Eltern beziehungsweise meine Großeltern viel, viel Geld dafür bezahlen, um mir dieses Gefühl, einer der Auserwählten zu sein, zu finanzieren. Ich wollte es so sehr. Ich wollte unbedingt weg. Weit, weit weg. Es waren Dinge vorgefallen, die ich hinter mir lassen wollte.
Was mich an diesem Nachmittag erwarten würde, wusste ich nur ungefähr: Ein Sprachtest, wahrscheinlich ein paar Gruppenspiele, um herauszufinden, ob ich tatsächlich der neugierige, selbstbewusste, natürlich auch rücksichtsvolle junge Mann war, als der ich mich beworben hatte. Dann noch ein Einzelgespräch und ein umfassender Fragebogen. Der Fragebogen war angeblich das Wichtigste, da auf ihn hin die passende Gastfamilie ausgesucht wurde. Und dann hatte ich in Hamburg auch noch etwas ganz anderes vor. Ich hatte einen Plan, der mich ebenso, wenn nicht sogar noch mehr in Aufregung versetzte als mein erhofftes Auslandsabenteuer.
Nach einer guten halben Stunde Fahrzeit kam ich nach Rendsburg. Nach Verlassen des Bahnhofs macht der Zug eine sehr elegante Kurve, schraubt sich in einer weiten Schleife auf eine Höhe von zweiundvierzig Metern und überquert auf der in Schleswig-Holstein durchaus als Topsehenswürdigkeit einzustufenden Rendsburger Hochbrücke den Nord-Ostsee-Kanal, der früher Kaiser-Wilhelm-Kanal hieß und die Ostsee mit der Nordsee verbindet. Diese Brücke stammt aus derselben Zeit wie der Eiffelturm, vielleicht etwas später. Die Eisenkonstruktion und die schweren Metallnieten lassen daran auch keinen Zweifel. Von dieser Brücke aus hat man ganz unvermittelt einen herrlichen Blick über das weite Land. Man sieht den Möwen auf den Rücken und, wenn man Glück hat, eines der mächtigen Schiffe, die auf diesem künstlichen Fluss vollkommen deplatziert wirken. Kaum ein norddeutscher Kalender verzichtet auf die optische Merkwürdigkeit, einen Ozeanriesen durch die Rapsfelder fahren zu lassen. In großer Höhe überfährt man kurz darauf einen Stadtteil. Dieser Stadtteil heißt, da er ganz von der Eisenbahn umrundet wird, also zur Gänze innerhalb des Schienenkreises liegt, Schleife. Rendsburg-Schleife. Ich beugte mich ein wenig vor und hatte einen guten Blick auf die direkt unter der Brücke gelegenen, aus der Vogelperspektive hübsch aufgereihten Rendsburger Backsteinhäuschen. Die Bewohner dieser Häuschen hatten jahre-, wenn nicht sogar jahrzehntelang einen erbitterten Kampf gegen die Deutsche Bahn geführt, da die Fäkalien der Bahnreisenden in ihre Vorgärten fielen. Nicht im Ganzen natürlich, sondern durch die Schwellen und das Tempo zu Kackepartikeln zerhäckselt. Immer und immer wieder konnte man das damals in der Zeitung lesen und auch sehen. Reißerische Schlagzeilen wie »Kot sprengt Grillparty!« oder Fotos mit von Ekel erfüllten Hausfrauen vor Wäschespinnen, die gesprenkelte Handtücher hochhielten. Man sah ehrwürdige Damen von der Haustür bis zum Auto rennen – sie rannten ja eh immer nur noch durch ihre Vorgärten, als stünden sie unter Gewehrfeuer, rannten zur Garage, nahmen sogar den Schirm –, denen winzige, schmierige oder auch krümelig braune bis ockerfarbene Scheißestückchen in die frisch ondulierten Frisuren geweht waren. Endgültig eskalierte die Situation, als sich ein circa sechs Kilogramm schwerer gefrorener Kotklumpen oder richtiger -zapfen, der sich an einer Eisenbahnschwelle gebildet hatte, löste, vierzig Meter in die Tiefe sauste, ein Carport durchschlug und wie eine endgültige Kriegserklärung, ein von der Deutschen Bahn geschleuderter Stuhlgang-Tomahawk, im Autodach einer fünfköpfigen Familie stecken blieb. Dieses Foto – immer wieder fiel damals diese Formulierung – ging um die Welt. Und so wurde Rendsburg kurzzeitig berühmt. Weltberühmt dafür, dass es ein Auto hatte, in dessen Dach ein ein Meter fünfzig langer Dolch aus Scheiße steckte. Die über Jahre gedemütigten Rendsburger – der Wert ihrer bespritzten Immobilien fiel und fiel – waren durch diese widerliche Heimsuchung zu einer eingeschworenen Leidensgemeinschaft zusammengeschweißt worden. Nun hatten sie endgültig genug. Noch während der stinkende Zacken im Auto zu schmelzen begann, in den Kindersitz tropfte, erkletterten die Verwegensten und Zornigsten von ihnen die Hochbrücke und setzten sich im eisigen Winterwind auf die Gleise. Die Polizei schritt nur sehr zögerlich ein. Was nicht verwunderlich war, da die Polizisten voll auf der Seite der Anrainer standen und nicht wenige von ihnen ebenfalls unter der Stahlkonstruktion wohnten. Sobald sie dienstfrei hatten, zogen sie die Uniform aus und kletterten selbst auf die Brücke. Die Deutsche Bahn lenkte ein und versprach, etwas zu ändern. Und ein oder zwei Jahre lang, bis die Züge endlich Fäkalientanks bekamen, gab es immer, kurz bevor man über die Rendsburger Hochbrücke fuhr, eine Durchsage, die ich sehr mochte und die stets zu einer gewissen Heiterkeit in den Abteilen führte: »Liebe Zugreisende, die Benützung der Toiletten ist während der Brückenüberfahrt strengstens verboten, da es für die Bevölkerung zu Unannehmlichkeiten kommen kann.«
Ich war alleine im Abteil und hatte das Fenster hinuntergezogen. Der Vorhang schlug wild hin und her. Gleich würden wir nach Neumünster kommen. Dann war es nur noch eine Stunde bis Hamburg. Obwohl Hamburg von der Kleinstadt, in der ich wohnte, nur hundertdreißig Kilometer entfernt ist, war ich nur selten dort gewesen. Wenn ich mit meiner Mutter und meinen beiden älteren Brüdern mit dem Zug zu meinen Großeltern fuhr, stiegen wir am Hamburger Hauptbahnhof in den Schlafwagen nach München um. Dass mir Hamburg so weit weg vorkam, war die Schuld meines Vaters, für den jede Reise eine massive Gefährdung darstellte. Die Vorstellung, mit dem Auto nach Hamburg zu fahren, war für meinen Vater der blanke Horror. Er sprach über Hamburg wie über London oder Paris. Als er mich am Morgen zum Bahnhof gebracht hatte, waren wir wie immer viel zu früh da gewesen, und er hatte mich so verabschiedet, als würde ich schon gleich jetzt nach Amerika davonfahren, mich lange umarmt und mir alles Gute gewünscht.
Jetzt, zwischen Rendsburg und Neumünster, verstand ich, warum mein Vater so bewegt war. Diese Hamburgreise, dachte ich, ist tatsächlich mehr als nur ein Ausflug. Sie ist vielleicht der Beginn der großen Reise, die ich vorhabe. Ich musste gar nicht einatmen, so sehr wehte mir die frische Luft durch das Fenster direkt in die Lungen hinein. Ja, diese Reise, dachte ich weiter, ist vielleicht die erste Etappe auf meinem weiten Weg nach Amerika. Ich werde alles zurücklassen. Meine Brüder, meine Eltern, unseren Hund. Meine Freundin. Meine Freunde, mein Zimmer, die Kleinstadt. Das alles könnte nun wirklich bald hinter mir liegen! War dieser Tag vielleicht sogar der wichtigste meines Lebens? Ich überlegte. Hatte ich überhaupt schon wichtige Tage erlebt? Einzelne aus der Masse der Tage herausragende, wegweisende Tage, nach denen alles anders war als davor? Mir fiel kein solcher Tag ein. Vor einem halben Jahr hatte mich meine erste Freundin verlassen. Sie fuhr auf dem Mofa davon, und ich war ihr ohne Schuhe auf Socken hinterhergerannt und hatte ein paar Mal gerufen: »Verlass mich nicht! Bitte, bitte nicht!« Aber wenn ich jetzt daran dachte, kam es mir wie eine Ewigkeit her vor. Schon wenige Wochen später hatte ich eine neue Freundin gefunden und war mit ihr sehr glücklich. Aber so glücklich nun auch wieder nicht, dass ich nicht nach Amerika wollte. Und so beschloss ich, dass dies der wichtigste Tag meines bisher, wie ich fand, durchaus schönen, aber doch auch faden Lebens werden könnte.
Immer noch wehte der Wind herein und zerrte und riss am Vorhang. Die Tür klapperte, und das Rattern des Zuges klang hell und aufgeregt, wie ein unermüdlich vorwärtstreibendes pochendes Herz. Da ergriff mich, ja überwältigte mich, eine Aufbruchstimmung wie noch nie. Eine Gier nach Neuem: neuen Orten, Gesichtern, ach egal, Hauptsache anders, als es war!
Ich stand auf, beugte mich aus dem Fenster und hielt mein Gesicht in den nach Gülle riechenden Wind. Nachdem mein Vater vor Wochen gesagt hatte, er würde mir gerne den Aufenthalt finanzieren, könne es aber nicht, da mein ältester Bruder bereits in München studierte und mein mittlerer Bruder in wenigen Wochen sein Studium in Gießen beginnen würde, rief ich meine Großeltern an und bat sie um Hilfe. Sie erklärten sich bereit, mir das Geld zu geben. Es gab noch irgendeine Abmachung, dass ich einen Teil davon später einmal wieder zurückzahlen solle. Doch davon war dann nie mehr die Rede gewesen. Jetzt, da das Finanzielle geklärt war, unterstützten mich meine Eltern, und doch, sie waren auch traurig, dass dann keines ihrer Kinder mehr bei ihnen sein würde.
In Neumünster kam eine Frau zu mir ins Abteil: strähnige Haare, hohlwangig, abgemagert, nur mit einer hautengen Jeans, kaputten Turnschuhen und einem T-Shirt bekleidet. Auf dem T-Shirt erkannte ich, verwaschen und verfleckt, ein Baby in Windeln, das am Daumen nuckelte und mit der anderen Hand ein Victory-Zeichen machte. Die Frau schien etwas verloren zu haben. Schon während sie das Abteil betrat, zwängte sie ihre Fingerspitzen in die engen Hintertaschen ihrer Jeans. Sie nahm mich gar nicht wahr. Wie bei einer Leibesvisitation fuhr sie sich mit den Handflächen über ihr T-Shirt, die knochigen Rippen, über den Bauch, fingerte am Hosenbund herum. Dann schob sie ihre Fingerspitzen in die Vordertaschen. Sie zog dabei den Bauch ein, um tiefer hineinfassen zu können. Sie stand aufrecht im Abteil, auf ihren staksigen Beinen, und schwankte hin und her. Nach einer weiteren gründlichen Durchsuchung der Vorder- und Hintertaschen setzte sie sich mir schräg gegenüber und strich sich mit zitternden Händen über die Oberschenkel. Die Fingerkuppen der einen Hand waren bis in die Fingernägel hinein gelbbraun verfärbt, die Adern auf ihren Handrücken geschwollene bläuliche Würmer. Da sie mich überhaupt nicht bemerkt zu haben schien, sah ich sie mir ganz unverhohlen an. Was sie wohl suchte? Sollte ich sie ansprechen, ihr meine Hilfe anbieten? War sie betrunken? Unverständliches Zeug murmelnd verbarg sie ihr Gesicht in den Händen. Keine Minute saß sie so da. Dann stand sie auch schon wieder auf, begann zu suchen, nicht hektisch, eher wie in Trance, gefangen in einer verzweifelten Zeitlupe. Erschöpft, verlangsamt, von Nebelwänden umstellt schob sie wieder und wieder die Hände in die Vordertaschen, dann in die Gesäßtaschen ihrer Jeans. Fuhr sich über das T-Shirt und schob sich die Hände unter den Stoff. Es sah aus, als ob sie jede einzelne Rippe zählen, als ob sie etwas unter ihrer Haut suchen würde. Sie verrenkte sich, schob sich die Hände zwischen die Schulterblätter. Dann in knetenden Bewegungen die dürren Spinnenbeine hinab bis zu den ausgelatschten Turnschuhen. Immer wieder setzte sie sich, suchte im Sitzen, um kurz darauf wieder aufzustehen und im Stehen noch gründlicher zu suchen. Diese akribische Sorgfalt, obwohl sie traurig und sinnlos aussah, bewunderte ich. Diese Uneinsichtigkeit und Unbelehrbarkeit! Diese unerschütterliche Gründlichkeit war beeindruckend. Mich faszinierte ihre Konzentrationsfähigkeit, ihre Hingabe, sich auschließlich dieser einen und einzigen Tätigkeit, der des Suchens, zu widmen.
Für mich war die Aufforderung, mich zu konzentrieren, eine Folter. Solange ich denken kann, sagen mir Menschen, und zwar nicht bösartige Menschen, sondern freundliche, nachsichtige, aufgeschlossene, mit den Weihen der modernen Pädagogik vertraute Menschen, dass ich mich konzentrieren solle. Beim Schreiben: Sauklaue! Beim Lesen: Leseschwäche! Beim Zeichnen: die Kuh! Beim Rechnen: Taschenrechner aus! Beim Reden: erst denken, dann sprechen, sonst Wortsalat und Kauderwelsch! Konzentriere dich! Konzentration war der goldene Schlüssel, der die Panzertür zu jedem meiner Probleme öffnen sollte. Konzentriere dich! Das war der Geheimcode. Ich hab es versucht und geglaubt, was man mir versprach. Umsonst. Ich sah ihn genau vor mir, diesen sorgfältigen, gründlichen, ordentlichen und hoch konzentrierten kleinen, zauberhaften Kerl, der ich gern gewesen wäre. Dem die Tinte nicht verwischt, der auf die Frage nach seinem Hobby »Hausaufgaben machen« antwortet, der Klavier spielt und den die Lehrer nach der Schule auf Händen nach Hause tragen. Ein genialischer Knirps, der sich stundenlang, ach was, tagelang, am besten gleich ein ganzes Leben lang anspruchslos und hoch konzentriert mit sich selbst beschäftigt. Diese Aufforderung sitzt mir noch heute unerbittlich auf der Schulter, ein preußischer Zuchtmeister, der mir seine Sporen ins Fleisch schlägt und brüllt: Konzentriere dich! Hör auf, so rumzuzappeln, und KONZENTRIERE DICH!!!
Was war bloß mit meinem Gehirn los? War es zu weich? Ein Brei? Am liebsten hätte ich mir in den Kopf gegriffen, um aus dieser zu nichts zu gebrauchenden Gehirnmasse einen scharfkantigen Ziegelstein zu formen.
Jetzt zog die Frau sogar ihre Schuhe aus, griff hinein, drehte sie um und schüttelte sie, als wäre sie am Strand spazieren gegangen. Ich verstand einzelne Worte. »Ohh nee. Gibt’s doch nicht!« oder »Scheiße, kann doch nicht …« oder »Bitte, bitte nicht … nee!«. Keine noch so genaue Suche konnte sie davon überzeugen, dass das, was sie suchte, ganz offensichtlich nicht da war.
Der Schaffner kam. »Schönen guten Morgen. Die Fahrkarten bitte!« Ich gab ihm meine, die ich seit über einer Stunde wie eine Oma auf großer Fahrt in der Hand gehalten hatte. Unbewusst hatte ich sie zwischen den Fingern hin und her gerollt, tagträumend darauf herumgerubbelt. Und da ich freudig erregt war, waren meine Hände feucht und die Fahrkarte ganz labberig geworden. Der Schaffner nahm sie und sah sie sich an. »Da ist ja gar nichts zu erkennen. Das Datum ist ja verschwunden!« Unwillig hielt er sie sich näher vor die Augen, sah mich an, nickte abfällig und stempelte sie ab. Da die Langhaarige auch den Schaffner keines Blickes gewürdigt hatte, rief er laut: »Guten Morgen! Ihre Fahrkarte bitte!« Die dünne Gestalt tat einfach so, als wäre sie nicht da. »Hallo! Fahrkarte!« Die Frau räusperte sich, schluckte etwas herunter und sagte leise: »Was ist los?« »Ihre Fahrkarte! Zeigen Sie mir mal Ihre Fahrkarte!« Der Zug verlangsamte sein Tempo, der Schaffner sah aus dem Fenster und fragte: »Wo steigen Sie denn aus!« Unter den Haaren flüsterte es: »Hamburg.« »Ich komm gleich wieder, ja, und dann will ich Ihre Fahrkarte sehen! Verstanden?« Die Frau nickte.
Kurz darauf hielten wir in Elmshorn. Durchs Fenster konnte ich den Schaffner auf dem Gleis herumstolzieren sehen, ein Gockel mit Kelle, und wie er zwei Mädchen verbot, ihre Fahrräder in den Zug zu hieven. Er zeigte immer wieder ans Ende des Bahnsteigs. Die Mädchen setzten sich auf die Räder. Sie hatten beide knappe Shorts an, Sandalen, gleich gemusterte Halstücher, und wollten Richtung Zugende radeln. Ich lehnte mich aus dem Fenster. Der Schaffner hielt sie an den Gepäckträgern fest und sagte nur »Absteigen!«. Eilig schoben die Mädchen davon. Ich sah ihnen nach. Da entdeckte ich weit hinten die ausgemergelte Frau auf dem Bahnsteig, die immer noch suchte, sich mechanisch über ihre Hosenbeine strich. Völlig überrascht drehte ich mich um. Ja, sie war weg. Wie hatte sie das so schnell, so geräuschlos geschafft? Sie schwankte. Die Mädchen mit den kurzen Shorts schoben links und rechts ihre Räder an ihr vorbei und verschwanden zwischen den Reisenden. Der Zug fuhr an, und der Schaffner kam zurück. »So, die Fahrkarte bi… Wo ist denn die Frau hin?« »Keine Ahnung«, antwortete ich. Er sah den Gang hinunter, zog missmutig meine Abteiltür zu und ging weiter.
Ich nahm aus meiner Sporttasche mein Portemonnaie, das kein gewöhnliches Portemonnaie war. Es war ein echter Bullensack, ein gegerbter Bullensack mit einzelnen Härchen daran. Diesen Bullensack nahm ich aus meiner Sporttasche, in der noch ein warmer Pullover, eine Regenjacke und ein Buch lagen. Das Buch hatte mir mein Vater mitgegeben und gesagt: »Lies das mal, das könnte dir gefallen!« Ich hatte nicht die geringste Lust zu lesen, überhaupt fiel mir das Lesen schwer. Lesen machte mich nervös, vom Lesen bekam ich das große Kribbeln. Nach nur zehn Minuten Lesen fingen meine Muskeln an zu jucken, und ich musste mich bewegen, schütteln, grimassieren und eine Runde rennen.
Der Bullensack war prall gefüllt, münzschwer lag er satt in meiner Hand. Mit seiner roten Kordel zum Zuziehen sah er geradezu historisch aus, samten, wie frisch von einer jungfräulichen Baronesse geraubt. In zwanzig Minuten würde ich in Hamburg ankommen, in Hamburg-Altona, und dann würde ich eine S-Bahn zum Hauptbahnhof nehmen. Dort in der Nähe war um zwölf das Treffen der Austauschanwärter. Es hieß »Austausch«, wurde immer »Austausch« genannt, obwohl es gar nicht um einen »Austausch« ging. Niemand würde während meiner Abwesenheit in mein Zimmer einziehen. Kein amerikanischer Sohn würde mich ersetzen. Von »Austausch« konnte keine Rede sein. Wie lange würde dieses Auswahlgespräch dauern? Hoffentlich nicht länger als bis drei oder vier Uhr. Denn ich hatte ja noch etwas vor! Meinen Eltern hatte ich gesagt, es könnte spät werden, und sie gebeten, nicht auf mich zu warten.
Der Zug fuhr langsamer. Vorm Fenster die ersten mehrstöckigen Wohnhäuser. So nah, dass ich hineinsehen konnte. Da eine Familie beim späten Frühstück. Da eine Frau, rauchend auf dem Balkon. Ich sah auch Fahrräder auf den Balkonen. Das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass Hamburg eine Großstadt ist, dachte ich. Wenn nicht einmal mehr ab- oder anschließen was nützte und man sich tagein, tagaus die Mühe machen musste, sein Fahrrad die Treppe hoch und auf den Balkon zu schleppen, spricht das unzweideutig für ein raues Pflaster. Ich sah sogar ein mit einer dicken Kette ans Balkongitter angeschlossenes Fahrrad im vierten Stock. Was für ein Moloch musste das sein, in dem die Fahrraddiebe bei Nacht wie die Eidechsen Fassaden erkletterten und sich mit ihrer Beute auf dem Rücken abseilten. In meiner kleinen Heimatstadt schloss ich, wenn ich zum Training fuhr und das Rad vor der Schwimmhalle abstellte, gar nicht ab. Ich hatte nicht einmal ein Fahrradschloss. Ach, klingt das schön! Oh du liebliche, verklärte, geduckte Heimatstadt am Meer!
Der behaarte Bullensack war voller Ein- und Zweimarkstücke. Ich hatte sie gespart. Insgesamt waren es einhundertvierundfünfzig Mark. Zweimal die Woche gab ich Kindern Schwimmunterricht und in kürzester Zeit hatte ich mir den Ruf erworben, auch den Wasserscheuesten zum Seepferdchen zu verhelfen. Ohne Übertreibung kann ich behaupten, den Schwimmunterricht in meiner Stammschwimmhalle revolutioniert zu haben. Nie zuvor war ein Schwimmlehrer zu den Kindern ins Wasser gestiegen. Lustlos zogen die Bademeister in kurzen weißen Hosen und Poloshirts die Kinder vom Beckenrand aus an langen Holzstangen durch das Wasser und sahen dabei aus wie hartherzige Krankenpfleger. Die Kinder krallten sich an diese Stangen, heulten und versuchten, an ihnen hinaufzuhangeln. Ich hatte das während meines Schwimmtrainings oft beobachtet. Bei der Seepferdchenprüfung mussten die Kinder eine Bahn schwimmen, vom Einmeterbrett springen und zu einem Ring hinabtauchen. Ich habe selbst gesehen, wie Kinder erst fünfundzwanzig Meter lang wie Ertrinkende nach der Stange schnappten, die ihnen der Bademeister immer ganz knapp vor den greifenden Fingerchen wegzog, wie sie anschließend vom Sprungbrett geschubst und schließlich mit einer Hand untergetunkt wurden, bis sie den Ring am Grund endlich hatten. Doch waren die Eltern hochzufrieden und bedankten sich sogar beim Bademeister dafür, dass ihr Kind fast abgesoffen, geschubst und ertränkt worden war, und das frierende, heulende und vor Angst schlotternde Kind bekam sein Seepferdchen mit den Worten »Freust du dich denn gar nicht?« überreicht.
Diese Bademeister hielten sich für fortschrittlich. Ich dagegen war mit den Kindern im Wasser, umfasste ihre Knöchel und übte so die Schwimmbewegung. Ich erfand Spiele, bei denen sie immer weitere kleine Strecken schwammen, ohne es zu merken. Nach nur drei oder vier Monaten versammelten sich in meinem Schwimmtraining lauter wasserscheue, ja wasserhysterische Härtefälle. Blasse Mädchen, die schon schreiend aus der Dusche kamen und vor Wassertropfen so viel Angst hatten wie vor Salzsäure. Jungen mit zusammengekniffenen blauen Lippen, die beim Schwimmen den Kopf weit aus dem Wasser streckten und zu atmen vergaßen. Ich verbannte die Holzstangen, legte ihnen meine Hände unter die Bäuche und kam mir vor wie ein Heilsbringer, der seine frohe Botschaft verkündet: »Wenn ihr eure Angst fahren lasst, eure Arme so bewegt, wie ich es euch gelehrt habe, wird das Wasser euch tragen. Vertraut dem nassen Element! Es ist euch wohlgesonnen!«
Die Bademeister sahen mir angewidert zu, und einer sagte: »Mich hat mein Vater einfach ins Wasser geschmissen. Zack, konnte ich schwimmen!« Doch der Erfolg gab mir recht. Bis zu zehn Wasserphobiker, hoffnungslose Fälle, die aus allen Schwimmkursen der Stadt zu mir geflüchtet waren, schwammen hinter mir her, als wären sie Entlein und ich Konrad Lorenz. Ich vorneweg: der Gott der Wasserscheuen. Sie liebten mich, und es machte mich so stolz, wenn die Eltern ihre Kinder nicht wiederzuerkennen glaubten. Eben hatten sie noch um sich getreten wie auf dem Weg zum Schafott und mit weit aufgerissenen Augen ins Styropor-Schwimmbrett gebissen, als würde sie der Teufel in die nasse Hölle zerren wollen. Am Ende der Stunde sprangen sie mit Anlauf vom Beckenrand und machten jauchzend eine Arschbombe.
Noch fünf Minuten bis Hamburg-Altona. Die Reisenden verließen schon ihre Abteile und drängten sich in den Gang. Waren es überhaupt Reisende? Das Gegenteil wird wohl eher der Fall gewesen sein. Das traurige Gegenteil vom Reisenden ist der sogenannte Pendler, dachte ich. Was bin ich von beidem, bin ich Reisender oder Pendler? Ich sah aus dem Fenster und erinnerte mich an Ole. Ole in der Leopardenbadehose. Ole, der immer von blauen Flecken übersät war, da sein einer Fuß leicht verkrüppelt war und er deswegen oft stürzte. Ole war sechs oder sieben Jahre alt und vollkommen lethargisch, in seiner Lethargie aber gnadenlos zielstrebig. Ich habe nie wieder jemanden gesehen, der so langsam hinfallen konnte wie er. In schicksalsergebener Ruhe stolperte er über seinen Klumpfuß und schlug auf die Schwimmhallenfliesen auf wie eine vom Sockel gestoßene Statue – ohne sich abzustützen. Im Wasser verweigerte er jede Schwimmbewegung, tauchte aber für sein Leben gern. Holte tief Luft und ließ sich vom Rand ins Wasser plumpsen und herabsinken. Bevor er das tat, rief er meinen Namen. Ich musste ihn retten und zum Beckenrand schleppen.
Und einmal ist er, ohne es mir vorher zu sagen, auf das Dreimeterbrett geklettert, über das Springen-Verboten-Schild hinweg. Vom Sprungbrett aus rief er meinen Namen und ließ sich fallen. Es war laut in der Halle. Meine Schwimmgruppe war mittlerweile viel zu groß geworden. Ein Mädchen, das mir ihre Katzenkrallen in die Schultern bohrte, kreischte in mein Ohr: »Mir ist kalt, ich muss mal Pipi, ich hab Angst!« Hatte da nicht eben jemand meinen Namen gerufen? War da nicht eben am äußersten Rand meines Sichtfeldes ein Leopard durch die Luft geflogen? Ich glaube, ich hatte bis dahin noch nie so einen Schreck bekommen. Einen Schreck ganz aus der Erkenntnis heraus, ohne direkte Fremdeinwirkung. Ich setzte das Mädchen zu den anderen auf den Beckenrand, »Bleibt da sitzen!«, rannte ein Stück vom flachen harmlosen Hellblau des Nichtschwimmerbereichs bis zum dunkelblau schimmernden Wasser unter dem Dreimeterbrett und sprang kopfüber hinein. Ich sah Ole am Grund. Ich rief ins Wasser: ein blubbernder Schrei. In circa vier Meter fünfzig Tiefe schwebte Ole knapp über dem Boden. Die Arme ausgebreitet, die Wangen aufgeblasen. Ein träges U-Boot. Ich erreichte ihn, spürte, so tief war es, den Druck auf den Ohren, packte ihn und riss ihn mit nach oben. Wir durchbrachen die Wasseroberfläche, und noch ehe ich ihn schimpfen konnte, fiel er mir um den Hals, umarmte mich und rief: »Boahh, war das toll da unten! Komm, gleich noch mal!«
Danach halbierte ich meine Gruppe, und Ole gab ich Einzelunterricht. Es dauerte Wochen, bis er begriff, dass es nicht genügte, die Schwimmbewegungen zu kennen, sondern dass er sie, um nicht unterzugehen, mit einem Minimum an Kraft auch machen musste. Er aber stand senkrecht im Wasser, rührte vorsichtig mit den Armen und bekam, so als hätte er Füße aus Eisen, den Leopardenhintern nicht hoch. Augen, Nase und Mund nur knapp über der Oberfläche, ein treibendes Halbrelief, so starrte er an die Hallendecke. Aber er machte sein Seepferdchen. Nirgendwo steht, wie lange man für die fünfundzwanzig Meter brauchen darf. Nach wenigen Zügen war er total erschöpft, hatte keine Lust mehr, machte eine Runde Toter Mann und ließ sich bis ins Ziel treiben. Toter Mann, das gefiel ihm, das konnte und mochte er.
Der Zug fuhr in den Bahnhof ein: Hamburg-Altona. Ich war da! Zog den Bullensack zu, warf ihn in die Sporttasche und stieg aus. Noch nie war ich ganz allein in Hamburg gewesen. Doch über Hamburg gehört hatte ich schon einiges. Hamburg bot jede Menge Gesprächsstoff auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Drei große Hs standen für Hamburg. H wie Hauptbahnhof, H wie Hafenstraße und H wie Herbertstraße. Und über jedes dieser Hs wollte ich nach diesem Tag mehr wissen, als ich gehört und mir vorgestellt hatte.
Eine halbe Stunde später war ich beim ersten H, dem Hauptbahnhof. Ein Freund hatte mir erzählt, dass man auf der Rückseite des Bahnhofs etwas Erstaunliches sehen könne. Ich würde, so der Freund, meinen Augen nicht trauen. Ich suchte die beschriebene Stelle und ließ meinen Blick über den aus schweren Kalksteinblöcken gemauerten Sims der Bahnhofsmauer gleiten. Da entdeckte ich es. Mehrere der großen Steine hatten tiefe Abschabungen und Rillen, waren teilweise völlig zerklüftet. »Stell dich etwas abseits und beobachte die Mauer. Meistens muss man keine fünf Minuten warten!«, hatte der Freund mir empfohlen. Und er hatte recht. Kaum hatte ich mich etwas entfernt, kamen zwei Gestalten heran und machten sich an der Mauer zu schaffen. Eine Frau und ein Mann. Beide glichen auf eigenartige Weise der abgemagerten, sich selbst abtastenden Erscheinung, der ich im Zug gegenübergesessen hatte. Die linkischen verlangsamten Bewegungen, die unter den Haaren nur schemenhaft erkennbaren verhärmten Gesichter, die schmerzliche Getriebenheit. Gleichzeitig auf der Suche und auf der Flucht. Die Frau nahm ein Geldstück, kratzte damit an der Mauer herum und schabte etwas vom Bahnhofsfundament in ein Plastiksäckchen. Dann schlurften sie davon. Von meinem Freund wusste ich, was sie abgeschabt hatten: Es war Kalk. Ich hatte es ihm nicht geglaubt. Seine Worte hatten mich fasziniert. Der Kalk würde zusammen mit Rauschgift und etwas Wasser in einem Löffelchen über einem Feuerzeug kurz aufgekocht. Ich ging zu den ausgekratzten Steinen. War das möglich? Dass rein rechnerisch der Hamburger Bahnhof in ferner Zukunft von Drogensüchtigen ab- und weggeschabt sein würde?
Bei meinem Weg um den Bahnhof herum, auf dem Bahnhofsvorplatz und in den angrenzenden Straßen sah ich unzählige befremdliche, mich verwirrende Gestalten. Sie zogen mich magisch an und stießen mich doch ab. Natürlich gab es auch in dem kleinen Ort, aus dem ich vor gerade einmal zweieinhalb Stunden abgefahren war, die ein oder andere stadtbekannte gestrandete Gestalt. Gab es eine Stelle in der pittoresken Fußgängerzone, wo sich drei oder vier, bei sonnigem Wetter auch fünf oder sechs Säufer trafen. Aber verglichen mit diesen lebendigen Toten, die niemand außer mir überhaupt zu sehen schien, hatten die Kleinstadtpenner fast etwas Romantisches: Bärte, große rote Nasen, Apfelkornflaschen. Doch eine solche Anhäufung von bizarren, herumlungernden Haut-und-Knochen-Existenzen hatte ich noch nie gesehen. Vielleicht, dachte ich, sehe ich sie ja nur deshalb, weil ich sie unbedingt sehen will. Vielleicht bin ich versessen auf ihren Anblick und das Opfer meiner selektiven Wahrnehmung. Denn es gab natürlich auch jede Menge andere Leute, die an mir vorbeieilten. Der Unterschied war dennoch massiv. Die, die in Eile waren, hatten ein Ziel, bewegten sich in einem völlig anderen Tempo. Die, die ich beobachtete, lungerten herum. Es war eine Zweiklassengesellschaft der Geschwindigkeit: die einen in der Zeit, die anderen aus der Zeit gefallen. Und dass manche von ihnen so taten, als wären sie cool, als hätte ihr Leben die Aura des Abenteuerlichen, machte es noch trostloser. Allein schon, dass sie glaubten, sich verstecken zu müssen! Außer mir interessierte sich kein Mensch für sie. Diesen Rest von Heimlichkeit zelebrierten sie mit letzter Kraft.
Ich lief eine Straße hinunter. Spritzen lagen auf dem Gehweg. Plötzlich der Blick in einen Hauseingang. Da kauerten zwei auf den Stufen, einer stand. Ich wagte nicht hinzusehen. Ging schneller weiter. Das war das Einzige, was half: Beschleunigung. Tatsächlich, je schneller ich lief, desto weniger fielen sie mir auf. Mütter mit Scheuklappen schoben ihre Kinderwagen und würdigten sie keines Blickes. Ich sah ein Mädchen mit tief liegenden, ungenau umtuschten Augen unter langen Ponyfransen, das sich bei Männern einhakte, lächelte und etwas sagte. Sie hatte den Reißverschluss ihrer grauen Sweatshirt-Jacke weit hinuntergezogen. Nichts drunter. Die Männer ignorierten sie. Einer stieß sie zur Seite. Das Mädchen pöbelte ihm hinterher: »Blöde Sau! Leck mich am Arsch, du Pisser!« Sie spuckte auf die Straße. Dann schlenderte sie an den nächsten Passanten heran, hakte sich ein, flüsterte und lächelte wieder. Eine andere Frau saß mitten auf dem Gehweg, neben ihr ein großer Hund, der bräunliche Brocken von einem Pappteller leckte. Als Halsband hatte er einen Nietengürtel. Sie umarmte den Hund, hing an ihm, hielt ihn fest umklammert. Ich hatte genug gesehen und verließ das Viertel.
Um halb zwölf erreichte ich das prächtige Haus, in dem im dritten Stock die Austauschorganisation residierte. Zur Eingangstür hinauf führte eine breite schmiedeeiserne Treppe, auf der in der Sonne mehrere Jungen und Mädchen in meinem Alter lagerten. Waren das überhaupt noch Jungen und Mädchen? Kinder waren es ganz sicher nicht mehr. Jugendliche? Heranwachsende? Oder waren das junge Männer und junge Frauen?
Ich selbst hatte das verwirrende Gefühl, jeden Tag bestimmt hundertmal vom Kind zum jungen Mann und mit Überschallgeschwindigkeit vom jungen Mann wieder zum Kind zurückkatapultiert zu werden. Wenn ich mich gut eingeschlossen im Badezimmer im Spiegel musterte, sprach schon einiges für einen Mann. Es sprach aber auch noch so einiges dagegen. In den letzten Monaten war ich noch einmal gewachsen, hatte endlich breitere Schultern und festere Beine bekommen, riesige Füße. Aber im Gesicht, da war für meinen Geschmack noch viel zu viel Weichheit. Nichts Markantes! Kein Grübchen im Kinn. Keine gut sichtbar malmenden Kieferknochen. Anstelle eines Charakterkopfes hatte ich unter den wuscheligen blonden Locken ein ovales, dicklippiges Kindergesicht. Sobald ich nicht daran dachte, meinen Mund geschlossen zu halten, öffneten sich meine Lippen, und ich sah aus wie ein unterbelichteter Karpfen. Besonders mein Blick gefiel mir nicht. Ein leicht dümmliches Erstauntsein vermochte ich daraus einfach nicht zu verbannen. Ich wollte endlich lernen, so zu gucken, als hätte ich ein Geheimnis, und nicht, als wäre mir die Welt eines. So, als wäre ich voller Rätsel und nicht die Welt ein riesengroßes.
Und ich hatte noch ein Problem: Ich mochte keinerlei alkoholische Getränke und war dadurch von der Mehrzahl pubertärer Initiationsriten von vornherein ausgeschlossen. Bier, Wein, Schnaps – fand ich alles ekelhaft. Ich mochte Milch und Saft. Das war auf jeder Party meine heimliche Hauptbeschäftigung: Bierflaschen ins Klo oder vom Balkon zu gießen, Cola-Bacardi-Gläser unauffällig im Regal abzustellen und betrunken zu spielen. Ich war voller aufkeimender, mich umtreibender, wilder Sehnsüchte, hatte aber die Zunge eines Grundschülers.
Während ich die schmiedeeiserne Treppe hinaufstieg, streiften mich die Blicke der Sitzenden. Warum, dachte ich, glotzen die mich denn alle so blöd an? Stimmt irgendetwas nicht? Bin ich hier falsch? Ich wählte einen Platz ganz oben, mit dem Rücken an der Hauswand, und setzte mich. Schlagartig war ich völlig verunsichert. Verunsichert und unglaublich wütend.
Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas klarstellen: Ich war kein verschreckter, armer Außenseiter, der von seinen Mitschülern gequält, mit dem Hintern in den Mülleimer gestopft und aufs Lehrerpult gehievt wurde. Eher sogar umgekehrt. Ich gehörte oft zu den Quälgeistern. Was ich von meinen Brüdern einstecken musste, teilte ich in der Schule wieder aus. Ich hatte Freunde, einen liebevollen Vater, eine liebevolle Mutter und zwei geliebte Brüder, die mich bis aufs Blut quälten. Und ich hatte sogar eine Freundin, die ich aufregend fand und mit der sich gerade Dinge entwickelten, die mir sehr gefielen. Alles in allem war ich ein zufriedener und behüteter Siebzehnjähriger. Ein Siebzehnjähriger mit miserablen Schulnoten und großer Sportleidenschaft. Und doch war etwas vorgefallen. Es hatte mit meinen mich immer wieder heimsuchenden Zornattacken zu tun. Der Grund für diese Zornanfälle lag viel tiefer als die meist profanen Anlässe, die sie auslösten. Mit hübscher Regelmäßigkeit ergriff mich ein rasender, roter Furor, der mir selbst das größte Rätsel war. Ich konnte in diesen Abgrund nicht hineinsehen. Ich wusste nicht einmal, wo der Weg begann, der zur Klippe dieses Abgrunds führte. Ich hasste meinen Zorn. Er machte mich zornig. Er kam mir vor wie eine Krankheit. Ein Anfallsleiden, das mich erniedrigte und entmündigte. Doch niemand, ich selbst nicht und auch sonst niemand, fand den Krankheitsherd, den Zornherd. Das war mir oft unheimlich. Dass es da einen allzeit zur Explosion bereiten bollernden Ofen in mir gab, der sich mit mir selbst vollkommen im Dunkeln liegenden Kränkungen befeuerte. Meine Brüder nannten mich: die blonde Bombe! Sie wussten, wie man mich zündete! Und sie taten es gerne.
Bis auf diese rätselhafte Disposition für Totalausraster war aber alles vollkommen normal, ja, durchschnittlich an mir. Ich war kein norddeutscher Nerd, kein Einzelgänger mit fettigen Haaren, Pickeln und Bremsstreifen in der Unterhose, der tief im Wald mit einem gestohlenen Luftgewehr Eichhörnchen abknallt. Ich war kein Opfer, das missverstanden und gedemütigt versuchte, nach Amerika zu entkommen. All das war ich eben nicht! Und doch wollte und musste ich unbedingt weg!