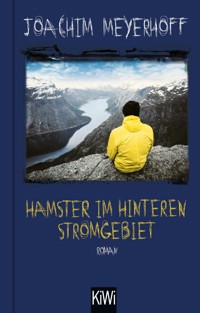9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alle Toten fliegen hoch
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen, ein Mann und das Wirrwarr der Emotionen Eine blitzgescheite Studentin, eine zu Exzessen neigende Tänzerin und eine füllige Bäckersfrau stürzen den Erzähler in schwere Turbulenzen. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse ist physisch und logistisch kaum zu meistern, doch trotz aller moralischer Skrupel geht es ihm so gut wie lange nicht. Am Anfang stand eine Kindheit auf dem Anstaltsgelände einer riesigen Psychiatrie mit speziellen Freundschaften zu einigen Insassen und der großen Frage, wer eigentlich die Normalen sind. Danach verschlug es den Helden für ein Austauschjahr nach Laramie in Wyoming. Fremd und bizarr brach die Welt in den Rocky Mountains über ihn herein. Kaum zurück bekam er einen Platz auf der hoch angesehenen, aber völlig verstörenden Otto-Falckenberg-Schule, und nur die Großeltern, bei denen er Unterschlupf gefunden hatte, konnten ihn durch allerlei Getränke und ihren großbürgerlichen Lebensstil vor größerem Unglück bewahren. Nun ist der fragile und stabil erfolglose Jungschauspieler in der Provinz gelandet und begegnet dort Hanna, einer ehrgeizigen und überintelligenten Studentin. Es ist die erste große Liebe seines Lebens. Wenige Wochen später tritt Franka in Erscheinung, eine Tänzerin mit unwiderstehlichem Hang, die Nächte durchzufeiern und sich massieren zu lassen. Das kann er wie kein Zweiter, da es der eigentliche Schwerpunkt der Schauspielschule war. Und dann ist da auch noch Ilse, eine Bäckersfrau, in deren Backstube er sich so glücklich fühlt wie sonst nirgends. Die Frage ist: Kann das gut gehen? Die Antwort ist: nein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Joachim Meyerhoff
Die Zweisamkeit der Einzelgänger
Alle Toten fliegen hoch Teil 4
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joachim Meyerhoff
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joachim Meyerhoff
Joachim Meyerhoff, geboren 1967 in Homburg/Saar, aufgewachsen in Schleswig, war vierzehn Jahre lang Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. In seinem sechsteiligen Zyklus »Alle Toten fliegen hoch« trat er als Erzähler auf die Bühne und wurde zum Theatertreffen 2009 eingeladen. Seine Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit 2019 ist Joachim Meyerhoff Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als stabil erfolgloser Schauspieler landet Joachim Meyerhoff in der tiefsten Provinz. Dort begegnet er Hanna, einer ehrgeizigen und blitzgescheiten Studentin. Es ist die erste große Liebe seines Lebens. Wenige Wochen später tritt Franka in Erscheinung, eine Tänzerin mit unwiderstehlichem Hang, die Nächte durchzufeiern. Und dann ist da auch noch Ilse, eine füllige Bäckersfrau, in deren Backstube er sich so glücklich fühlt wie sonst nirgends. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse ist physisch und logistisch kaum zu meistern. Kann das gut gehen? Die Antwort ist: nein.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2017, 2019, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © privat
ISBN978-3-462-31722-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Illustration zum Buch
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Leseprobe »Man kann auch in die Höhe fallen«
Für meine Mutter
und meinen Bruder
Mit dreiundzwanzig ging ich nach Bielefeld an das dortige Stadttheater. Um eine Unterkunft zu finden, hatte ich in der Innenstadt auf Stromkästen, Laternen und Ampelmasten fotokopierte Wohnungsgesuche geklebt, den unteren Rand sorgsam zu Zettelchen mit der Telefonnummer meiner Mutter eingeschnitten. Vierundfünfzig hoffnungsvoll flatternde Zahlenklaviere. Am Abend lief ich eine erste Kontrollrunde, neugierig, ob schon der ein oder andere Papierstreifen abgerissen worden war. Ich hatte mich für den denkbar einfachsten Text entschieden:
Junger Schauspieler sucht ab sofort:
kleine, helle, ruhige Wohnung!
Ewig hatte ich über die Abfolge der Adjektive nachgedacht, sie gedreht und gewendet, als hinge allein davon der Erfolg meiner Suche ab.
Ich wanderte durch die fremde Stadt. Alle Blätter unversehrt. Doch eine Anzeige war durch einen Zusatz ergänzt worden. Mit dickem Filzstift hatte jemand unter meinen Satz geschrieben:
Zum Sterben
Junger Schauspieler sucht ab sofort: kleine, helle, ruhige Wohnung zum Sterben!
Das als ein gutes Vorzeichen zu deuten, gelang selbst mir nicht.
Dann allerdings, kurz bevor ich nach nur zehn bitteren Monaten Bielefeld Richtung Dortmund wieder verließ, lernte ich jemanden kennen.
Die erste große Liebe meines Lebens.
1.
»Willst du dich umbringen?« Das war der erste Satz, den sie zu mir sagte, und ich habe mich später noch oft gefragt, ob mir das eine Warnung hätte sein sollen. Ich hatte sie den ganzen Abend über während der faden Premierenfeier beobachtet, fasziniert von ihrem Aussehen. Zu große Zähne, zu große Augen, zu platte Nase, verdammt kurze Haare. Sie gefiel mir sofort. Immer wieder sahen wir uns an und tatsächlich – sie lächelte ein bisschen. Ihr Kopf bewegte sich seltsam mechanisch, auch die Arme und Hände, alles wie einzeln, unabhängig voneinander, als passe kein Körperteil zum anderen. Dadurch sah ich sie aber umso deutlicher. Elegant, aber doch auch steif, ja fast ein wenig roboterhaft hob sie die Bierflasche zum Mund. Ihr eines Auge wurde je nach Kopfhaltung mal mehr, mal weniger von fallenden Strähnen verdeckt, das Haar im Nacken hingegen war ausrasiert. Sie trug eine weiße Bluse mit eigenwilligem Kragen, einen dunkelblauen Bundfaltenrock, dessen Kanten und Knicke in gut organisierten Wellen hin und her schwangen, eine dunkle Strumpfhose und altmodische Schuhe mit abgerundeten Schuhspitzen. Es kostete mich einige Mühe, sie momentweise aus den Augen zu lassen, sie nicht ununterbrochen anzustarren. Etwas an ihr war komplett eigenartig. Aber was es genau war, konnte ich nicht sagen. War es die von Sommersprossen überstreuselte, wie von einem schweren Boxhieb eingedrückte Nase oder der sehr rot geschminkte, aufgeworfene Mund? Waren es die etwas zu dick gezogenen schwarzen Lidstriche? Seltsam zusammengewürfelt war dieses Gesicht: Mund, Augen, Nase überdimensioniert, und in der Summe hätte diese Anordnung leicht ein grobschlächtiges Gesamtes ergeben können. Tat sie aber nicht. Ich war mir nicht sicher, sah sie fantastisch aus oder grotesk?
Egal, wo ich mich während der Feier aufhielt, ich wusste immer, wo sie war. Eine innere Magnetnadel zeigte stur in ihre Richtung. Drehte ich mich ab, musste ich das gegen einen Widerstand tun, so als würde ich versuchen, mich aus einem Kraftfeld herauszuarbeiten. Drehte ich mich wieder zu ihr, wirbelte es mich regelrecht herum. Im Laufe des Abends wuchs ihre Gravitation auf mich. Meine Füße wollten zu ihr, einfach losmarschieren und sich vor sie stellen. Doch völlig ohne Plan, ohne wohlüberlegte Sätze schien mir das eine zu waghalsige Annäherung zu sein, und erst als ich mich mit dem Arm in ein Geländer einhakte, eine der Streben fest umfasst hatte, fühlte ich mich sicher, nicht gegen meinen Willen ihrer Anziehungskraft zu erliegen. Ich unterhielt mich mit einem Kollegen über die Aufführung, ob sie ein Erfolg gewesen war oder nicht, ob die verhaltene Reaktion des Publikums Ergriffenheit oder doch eher Langeweile bedeutet hatte. Während des Gespräches sah ich ihr auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes ohne meinen Satz zu unterbrechen direkt in die Augen. Das war von einer betörenden Beiläufigkeit und Intensität. Immer und immer wieder trafen sich unsere Blicke.
Ich schlenderte ihr hinterher zur Tanzfläche. Noch nie hatte ich jemanden so tanzen gesehen. So ungelenk. Die Hände zu Fäusten geballt, sah es aus, als würde sie mit unsichtbaren Skistöcken herumhantieren, dazu stapfte sie unrhythmisch auf der Stelle herum. So, dachte ich, präparieren Camper welliges Gelände, bevor sie ihre Zelte aufbauen. War das ihr Ernst? Machte sie sich über sich selbst lustig? Oder war das wirklich ihre Art zu tanzen? Mit ironisch verführerischem Blick sah sie zu mir herüber, warf sich mit einem kurzen Kopfwischer lässig die hellblonden Haare aus der Stirn, beugte und streckte die Arme, als teste sie neue Gelenke, und machte große Augen. Ich musste lachen. Augenblicklich verfinsterte sich ihr Ausdruck und sie drehte mir den Rücken zu. Ich erschrak, hatte ich sie gekränkt?
Da ich vor der Premiere sehr aufgeregt gewesen war, hatte ich zu essen vergessen. Mein vernachlässigter Magen knurrte mich an, und ich ging in den Nebenraum, wo das Buffet zwar noch aufgebaut, aber bereits von einer Horde hungriger Hunnen überfallen worden war. Auf den leer gefressenen Tabletts lagen nur noch die zerfetzten Salatblätter der Dekoration, zerrissen und zermatscht, wie die noch nicht abtransportierten Schwerverwundeten nach einer brutal gekämpften Buffetschlacht. In einem der Zinksärge litten ein paar panierte Hähnchenschnitzel vor sich hin, die letzte Reserve, knapp der Meute entronnen, ganz bisschen warm noch, aber kurz vor dem Labbrigkeitstod. Während ich mir das dritte Hähnchenschnitzel auf den Pappteller stapelte, war ich mir plötzlich sicher, dass sie in meiner Nähe war. Aber ich drehte mich nicht um, war gebannt von einer Kraft in meinem Rücken, einer wohltuenden Gefahr. Es war, als wäre ich rückwärts an eine Schlucht herangetreten, oder richtiger, als wäre der Abgrund zu mir gekommen. Direkt hinter meinen Fersen schien ein Krater zu klaffen.
»Willst du dich umbringen?« Ihr Satz riss mich herum. Ihr Blick war klar und angriffslustig wie nach einem heftigen Streit und traf mich voll. Ich schmeckte, was ich nicht begriff: Rauch. In meinem Rachen kratzte es. Beißender Qualm wie von einem Lagerfeuer, geschichtet aus nassem, zu jungem Holz. Ich räusperte mich mehrmals. Woher kam nur dieser Aschegeschmack? »He, ich hab dir eine Frage gestellt. Willst du dich umbringen?« »Nein, eigentlich nicht, sollte ich?« »Vielleicht.« »Warum?« Sie zuckte mit den ohnehin schon ein wenig hochgezogenen Schultern und antwortete: »Erfahrungen sammeln.« Da ich größer war als sie, sah ich auf sie hinab. Gleich oberhalb der Nase war ihre Stirn hart und eben, eine kreisrunde Fläche. Eine bockige, ja störrische kleine Platte. Da, dachte ich, wäre genau die richtige Stelle für ein Horn, genau so sähe es aus, hätte man ihr das Horn präzise über der Stirn abgesägt und dann die Schnittstelle mit Stirnschleifpapier glatt geschmirgelt.
»Willst du wirklich drei von diesen ekelhaften Hühnerschnitzeln essen? Das ist doch Selbstmord. Da gibt es doch elegantere Möglichkeiten. Oder hast du Kopfschmerzen?« »Was bitte?« »Na, ob du Kopfschmerzen hast!« Ich zögerte. Da legte sie los: »In der Massentierhaltung werden die Hühner so eng zusammengepfercht, dass sie sich gegenseitig wund scheuern und offene Stellen an den Flügeln bekommen. Der Schmerz macht sie aggressiv, und deswegen hacken sie sich gegenseitig die Augen aus oder töten sich. Also bekommen sie Schmerzmittel ins Futter gemengt. Dann spüren sie wenigstens ihre Verletzungen nicht mehr und halten still. Von den Wachstumshormonen werden sie so fett, dass sich ihre Gelenke entzünden. Da bekommen sie auch noch Antibiotika. Zur Massenexekution humpeln sie ahnungslos durch dunkle Gänge und gackern leise miteinander. Würde irgendjemand ihre Sprache sprechen, könnte man Sätze aufschnappen wie ›Mir haben sie gesagt, sie bringen uns auf eine herrlich grüne Wiese‹ oder ›Macht euch keine Sorgen, jeder wird sein eigenes Nest bekommen‹. Lieb, wie sie sind, trippeln sie gutgläubig ihrem neuen Leben entgegen, immer weiter. Dann aber fallen sie durch Löcher auf Förderbänder, werden fixiert, maschinell geköpft, überbrüht, gerupft, aufgeschlitzt und ausgeweidet. Zu Tausenden auf Haken gespießt. Splitterfasernackt, kopfüber, kopflos ruckeln sie im Todeskarussell aus der Todesfabrik in den Verpackungstrakt. Noch in derselben Nacht werden die zerteilten Körper, die amputierten Schenkel und Flügel auf Styroporbettchen aufgebahrt, in Folie eingeschweißt und von Tiefkühllastern im Morgengrauen über menschenleere Autobahnen ins ganze Land ausgeliefert. Frisch aus dem Regal auf deinen Tisch. Vollgepumpt mit Medikamenten!«
Sie tippte mit ihrem lackierten Fingernagel auf die Panade meines Hühnerschnitzels. »Das ganze Zeug lagert sich im Fleisch ab. Also genau genommen hilft schon ein winziger Happs dieser gefolterten Schuhsohlen nicht nur gegen Kopfweh, sondern auch gegen Husten und Fieber. Eigentlich dürfte es die nur in der Apotheke auf Rezept geben. Von den Hormonen kann es sein, dass du Brüste bekommst, dir die Haare ausfallen und wichtige Körperteile verschrumpeln. Also ich an deiner Stelle würde mir das gut überlegen. Guten Appetit.«
Ich kam mir vor, als wäre ich in ein hochprofessionelles Spiel eingewechselt worden, dessen Regeln ich nicht kannte. Kein Mensch konnte so viele Bälle auf einmal fangen, geschweige denn zurückspielen. »Nein, es gibt …«, ich suchte nach Worten, blätterte hektisch in meinem Gehirnduden, aber alle Seiten verklebt, »eigentlich hab ich einfach nur …« Doch bevor ich meinen Satz zu Ende sprechen konnte, rief sie: »Sag bitte nicht: Hunger. Bitte, bitte, nicht. Das wäre so langweilig. Du wolltest nicht sagen, dass du Hunger hast, oder?« So ging das nicht weiter. Ich musste jetzt langsam mal aufwachen, irgendeinen Motor anwerfen, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich ihn überhaupt hatte. Doch die einzige Antwort, die mir einfiel, war mir nicht ganz geheuer. Egal. »Ehrlich gesagt«, ich zögerte, sorgte ein wenig für Spannung, »hab ich die Hähnchenschnitzel für dich geholt, da ich dachte, du könntest vielleicht hungrig vom Tanzen sein!« Sie kniff die Augen zusammen, blitzartig, taxierte mich mit grünem Klapperschlangenblick, was ihr für einen Moment eine Madame-Tussaud-artige Maskenhaftigkeit verlieh. Sie hob den Kopf, die flache Stirn spannte sich, die Stelle, wo sie ihr das Horn abgesägt hatten, zielte zwischen meine Augen. Es sah tatsächlich so aus, als würde sie mir gleich den finalen Kopfstoß verpassen, mich mit etwas Unsichtbarem durchbohren. »Ist das die Wahrheit?« Ich nickte. »Du wolltest mir diese drei Hähnchenschnitzel zur Tanzfläche bringen?« »Klar, magst du eines?« »Du lügst! Ich sehe es dir an.« »Warum sollte ich lügen? Hier, greif zu.« Ich hielt ihr den Teller hin. So war ich noch nie angesehen worden. Selbst Zwinkern schien ein Zeichen von Schwäche zu sein, das mich in die Defensive bringen könnte. Eigentlich hätte ich sie einfach nur gerne kennengelernt und das ein oder andere süffige Bonmot wie einen Ballon elegant mit dem Finger durch die Luft zu ihr hinübergestupst. Doch bereits nach den ersten fünf gemeinsam verbrachten Minuten ging es um nichts anderes mehr, als ihr standzuhalten, ihr gewachsen zu sein, sich nicht zum Idioten zu machen. Sie war schlagfertig und ich hatte Schlagseite. Ihr Atem ging schnell, und ich fragte mich, ob sie ihre Bluse bewusst oder fahrlässig den einen entscheidenden Knopf zu weit aufgeknöpft trug. Unsere Blicke waren kollidiert und hatten sich unlösbar ineinander verkeilt. Wer sollte die je wieder trennen?
»Ich frag dich jetzt noch ein allerletztes Mal«, ihre Stimme war ernst, ohne Betonungen flog der Satz heraus, »hast du diese drei Hähnchenschnitzel wirklich, also ich meine wirklich, für mich geholt?« Bei dem Wort wirklich hatte sie sich beim W so überdeutlich mit den hasengroßen Schneidezähnen in die Unterlippe gebissen, dass die Zahnkanten nun wie die Feuerkuppen von Streichhölzern ein klein wenig vom Lippenstift rot gefärbt worden waren. Plötzlich schien es hier um so viel mehr als die drei mittlerweile erkalteten und von mir immer noch wie von einem fossilen, aus dem Fels herausgeklopften Steinzeitkellner dargebotenen Hähnchenschnitzelleichen zu gehen. Ihre Augen hatten sich verändert. Unsicher und gespannt sah sie mich an. Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Was war die richtige Antwort?
»Gut«, sagte ich, »wenn du wirklich, also ich meine wirklich die Wahrheit wissen willst …« Ich imitierte sie, biss ebenfalls mit den Zähnen in das W der Wirklichkeit. »Sie sind«, ich holte theatralisch Luft, »für mich. Alle drei! Denn ich habe unglaublichen Hunger.« Ich nahm mir das oberste Hähnchenschnitzel und biss hinein wie ein kerniger Landwirt aus der Geflügelwerbung.
Sie strahlte mich an, strahlte und zuckte zusammen. »Autsch, immer wenn ich zu dolle grinse, reißen mir die Mundwinkel ein. So ein Mist. Ich bin eine Fehlkonstruktion. Ich kann nicht mal richtig lachen, wenn mich mal was freut. Aber du hast es geschafft mit deiner grandiosen Hähnchenschnitzelnummer. Danke für den Schmerz.« Tatsächlich sammelte sich in ihrem Mundwinkel ein bisschen Blut. Mit breitem Vampirgrinsen sah sie mich an. Ich gab ihr eine Serviette vom Buffettisch. Sie tupfte sich die pralle Blutperle aus dem Mundwinkel heraus. Auf dem Weiß des saugstarken Papiers breitete sich zeitrafferrasant ein kreisrunder Fleck aus. Triumphal schwenkte sie das blutige Fähnlein in meine Richtung. So einfach also, dachte ich, bastelt man sich eine japanische Flagge. »Wusstest du, dass in der russischen Sprache das Wort Blut auch Schönheit bedeutet? Wenn man also sagt ›Ich liebe deine Schönheit‹, sagt man auch ›Ich liebe dein Blut‹. Oder wenn sich jemand die Pulsadern aufschneidet. Die russische Mutter tritt die Badezimmertür ein, findet ihre Tochter und schreit los: ›Oh mein Kind! Mein über alles geliebtes Kind. Überall Blut!‹ Dann heißt das eben auch: ›Oh mein Kind! Mein über alles geliebtes Kind. Überall Schönheit!‹« Wieder machte sie ihre großen Augen. Das schien ihr Gesichtsfavorit zu sein, diese abenteuerlichen Glupschaugen, dieser Milchglasmurmelblick mit viel makellosem Weiß um die Iris. Abermals wischte sie sich den Mundwinkel sauber: »Mein Gott, ich kann kein Blut sehen, ich glaub, ich werd ohnmächtig!« Katastrophal schlecht, aber dadurch umso bezaubernder, spielte sie die drohende Ohnmacht. Wie eine Volltrunkene ließ sie den Kopf nach hinten wegsacken und schwankte mit dem Oberkörper hin und her. Ihre Haarsträhne, von der ich mich fragte, ob sie blondiert sei, so unnatürlich hell war sie, fiel ihr über die Augen. »Hilfe, zu Hilfe. Ich verblute!«
Da krallte sie sich plötzlich in meinen Unterarm, schloss die Augen, stand reglos da und wurde kreideweiß. »Mist. Warte, warte kurz.« Nach einer Weile, während der sie behutsam ein- und ausgeatmet hatte, flüsterte sie: »Oh je, oh je. Mir ist schlecht. Ist das okay, wenn wir hier einen Moment so stehen? Geht gleich wieder. Mon dieu. Ich hab überhaupt nichts gegessen.« Sie hatte ihren festen Griff gelöst, locker lag ihre Hand auf meinem Arm, als warte sie darauf, von mir zu einem höfischen Tanz geführt zu werden. Sie hatte kurze, kräftige Finger, alle Nägel abgekaut, bis tief hinein in das nicht für die Luft bestimmte hellrosa Nagelfleisch.
»Kann ich irgendwas tun? Soll ich dir ein Glas Wasser holen?«, fragte ich besorgt. »Nur noch einen Augenblick. Mir ist total schummerig.« Ich wollte etwas sagen, doch sie hörte mich einatmen und machte sogleich: »Psssst.« Und hauchte: »Nous nous arrêtons et la terre continue à tourner.« Ich verstand kein Wort. Und so standen wir da, ein Marmorpaar im Gewirr der Gäste. Ein paarmal presste sie ihren Daumen in meinen Unterarm, sehr sachlich, eher so wie man eine Avocado prüft. Mir war rätselhaft, was das sollte. War es eine Zärtlichkeit oder ein Test? Die Minuten vergingen, und wenn ich auch nur das Gewicht verlagerte, zischelte sie: »Pss-pss-pss …« Wie eine desorientierte Blinde tastete sie mit der Hand in der Luft herum, stieß gegen den Pappteller, nahm sich ein Schnitzel und schlenkerte es vor ihrem Gesicht hin und her, schwenkte den Fächer aus Fleisch. »Luft, Luft. Ich brauche Luft!« Sie schlug die Augen auf, wobei es mehr war als nur ein bloßes Augenöffnen, es war, als ob etwas aus ihr heraussprang. Sie schaute nicht nur, ihr Blick schoss wie durch brennende Reifen ins Freie. Sie lachte los. »Haaaa, haaaa, haaaa!«, und klang dabei wirr, wie ein durchgeknallter Diktator im Schundfilm. »Hast du es etwa geglaubt?« Ich war ratlos und auch müde geworden vom langen Herumstehen. »Du hast es geglaubt!« Ihre sehr helle, eindeutig empfindliche Haut verfärbte sich triumphrosa. »Gut gespielt, oder?« Ich nickte. »Absolut, bin voll drauf reingefallen.« »Komm, jetzt guck nicht so geknickt. War doch ’ne nette Pause.« Sie sperrte den Mund auf, stieß ihre kerngesunden Schneidezähne in mein Schnitzel, zerrte ausgehungert daran herum, bis sie gut die Hälfte abgerissen hatte. Kauend, kaum verständlich, fragte sie mich: »Darf ich eventuell von deinem Hähnchenschnitzel abbeißen?« Überdeutlich antwortete ich: »NEIN!«, und dann »Du hast doch nicht etwa Hunger?«. Ohne auch nur einen Moment überlegen zu müssen, schmatzte sie die Antwort wie in einer gut geölten Komödie heraus. »Ach Quatsch, ich hab total Kopfschmerzen.« Wir lachten beide, und es geschah etwas höchst Befremdliches. Ich sah sie zwar lachen, hörte es aber nicht, mein eigenes Lachen hingegen schien sehr laut und kräftig zu sein. Die einzige Erklärung für dieses wiehernde Klangwellenwunder konnte nur sein, dass sie exakt auf meiner Frequenz gelacht hatte. Dass wir wie zwei perfekt gestimmte Instrumente denselben Ton angeschlagen hatten und zu einem einzigen Lachton verschmolzen waren. Da sie ihren eingerissenen Mundwinkel schonen wollte, versuchte sie nur halbseitig zu lachen. Das verlieh ihr einen irren Gesichtsausdruck und ließ sie wie eine extrem gut gelaunte Hexe aussehen.
»Wenn das so weitergeht, muss ich noch zum Mundwinkelchirurgen, meine große Klappe zunähen lassen.«
»Hast du vielleicht Lust, spazieren zu gehen?«
Ich war genauso fassungslos über den Satz wie sie. Meine Frage war ohne Ausweispapiere an allen Kontrollpunkten und Sicherheitsschleusen vorbei dreist von meiner Zunge aus ins Freie gesprungen. Kein Gedanke war diesem Satz vorausgegangen.
Vielleicht, dachte ich später, trägt jeder Mensch so ein paar Sätze in sich, von denen er gar nichts weiß, die unbemerkt in ihm schlummern und das ganze Leben verändern können. So einen kleinen handlichen Trommelwortrevolver, dessen Kugeln sich unerwartet lösen und unleugbar, unumstößlich ins Dasein knallen. Natürlich kann man auch nach monatelangen Qualen und Hunderten heimlich absolvierter Therapiesitzungen sagen: ›Ich kann nicht mehr mit dir leben.‹ Aber es kann eben auch passieren, dass sich solch ein Satz wie ein Schuss löst, eine unbekannte tiefer gelegene Macht den Hahn spannt und ansatzlos die Worte beim Abwaschen abfeuert. ›Ich verlasse dich‹ oder ›Ich hasse euch‹. ›Was bitte?‹ ›Ja, ich kündige. Ich pack jetzt meine Sachen und komme nie wieder.‹ Diese Vorstellung ist gleichermaßen erschreckend wie befreiend, da diese Sätze hinterrücks ein ganzes Leben zunichtemachen, aber auch etwas in Bewegung setzen können, was desillusioniert, außerhalb der eigenen Möglichkeiten zu liegen schien. Nun klingt die Frage ›Hast du vielleicht Lust, spazieren zu gehen?‹ nicht gerade nach einer Lebenswendemarke. Aber für mich war es eine, denn ich war in diesen Dingen alles andere als mutig. Geplant und im Hirn zurechtgeschliffen, hätte solch ein Satz mit absoluter Sicherheit niemals meinen Mund verlassen, wäre vielmehr herabgesunken, am Herz vorbei, tiefer und tiefer ins Dunkle, auf den bereits gut belegten Friedhof der verpassten Möglichkeiten.
»Hast du vielleicht Lust, spazieren zu gehen?«
Sie riss die Augen auf, sah aus wie ein fassungsloser Kobold, vor dessen Höhle jemand nach Jahrhunderten den Stein weggerollt hatte. Sie wandte sich ein wenig von mir ab und begann zu sprechen, führte ein Selbstgespräch, in rasendem Tempo ging es mit verstellter Stimme hin und her. »Du, ich bin gerade gefragt worden, ob ich einen Spaziergang machen möchte.« »Wie, einfach so?« »Ja, stell dir vor. Oh mein Gott!« »Mensch, sei bloß vorsichtig, du kennst den doch gar nicht! Es ist mitten in der Nacht.« »Glaubst du, der ist gefährlich?« »Man weiß ja nie.« »Also, er macht auf mich einen extrem harmlosen Eindruck.« »Harmlos oder eher langweilig?« »Ich bin mir nicht ganz sicher.« »Sieht er denn wenigstens gut aus?« Sie sah prüfend an mir hoch und runter: »Na ja, geht so.« »Also dann, klares Nein.« »Immerhin, er hat mich zum Lachen gebracht.« »Na dann, wenn du unbedingt willst, mach es halt!« Sie nickte mir zu und sagte betont nüchtern: »Ich darf.«
»Freut mich.« »Sind da noch welche von den Schnitzeln in der Wanne? Die sind lecker.« Ungeschickt klapperte sie den Deckel herunter und griff sich mit jeder Hand zwei weitere Stücke Fleisch. »Proviant!«, rief sie. »Guck mal, das eine sieht aus wie Korsika und das andere wie Sri Lanka. Obwohl …«, sie knabberte am Fleisch herum, »die Landzunge muss noch weg. Oh Mist. Zu viel. Jetzt sieht es aus wie Ungarn. Wir brauchen auch noch was zu trinken. Geh du mal Bier klauen und ich besorg Zigaretten. Les cigarettes transforment les pensées en rêves. Ich hol meinen Mantel.«
Ich ging zur Bar und war unsicher, wie viele Flaschen ich kaufen sollte. Plötzlich schien die Anzahl der Bierflaschen der Gradmesser meiner Erwartungen für den noch ausstehenden Abend zu sein. Zwei Flaschen sahen schwer nach Halbe-Stunde-noch-dann-geh-ich aus. Zwei für jeden ist vernünftig, dachte ich, aber was, wenn sie noch gerne eine dritte hätte, und alleine trinken lassen wollte ich sie auch nicht. »Sechs Flaschen Bier, bitte.« Ich war schon immer jemand, der durch seine vorauspreschenden Vorstellungen Situationen in Sekundenschnelle ins Irrationale zu potenzieren verstand. Zwei Gedanken, vier Gedanken, acht Gedanken, sechzehn, zweiunddreißig. Jetzt geriet ich zum Beispiel in Sorge darüber, wie ich im Fall der Fälle ihre Hand halten oder sie gar umarmen sollte, wenn ich sechs verdammte Bierflaschen durch die Nacht schaukeln musste. Während ich wartete, geriet ich tiefer und tiefer in Gedankenspannungen, die mit Wechselstrom betrieben wurden. Minus: Ihre französischen Satzhäppchen ärgerten mich. Plus: Ihre Gedankenschnelle begeisterte mich. Minus: Ihr permanentes Hakenschlagen machte mich nervös. Plus: Ihre aufgerissenen Augen platzten fast vor Ungestüm. Minus: Fand sie mich wirklich hässlich? Plus: Ich hatte sie zum Lachen gebracht. Minus: Sie würde die sechs Bierflaschen sehen und denken, ich würde etwas im Schilde führen.
Jemand versetzte mir einen Hieb auf die Schulter: »Schönen guten Abend. Ich glaub, wir sind verabredet!« Sie sah die Bierflaschen. »Ich hatte eigentlich eine Nachtwanderung gebucht und kein Besäufnis. Los, komm.« Ohne uns von irgendjemandem zu verabschieden, verließen wir das Theater. Sie schien tatsächlich allein auf der Premierenfeier gewesen zu sein. Sie kommt mir vor, dachte ich beim Treppenhinabsteigen, wie jemand, den zu Hause die Einsamkeit übermannt haben könnte, und der sich in einem Kraftakt aufgerafft und sich schön gemacht hatte, um so auf andere Gedanken zu kommen. Um mit dem Zuschlagen der Wohnungstür auch in sich selbst etwas für einige Stunden zu verschließen.
Sie stieg die Stufen auffallend unbeholfen hinunter. Jeden Schritt setzte sie einzeln und hielt sich dabei am Geländer fest. Als sie meinen fragenden Blick sah, sagte sie: »Treppen und ich, das ist eine traurige Geschichte. Wir stehen auf Kriegsfuß.« »Kann ich was tun?« »Wenn dir was Gutes einfällt, gerne.« Ich wurschtelte mit den Flaschen herum und stützte sie. Stufe für Stufe half ich ihr hinab.
2.
Es war noch erstaunlich warm draußen, und wir spazierten scheinbar ziellos durch die Stadt. Durch Bielefeld. Ich hatte mir die Flaschenhälse zwischen die Finger geklemmt, drei pro Hand. Sie lächelte und sagte nur ein einziges Wort: »Biertatzen.« Es war angenehm, neben ihr zu gehen. Unsere Schrittlängen verstanden sich gut. Wir setzten uns auf eine Bank, auf der in breiter Sprühdosenschrift Sachbeschädigung verboten stand, ich reihte die Flaschen vor uns auf und wir aßen die entwendeten Hähnchenschnitzel. Geschickt ploppte ich an einer scharfkantigen Metallstrebe der Rückenlehne die beiden Kronkorken hinunter und bekam dafür einen anerkennenden und doch auch belustigten Blick mit einseitig hochgezogener Augenbraue. Sie sagte »Oh hauahauaha«, nahm das Bier und trank mit geschlossenen Augen, wobei sie Ober- und Unterlippe wie ein Kleinkind über den Flaschenhals stülpte. So suggelte sie die halbe Flasche leer. »Ahhhh.« Andauernd wirkte das, was sie tat oder wie sie mich ansah, wie ein Zitat von etwas anderem. Sie machte nicht nur ›Ahhhh!‹ wie jemand, der durstig mehrere Schlucke Bier getrunken hat. Sie machte ›Ahhhh!‹ wie jemand, der jemanden nachmacht, der ›Ahhhh!‹ macht.
Sie spuckte auf ihre Serviette: »Entschuldige, ich kann das nicht länger mitansehen. Du bist ja noch total geschminkt.« Und eh ich mich wegdrehen oder etwas sagen konnte, war sie an mich herangerückt und wischte mir mit einem nassen Zipfel am Augenlid herum. »Keine Sorge, ich mach das täglich bei mir. Halt mal still.« Akribisch reinigte sie mir die Augen. Sie roch gut, sehr dezent nach sich selbst und nach etwas anderem. Aber da war wieder dieses rauchige Kratzen in meinem Hals, diese Nervosität im Rachen, ein Kribbeln im Kehlkopf, ein nicht wegzuschluckender Aschegeschmack. »Siehst ja bisschen transig aus. Ob Bielefeld die richtige Stadt für solche Aufmachungen ist, wage ich zu bezweifeln. Oder ist das etwa Absicht?«
Da hatte sie tatsächlich ins Schwarze getroffen. Ich mochte es, mich nicht vollständig abzuschminken und nach der Vorstellung mit Lidstrich und dunklen Wimpern herumzulaufen. »Nee, aber das ist immer so mühsam«, rechtfertigte ich mich. »Bist du fertig?« »Gleich.« Immer wieder sah ich, wie ihre Zungenspitze reptilienschnell zwischen den Lippen hervorschoss und die schon arg verschmierte Serviette einspeichelte. Ich roch ihre Spucke in meinem Gesicht. »So, guck mich mal an. Ja, besser. Wie wäre es mit einer Zigarette?« »Gerne.«
Es war mir trotz massiver Widerstände meines durch viele Jahre Sport, ja Hochleistungssport, trainierten Körpers gelungen, mich von einem reinen Gelegenheitsraucher zu einem stabilen Gewohnheitsraucher zu steigern. Anfänglich war meine kerngesunde Physis geradezu entrüstet, wenn ich rauchte. Mir wurde übel, meine Lunge krampfte sich empört zusammen, jedes Lungenbläschen rief und jede Bronchie brüllte ›Was machst du denn da? Spinnst du? Lass das!‹, und mein im Kleinkindmodus stecken gebliebener Geschmackssinn meldete ›Alarmstufe Rot‹. Mein Vater hatte jahrzehntelang Roth-Händle geraucht, und seine Krankheit, sein viel zu früher Tod hatte sicherlich auch mit den außerordentlich starken Zigaretten zu tun gehabt. Diese Tatsache zu ignorieren, wider besseres Wissen zu rauchen, war ein Genuss für mich, ein Vernunfttrotz, der im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch auf andere Lebensbereiche übergreifen sollte. Das Falsche zum Richtigen umzuwidmen, wurde zu einer echten Obsession.
»Es tut mir leid, dass ich voll verpasst habe, dich zu fragen, wie du eigentlich heißt. Jetzt ist das ja fast schon peinlich.« Sie gab mir eine Zigarette und sagte: »Oh wie schön, jetzt kann ich einen der ganz großen Sätze des zwanzigsten Jahrhunderts sagen: Hast du mal Feuer?« Ich klopfte mir auf die Hosentaschen: »Nee, Mist.« »Ich aber.« Sie griff in die Tasche ihres Mantels, eines schwarzen secondhand verlebten Trenchcoats, dessen Kragen sie aufschlug. Sie hielt mir das brennende Feuerzeug hin, machte ein detektivisches Gesicht, zog die eine Augenbraue hoch, Zigarette im Mundwinkel, und blies cool den Rauch über die Kragenkante. Das mochte ich sofort sehr an ihr, dass sie in jedem Augenblick spielbereit war, dass sie all die Klischees, die uns umgeben, die uns niederzudrücken drohen, durch ihre rastlosen Volten, ihre ironischen Verspiegelungen unschädlich machte. »Also, sagst du mir deinen Namen?« »Rate mal.« »Was?« »Das heißt: Wie bitte!« »Wie bitte?« »Rate mal.« »Das ist unmöglich. Wie soll das gehen?« »Na komm, das schaffst du schon. Welcher Name passt zu mir?« »Mein Gott!«, rief ich in den laternenhellen Nachthimmel, in dem lichtverwirrt eine Amsel zwitscherte, »es gibt eine Million Namen. Wie soll ich ausgerechnet deinen erraten?« »Wir kennen uns doch schon eine Ewigkeit. Versuch es mal.« »Wie soll das gehen? Das ist absurd!« Sie wandte sich ab: »Siehst du, hab ich dir doch gesagt. Der Typ ist voll der Langweiler!« »Also gut. Ich versuche es.« Ich trank einen Schluck, knibbelte am Etikett der Flasche herum und sagte: »Rumpelstilzchen!« Sie unterdrückte ein kleines Lächeln, das sah ich sehr wohl. »Sehr witzig. Los, sag mir, wie ich heiße.« Sie meinte es wirklich ernst. »Gut, du musst mir aber ein bisschen Zeit geben.« »Na klar. Nous sommes jeunes et nous avons le temps éternel. Hauptsache, du schaffst es.« »Bevor ich es versuche, möchte ich dich noch darüber informieren, dass ich absolut kein Französisch spreche.« »Ist doch egal. Ich versteh auch nicht alles, was du redest. Los, jetzt sag mir endlich, wie ich heiße.«
Was wusste ich über sie? So gut wie nichts. Sie konnte nicht tanzen, hatte Probleme mit Treppen. Aber aus motorischen Auffälligkeiten auf Namen zu schließen, war müßig. Fällt eine Hannelore eher die Treppe herunter als eine Rita? Einzig und allein ihre französischen Einwürfe, die für mich perfekt muttersprachlich geklungen hatten, ließen eventuell den Schluss zu, dass sie etwas mit Frankreich zu tun hatte. Was für eine magere Fährte, aber die einzige Spur weit und breit. Welche französischen Namen kannte ich? Ich musste etwas Besonderes finden, das nicht zu bizarr war. Sieht man aus wie der Name, den man hat? Kann schon vorkommen. Aber ich war immer eher erstaunt darüber, wie ein zu hundert Prozent unsäglicher Name durch seinen Namensträger entschärft, ja veredelt werden konnte, und ohne die geringste Irritation sagt man dann ›Hallo Herbert‹ oder ›Hallo Detlef‹. Mir war klar, dass ich ihn nicht erraten konnte, aber ich nahm mir vor, wenigstens einen Namen zu nennen, der ihr schmeicheln, der ein Kompliment sein würde. Da entzündete ein herumstiebender Neuronenfunke meine Erinnerung. Meine Eltern hatten eine Schallplatte besessen, auf der eine Frau französische Chansons sang. Ihr dichtes schwarzes Haar rahmte das kleopatrahaft frei geschnittene Gesicht ein, die Augen dramatisch geschminkt. Ich machte mich auf die Suche nach dem Namen, formte mit der Zunge in meinem geschlossenen Mund Buchstabe für Buchstabe des Alphabets. Schon oft war ich durch diese Methode auf Verschollenes gestoßen. So als wäre die Zunge ein Fühler des Gehirns, der durch das Abtasten der Anfangsbuchstaben den gesamten Namen enttarnt. Ich war schon bei H angekommen, ohne auch nur den Hauch einer Verbindung zwischen Zunge und Namenslücke gespürt zu haben, als es bei J eine heftige Rückkoppelung gab. Ich hängte rein phonetisch verschiedene zweite Buchstaben an. Je – Ja – Jo – Ju? – Ju? Peng! Treffer: Juliette Gréco.
»Okay, ich hab einen Namen.« Sie warf die Zigarette weg, setzte sich aufrecht hin, bereit für ihre Sommernachtstaufe. Ich zögerte kurz, war überrascht, dass ich es nun tatsächlich für möglich hielt, ihren richtigen Namen gefunden zu haben. Ich versuchte ihn so französisch wie möglich auszusprechen: »Juliette.« Weder sah sie mich an noch sagte sie etwas. Wie nach einer erschütternden Diagnose saß sie da, den Rücken erbärmlich gekrümmt. Nach einer Weile schüttelte sie kraftlos den Kopf. Sollte ich mich jetzt wirklich dafür schämen, dass es mir nicht gelungen war, ihren Namen zu erraten? Ich kannte sie erst seit circa hundert Minuten, und schon sollte ich für eine derart herbe Enttäuschung verantwortlich sein? »Ja, tut mir leid.« Ich zündete mir eine nächste Zigarette an, während sie leise zum Gehweg sprach: »Gibt halt keine Wunder.« »Tja. Ich sag ja, es tut mir leid.« Wir schwiegen. Da richtete sie sich auf: »Versuch es noch mal. Na los, eine Chance gebe ich dir noch.« Ich imitierte einen flehentlichen Tonfall, wimmerte: »Bitte, Schluss jetzt damit. Es ist unmöglich!« »Quatsch. Schau mal, einen Namen kannst du jetzt schon mal ausschließen. Das macht es doch wesentlich leichter. Du bist gar nicht so schlecht gewesen!« »Ach wirklich? Wie wäre es mit: Jutta?« »Komm, nicht gemein werden.« Sie boxte mich auf den Oberarm, und ich war mir sofort sicher, dass sie mindestens einen älteren Bruder haben musste, so treffsicher fand sie die Stelle am Muskel, die schmerzte. Wir wurden beide ein wenig hysterisch, was ich ganz angenehm fand.
»Also los, nutze deine letzte Chance. Mein Gott, stell dich doch nicht so blöd an. Das kann doch nicht so schwer sein. Spuck endlich meinen Namen aus!« Ich hielt mir die Hände vor das Gesicht und rief in die Handflächen: »Äääähhhh – Judith!« »Stimmt.« Ich wandte mich ihr zu, ruckartig, und spürte den Alkohol. »Quatsch, oder? Das kann nicht dein Ernst sein! Du heißt Judith?« Sie sah mich bestürzt an, die Nasenflügel ihrer eingedrückten Nase bebten so, wie ich das noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Es sah eher aus wie ein Trick, mit dem man in geselliger Runde punkten kann, etwas in der Art wie Ohrenwackeln oder Zunge an die Nasenspitze. Ihre Nasenflügel flatterten und ihre Augen schimmerten. Vorsichtig fragte ich: »Du heißt wirklich Judith? Also wirklich?« Sie nickte, und da raste mein Herz los, etwas in meinem Hirn begann zu glänzen und ich konnte nicht anders, als breit zu grinsen. Ein, wie ich mich augenblicklich sorgte, dümmliches Lächeln, das ich aber nicht zu unterdrücken vermochte. Hätte man mir in diesem Augenblick Löcher in den Schädel gebohrt, wäre aus jeder einzelnen Öffnung ein gebündelter Lichtstrahl geschossen. »Was ist denn mit dir los? Warum grinst du so krass?« »Es ist absolut unfassbar, was da gerade passiert ist«, strahlte ich, »ich habe deinen Namen erraten! Das ist der helle Wahnsinn.« »Na ja, so schwer war es nun auch nicht. Wenn Jutta und Juliette nicht stimmen, bleibt ja nicht mehr viel übrig. La vérité appartient à ceux qui la cherchent. Ich habe dir den Namen doch wie einen abgeschlagenen Kopf auf dem Präsentierteller serviert.« In einem Anfall von Hybris rief ich: »So, und wo wir schon mal dabei sind: Jetzt rate ich auch noch deinen Nachnamen. Schau mich mal an. Warte.« Ich nagte auf meiner Oberlippe herum, spielte Abwägen und hoffte wie ein Wissenschaftler auszusehen, der ein seltenes Insekt begutachtet. Ich kam ihrem Gesicht ganz nah – woher kam nur immer dieser Waldbrandgeruch –, nahm wieder abschätzend Abstand und sagte: »Konradi. Judith Konradi? Stimmt, oder?« Gegen ihren Willen lachte sie los: »Absolut. Du bist ein Hellseher. Wow, was für ein Kack-Name. Klingt für mich eher wie jemand, der von der Polizei gesucht wird. Gestern gegen Mittag wurde Judith Konradi zum letzten Mal gesehen. Sie trägt eine rote Wollmütze. Ein Gewaltverbrechen kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Aber wir bitten Sie nicht um Ihre Mithilfe, denn sie wird von niemandem vermisst. Sollte Ihnen Judith Konradi auf der Straße begegnen, behalten Sie es bitte für sich. Übrigens bekommt Frau Konradi langsam einen kalten Hintern. Wollen wir mal weiter?« Sie kannte sich in der Stadt wesentlich besser aus als ich, lief zielstrebig in enger werdende Gassen hinein.
Ich hatte mir, als ich nach Bielefeld gekommen war, fest vorgenommen, meine jahrelange Unbedarftheit in modischen Angelegenheiten mutig abzuwerfen, um endlich so etwas wie einen eigenen Stil zu kreieren. Von meinen unkontrollierbar aus zwei Wirbeln herauswuchernden Hinterkopflocken hatte ich mich endgültig getrennt und mir sogar eine eigene Haarschneidemaschine zugelegt, mit der ich mich auf dem Boden kniend selbst scheren konnte. Alles eine Länge: 0,3 Millimeter. Die Stoppelhärchen, die ich mit den Handflächen zusammenschob und zum Mülleimer trug, sahen eher so aus, als hätte man einen blonden Maulwurf rasiert und nicht einen markanten Nachwuchsschauspieler frisiert. Jedes Mal aufs Neue kam mir dieses Häuflein Haare elend vor und jedes Mal aufs Neue war ich ein Häuflein Elend, wenn ich diese Haare sah. Farblich hatte ich mich von allem irgendwie Buntem getrennt und mich ganz und gar in Schwarz gehüllt. Sehr enges schwarzes T-Shirt, das den Bizeps ansehnlich aus dem Bündchen hervorschauen ließ, darüber einen schwarzen, ebenfalls möglichst engen Pullover mit V-Ausschnitt, unter dem aber der T-Shirt-Kragen niemals zu sehen sein durfte. Enge schwarze Jeans mit Gürtel und fetter silberner Gürtelschnalle. Ich hatte zwei Modelle zur Auswahl. Ein verschlungenes Schlangenmotiv à la Medusa und eine Schnalle, die ich mir aus meinem Austauschjahr in Laramie, Wyoming, mitgebracht hatte: Rodeo-Cowboy mitten im Sprung. Bei den Schuhen war etwas schiefgelaufen, das jetzt, da ich durch die stillen Straßen wanderte, mehr und mehr hervortrat. Ich hatte mir sogenannte Biker-Boots gekauft, halbhohe schwarze Lederstiefel mit breiten Riemen über Ferse und Spann. Der Verkäufer hatte mir, um die Haltbarkeit der Sohlen zu verlängern, nahegelegt, sie mit Eisen zu beschlagen, was ich dann auch begeistert bei einem Schuster in Auftrag gegeben hatte. Dieser Schuster hatte, als ich die Stiefel abholte, beide Arme in Gips und sein linkes Auge war komplett von seiner blaugrünlila geschwollenen Gesichtshälfte verschluckt worden. Entzückend altmodisch hatten Glöckchen beim Eintreten gebimmelt und dann das. Er stellte mir die Schuhe einzeln mit den Zähnen auf den Tresen, nannte den Preis, und ich musste den Betrag selbst in die Kasse legen und mir das Wechselgeld herauszählen. Währenddessen stand er hinter mir wie ein verkloppter Zyklop und überwachte mich. Schon eine Minute nachdem ich das Geschäft wieder verlassen hatte, konnte ich kaum noch glauben, was ich gerade erlebt hatte. Aber die beschlagenen Stiefel machten mir nur, wenn ich regungslos dastand, Freude. Wenn ich ging, klackerten sie bei jedem Schritt penetrant laut auf dem Boden und wenn ich mich beeilte, klang es gar, als wäre ich ein zweibeiniges Pferd in Zeitnot. Durch extremes Nach-oben-Drücken der Zehen versuchte ich jetzt das Klappern zu mildern, die Sohlen sanft auf den Asphalt zu setzen. Dadurch lief ich allerdings so eigenartig neben ihr her, dass sie schließlich stehen blieb und mich fragte: »Sag mal, was veranstaltest du da eigentlich?« Ertappt blieb ich stehen. »Warum schleichst du denn so komisch neben mir rum? Was ist denn mit deinen Schuhen los?« »Vier Flaschen Bier haben wir noch«, sagte ich, um irgendetwas zu sagen. »Gut gezählt, Fred Astaire!« Um mich aus der Sackgasse zu befreien, in die mich meine lächerlichen Stiefel hineingesteppt hatten, schnitt ich ein Thema an, das bis jetzt, ob absichtlich oder aus Gedankenlosigkeit, noch gar nicht angesprochen worden war.
»Wie hat dir eigentlich die Premiere heute Abend gefallen?« Ich spielte den Tybalt und hatte die letzten Wochen mit stundenlangem Fechttraining verbracht. Sie nahm einen Schluck Bier, sah mich wohlwollend an und sagte: »Grauenhaft. So was Armseliges wie diese Aufführung habe ich schon lange nicht mehr gesehen.« Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden hatte, oder ob das, was ich meinte, verstanden zu haben, ernst gemeint war.
Es waren mühsame Proben gewesen. Der Jungregisseur kam aus Berlin, trug an jedem Finger einen klobigen Totenkopf-Ring und hatte alle Schauspieler durch seine coole Ahnungslosigkeit zur Verzweiflung gebracht. Immer wieder hatte er unsägliche Einträge aus seinem Tagebuch vorgelesen. Ich erinnere mich an den Satz: »Die Landschaft hinter Magdeburg zum Ficken so schön.« Auch mich hatte er angebrüllt: »Ik seh dein Schmerz nich, Alter!« Eine Woche vor der Premiere war er plötzlich in Tränen ausgebrochen und hatte uns regelrecht angebettelt, ihm zu helfen, ihn nicht im Stich zu lassen. Weinend lag er zwischen den Sitzreihen im Zuschauerraum und winselte: »Ik schaff dit nich. Ik schaff dit nich ohne euch.« Wir hatten uns zusammengerauft und die letzten Tage ununterbrochen gearbeitet. Ich fand den Abend durchaus gelungen. Sie war anderer Meinung. »Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte, so peinlich war mir das alles. Diese Julia!«, rief sie. »Das geht doch nicht, dass ’ne Dreißigjährige, die aussieht wie ’ne Vierzigjährige, ’ne Vierzehnjährige spielt. Und dann macht die sich auch noch nackt. Hüpft da rum mit ihrem Hängebusen und ruft: ›Romeo! Oh Romeo!‹ Ich hab geglaubt, die ist irre geworden, die ruft nach ihrem Kind. Und der Romeo, der ist doch schwul, oder? Wie der gefochten hat! Pieks, pieks, pieks. Wie ’ne Volltunte. Nee, wirklich, also wirklich, kein einziger schöner Moment. Nix. Keine Liebe, keine Magie, kein Hass, keine Pest, keine Politik, keine Form. Unsäglicher Quatsch. Shakespeares Sprache, Shakespeares Sätze, das sind Billardkugeln. Die müssen aufeinanderprallen. Da müssen Kräfte frei und übertragen werden. Da muss Reibung entstehen. Hitze in der Sprache. Die Sprache ist der Ort der Hitze und nicht, dass Julia, entstellt von Laster und Geburt« – das waren tatsächlich ihre Worte, ›entstellt von Laster und Geburt‹ –, »auf einem schwulen Romeo rumrutscht. Und noch in der letzten Reihe sieht man, dass die sich voreinander ekeln. Da könnt ich kotzen, wenn ich so was sehe. Das kann doch …«
Um nicht völlig von ihrer Wortlawine verschüttet zu werden, um nicht für immer unter der zentnerschweren Schneelast ihrer Entrüstung zu verstummen, rief ich: »Du weißt schon, dass ich da auch mitgemacht habe?«
Sie sah mich an, geradezu liebevoll. Nie hätte ich es für möglich gehalten, und auch später hat mich das jedes Mal aufs Neue aus der Fassung gebracht, dass jemand mit einem so entwaffnenden Gesichtsausdruck solche Gemeinheiten von sich geben konnte: »Willst du die Wahrheit wissen? Also, ich meine wirklich die Wahrheit?« Ich nickte: »Na klar!« »Also gut«, sagte sie sanft, »du warst der Schlimmste von allen. In deiner zu engen schwarzen Lederhose. Mit freiem Oberkörper. Tickst du noch ganz richtig? Das ist ein Theaterstück und kein Fechtturnier! Und kannst du mir mal verraten, warum Tybalt mit norddeutschem Akzent gesprochen hat? Kommt Tybalt aus Hamburg oder aus Husum? ›Romeo, ich sstech dich doot.‹ Und wie du gestorben bist!« Sie lachte los. Dieses Lachen! Es hörte sich an wie mein eigenes Lachen. Obwohl mir absolut nicht zum Lachen zumute war, fühlte es sich so an, als wenn nicht sie, sondern ich selbst lachen würde. Ich lachte mich aus. »Wie du dich da minutenlang am Boden gewälzt hast. Nur weil du selbst so laut geschrien hast, hast du nicht gehört, wie die Leute gekichert haben.«
Während sie mich beschimpfte, wurde sie schöner und schöner, blühte regelrecht auf. Langsam machten sich ihre Fliegenpilzworte in mir breit, entfalteten ihre giftige Wirkung, und ich spürte, wie mein Beleidigtsein mehr und mehr wuchs, sich ätzend durch die Fassade meines dümmlich nickenden Äußeren durchfraß. Ich war verletzt, sprachlos, wollte sie schubsen und wegrennen und war doch gelähmt durch ihre toxischen Worte. Das Schlimmste von allem: In mir regte sich die bittere Erkenntnis, dass sie recht haben könnte. »Die Leute haben gelacht, als ich gestorben bin?« »Allerdings! Hast du im Todeskampf gar nicht mitbekommen, hm?« Gekränkte Stille. »Na komm!« Sie klapperte mit ihren großen Zähnen. »Mir wird kalt. Gehen wir mal ein bisschen schneller?«
Wieder spielte sie, den Kopf hin und her wendend, ihr Selbstgesprächsspiel: »Du hast ihn verletzt!« »Was kann ich denn dafür? Er wollte doch die Wahrheit wissen. Ich hab doch sogar extra noch mal nachgefragt.« »War die Aufführung denn echt so schlimm?« »Also, unter uns, die war der größte Scheiß, den ich je gesehen habe.« »Egal, du musst jetzt irgendwas machen, sonst rennt er dir weg!« »Ja, aber was denn?« Sie stellte sich vor mich, machte einen Schritt auf mich zu und umarmte mich. Ihr Haar war direkt unter meiner Nase, aber ich roch kaum etwas. Im Mund war wieder dieser Geschmack von Verbranntem. Prüfend schob ich meine Zunge am Gaumen hin und her. Lagerfeuerromantik zum Essen. Woher kam das nur? War sie eine Pyromanin? Trug sie angekokelte Unterwäsche? Sie flüsterte: »Du bist ja ganz zerbrechlich.«
Das hatte noch nie jemand zu mir gesagt! »Du bist ja ganz zerbrechlich.« Das war ein Satz, das wusste ich sofort, den ich niemals wieder vergessen würde. Ein Satz, der in Bezug auf mich außerhalb aller Möglichkeiten gelegen hatte, den ich niemals als einen für mich in Betracht kommenden Satz zu denken gewagt hätte. Und doch hatte ich mich nach genau diesem Satz gesehnt. Im ersten Augenblick dachte ich noch: Was ist denn das für ein sentimentaler Quatschsatz? Aber dann glitt er in mich hinein, fand seinen Platz, eine freie Stelle, die wie gemacht war für ihn. Ausnahmslos alles, was Regisseure oder Kollegen zu mir sagten, egal ob Lob oder Kritisches, empfand ich auf eine unangenehme Art als sperrig. Es verkantete sich in mir, und zwanghaft hatte ich das Gefühl, mich positionieren, ja, mich wehren zu müssen. Aber dieser Satz passte, passte perfekt. Genauso wie jeder Mensch ein paar Sätze mit sich herumträgt, die aus ihm herauswollen, genauso, dachte ich, gibt es auch ein paar Sätze, auf die ein Mensch wartet, Worte, von denen er nicht ahnt, dass sie auf ihn zutreffen könnten, und die ihm dann aber ermöglichen, sich selbst völlig neu zu denken. »Du bist ja ganz zerbrechlich.«
Sie ließ die Hände über meinen Rücken gleiten, drückte links und rechts der Wirbelsäule ein wenig mit den Fingern auf mir herum. Das hatte etwas Medizinisches, fühlte sich an wie das Maßnehmen für eine Wirbelsäulenoperation. Auch ich legte meine Arme um sie. Lange schlaffe Affenarme. Sie sah auf, öffnete die Augen so weit, dass ihre Stirn nicht mehr wusste, wohin mit all der Haut, die sich in zig Falten wellte, und legte ihren Kopf an meine Brust. Wie schon auf der Premierenfeier standen wir bewegungslos da. Ob ihre Gedanken genauso rasten wie meine? Ich jedenfalls war äußerlich ein umarmtes Monument und innerlich ein Ameisenhaufen im Ausnahmezustand. Ich schloss meine Augen und wurde schlagartig schläfrig, so als würde mir das Dunkel mit dem Handrücken über die Stirn streichen, um mich zu beruhigen. Minute für Minute ging dahin. Wobei ich vermutete, dass auch die Minuten selbst nicht mehr so genau wussten, wie lang sie eigentlich dauerten, wann exakt eine Minute zu Ende war und sie Platz machen sollte für die nächste Minute, die schon ungeduldig in der Schlange stand, um ihrerseits endlich dranzukommen, sich an uns zu schmiegen und ihr kurzes Minutenleben gemeinsam mit uns zu verbringen. Ich stellte sie mir vor, diese lange Schlange der Minuten, die sich genau uns ausgesucht hatte, ein Paar in einer lauwarmen Nacht, das sich aus unerfindlichen Gründen nicht vom Fleck rührte. Und weil es so schön mit uns ist, fängt eine Minute an zu schummeln und klammert sich fest, versucht doch ein wenig länger zu bleiben, und die anderen Minuten rufen: ›Schluss jetzt, du bist vorbei, bist verronnen. Hau ab! Jetzt sind wir dran.‹ ›Nein, ich will noch bleiben. Eine Minute ist viel länger, als ihr denkt.‹ ›Kommt nicht infrage, mach, dass du wegkommst, jetzt beginnt unsere große Zeit.‹ Hunderte Sekunden werden angelockt und schwirren winzig und enervierend um die Minuten herum. Wenn wir noch lange so dastehen würden, käme vielleicht sogar majestätisch eine Stunde daher, schweifte ich weiter ab, würde die lästigen Minuten mit kraftvoller Pranke verscheuchen und uns zuraunen: ›Lasst euch Zeit. Ich bin es: eine ganze Stunde.‹ Oh je, Gedankenlawinen gingen ab in unzugänglichsten Hirnregionen. Vorsichtig hob ich die Augenlider und sah mich, ohne den Kopf zu bewegen, um. Unspektakulärer ging es nicht. Gehweg, Straße, Fassaden, Hauseingänge, parkende Autos. Sie und ich, dachte ich, sind sicherlich das Aufregendste, was dieser Nullachtfünfzehnweltenecke seit Langem widerfahren ist. Zig Jahre war diese trostlose Straßenansicht nicht zu Ende gepuzzelt worden. Doch jetzt endlich waren die letzten beiden entscheidenden Teilchen eingefügt – ein Sieteilchen und ein Ichteilchen – und passten genau. Da, wo ihr Ohr auf meiner Brust lag, war es durch den Stoff hindurch so warm geworden, als hätte mir jemand einen frisch gegossenen, noch nicht ganz ausgekühlten Orden angeheftet, und auch unter ihren Händen auf meinem Rücken staute sich fingerförmige Wärme. Ich hätte sie gerne an mich gedrückt, aber es ging nicht. Sie bestimmte Abstand und Dauer. Ich war hin- und hergerissen. Mal dachte ich: Ist doch herrlich, hier zu stehen. Von mir aus auch die ganze Nacht, bis es hell wird. Dann allerdings: So, jetzt reicht es aber auch, ich muss mich mal bewegen. In mir machte sich unangenehm unromantische Nervosität breit, die ich versuchte niederzuhalten und wegzudrücken. Wer war diese Frau da in meinem Arm? Wir standen und standen, und die Zeit schien sich nicht mehr für uns zu interessieren, war gelangweilt weitergetrottet.
Da sagte sie »Tausend«, löste sich von mir, nahm meine Hand und zog mich aus dem Bild heraus. Tausend? Was sollte das? Hatte sie tausend Männer so umarmt? War ich ihr tausendster Mann? Quatsch, das konnte unmöglich sein. »Was meinst du mit tausend?« »Dein Herz«, sagte sie, »macht aber seltsame Sachen.« »Warum?« »Mal rast es, dann holpert es, dann bleibt es fast stehen. Klingt ein bisschen desorientiert.« »Du hast mitgezählt?« Sie nickte und ich fragte: »Wirklich? Also ich meine: wirklich? Bis tausend?« Sie freute sich sichtlich, dass wir schon ein eigenes kleines Spiel gefunden hatten. »Na klar: wirklich.«
Wir gingen Hand in Hand einfach immer weiter, und es war seit Jahren das erste Mal, dass ich mir dieses Hand-in-Hand-Gehen gefallen ließ. Nie hatte ich es gemocht, wie ein Kind von jemandem herumgeführt zu werden. Es hatte mich gestört und aus dem Rhythmus gebracht. Früheren Freundinnen hatte ich stets meine Hand entzogen und erklärt, ich fände das eine lächerliche, den Einzelnen kleinmachende Angelegenheit. Händchenhalten wäre eine Albernheit. Mein Fazit: Kinder gehen bei Mami an der Hand, Männer gehen allein durch die Welt. Aber mit ihr war es überraschend angenehm. »Und weißt du, was das Alleraller-, also wirklich, wirklich Allerschlimmste war, was du gemacht hast?« Ansatzlos setzte sie die Unterhaltung fort, die wir vor einer halben Stunde unterbrochen hatten. »Nein. Aber ich bin mir sicher, du wirst es mir sagen.« »Obwohl du eine Stunde vor Stückende gestorben bist, hast du dich mit freiem Oberkörper verbeugt. Das ist so eitel. Da schüttelt es mich, wenn ich dran denke. Und deine Perücke!« Wieder bekam sie einen Lachkrampf, schlug sich klatschend die freie Hand vor den aufgerissenen Mund und schrie in ihr eigenes Lachen hinein, da sie abermals der Mundwinkelschmerz durchzuckte. Ich versuchte mitzulachen, aber es gelang mir nicht recht.
Wir liefen einfach weiter, ohne je über den Weg zu reden. Kreuz und quer durch die Innenstadt. Die Straßen wurden erst steiler, dann schmaler und mehr und mehr Häuser hatten Gärten. Sie zog sich den Trenchcoat aus und warf ihn mir zu. »Geh weiter, ich komm gleich.« Sie verlagerte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen, wackelte mit dem Po und begann mitten auf dem Bürgersteig den Rock zu lüpfen. Ich war so perplex, dass ich mich nicht von der Stelle rührte. Sie scheuchte mich mit wedelnder Hand davon: »Mensch, geh mal weiter. Ich muss mal. Was bist du denn für einer? Polizei! Polizei!« Ich eilte ein paar Schritte voran und blieb stehen. Ich hörte sie pinkeln. Es klang erstaunlich druckvoll. Ich sah mich kurz um. Sie war zwischen den Autos verschwunden. Hätte ich nicht gewusst, wer da pinkelt, hätte ich eher auf einen dicken Kerl getippt, einen abgefüllten Oktoberfestbesucher, der zehn Maß Bier intus hat. Ich hörte ihre Schritte auf dem Gehweg hinter mir und drehte mich um. Sie ruckelte sich noch den Rock zurecht und stopfte sich die Bluse unter den Bund. Wir bogen in eine Sackgasse ab, in der nur noch vereinzelt Villen standen. »Hier wohnen die richtig reichen Bielefelder. In einem dieser Paläste ist vor Kurzem eine Frau gefunden worden. Tot. Zusammen mit ihrem mumifizierten Hündchen. Kein reicher Nachbar hat was mitbekommen. Sie hatte sich selbst im Bett aufgebahrt, lag da mit all ihrem Schmuck behängt und dem zusammengerollten Hund neben sich. Beide vollkommen skelettiert. An jedem Knochenfinger hatte sie mehrere Ringe. Geschmückt lag sie da, wie eine Reliquie. Überall Vasen mit vertrockneten Blumen. Sie trug ein Seidennachthemd, das so weich war, dass es tief zwischen jede einzelne Rippe eingesunken war. Ich frage mich, ob sie den Hund selbst umgebracht hat oder der sich an seine tote Herrin geschmiegt hat, bis er selbst gestorben und vertrocknet ist. Besonders merkwürdig war, dass die Suppe, die auf dem Tisch stand, noch warm war, als man sie fand. Und da irgendwo«, sie deutete den Hang hinauf, »wohnt Doktor Oetker.« Weit unterhalb der steil abfallenden Gärten lag die Stadt, sehr mit sich zufrieden, voller schläfriger Lichter. Das Sträßchen endete an einem Wendekreis umstanden von Bäumen, dahinter ein stockdunkler Wald.
»Komm!« Sie zog mich durch meinen Kopf streifende Blätter in die Finsternis hinein. »Ich sehe nichts. Nicht mal dich!«, sagte ich leise, eingeschüchtert durch die Kühle atmende Undurchdringlichkeit. »Wir müssen nur kurz warten, bis sich unsere Augen gewöhnt haben und die Blindheit verfliegt.« Während wir dastanden, kam mir ein Gedanke, doch ich zögerte, ihn zu äußern, da ich mir nicht ansatzweise sicher war, an ihre Eloquenz heranzureichen. »Mein Vater hat in einer Psychiatrie gearbeitet«, begann ich vorsichtig. »Wir haben direkt auf dem riesigen Anstaltsgelände gewohnt. Nachts haben die Patienten geschrien. Richtig laut. Ich mochte das.« »Du hast es gemocht, dass da jemand rumgebrüllt hat?« »Ja, absolut. Ich kannte es ja nicht anders. Ich bin gerne dabei eingeschlafen. Wenn es so dunkel und still ist wie jetzt gerade, muss ich an damals denken, an das Geschrei der Patienten. Dunkelheit und Stille – passen die wirklich so gut zusammen? Mir kommt es dann so vor, als wären die Kranken alle geknebelt, verstummt oder längst tot.« Sie antwortete nicht, aber ihr Schattenriss schien durchaus wohlwollend. Aus der Schwärze rings um uns tauchten die Konturen eines Weges auf und übervorsichtig tappten wir in die Dunkelheit hinein. Schritt für Schritt wurden wir sicherer, verließ uns die Sorge, gleich gegen einen Ast zu stoßen.
Ich hatte ein wenig Mut gefasst. »Kennst du das, auf einem Bürgersteig oder auch auf einem Platz die Augen zu schließen und zu versuchen, möglichst viele Schritte zu gehen, ohne sie wieder zu öffnen?« »Nö, was soll das bringen?« »Ich hab es immer erstaunlich gefunden, wie schnell sich im Inneren die Panik ausbreitet, ein archaisches Misstrauen, das einem gegen den Willen die Lider aufschiebt. Der Körper fängt an, sich zu verkrümmen, windet sich wie ein Wurm in die Ungewissheit hinein, und nach dreißig Schritten ist man gelähmt vor Angst.« Sie ließ meine Hand los und fing zu zählen an. Ich sah, wie sie bereits nach drei Metern abzudriften begann. Aufrecht und forsch schritt sie voran. »Sechs, sieben, acht, neun.« Kurz hatte ich den Impuls, sie zu warnen, doch wozu? War das meine Aufgabe? Ich ließ sie laufen. »Zehn, elf, zwölf, dreizehn.« Sie war bereits in die ersten Zweige geraten. »Vorsicht!« »Vierzehn, fünfzehn.« Äste knackten. Sie brach durchs Unterholz wie ein aufgescheuchtes Wildschwein. Ich verlor sie aus den Augen. »Sechzehn, siebzehn, achtzehn.« Ich hörte ein dumpf-hölzernes Geräusch und einen tiefen Einatmer. Stille. Die spinnt ja, dachte ich und rief: »Judith? Alles in Ordnung?« Es raschelte, und zwischen den Stämmen entdeckte ich einen sich wälzenden Schatten. Ich ging in ihre Richtung. Sie rappelte sich auf. »Neunzehn, zwanzig, einundzwanzig.« Sie zählte einfach weiter, und es sah aus, als würde sie durch die Bäume hindurchgehen, sich ihr Umriss durch die Stämme schieben. Da gab es den nächsten Kopf-trifft-Rinde-Schlag. Doch sie zählte weiter. »Achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Geschafft. Ich hab es geschafft. Wo bist du?« Ich tastete mich vor. »Geht’s, Judith?« »Wie bitte? Ach so, ja! Dreißig Schritte Ungewissheit. Das hat was. Huch, wo bin ich denn gelandet?« »Hast du gemerkt, wie die Panik wächst?« »Und ob, als wäre jeder Schritt der letzte. Seiltanz ins Nirwana. Höchst befremdlich und erhellend. Es war, als würde jedes Organ seinen ganz eigenen Schreck bekommen.«
Ich nahm sie am Ellenbogen und gebückt kämpften wir uns Zweige biegend zurück auf den Weg. Sie strich sich den Rock glatt, pflückte sich Blätter von der Strumpfhose und aus den Haaren. »Du hast vollkommen recht. Nach drei Schritten fängt die Ungewissheit wie wild in einem zu jucken an. Jeder weitere Schritt macht es schlimmer, zieht die Schlinge zu und füttert die Sorge. Mein Magen hatte vollkommen anders Angst als meine Lunge. Und meine Milz war überhaupt der größte Feigling! Danke.« »Hattest du wirklich die ganze Zeit über die Augen zu?« »Na klar, und als ich sie aufgemacht habe, war es immer noch dunkel, aber trotzdem war die Panik weg.« »Ist dir nichts passiert? Ich hab so ein komisches Geräusch gehört.« Sie antwortete nicht, nahm meine Hand und zog mich weiter.
Ewig lange wanderten wir den Waldweg entlang. An einer Gabelung entdeckte ich ein primitives, an einen Baum genageltes Holzschild. Ich hielt ihr Feuerzeug in die Höhe, und wie in einer Wirtshaus-im-Spessart-Verfilmung flackerte die eingebrannte Schrift auf: Zum Eisernen Anton 2 km. Die Luft im Wald war wesentlich kühler als in der Stadt und es gab eiskalte, nach Granit riechende, scharf begrenzte Luftschwaden, in die wir mit nur einem einzigen Schritt hineingerieten, als würde man an einer geöffneten Gefriertruhe vorbeieilen. »Schön und gruselig gleichzeitig«, sagte sie, und das doppelte Weiß ihrer Augen schwebte unnatürlich und kugelrund im von der Nacht verwischten Gesicht. »Hier muss es sein.« Sie ließ meine Hand los. Lief ein paar Schritte vor, wieder zurück und verschwand wie in einem Zaubertrick. »Hier, komm, hier durch.« Ein noch schmalerer Weg führte steil bergauf, und mehrmals stolperten wir über Wurzeln, die im Dunkel aussahen wie versteinerte Elefantenrüssel, die sich durch das Erdreich wanden. Die beiden verbliebenen Bierflaschen schlugen aneinander, gläserne Kastagnetten, und ich hörte mich vor Anstrengung keuchen.
3.
»Gleich haben wir es geschafft.« Wir traten aus dem Wald hinaus, gingen durch hohes Gras und erreichten die Mitte einer Lichtung. Sie ließ meine Hand los, die daraufhin merkwürdig aus dem Zusammenhang gerissen an meinem Unterarm herumbaumelte. »So, angekommen. Was siehst du?« »Wie meinst du das?« »Ich meine gar nichts. Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Was siehst du?« Ich begriff, was sie wollte, und begann eher unwillig: »Wir sind auf einer Lichtung.« »Stimmt. Der Punkt geht an dich. Und weiter?« »Dahinten sehe ich einen Haufen gestapelter Baumscheite und tja … Wald.« Sie war unzufrieden mit mir: »Genauer!« »Es ist doch noch total dunkel«, sagte ich, obwohl ich sah, wie sich ganz entfernt der Himmel rötlich zu verfärben begann. »Streng dich an. Was siehst du?« »Ich sehe diesen Holzstoß.« Ich starrte in die Nacht. »Der Umriss des gesamten Stapels ist, glaube ich, mit einer Sprühdose markiert.« »Schon besser. Weiter!« »Ich sehe die Wiese.« »Welche Farbe hat die Wiese?« »Grün.« »Ja, findest du?« »Nein, stimmt, du hast recht, eigentlich ist sie noch schwarz.« »Warum hast du grün gesagt?« »Ich weiß auch nicht.« »Aber ich weiß es. Weil du von einer Wiese nun mal erwartest, dass sie grün ist. Egal, ob am Tag oder in der Nacht. Was für ein Schwarz? Ist die Wiese tiefschwarz oder glänzend schwarz, samtschwarz oder kohlpechrabenschwarz?« »Ich weiß nicht«, antwortete ich, »nachtschwarz vielleicht.« »Was siehst du noch?« »Ich sehe die Bäume.« »Was für Bäume sind das? Erkennst du sie an ihren Silhouetten?« »Nein, oder doch, warte. Es könnten Buchen sein. Ich erkenne die glatten Stämme. Und das da drüben könnten Tannen oder Fichten sein!« »Ja, ich glaube auch, dass das da Buchen sind. Aber die da, mit den weit ausladenden Armen, an deren Ende die Nadeln wie Fasern sich im Finsteren verfangen, ich würde sagen, das ist eine Tränenkiefer.« Ach du liebes bisschen, dachte ich, ich würde eine Tränenkiefer nicht mal am Tag erkennen. Wir standen im Gras, um uns herum der Schattenwald. Judith fragte und fragte: »Was siehst du?«, »Was riechst du?«, »Was hörst du?« Ich beschrieb die Büsche: »Schau mal, was für komische Frisuren die haben.« Über uns die verblassenden Sterne. Ich zeigte in den Himmel: »Wenn du über dem zweiten Stern der Deichsel des Großen Wagens den klitzekleinen Stern sehen kannst, den sogenannten Reiter, brauchst du keine Brille.« »Ich sehe ihn! Ich sehe ihn!«, rief sie. Mit Erstaunen in der Stimme lobte sie mich: »Das kannte ich noch gar nicht. Danke. Tritt mal das Gras platt, damit wir uns setzen können.«