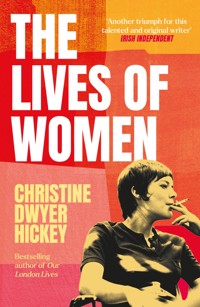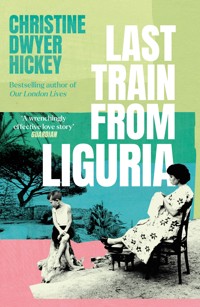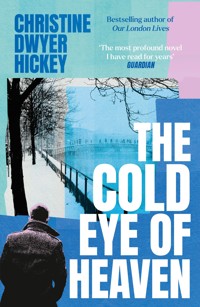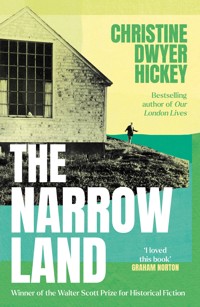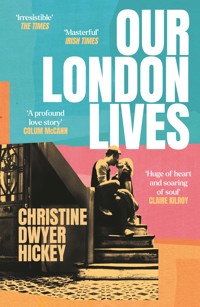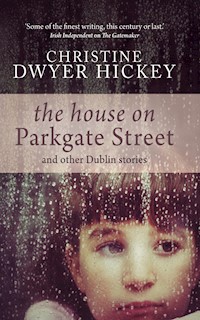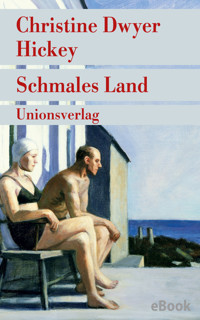19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist der Beginn einer vier Jahrzehnte andauernden Suche nach Liebe: 1979, in einem weiten, gnadenlosen London, finden sich zwei irische Außenseiter – Milly, eine junge Ausreißerin, und Pip, ein talentierter junger Boxer. Sie verlieben und verlieren sich ineinander, doch das Leben drängt sie in unterschiedliche Richtungen. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege, wandern die Gedanken zum anderen. Vierzig Jahre später klammert sich Milly an das einzige Zuhause, das sie je gekannt hat, während Pip durch die Straßen Londons streift und mit seinen Dämonen kämpft. Zwischen ihnen, vielleicht unüberwindbar, liegt ein ganzes Leben. In einer sich ständig wandelnden Stadt entfaltet sich eine epische Geschichte über Einsamkeit, Sehnsucht, Menschlichkeit und Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Es ist der Beginn einer jahrzehntelangen Suche nach Liebe: 1979, in einem gnadenlosen London, verlieben und verlieren sich die irischen Außenseiter Milly und Pip. Vierzig Jahre später führt die Stadt sie wieder zusammen – doch zwischen ihnen liegt ein ganzes Leben. Eine epische Geschichte über Einsamkeit, Sehnsucht, Menschlichkeit und Liebe.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Christine Dwyer Hickey (*1958 in Dublin) ist Autorin und Dramatikerin. Sie schreibt Romane, Kurzgeschichten und Theaterstücke, ihre Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Für Schmales Land wurde sie mit dem Walter Scott Prize und dem Dalkey Literary Award ausgezeichnet.
Zur Webseite von Christine Dwyer Hickey.
Kathrin Razum (*1964) studierte Anglistik und Geschichte und arbeitet seit 1992 als freiberufliche Literaturübersetzerin. Aus dem Englischen übertrug sie u. a. Susan Sontag, Edna O’Brien, V. S. Naipaul, Rebecca Solnit und Katie Kitamura. Sie lebt bei Heidelberg.
Zur Webseite von Kathrin Razum.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Christine Dwyer Hickey
Alle unsere Leben
Roman
Aus dem Englischen von Kathrin Razum
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2024 bei Atlantic Books, London.
Die Auszüge aus Das wüste Land wurden von Ernst Robert Curtius ins Deutsche übertragen, aus: T.S. Eliot: Das wüste Land. Ausgewählte Gedichte, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983.
Übersetzung und Publikation dieses Werks wurden von Literature Ireland unterstützt.
Originaltitel: Our London Lives
© by Christine Dwyer Hickey 2024
© by Unionsverlag, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Anne McAulay (Millennium Images/Gallery Stock)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31188-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 01.08.2025, 12:11h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Modernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ALLE UNSERE LEBEN
Erster TeilMilly1979 – Das erste Mal sah sie ihn nur flüchtig …Pip2017MärzMilly1980 – Es wurde Mitte Januar, bis sie Mrs Oak …Pip2017AprilZweiter TeilMilly1982 – Die Verkäuferin legte das dritte Kleidchen auf den …Pip2017MaiMilly1982 – Ende Juli kam sie aus der Finsbury Library …Pip2017JuniDritter TeilMilly1989 – Sie hängte sich bei ihm ein, als sie …Pip2017JuliVierter TeilMilly1995 – Sie hatte schon den ganzen Tag das Gerede …Pip2017AugustFünfter TeilMilly1999 – Sie machten sich gerade bettfertig, als Matthew beiläufig …Pip2017SeptemberSechster TeilMilly2008 – Die Frau, die im Haus putzte, erzählte ihr …Pip2017OktoberSiebter TeilMilly und Pip2017NovemberMilly und Pip2017DezemberAchter TeilPip und Milly2017DezemberDankMehr über dieses Buch
Über Christine Dwyer Hickey
Über Kathrin Razum
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Christine Dwyer Hickey
Zum Thema England
Zum Thema Irland
Zum Thema Großstadt
Zum Thema Liebe
Für Denis – in Liebe
Dadurch, dadurch nur sind wir gewesen
Nichts davon findet sich in unsern Nachrufen
Nichts im Gedächtnistuch das wohltätige Spinne webt
Nichts unter Siegeln, die der magre Notar aufbricht
In unsern leeren Zimmern.
T. S. ELIOT,Das wüste Land
Erster Teil
Milly
1979
Das erste Mal sah sie ihn nur flüchtig. Kurz, als er hereinkam, und dann später noch einmal, als dieses Mädchen regelrecht an ihm klebte. Damals arbeitete sie noch nicht lange dort, zwei Wochen oder vielleicht drei, und musste sich noch zurechtfinden: all die unterschiedlichen Flaschen und Zapfhähne, der große geschwungene Tresen im Barraum, die kleine Lounge hintendran. Und jenseits davon die vier Treppenfluchten, eine dunkler als die andere.
Sie war dabei, Whiskeygläser zu polieren. Nicht, dass die Gläser es gebraucht hätten, aber Trish hatte ihr gesagt, dass Mrs Oak es nicht mochte, wenn ihre Barfrauen untätig herumstanden. »Sie findet, dass es hier sonst aussieht wie in der Kirche«, sagte Trish, »und wer will in der Kirche schon trinken?«
Mrs Oak lag damals noch im Krankenhaus wegen ihres Autounfalls, sie waren sich also noch nicht persönlich begegnet. Trotzdem hatte sie das Gefühl, sie allmählich kennenzulernen, denn wenn Trish ihr auftrug, irgendetwas zu tun, waren ihre ersten Worte immer: »Also, Mrs Oak will, dass das so gemacht wird«, oder: »Mrs Oak mag es nicht, wenn …«
Es war ein Boxklub-Abend – also Dienstag oder Donnerstag –, und Trish stand am Ende des Tresens, an die geöffnete Klappe gelehnt, und unterhielt sich mit einem Mann namens Jackie. »Der ist echt vielversprechend«, sagte der Mann, »braucht noch ein bisschen Arbeit, und härter muss er werden. Aber wenn er richtig geführt wird …«
Zuerst hatte sie gedacht, die beiden unterhielten sich über einen Greyhound. Der Mann sah aus wie jemand, der Greyhounds halten könnte, mit seinem Schaffellmantel und einem Hut, der für seinen Kopf zu klein schien. Aber dann fragte Trish: »Wie alt ist er denn, dein junger Boxer?«
»Oh, es ist nicht meiner. Noch nicht. Dieser Shamie behütet ihn wie eine alte Glucke. Zwanzig ist er, fast einundzwanzig. Wäre besser gewesen, ich hätte ihn ein bisschen früher in die Finger bekommen, aber es ist immer noch genug Zeit. Ich meine – schau dir mal an, wie der beieinander ist!«
»Oh, das hab ich schon gesehen, Jackie«, sagte Trish. »Glaub mir, das hab ich gesehen.«
Trish hatte das auf so eine bestimmte Weise gesagt.
Es war ungefähr eine Stunde, bevor sie zumachten. Die Jungs aus dem Klub trudelten jetzt ein, zu zweit oder dritt. Sie strahlten eine sirrende Energie aus, und ihre Stimmen schienen den ganzen Raum unter Strom zu setzen. Er kam als Letzter, zusammen mit Shamie. Die beiden blieben ein paar Minuten in dem kleinen Vorraum stehen, sein Gesicht im Schatten. Shamie stand mit dem Rücken zur Bar, eine Hand auf der Schulter des jüngeren Mannes, und schien die Unterhaltung allein zu bestreiten. Sie wusste, wer Shamie war, denn er hatte es sich nicht nehmen lassen, sich ihr an ihrem ersten Arbeitstag vorzustellen. »Ich betreibe den Boxklub hinter dem Pub«, hatte er gesagt, »du wirst mich also oft zu sehen kriegen. Wenn dir meine Jungs Scherereien machen, sagst du mir Bescheid.«
Er hat ein nettes Gesicht, hatte sie gedacht, auch wenn es ein bisschen ramponiert aussieht, und gehofft, dass das mit den Jungs und den Scherereien ein Scherz gewesen war.
Trish stand bereits an der Kasse und tippte die Bestellungen des Boxklubs ein. Sie stellte das Whiskeyglas zurück an seinen Platz, faltete das Tuch zusammen und folgte ihr. Die Jungs aus dem Klub standen in einer Reihe am Tresen. Ein Hauch von Aftershave und frischem Schweiß, keineswegs unangenehm. An ihrem ersten Abend hier hatte sie gehört, wie Trish das als Gestank bezeichnete. »Ihr Kerle stinkt«, hatte sie gesagt. »Was ist denn mit euch passiert, ist euch eine Kiste Rasierwasser auf den Kopf gefallen oder wie?«
Sie musste sich beherrschen, um nicht laut aufzulachen, als Trish das sagte.
Als sie das nächste Mal hinüberschaute, war der Vorraum leer. Sie sah Shamie, sein flaches Profil, die kaum vorragende Nase, er stand jetzt in der Mitte der Bar. Die Jungs aus dem Klub drängten sich um ihn wie Kinder, die beachtet werden wollen.
Während sie darauf wartete, dass sich bei einem Bier der Schaum setzte, ließ sie den Blick durch den Raum schweifen: die beiden Sitznischen mit den Lederbänken, die lange Bank unter dem großen Fenster zu ihrer Rechten, die Barhocker vor dem Bord an der Rückwand. Nur den jungen Boxer sah sie nirgends.
Und dann, kurz bevor Trish die letzte Runde ausrief, entdeckte sie ihn. Er saß in der Nische hinter dem Zigarettenautomaten, das Mädchen neben ihm versperrte die Sicht auf ihn. Das Mädchen war ihr schon vorher aufgefallen, eine Schöne, hatte sie gedacht, auch wenn sie ein bisschen verrückt aussah. Wie jemand aus dem Zirkus oder wie die Moderatorin einer Kindersendung im Fernsehen. Ihr langes fransiges Haar war von hellen Strähnchen durchzogen. Sie trug einen kurzen Schottenrock und eine flauschige rote Jacke, ihre Wollstrumpfhose hatte bunte Streifen, und ihre Beine waren lang und dünn. Tatsächlich hatte sie ihr leidgetan, denn sie hatte über eine Stunde allein dagesessen, Cider hinuntergestürzt und lange Zigaretten geraucht, und jedes Mal, wenn die Tür aufging, war ihr Kopf in die Höhe geschnellt. Jetzt allerdings wirkte sie nicht mehr sonderlich nervös, sie hatte die Arme schraubstockartig um seinen Hals verschränkt und schlabberte ihn ab.
Hinter der Schulter des Mädchens ein dunkelbrauner Scheitel. Um ihre Taille eine große Männerhand. Eine Schulter im marineblauen Pullover, ein Jeansbein. Die andere Hand erschien, nahm ein Bierglas vom Tisch, und eine Sekunde lang war da ein Eckchen Stirn, eine Nasenspitze. Sie bekam nicht genug von seinem Gesicht zu sehen, um zu wissen, wie er aussah. Trotzdem glaubte sie, ihn wiedererkennen zu können.
Sie war Mitte Oktober nach London gekommen, als das Wetter gerade umschlug. Hier war es viel wärmer als in dem Dorf im County Louth, das sie hinter sich gelassen hatte, allerdings wurde es früh und schnell dunkel. Aber wenigstens konnte man tagsüber noch im Pullover rausgehen, was sich gut traf, denn ihr Mantel war ihr ein bisschen eng geworden, seit sie ihn das letzte Mal angehabt hatte. Sie hatte sich für London entschieden, weil es groß genug war, um sich darin zu verlieren, und beschlossen, es mit einem Bar-Job zu versuchen, nachdem sie gehört hatte, wie unten im Hof ein Mann ihrem Großvater von einem Bekannten erzählte, der in einem Londoner Pub Arbeit gefunden hatte. »Die suchen händeringend Barpersonal«, sagte er, »und so hat er doch wenigstens ein Dach über dem Kopf.«
Sie glaubte, dass ihr diese Arbeit liegen würde, denn in dem einzigen Pub im Dorf kannte sie sich aus, ihre Großmutter putzte dort. Als sie noch klein gewesen war, hatte der Inhaber sie ab und zu zur Guinness-Schanksäule hochgehoben und ihr erlaubt, den Zapfhahn zu bedienen, und dann hatte er ihr gesagt, sie solle sich ein Mineralwasser vom Regal nehmen und die Flasche selbst öffnen. Als sie älter war, hatte sie dann dort in der Lounge als Bedienung gejobbt: samstagabends, wenn ein Mann aus Dundalk kam und Gitarre spielte, und sonntags am späten Nachmittag, wenn sich die alten Bauern zum Singen trafen. Sie kannte den Druck eines Flaschenöffners in ihrer Hand, den Widerstand eines Guinness-Zapfhahns. Und sie wusste auch, wie man eine Tropfschale sauber macht und die Sägespäne zusammenfegt.
Mrs Oaks Pub war ihr letzter Versuch gewesen, nachdem sie einen Tag lang die Pubs in diesem Teil von London abgeklappert hatte. Der Barmann in dem Laden am Ende der Straße hatte ihr den Tipp gegeben. Sie nahm an, dass er aus Belfast oder jedenfalls aus dieser Ecke kam, so wie er redete.
»Versuch’s mal mit dem Pub gegenüber von der U-Bahn-Station. Die Inhaberin liegt im Krankenhaus, der Barmann hat hingeschmissen, und die arme Trish hat nur ein paar Teilzeitaushilfen und schuftet sich halb tot.«
Er hatte ihr einen Orangensaft spendiert und sich dabei Zeit gelassen, die Flasche erst mal eine Weile in der Hand gehalten, bevor er sie öffnete, und sich dann eine Fluppe angezündet. Es machte ihr nichts aus – so konnte sie sich mal einen Moment hinsetzen, ihre Beine meckerten eh nach all dem Rumgelatsche.
»Es ist ein guter Laden«, sagte er, als er ihr den Orangensaft schließlich einschenkte. »In Farringdon gibt’s keinen besseren, und in Clerkenwell auch nicht. Ich geh da selbst auch hin. Wobei da manchmal echt die Hölle los ist. Nicht so wie in diesem Loch hier. Hier passiert nach sechs überhaupt nichts mehr. Aber dort gehen die Leute direkt nach der Arbeit hin, und dann müssen sie nur aus der Tür fallen, um die letzte U-Bahn nach Hause zu kriegen. Wahrscheinlich ist das jetzt sogar eine gute Zeit, um Trish zu erwischen.«
Er beugte sich über den Tresen und senkte die Stimme. »Allerdings solltest du nicht sagen, dass du aus dem Norden bist.«
»Bin ich auch nicht«, sagte sie.
»Nicht?«
Sie spürte, wie der Orangensaft in ihrem Magen bitzelte, und musste einen Rülpser unterdrücken, bevor sie antwortete: »Ich komme aus Louth.«
»Ach so – na dann sollte es keine Probleme geben.« Er klang ein bisschen enttäuscht.
Der Barmann hieß Gerry. Er sagte ihr seinen Namen nicht, aber sie hörte einen Gast nach ihm rufen, als sie die Tür zur Straße aufstieß.
Ein paar Minuten später drängte sie sich durch einen vollen Pub. Ein Gewirr sich überlagernder Stimmen. Und noch andere Geräusche, ein Klingeln und Gluckern, Klirren und Schwirren. Als befänden sie sich in einem großen Räderwerk, das gerade neu aufgezogen worden war. Sie wartete darauf, dass sich der Eindruck setzte. Allein die Zahl der Gäste! Ihre Kleidung, die unterschiedlichen Hautfarben. Ein Mann, der genauso aussah wie Bob Marley, mit Haaren wie eine Teppichunterlage, die über seinen Rücken hingen, ein anderer Mann mit einem Turban. Ein Mädchen mit einem Haarschnitt wie ein Soldat, dafür Wimpern bis zur Nase. Sie versuchte, nicht zu gaffen. Ihren Blick auf die Frau hinter dem Tresen zu heften, deren Gesicht man die Anstrengung ansah. Ihre Hände bewegten sich so schnell, dass man hätte schwören mögen, sie hätte drei und nicht zwei davon.
»Entschuldigung – sind Sie Trish?«
»Augenblick.«
»Ich wollte nur fragen, ob –«
»Ich hab doch gesagt –«
»Gerry hat mich geschickt, aus dem anderen Pub hier in der Straße, er hat gesagt, Sie suchen Personal.«
»Gerry schickt dich?«
»Ja.«
Ohne den Blick von ihr abzuwenden, stellte Trish ein volles Bierglas auf den Tresen, griff nach einem leeren, hielt es schräg unter den Zapfhahn und begann, es zu füllen. »Irin, oder?«, fragte sie.
»Ja.«
»Norden oder Süden?«
»Süden.«
»Referenzen?«
»Referenzen? Ja, klar, hab ich. Die sind in meiner Tasche, unten drin.«
»Kannst du ein Bier zapfen?«
»Ja, natürlich.«
»Na dann zapf mir mal eins, wenn ihr schon dabei seid!«, rief jemand hinter ihr.
»Und mir auch, mir ist schon ein Bart gewachsen, so lange stehe ich hier!«
»Na los, worauf wartest du noch?«, raunzte Trish sie an. »Leg deinen Kram hier unter den Tresen, darum kannst du dich später kümmern. Zackzack!«
Und so war sie eine Londoner Barfrau geworden.
Sie war achtzehn und hatte bis dahin nicht viele Menschen gekannt. Ihre Großmutter und ihren Großvater, die Arbeiter, die bei Bedarf in deren kleiner Landwirtschaft aushalfen, zur Erntezeit hin und wieder ein Student. Es hatte einen Vikar gegeben, bis die Pfarrkirche schloss, und eine Handvoll Kinder aus der protestantischen Schule, bis auch diese schloss, ein Jahr, nachdem sie selbst von der Schule abgegangen war. Es gab den katholischen Priester einer zwanzig Kilometer entfernten Gemeinde, der in den Pub kam, um sich zu betrinken und Lieder zu singen. Und früher hatte es auch mal eine Mutter gegeben, die sich von Zeit zu Zeit noch in ihre Gedanken schlich.
Sie kannte das Mädchen in dem Laden, wo sie den Schnupftabak und die Wochenendzeitungen für ihren Großvater kaufte. Sie kannte den Inhaber des Pubs und seine sauertöpfische Schwester, die das Postamt betrieb. Sie kannte den Busfahrer, der ihr aus seinem großen grünen Bus zuwinkte, dem Bus, mit dem man nach Newry hoch oder runter nach Dublin fahren konnte, wohin sie ihren Großvater manchmal begleitete, denn wenn er rückfällig wurde und wieder trank, brauchte er Hilfe, um zum Bus zurückzufinden.
Es gab die Hauptstraße und den Fluss, den Kirchturm und die Molkerei. Es gab die Friseurin im Wohnzimmer eines Cottages, wo ihre Großmutter sich hin und wieder eine Dauerwelle legen ließ. Es gab den alten Heuschober, in dem gebrauchte Traktorreifen verkauft wurden. Den grünen Briefkasten an der einen Straßenecke und die grün- und cremefarbene Telefonzelle an der anderen. Die große blaue Marienstatue an der Gabelung, einen Kranz aus schmutzigen Plastikrosen zu ihren Füßen. Es gab den Friedhof auf dem Hügel neben der großen katholischen Kirche. Und den kleinen Friedhof hinter der geschlossenen protestantischen Kirche, wo sie, wenn sie seitlich durch den Zaun schaute, in einen hellen Grabstein eingemeißelt den Namen ihrer Mutter sehen konnte.
Auf dem Boden von Mrs Oaks Pub lagen keine Sägespäne, die Decke war deutlich höher, die Räume waren großzügiger, und die lange Reihe unterschiedlicher Flaschenetiketten schien gar kein Ende zu nehmen, selbst hinten in der kleinen Lounge. Der Dorfpub mit seiner niedrigen Decke und den winzigen Fenstern war mal der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen. Doch kaum hatte sie einen Fuß hier hineingesetzt, begann er in ihrer Vorstellung zu schrumpfen. Bald war kaum noch etwas davon übrig, bis auf Erinnerungen an Geräusche oder Gefühlswahrnehmungen. Das Zischen, wenn ein alter Mann ins Kaminfeuer spuckte, das träge Ticken der Uhr, das Rascheln des Besens, mit dem ihre Großmutter fegte. Sie konnte immer noch spüren, wie sich der kräftige behaarte Arm des Inhabers in ihren Bauch gedrückt hatte, als er sie zum Zapfhahn hochhob, erinnerte sich an sein Ächzen und an seinen leicht muffigen Geruch. Und sie erinnerte sich auch daran, wie das Porter aus dem Zapfhahn geströmt war und sich weich in das Glas geschmiegt hatte, daran, wie, wenn sie direkt hineinschaute, für ein paar kostbare Sekunden alles ringsum verschwand.
Im großen Barraum von Mrs Oaks Pub gab es zu viel Licht. Es traf sie, wohin sie sich auch wandte. Morgens, wenn sie die Läden vor den großen Fenstern aufklappte, fiel es in einer breiten Bahn auf sie. Und abends sprang es ihr aus den Spiegeln entgegen, stach vom Kronleuchter herab. Den ganzen Tag funkelte und blitzte es von den Reihen unterschiedlich geformter Gläser, die sie mit ihren emsigen Händen wieder und wieder polierte.
Doch überall sonst gab es zu wenig Licht. Je tiefer man ins Haus hineinging, desto schummeriger wurde es. Hatte man in dem langen Korridor die kleine Lounge, Büro und Lagerraum passiert, sah man bis zum Windfang der Hintertür, die in den Hof führte, kaum mehr die Hand vor Augen. Dasselbe galt für die Treppe – zum ersten Stock hoch ging es noch, aber dann schwand das Licht. Die letzte, schmalere Treppenflucht zu ihrem Zimmer hinauf war eine undurchdringliche Finsternis. Auf den Treppenabsätzen befanden sich Lichtschalter an der Wand – sie hatte sie ertastet –, aber die waren alle überklebt. Selbst am helllichten Tag zerrte es an ihren Nerven, hinaufzugehen.
Sie zählte die Stufen und Treppenabsätze. Im ersten Stock befanden sich Trishs Wohnschlafzimmer, die Küche und ein Aufenthaltsraum für das Personal, der niemanden zu interessieren schien. Im zweiten Stock ein großes leeres Zimmer, in dem früher Klubtreffen stattgefunden hatten, und ein eigener Raum für Klopapiervorräte, diverse Eimer und Besen. Im dritten Stock die große Rumpelkammer, in der sich hauptsächlich altes Barmobiliar befand, Tische und ineinander verkeilte kleine Hocker, außerdem das kaputte Dartboard, in dem noch die Wurfpfeile steckten, es klaffte in der Mitte auseinander, sah aus wie ein gebrochenes Herz. Einmal war sie in das Zimmer getreten, um sich ein bisschen umzusehen, und da hatte ein Koch-Aufsteller mit einer Tafel in der Hand ein bisschen geschwankt und ihr einen Heidenschreck eingejagt.
Mrs Oaks Wohnung war ebenfalls im dritten Stock. Die Eingangstür sah aus wie eine richtige Haustür. Sie hatte ein Zylinderschloss, es gab eine Klingel und einen Fußabstreifer, und gleich daneben stand, mit dem Bild eines Flamingos verziert, ein schmaler, hoher Behälter, in dem ein schwarzer Männerschirm lehnte.
Vor Trish hatte sie sich anfangs gefürchtet, wegen der Fragen, die sie manchmal stellte, der Sachen, die sie sagte. Aber mit der Zeit gewöhnte sie sich daran. Tatsächlich hörte sie Trish gern zu, sie hatte so eine Art, ihre Sätze zu zerstückeln und den Gästen über den Tresen zuzuschieben. Trish übernahm das Reden mehr oder weniger allein, und das kam ihnen beiden entgegen. Jeden Morgen, bis auf sonntags, wenn der Pub geschlossen war, frühstückten sie zusammen. In der Küche wirkte alles ein bisschen zu groß: Töpfe, Pfannen, selbst der Wasserkessel. Es gab eine Fritteuse, wie man sie in einer Frittenbude erwarten würde, und eine Wurstschneidemaschine, die eher in eine Metzgerei gepasst hätte. Außerdem eine riesige Teekanne, die sie an den Kopf eines kleinen Elefanten erinnerte. Wenn sie in dieser Küche stand, fühlte sie sich wie Alice, nachdem sie von dem Pilz gegessen hat.
Für sie eine Portion Cornflakes aus einem großen Stahlbehälter und Brot aus einer riesigen Packung Toast. Für Trish zwei Tassen Kaffee und dazu eine Fluppe, während sie sich schminkte und redete.
Mrs Oak sei Witwe, erzählte Trish. Ihr verstorbener Mann habe Terry geheißen. Bei ihrem Autounfall habe sie sich ein Bein und das Becken gebrochen. Sie habe eine Schwester namens Martha, die in Howe lebte. »Ein harter Brocken, diese Martha«, sagte Trish.
Mrs Oak war auf dem Heimweg von einem Besuch bei dem harten Brocken gewesen, als ihr Wagen ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Sie hatte wochenlang im Krankenhaus gelegen, würde aber demnächst entlassen werden. Zunächst in eine Rehaklinik, und danach noch für eine Weile zu ihrer Schwester, denn die wohnte in einem Bungalow. Mitte Januar würde sie mal hier vorbeischauen, und wenn alles gut ging, dann Ende des Monats wieder ganz da sein.
»Und ich sag dir eins«, ergänzte Trish, in den Spiegel blickend, ein Auge geschminkt und groß, das andere klein und nackt, »dann muss hier alles blitzblank sein! Denn Mrs Oak, na ja – die hat gern alles so, wie sie es will. Sie ist okay, wirklich, solange man offen und ehrlich ist. Du darfst nur nicht versuchen, ihr was vorzumachen. Die kann nämlich in dich reinschauen, in deinen Kopf. Glaub mir, ich weiß das.«
Im Büro hing ein Hochzeitsfoto an der Wand. Wenn die Tür offen war, blieb sie manchmal stehen und schaute es sich an. Mrs Oak und ihr verstorbener Mann, der ein langes Messer über eine Hochzeitstorte hielt. Mr Oak hatte ein massiges Gesicht mit Hängebacken, Mrs Oak sah aus wie ein kluges Schulmädchen, das feine Dame spielt.
Die ersten paar Tage tastete sie sich die dunkle Treppe hinauf und hinunter. Bis eines Nachmittags die Putzfrau, Mrs Gupti, zufällig vor ihr hochging und die einzelnen Treppenfluchten wie auf Kommando erhellt wurden. Das Licht blieb nur ein paar Sekunden an, aber jetzt konnte sie sehen, dass sich unter jedem der stillgelegten Schalter ein dicker runder Knopf befand. Sie hätte die ganze Zeit nur auf diese Knöpfe drücken müssen, um jeweils eine Ration Licht gespendet zu bekommen, die ausreichte, um wohlbehalten von einem Stockwerk ins nächste zu gelangen.
Natürlich hätte sie wegen des dunklen Treppenhauses jemanden fragen können. Auch wegen etlicher anderer Dinge, aber man kann nicht endlos Fragen stellen, wenn man nicht vollkommen dämlich wirken will.
Trish hatte gesagt: Wenn du irgendwas wissen willst, nur raus damit!
Aber fragte sie Trish dann tatsächlich etwas, kam die Antwort in einer derartigen Geschwindigkeit, dass sie manchmal die Hälfte nicht mitbekam. Bei den Aushilfen versuchte sie es erst gar nicht, sie wusste, dass das sinnlos gewesen wäre. Die stille Muriel, die nur über Mittag da war, um beim Lunch zu bedienen, und niemandem in die Augen sah. Und dann diese Brenda mit ihren höhnischen Kommentaren – die zog jedes Mal eine Grimasse, wenn sie etwas sagte, als würde sie Chinesisch reden oder so was. »Bitte, was? Keine Ahnung, wovon du redest. Was? Wie? Bei der verstehe ich echt kein Wort.«
Also beschränkte sie sich die meiste Zeit aufs Zusehen und Hinhören, und abends in ihrem Bett ganz oben im Haus, in einem Zimmer, das viel zu groß für sie war, sorgte sie sich, bis sie einschlief.
Sie sorgte sich, dass Mrs Oak in ihren Kopf hineinschauen würde. Sorgte sich, was sie dort womöglich sehen könnte. Mit jedem Tag nahm ihre Beklemmung zu. Es fühlte sich an, als würde in ihrer Brust eine Schraube immer fester zugedreht. Kleinigkeiten ließen sie nicht mehr los. Ein Stückchen Schinken im Senftopf, eine falsche Reihenfolge, ein kleiner Blutfleck auf der Kruste eines Käse-Sandwiches, wenn sie sich wieder mal an einem zerbrochenen Glas geschnitten hatte.
Von den Lichtern in der Bar begann sie Kopfschmerzen zu bekommen. Von den Kopfschmerzen wurde ihr übel. Und dann war da noch etwas, etwas, das sie nicht klar benennen konnte. Aber es war trotzdem da, ein Schatten in der Ecke oder hinter ihr auf der Treppe. Er war am Fußende ihres Betts, wenn sie morgens erwachte. Er folgte ihr auf die Toilette, stand mit dem Rücken zur Tür, wartete.
Und dann sorgte sie sich wegen der Männer in der Bar, wegen der Kosenamen, die sie ihr gaben: Schätzchen, Süße, Herzchen, meine Hübsche. Meine Hübsche! Sie hätte fast laut aufgelacht, als sie das hörte. Ihre Großmutter hatte sie vor Männern gewarnt, denen solche Schmeichelworte von den Lippen tropften. »Die erzählen dir das Blaue vom Himmel, nur um dich rumzukriegen. Das sind Männer, die junge Mädchen aussaugen und sie dann achtlos wegwerfen.«
Sie befürchtete, zu vertraulich mit den Männern in der Bar umgegangen zu sein, als die Sorte Frau rüberzukommen, die ihre Mutter angeblich gewesen war: flatterhaft und ein bisschen zu freizügig. Aber sie hatte sich mit niemandem Freiheiten erlaubt. Sie war höflich gewesen, ja schüchtern. Hatte kaum den Mund aufgemacht. Dafür hatte schon allein die Scham über ihren Akzent gesorgt – eine Scham, mit der sie nicht gerechnet hatte.
Und dann befürchtete sie, dass den Männern vielleicht gerade das gefiel. Ein Mädchen, das kaum redete und jedes Mal feuerrot wurde, wenn jemand sie ansprach. Sie überlegte, ob sie es vielleicht mal auf Trishs Art probieren und kontern sollte, das eine Lid gesenkt, die Lippen gekräuselt.
Sie übte vor dem Spiegel, Trish zu sein. Sie sagte: »Ja, Schätzchen, du kriegst es gleich – hinter die Ohren.«
Und dann: »Im Leben nicht, Kumpel.«
Und dann: »Mit mir? Du willst dich mit mir verabreden? Hör zu, Junge, wenn ich irgendwann mal blind und taub werde und meinen Geruchssinn verliere, dann sag ich dir Bescheid.«
Aber selbst allein in ihrem Zimmer wurde sie dabei puterrot, und die Worte hatten keine Kraft. Außerdem sagten die Männer zu ihr ohnehin nicht solche Dinge wie zu Trish mit ihren schwarzen Wimpern, hellblauen Lidern und üppig weichen rosa Lippen.
Watneys, Whitbread, Worthington E, Carling Black Label. Watney Red. Best Bitter. London Pride. Draught Bass. Glenfiddich and Haig. Irish. Black Bush. Macallan, Glenlivet. John Jameson’s, John Smith’s, Johnnie Walker. Jack Daniel’s, Jim Beam und noch irgendwer.
Der Wochenrhythmus wurde ihr vertraut. Vom Montag mit seiner schleppenden, einsamen Anmutung bis zum Freitagabend, dessen Geräuschkulisse an einen Bauernhof erinnerte, hatte jeder Tag seine eigenen Abläufe. Sie wusste, dass die Mädchen aus der Textilfabrik am Freitagmittag zum Lunch kamen und dass die Bingotruppe am Montag erschien. Die Jungs aus dem Boxklub kamen mehrmals die Woche, wobei einige öfter dabei waren als andere. Die Drucker und Markthändler kamen und gingen von Montag bis Freitag. Und die Journalisten waren jeden Morgen, Mittag und Abend da.
Allmählich legte sich das Chaos in ihrer Wahrnehmung, das Gefühl, auf einem überfüllten Bahnsteig zu stehen und nicht zu wissen, wo die Kante ist. In den Momenten, bevor sie einschlief, sah sie das Ganze als menschlichen Dschungel. Sie sah manche Gestalten verschattet, andere aus der Nähe. Manchmal sah sie nur Teile von ihnen. Den von alten Blutflecken übersäten Ärmel eines Fleischhändlers, das Glitzern am Handgelenk eines Juweliers aus Hatton Garden, den Umriss des Huts der alten Mrs Rogers. Die Lichter der Jukebox und die Lichter des Zigarettenautomaten. Münder schwebten durch die Dunkelheit, öffneten und schlossen sich wie Fischmäuler. Sie sah Hände, die nach oben schossen, und hörte, wie ihr Name gerufen wurde, wieder und wieder.
Martini Bianco, Martini Rosso, Campari Soda. Dubonnet Citron. Gin Tonic. Gin Orange. Gimlet. Wodka pur. Oder Wodkar, wie manche Leute es hier nannten.
Das nächste Mal sah sie ihn etwa eine Woche später, gleich am Montagmorgen. Sie hätte nicht sagen können, woher sie wusste, dass er es war, sie wusste es einfach. Der Pub war vielleicht seit zehn Minuten geöffnet, und die alte Mrs Rogers saß wie festgeschraubt auf ihrem üblichen Platz auf der Bank unterm Fenster und nuckelte an ihrem morgendlichen Milk Stout. Ganz hinten in der Bar saßen zwei Markthändler, tranken Kaffee und fauchten einander über einem Stapel Bestellscheine und Quittungen an. Es war so ruhig, dass sie den Verkehr draußen hören konnte, und gedämpft sogar die blechernen Ansagen aus dem U-Bahnhof gegenüber. Ein kalter Morgen Anfang November, die Fensterscheiben vereist, und er ohne Mantel. Er ging schnurstracks an ihr vorbei zum hinteren Ende des Tresens, wo Trish gerade Münzen in die offene Schublade der Registrierkasse kippte. Im Vorbeigehen legte er einen Schein auf den Tresen und brummte etwas. Dann setzte er sich. Er schlug die Zeitung auf, die er unterm Arm gehabt hatte. Als Trish zu ihm ging und ihm seinen Drink hinstellte, blickte er nicht auf, doch ein paar Minuten später sah sie ihn den Kopf heben. Sie war gespannt, wie seine Stimme klang, ob er gute Manieren hatte, ob er Trinkgeld geben würde. Sie hatte sich schon dafür gewappnet, zu ihm zu gehen und ihn zu bedienen. Aber dann stand er auf und ging zu Trish, lenkte ihre Aufmerksamkeit auf sich, indem er mit einer Münze einmal kurz auf den Tresen klopfte, und kehrte an seinen Platz zurück. Trish brachte ihm den zweiten Whiskey. Es schien kaum einen Moment zu dauern, da war sein Glas leer und er gegangen, ein kleiner Stapel Münzen auf dem Tisch, die Zeitung auf dem Stuhl zurückgelassen.
Trish drehte sich zu ihr um. »So ein junger Mann, und trinkt schon allein«, sagte sie. »An einem Montagmorgen, und dann auch noch Whiskey? Ein schlechtes Zeichen, meiner Erfahrung nach. Aber er sieht gut aus, oder? Das muss man ihm lassen.«
»Hab ich gar nicht drauf geachtet.«
»Erzähl mir nichts«, sagte Trish.
In den folgenden Wochen sah sie ihn oft. Manchmal erwartete ihn das Mädchen, wenn er aus dem Boxklub kam. Manchmal blieb er allein. Er hatte fast immer eine Sporttasche über der Schulter und meistens ein Buch dabei. Für gewöhnlich setzte er sich auf den Platz hinter dem Zigarettenautomaten, es sei denn, dort saß schon jemand, dann setzte er sich auf einen der Hocker hinten an der Wand. Am Tresen trank er nie. Ab und zu ging er in den Korridor hinaus, um zu telefonieren, oder in die andere Richtung zur Toilette. Mittags kam er oft mit Shamie.
Eines Tages erschien er mit einem Mann, den sie noch nie gesehen hatte. Sie sahen aus wie Brüder und dann doch wieder nicht. Der andere Mann war leicht untersetzt, hatte ein runderes Gesicht und langes, eher helles Haar, aber sie hatten einen ähnlichen Ausdruck um die Augen. Der Mann hatte einen seltsam geformten länglichen Kasten aus dunkelbraunem Leder dabei, auf dessen Seite in Gold die Initialen N. D. prangten, und als er Trish bat, den Kasten sicherheitshalber hinter den Tresen stellen zu dürfen, fragte die ihn: »Was ist denn da drin, ein Maschinengewehr?«
»Nein«, sagte er. »Eine Trompete.«
»Ah, und wo sind die Pauken?«
»Ha, ha«, sagte er. »Sehr originell.«
Wenn er mit Shamie kam, trank er nie, er aß eine Suppe und zwei Sandwiches, und dazu gab es einen halben Liter Milch. Kam er mit dem Mädchen, trank er Lager und, wenn sie bis zur Sperrstunde blieben, ein paar Jack Daniel’s. Wenn er allein war, saß er da und las sein Buch oder vielleicht eine Zeitung. In Gesellschaft stand er gern.
In ihren Augen stach er heraus, weil er still stand. Die übrigen Jungs aus dem Klub hatten zappelige Füße und zuckende Schultern, stupsten einander beim Reden an. Und spuckten große Töne, natürlich. Sie fand, dass er etwas Gelassenes hatte, oder jedenfalls eine ruhige Kraft, die eher zu einem viel älteren Mann passte.
Sie wollte unbedingt hören, wie seine Stimme klang, doch bislang hatte sich das nicht ergeben. Eines Abends kam sie auf die Idee, es selbst herauszufinden. Sie beschäftigte sich in der Nähe seines Tischs, leerte Aschenbecher aus und wischte die umliegenden freien Tische gründlich ab. Aber sie hörte nur die Stimme des Mädchens. Die ziemlich enttäuschend war, dafür, dass das Mädchen so gut aussah. Es kam ihr vor, als stünde sie vor dem Hühnerstall ihrer Großmutter: ein anhaltendes wirres Gegacker, von einem gelegentlichen Schrei durchbrochen.
Sie wartete, bis die beiden sich zum Aufbruch rüsteten, dann machte sie Anstalten, die Gläser von ihrem Tisch abzuräumen. »Oh, nein, nicht!«, rief das Mädchen und barg ihr Glas an ihrer Brust, als wäre es in Lebensgefahr. »Das ist das Beste, der letzte Schluck! Sag ihr das!« Das Mädchen stieß ihn an. »Es ist das Beste.«
Er sagte gar nichts, sondern griff nach seinem leeren Glas und reichte es ihr.
Einen Moment lang trafen sich ihre Blicke. Sie spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss, und beinahe hätte sie das Glas fallen lassen, weil sie so darauf bedacht war, seine Hand nicht zu berühren, als er es ihr gab.
Sie zitterte, als sie wieder hinter dem Tresen stand, und wusste nicht, was sie davon halten sollte, warum sie so reagierte. Sie hatte Angst vor ihm, entschied sie dann. Das musste es sein. Warum auch nicht? Jemand, der sein Geld damit verdiente, andere Leute zu verprügeln, musste gefährlich sein. So jemand konnte einen anderen Menschen wahrscheinlich umbringen. Allerdings hatte er wirklich sehr schöne Augen.
Es war inzwischen Dezember, und rote Glitzergirlanden zogen sich durch die ganze Bar. In den Spiegeln funkelten die Weihnachtslichter, und der Geruch nach Würstchen im Schlafrock erfüllte das ganze Haus. Wenn sie vormittags öffneten, drängten die Gäste herein, und machten sie am frühen Abend dann wieder auf, standen die Leute draußen schon Schlange. Selbst tagsüber hing etwas Wildes in der Luft, Fremde verloren alle Hemmungen und gesellten sich zueinander, schrien und sangen und knutschten einander unter dem Plastik-Mistelzweig ab. Sie musste Mrs Gupti zur Hand gehen, weil die Toiletten so oft sauber gemacht werden mussten, und draußen den Gehweg abspritzen, weil der Bierlieferant sich beschwert hatte, dass er in Erbrochenem ausgerutscht sei und sich fast den Zinken gebrochen hätte.
Wenn schließlich die Sperrstunde nahte, hatte sie das Gefühl, den ganzen Tag Zuckerwatte aus Zigarettenrauch gegessen zu haben. Ihre Augen waren rot und juckten, und ihr Kopf war ständig von einer leichten Hitze erfüllt. Den Geruch des Rauchs wurde sie gar nicht mehr los, auch nach vier- oder fünfmaligem Einseifen haftete er noch an ihren Händen. Sie roch ihn in ihren Kleidern und Haaren, sogar in ihrem dunkelgelben Pipi, wenn sie aufs Klo ging. Das Essen im Pub war ihr widerwärtig. Zu viel Plastikschinken, befand sie, zu viele frittierte Würstchen. Sie sehnte sich nach einer anständigen Mahlzeit, irgendwas mit Petersilien- oder Bratensoße. Sie entdeckte eine Fernfahrerkneipe am Charterhouse Square, wo es den ganzen Tag warmes Essen gab, und eine Weile aß sie in der Nachmittagspause dort. Aber die Portionen waren riesig, und nach dem Essen fühlte sie sich lahm und aufgedunsen. Ihr Gesicht war teigig geworden, fand sie, und sie hatte richtige Schweinsäuglein bekommen. Sie wurde dick, zum ersten Mal in ihrem Leben, bekam kaum noch Luft, wenn sie ihren Mantel ganz zumachte, und musste sich sogar einen Männerpullover mit V-Ausschnitt kaufen, damit sie den Knopf an ihrem Rock offen lassen konnte.
Sie erinnerte sich daran, wie sie einmal mit ihrer Großmutter vom Dorf nach Hause gelaufen war, nachdem sie das Grab ihrer Mutter besucht hatten. Ihre Großmutter hatte geweint, kleine, harte Schluchzer den ganzen Heimweg über. Am Gartentor hatte sie sich dann zusammengerissen, hatte sich die Nase geputzt und die Tränen abgewischt. »Sei froh, dass du nicht viel hermachst«, hatte sie gesagt. »Das bewahrt dich vielleicht vor Unglück.«
Oh, aber der Baum war schön, das auf jeden Fall.
Sie hatten das Ende der Bank abmontieren müssen, um Platz für den Baum zu schaffen, und es hatte Trish und sie einen ganzen Sonntagnachmittag gekostet, ihn aufzustellen und zu dekorieren. Tagsüber warf sie nur ab und zu einen kurzen Blick darauf, doch abends, wenn alles sauber gemacht und die große Beleuchtung ausgeschaltet war, blieb sie eine Weile im Dunkeln sitzen und betrachtete den Baum. Manchmal dachte sie dann an ihre Mutter, die an einem Winterabend nicht lange vor ihrem Tod einen Nachbarn gebeten hatte, sie beide in ein Dorf in der Nähe mitzunehmen, wo, wie sie gehört hatte, vor der katholischen Kirche ein Weihnachtsbaum stand. Sie selbst war damals erst vier gewesen, aber ihre Mutter hatte den Baum noch mehr bestaunt als sie. Dabei war es ein dürres Ding gewesen, mit ein paar traurigen Lichtern und an die Zweige gehefteten Heiligenbildchen. Und jetzt stand hier Mrs Oaks Weihnachtsbaum, füllig und prachtvoll, in schönstem Lichterglanz. Ein Gefühl inniger Liebe zu dem Baum durchströmte sie, als wäre er ein Lebewesen. Ihre Mutter noch so jung. Eher wie eine große Schwester, hatte der Nachbar gesagt, als er sie wieder nach Hause fuhr. »Deine armen Eltern«, hatte er zu ihr gesagt. »Denen hast du sicher das Herz gebrochen mit deinem vaterlosen Kind.«
Das Gesicht ihrer Mutter, als er das gesagt hatte.
Eines Tages sagte Trish, sie sehe ein bisschen blass um die Nase aus. »Du musst dir jeden Tag die Zeit für einen Spaziergang nehmen, ein bisschen frische Luft tanken. Der Pub ist um diese Jahreszeit eine einzige Keimschleuder, und Mrs Oak würde ja wohl kaum wollen, dass du krank wirst.«
Und jetzt hatte sie das Gefühl, rausgehen zu müssen.
Sie hätte lieber weiter das getan, was sie am liebsten tat, sich ein übrig gebliebenes Sandwich aus der Bar auf ihr Zimmer mit hochnehmen und den Nachmittag dort verbringen. Sie war gern in ihrem Zimmer, mochte die Dachschräge und den weiten Blick über die Londoner Dächer, den ihre beiden kleinen Fenster boten. Sie hatte einen Sessel, in dem sie Zeitschriften lesen konnte, und einen kleinen runden Tisch sowie ein Kaminsims für ein bisschen Krimskrams. Und sie hatte ein Schminktäschchen mit Kosmetikartikeln, das jemand auf der Damentoilette hatte liegen lassen.
Manchmal breitete sie den Inhalt des Täschchens auf dem Kaminsims aus und übte, sich zu schminken, wobei sie sich an Gesichtern aus ihren Zeitschriften orientierte. Sie ließ das Make-up im Gesicht, während sie ihren Lunch aß und ein bisschen herumräumte, und blieb ab und zu vor dem Spiegel stehen, um sich zu betrachten. Aber sie wusch immer alles ab, bevor Trish zur Abendschicht läutete.
An manchen Tagen war sie hundemüde, dann streckte sie sich auf dem Bett aus und schlief die Nachmittagspause durch.
Die Namen der Straßen ringsum: Cowcross und St John, Briset und Benjamin. Die Namen der schmalen Durchgänge, die ihr halfen, wieder nach Hause zu gelangen: Passing Alley, Jerusalem Passage, Turk’s Head Yard.
Sie hatte schon ein paar Besorgungen für Trish gemacht – Gänge für sie erledigt, wie Trish es ausdrückte. Zum Postamt, zur Reinigung, zur Apotheke, wenn Trish etwas für ihren empfindlichen Magen brauchte. Einmal hatte Trish sie auch nach Hatton Garden geschickt, wo sie ein Armband abholen sollte, das Mrs Oak vor ihrem Unfall zur Reparatur gebracht hatte, und da hatte ein Juwelier mit Mädchenwimpern zu ihr gesagt: »Hallo, meine Hübsche, was kann ich für Sie tun?«
Auf der Straße nickten ihr Leute zu. Sie hupten im Vorbeifahren, klopften gegen Schaufensterscheiben. Es war, als wäre sie wieder in dem Dorf, in dem sie aufgewachsen war, alle schienen zu wissen, wer sie war und wie sie hieß. Aber hier wenigstens nicht aus einem schändlichen Grund.
Einige der Leute erkannte sie sofort: Ladeninhaber oder Freundinnen von Trish, die gelegentlich mit am Küchentisch saßen, Vera Greene etwa, deren Vater die Apotheke gehörte. Mr Hart, den Besitzer der Textilfabrik, und Mr Wells, der Buchhalter war und Mrs Oak immer explizit Grüße ausrichten ließ. Sie kannte Maggie, die vor der U-Bahn-Station Zeitungen verkaufte, und Tony Agnesi, der das Café betrieb. Sie kannte Fred Darlington, der in Trish verliebt war und den Schaffell-Laden in der Leather Lane führte, von dem ein Geruch nach Tod ausging.
Und dennoch kam ihr das Stadtviertel zu groß für sie vor. Sie hatte Angst, sich zu verirren und dann zu spät zur Arbeit zu kommen, oder womöglich in eine gefährliche Ecke zu geraten und überhaupt nicht mehr zurückzukommen.
Auf einem ihrer Gänge sah sie ihn eines Tages. Sah ihn, als er mit der Sporttasche über der Schulter aus der Peter’s Lane kam. Sie schlüpfte in den Eingang von Agnesi’s auf der anderen Straßenseite, hielt das Gesicht vor die Speisekarte im Fenster. Ein paar Sekunden lang konnte sie ihn durch die Scheibe sehen. Die roten und schwarzen Karos seiner Jacke. Sie gab ihm noch einen Moment, dann trat sie aus dem Eingang und folgte ihm. Beim Smithfield Market überquerte er die Straße und verschwand hinter einer Reihe geparkter Lieferwagen und Transporter. Sie ging ihm nicht nach, sondern blieb an einer Stelle stehen, von der aus sie durch eine Lücke zwischen zwei Lieferwagen freie Sicht hatte. Sie sah, dass er abbog und zwischen den Markthallen hindurchlief. Es war Nachmittag, und kaum jemand war da, deshalb konnte sie seine einsame Gestalt auf dem Weg durch die Passage gut verfolgen, unter den Schildern der Metzger hindurch, vorbei an aufgehängten Rinderhälften. Sie spürte das eisenharte Pochen ihres Herzens. Zugleich merkte sie, dass sie keinerlei Angst empfand. Sie hatte das Gefühl, sie könnte ihm bis nach Hause folgen, und selbst wenn er sich umdrehte und sie entdeckte, würde ihr das nichts ausmachen. Doch als sie einen Blick auf die Uhr über dem Eingang zur Markthalle warf, sah sie, dass es Zeit war, wieder zur Arbeit zu gehen. Sie wartete, bis er das Ende der Passage erreicht hatte und in die Helligkeit des Torbogens gesogen wurde. Sie dachte sich, dass man das wohl eine Holzfällerjacke nannte, was er da trug, und dass er leichte O-Beine hatte.
An diesem Abend ging sie in ihrer Pause in den Hof hinaus.
Sie setzte sich auf einen Bierkasten und trank ihren Becher Tee. Die Geräusche aus dem Boxklub drangen über die hohe graue Mauer, das Ächzen der Männer und der dumpfe Aufprall der Fäuste, es war wie der Klang der verstreichenden Zeit. Sie fragte sich, ob er auch dadrin war, ob seine Fäuste zu diesem Klang beitrugen, was für Kleider er wohl trug und wie sein Gesichtsausdruck gerade war und ob sein Haar schweißnass war. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie seine rot-schwarze Jacke an einem Haken an der Wand hängen sehen.
Mit so einem Mann an seiner Seite wäre man sicher, dachte sie, so ein Mann würde einen beschützen.
Ein paar Tage vor Weihnachten sagte Trish, sie müsse etwas mit ihr besprechen. Ihr war fast schlecht vor Sorge, als sie Trish aus der Bar durch den Korridor zum Büro folgte. Auf dem Kleiderständer hinter Mrs Oaks Schreibtisch hing ein Pelzmantel, schwarz und üppig, und auf den starrte sie nun, während sie in der Tür stand, die Arme über dem Unterleib verschränkt, und darauf wartete, dass Trish begann.
Trish zündete sich eine Zigarette an und nahm ein paar Züge. »Ich wollte dich etwas fragen«, sagte sie dann, »also, nur so eine Überlegung. Ich dachte – hast du irgendwelche Pläne für Weihnachten? Ich meine, fährst du nach Hause oder so?«
»Nach Hause?«
»Ja, nach Irland, hast du vor, nach Hause zu fahren?«
»Oh. Nein. Nein, das habe ich nicht vor.«
»Ah. Weil, also – ich habe da so einen Freund, der mir vorgeschlagen hat, ein paar Tage mit ihm zusammen wegzufahren, und ich – ich wollte dich fragen, ob du hier vielleicht solange ein Auge auf das Haus haben könntest?«
»Allein?«
»Oh, du müsstest nicht arbeiten oder so. Wir schließen Heiligabend am Nachmittag und machen erst am Dreißigsten abends wieder auf. Ich helfe dir vorher noch, ein bisschen sauber zu machen und alles abzusperren, und du würdest dann in den paar Tagen einfach die Seitentür nehmen und schauen, dass alles seine Ordnung hat. Es ist nämlich … na ja. Hör zu, ich würde da wirklich gern hinfahren, es ist ein reizendes kleines Hotel – also, jedenfalls dem Prospekt zufolge, sicher weiß man das natürlich erst, wenn man dort ist. Manchmal sind solche Hotels ja auch einfach nur sehr fotogen. Und dieser Freund von mir … na ja, es wäre sehr schön für mich, mehr will ich nicht sagen. Du kriegst das hin, Schätzchen – ich würde dich nicht darum bitten, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass du das kannst. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, wendest du dich an Vera Greene. Wo bist du denn am Ersten Weihnachtsfeiertag, hast du Verwandte in London?«
»Verwandte? Oh – ja, ja, habe ich.«
»Wen denn?«
»Na ja, meine Tante. Und, und meinen Onkel. Die wohnen in – oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es ist auf der anderen Seite von London. Mein Onkel holt mich ab.«
»Meinst du, du wirst bei ihnen übernachten? Denn ich würde das Haus ungern –«
»Oh, nein! Die hätten gar keinen Platz für mich, ich bleibe da sicher nicht lange.«
Trish drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, ein kleines Lächeln auf den Lippen. »Gut, dann wäre das ja geklärt. Prima. Ich bin dir was schuldig. Und bei Mrs Oak lege ich sowieso ein gutes Wort für dich ein. Ich bin mir sicher, dass sie dich behalten wird. Wenn ich ihr erzähle, wie du meinen Bacon gerettet hast und wie gut du dich überhaupt schlägst. Eine Bitte habe ich allerdings noch – also, wenn es dir nichts ausmacht. Könnte das unter uns bleiben? Mrs Oak – also, es geht sie ja eigentlich nichts an, aber sie hält nicht viel von meinem Freund. Sie findet, dass er … Na, ist ja egal, was sie findet, oder? Mir wäre es jedenfalls lieber, wenn sie nichts davon erfährt. Ist das in Ordnung, bleibt das unter uns? Danke, Mill, vielen Dank.«
An Heiligabend schickte Trish sie über Mittag in die Lounge, damit sie Brenda aushalf. Mr Hart hatte Geld für die Mädchen aus der Textilfabrik an der Bar hinterlegt, und die hatten schon jetzt alle ordentlich einen sitzen, obwohl es erst kurz nach halb zwei war. Der Raum bebte vor Lärm. Geplapper, Geschrei, Gelächter. Sie konnte kaum die Bestellungen verstehen, die ihr zugebrüllt wurden.
Aus der Jukebox erklang nun »Brown Girl in the Ring«, und die Frauen hakten sich unter, schunkelten zur Musik und sangen mit, tralalalala. Gerade hatte sie noch gedacht, dass das ein seltsames Lied für diese Jahreszeit war, es passte nicht zu dem Deko-Schnee in den Ecken der Fensterscheiben und zu den Weihnachtsmützen, die jetzt jeder Depp auf dem Kopf trug. Doch mit einem Mal war sie so froh, dass sie sich bremsen musste, um nicht mitzusingen. Es war ein kleiner Schock, diese Freude, denn sie konnte sich nicht erinnern, sich je zuvor so gefühlt zu haben. Freudig, genau, das war wohl die richtige Bezeichnung dafür. Voller Freude. Es musste an der Musik liegen, an den fröhlichen Gesichtern, an der Tatsache, dass sie sich, zum ersten Mal, seit sie hierhergekommen war, nicht unpässlich fühlte: kein Kopfweh, keine Übelkeit – nichts. Und dann durchfuhr sie ein anderes Gefühl. Es kam tief aus dem Bauch, schoss in ihre Brust. Drang in ihre Arme, pulsierte an ihrem Hals. Sie musste sich kurz am Tresen festhalten. Eine Welle der Angst.
Sie empfand Freude und Angst zugleich.
Zum ersten Mal formten sich die Worte in ihrem Kopf. Und schienen sie im nächsten Moment anzuschreien.
Du hast ein Kind in dir. Ein Kind. Ein echtes Kind.
Oh Gott. Oh Gott, was mache ich bloß?
Sie trug Trishs Tasche zum Taxi. Trish stieg ein, dann senkte sich die Fensterscheibe, sodass die obere Hälfte ihres Gesichts erschien und ein sanfter Geruch nach Gin und Parfüm herauswehte.
»Es ist jede Menge zu essen da«, sagte Trish. »Schinken und saure Gurken, alles, was dazugehört. Ein Brot liegt auf dem Tisch, und im Tiefkühlschrank ist noch mehr, Pommes sind auch da. Du weißt ja, wie die Fritteuse funktioniert? Natürlich weißt du das. Und es reicht, wenn du am zweiten Weihnachtsfeiertag alles wieder sauber machst – bloß Essensreste solltest du nicht herumstehen lassen, diese vierbeinigen Besucher mit den langen Schwänzen können wir hier nicht gebrauchen. Ich habe dir ein bisschen was zum Naschen auf den Tisch gestellt, außerdem eine von diesen neuen Baileys-Geschenkboxen, die kannst du morgen deiner Tante mitbringen. Mrs Gupti ist am Mittwochmorgen wieder da. Ich am Freitag. Hab einen schönen Tag morgen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt: Vera ist immer erreichbar. Und denk dran: Falls Mrs Oak anruft, sagst du ihr, ich wäre gerade unterwegs, und du wüsstest nicht, wo. Ich werde morgen auf jeden Fall mal bei ihr anklingeln und ihr schöne Weihnachten wünschen, wahrscheinlich rührt sie sich dann auch nicht mehr. Und noch mal vielen Dank, Mill, ich weiß das echt zu schätzen, wirklich. Also, dann zisch ich mal ab. Schöne Weihnachten!«
Die Fensterscheibe schob sich wieder nach oben, das Taxi fuhr los, wendete und kam noch einmal an ihr vorbei. Sie winkte kurz, aber Trish schaute geradeaus und schien es nicht zu bemerken.
Sie ging durch die Seitentür ins Haus, schloss die Bar wieder auf und stöpselte die elektrischen Christbaumkerzen ein. Eine Weile stand sie da und betrachtete den Baum, dann trat sie hinter den Tresen, nahm sich zwei Tüten Salzchips und zwei Flaschen Orangenlimonade und packte alles in eine Lunchtüte. Sie löschte die Lichter wieder und vergewisserte sich, dass alles korrekt abgeschlossen war. Als sie am Büro vorbeikam, fiel ihr Mrs Oaks Pelzmantel ins Auge, sie nahm ihn vom Ständer und legte ihn sich behutsam über den Arm.
Oben in der Küche begann sie mit ihren Weihnachtsvorbereitungen. Sie machte sich drei Schinken-Käse-Sandwiches, schlug sie einzeln in Folie ein und legte sie in Mrs Oaks Einkaufskorb, zusammen mit der Schachtel Mr Kipling Cakes und der Baileys-Geschenkbox, die Trish ihr für ihre unsichtbare Tante dagelassen hatte. Als Nächstes wanderten eine Packung Milch, ein paar Teebeutel, eine Tasse, ein Teller und ein Messer in den Korb. Sie füllte den Wasserkocher, zog den Stecker des Radios heraus. Aufgeregt und atemlos rannte sie zweimal die Treppe hoch und runter, dann sah sie sich noch einmal in der Küche um. Drei Weihnachtskarten lagen auf dem Tisch. Sie nahm die Karten, eine Schachtel Streichhölzer und eine dicke rote Kerze, die sie in einer der Küchenschubladen entdeckt hatte. Jetzt war sie so weit und schaltete das Licht aus, überlegte es sich dann aber doch noch mal anders und schaltete es wieder ein.
Auf dem Weg zu ihrem Zimmer hinauf blieb sie kurz an Mrs Guptis Schrank stehen und nahm einen Eimer und eine Rolle Klopapier heraus.
Sie schloss ihre Zimmertür hinter sich ab und wartete ab, bis ihr Herzschlag sich beruhigt hatte. Dann richtete sie sich neben dem Schrank mit Eimer und Klopapier ihre eigene kleine Toilette ein. Der Frisiertisch wurde zu ihrer kleinen Küche. Sie stellte die Weihnachtskarten am einen Ende des Kaminsimses auf, zündete die Kerze an und stellte sie ans andere Ende. Schließlich stöpselte sie das Radio ein. Eine Stimme sprach zu ihr:
»Es ist Heiligabend und acht Uhr vorbei. Ahhhh – sind denn all die kleinen Jungs und Mädchen schon im Bett?«
Die beiden Heizstäbe leuchteten grell. Aber es war kalt im Zimmer, also nahm sie Mrs Oaks Pelzmantel vom Bett. Der Mantel schien sich über sie zu ergießen wie kühles Wasser, und sie fröstelte, aber das ging schnell vorbei, und bald fühlte sie sich warm von ihm umfangen. Sie öffnete die Baileys-Geschenkbox, nahm eines der kleinen Gläser und die Flasche heraus. Sie schraubte den Deckel ab, schnupperte und schenkte sich ein bisschen was in das kleine runde Glas ein.
Am Fenster sitzend aß sie Sandwich und Chips, nippte an ihrem Drink, überließ sich ganz ihren Empfindungen: die salzige Masse in ihrem Mund, die warme milchige Flüssigkeit, die über ihre Zunge glitt, in ihre Kehle rann, in ihrer Brust sich auszubreiten schien.
Nach einer Weile stand sie auf und schaute auf die Straße hinunter. Sie versuchte, sich vorzustellen, was Passanten wohl sehen würden: eine Frau im Pelzmantel, die an einem Fenster stand. Gerry, der Barmann, würde das vielleicht denken, wenn er hochsähe – nicht ein Mädchen im Pelzmantel, sondern eine Frau. Und der Boxer? Den würde sie an eine Frau aus einem der Bücher erinnern, die er immer in der Tasche seiner Holzfällerjacke mit sich herumtrug. Sie drehte den Kopf und schaute zu dem stillen U-Bahnhof hinunter. Jenseits des Bahnhofs, jenseits der Dächer lag die Innenstadt von London. Parks und Plätze, Läden und Theater, Brücken und ein Fluss. Ein echter Palast. Orte, an denen sie noch nicht gewesen war, die sie aber aus dem Fernsehen kannte und von den Postkarten im Drehständer vor dem Zeitungsladen. Und rings um London lag ein ganzes Land.
Bald würde das Jahr 1980 beginnen. Mrs Oak würde wieder da sein, würde sie mit ihren allsehenden Augen betrachten und wissen, was es über sie und das Kind zu wissen gab. Gut möglich, dass sie sie vor die Tür setzen würde. Aber vorerst war dies ihr Zuhause. Alles, was sie nur irgend brauchen könnte, war in diesem Zimmer. Die kommenden paar Tage konnte sie alles andere wegschieben.
Sie hörte ein Auto die Turnmill Street entlangfahren, dann leisen Glockenklang von einer fernen Kirche. Aus dem Radio ertönten weiterhin Stimmen, ab und zu ein Weihnachtslied, und manchmal sang sie mit.
Pip
2017
März
Als er auf die Straße tritt, stellt er fest, dass der Frühling da ist.
Er hat es schon gesehen in den letzten paar Tagen, durch die verschiedenen Fenster. Auch über die Mauer des langen Gartens ist es in ihn eingedrungen: Knospen, längere Tage und natürlich das Konzert in der Morgendämmerung, das dem ohnehin zu langen Tag eine weitere Stunde hinzufügt.
Heute Morgen, als die Krankenschwester ihm sagte, dass in zwei Tagen der April anfängt, hat er geantwortet: »Ja, das ist wohl so.« Trotzdem ist er nicht darauf gefasst: die warme Luft, das Licht, dieses Gefühl von Erneuerung.
Er erinnert sich noch daran, wie er auf den Schnee gewartet hat. In den Nachrichten hatten sie davor gewarnt, und im Garten herrschte diese eigenartige Stille. Er hatte sich darauf gefreut, den Schnee zu betrachten, aus der Wärme, aus sicherer Entfernung. Ein gelegentlicher Blick von seinem Ringplatz hinaus in den Garten. In das fedrige Durcheinander. Und dann zurück zu seinem Buch, und mit warmen, beweglichen Händen die Seite umgeblättert. Schönheit ohne Schmerz. Das muss im Januar gewesen sein. Letztlich hielt sich der Schnee kaum länger als die eine Nacht, und seither hat er vom Wetter wenig oder nichts mitbekommen, nur ein vager Eindruck von Grau und Regen, gelegentlich durchbrochen von ein paar milchigen Sonnenstrahlen.
»Eine gute Zeit, um nach Hause zu gehen«, hatte die Krankenschwester gesagt. Ein breites Lächeln und kleine, fröhliche Augen. Aus den Philippinen vielleicht, hatte er gedacht. Die anderen aus der Belegschaft nannten sie Tracey, aber er bezweifelte, dass das ihr echter Name war.
»Und wo sind Sie zu Hause?«, hatte er sie gefragt, um ein bisschen Small Talk zu machen, bis Dom kam.
»Oh, weit weg, viele, viele Kilometer.«
»Wie viele?«
»Tausende. Zehntausend.«
»Haben Sie oft Gelegenheit, heimzufahren?«
Darauf antwortete sie nicht, zuckte nur kurz die Achseln. Ihre Hand strich besänftigend über die Decke am Fußende seines Betts. Nach ein paar Sekunden gab sie die Frage zurück: »Und Sie? Wo ist Ihr Zuhause?«
Er hätte ihr gern gesagt, dass er kein Zuhause hatte, keines mehr gehabt hatte – jedenfalls kein richtiges –, seit er zehn gewesen war.
Aber gegenüber einer Frau, die wahrscheinlich alles zurückgelassen hatte – Mann, Kinder, selbst ihren Namen –, um die Familie über Wasser zu halten, wäre das wenig feinfühlig gewesen.
»Mein Zuhause«, sagte er, »ist jetzt erst mal bei meinem Bruder.«
»Ah, schön, und wo?«
»Notting Hill.«
»Oh, also sehr schön!«
»Das Haus ist wirklich schön«, sagte er, »soweit ich mich erinnere.«
Wenig später war die Frau vom Empfang gekommen und hatte Schwester Tracey herausgewinkt. Leise Stimmen im Gang, dann kam die Schwester wieder herein und gab nervös die Nachricht weiter. »Ihr Bruder kann nicht. Tut ihm sehr leid, sagt er.«
»Sagt er oder seine Sekretärin?«
»Oh, das weiß ich nicht«, sagte sie und reichte ihm die Notiz der Empfangsdame.
Noch in der Probe, lieber zu Hause treffen, geht schneller. Um fünf daheim.
»Ihr Bruder ist ein berühmter Trompeter?«, fragte sie. »Schwester Margo hat es mir erzählt.«
»Ich glaube schon.«
»Wollen Sie jetzt ein Taxi?«
Er stand auf, nahm seine Tasche vom Bett und sagte: »Lassen Sie mal, ich komme da schon alleine hin.«
Dann wandte er das Gesicht ab, damit sie nicht sah, wie sich Erleichterung darauf breitmachte.
Drei Krankenschwestern verabschieden ihn. Er steht auf der Straße, schaut zurück und sieht, wie sie ihm vom Foyer aus nachwinken. Ein weißes Lohen vor dunklem Hintergrund. Ein braunes Gesicht, ein schwarzes, ein irisch blasses. Schon spürt er es wieder: wie Fragmente der Zeit wegfallen. Das Leben hier drinnen, das andere Leben, das draußen wartet. Der Einwegspiegel, der sie voneinander trennt. Vor wenigen Augenblicken hat er noch im Foyer gestanden und ist von ihnen betüddelt worden wie ein kleiner Junge, der gleich zur Schule geht. Jetzt steht er hier in diesem gleißenden Licht, fragt sich, wie ein Märztag so warm sein kann, und versucht zu entscheiden, in welche Richtung er gehen soll.
Die irische Krankenschwester hat ihn zur Tür gebracht. Dann ist sie ein paar Minuten auf der Stufe stehen geblieben und hat ihm mit ihrem kernigen ländlichen Akzent Anweisungen erteilt. »Also. Ihr Bruder hat gesagt, er ist bald daheim. Ein paar Häuser weiter in seiner Straße gibt es ein Café, hat er gesagt – da können Sie warten, wenn Sie nicht auf der Straße herumstehen wollen. Essen Sie was, Sie haben Ihr Mittagessen nicht angerührt. Denken Sie dran, Sie sollten es vermeiden, hungrig zu werden. Oder durstig. Ich habe Ihnen eine Flasche Wasser eingepackt.«
»Oder mich zu ärgern«, sagte er, »das haben Sie vergessen.«
»Bitte?«
»Ich soll es vermeiden, mich zu ärgern. Es ist einer meiner Trigger. Hunger, Durst, Ärger.«
»Muss man Sie denn jetzt schon daran erinnern, dass Sie sich nicht ärgern sollen? Nein? Gut. Also, Ihre Tabletten und Rezepte sind hier drin. Sie haben genug für drei Tage – achten Sie darauf, dass Ihnen die Tabletten nicht ausgehen. Und Ihre Entlassungsunterlagen – bitte auf keinen Fall verlieren, da sind all Ihre Telefonnummern drin. Speichern Sie sie gleich ein, wenn Sie ein neues Handy haben – und denken Sie daran, Sie können Ihren AA-Sponsor jederzeit anrufen, Tag und Nacht, zu jeder Uhrzeit. Sollen wir Ihnen jetzt ein Taxi rufen?«
»Nein, ich möchte wirklich gern zu Fuß gehen. Dann kann ich mir auch unterwegs gleich ein Handy kaufen.«
»Na gut, aber nehmen Sie sich ein Taxi, wenn Sie müde werden. Auf die nächsten paar Wochen kommt es an. Gehen Sie einen Tag nach dem anderen an, und Sie werden sehen, dann ist der April im Nu vorbei.«
»Der grausamste Monat.«
»Warum sagen Sie das? Es ist doch ein schöner Monat. Freuen Sie sich daran. Seien Sie einfach vorsichtig. Haben Sie eine Sonnenbrille? Nein? Dann machen Sie das als Allererstes, kaufen Sie sich eine Sonnenbrille.«