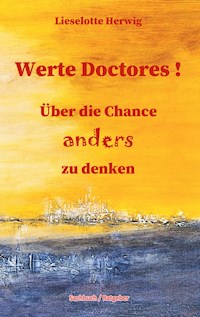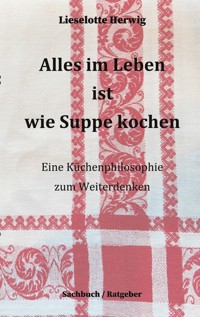
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Alles im Leben ist wie Suppe kochen - ein banaler Satz, der aufhorchen lässt, wenn er zum Zentrum philosophischer Gedanken wird. Auf der Sinnsuche unseres Lebens begegnen wir vielen Ungereimtheiten und müssen uns entscheiden zu unserem eigenen Weg. Doch welcher ist der richtige? Die Suche in der Küche zu beheimaten, hat bislang in philosophischen Diskursen keinen Platz gefunden, und doch wirft dieser Ort mit seinem Geschehen grundsätzliche Fragen auf. Und er gibt Antworten, die jeder in seinem Leben nachvollziehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Küchenphilosophie
2. Alles im Leben
3. Ein sinnvolles Handeln
4. Wer weist uns den Weg?
5. Auf der Suche
6. Religion
7. Philosophie
8. Was will ich denn?
9. Auf der Suche nach dem rechten Weg
10. Ist Suppe kochen alles?
11. Angekommen
12. Rückschau
13. Epilog
1. Küchenphilosophie
Plötzlich war er da, der Vergleich, hatte in unserer Familie Platz gefunden, Sicher, um den Kindern bei einer schwierigen Aufgabe den Mut zuzuflüstern: Es ist alles ganz einfach. Wenn du eine Suppe kochen kannst, dann schaffst du das auch, denn „Alles im Leben ist wie Suppe kochen".
Als die Kinder ihren Weg gefunden hatten, geriet er in Vergessenheit und hatte sich auch in meinem Hinterstübchen verborgen. Aber wie es so ist: Irgendwann lugte er hervor, nahm Raum ein in meinen Gedanken und wollte bedacht werden. Und er schien in meine philosophischen Vorstellungen hineinzupassen. Erst nur als Floskel, die aufhorchen ließ, dann, beim genaueren Durchdenken, als Sinnbild für einen durchaus einleuchtenden Vergleich, und schließlich entdeckte ich Grundlegendes in ihm.
Aber da war noch die Frage: Kann/Darf ich als schlichte Hausfrau solche banalen Vergleiche in den Rang von philosophischen Grundsatzfragen erheben? In der Suppe eine tiefere Bedeutung erkennen wollen, sie nicht nur als schlichten Magenwärmer und Mahlzeitenfüller sehen? Was sollte an einer Suppe und ihrer Herstellung sobedeutend sein, dass es sich lohnt, mehr als dieses in ihr zu erkennen.
Eines scheint dem entgegenzustehen: die Philosophie. Allein der Begriff lässt uns ehrfürchtig erstarren: „Liebe zur Weisheit" ‒ wie umfassend und tiefgründig muss man seine Gedanken ausrichten, um sie in einer philosophischen Debatte einbringen zu dürfen? Und waren es nicht große Denker, fast ausnahmslos Männer, die uns aus unserer Geschichte von der Antike an und in allen Kulturen als Philosophen bekannt geworden sind. Das christliche Abendland pflegte die Annahme, dass dem Manne der Geist, der Frau die Sinnlichkeit zustehe, der Mann musste im Leben bestehen, die Frau ihm den Rücken freihalten durch eine gepflegte Häuslichkeit. Der Frau wurde Bildung untersagt, der Mann dagegen prägte seiner Bildungsgrundlage männliche Prinzipien auf. Und so ist auch die Philosophie zu dem geworden, was wir mit ihr verbinden: ein „phallozentrisch" geprägtes Gedankenkonstrukt, in dem weibliche Sicht-weisen wenig zum Tragen kommen. Ein „Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt" - was sollten Frauen auch dazu sagen, wenn ihr Platz in der Küche sich um das körperliche Sattmachen all derer zu drehen hatte, deren geistige Potenz genährt werden musste. „Lehre und Wissenschaft" von der Erkenntnis des Sinns des Lebens, das hat man Frauen schon gar nicht zugetraut.
Dass sich Frauen heute in der Philosophie etablieren und weibliche Sichtweisen einbringen, ist richtig und wichtig, aber den ehrerbietenden Rang eines „Philosophen alter Schule" können sie in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit kaum erringen. Doch ist nicht die Philosphie weiblichen Geschlechts, die Liebe, wozu auch immer, ebenso weiblich, und „Sophie" ein Frauenname, der der Weisheit der Frau Gestalt gibt.
Eine weitere Definition ist „die persönliche Art und Weise, das Leben und die Dinge zu betrachten, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu denken und zu verstehen". Und genau das möchte ich: von meiner Küche aus meine persönlichen Gedanken richten hinaus in die Welt, hinein in die objektive Wissenschaft, vor allem die neueren Datums, und beides verbinden mit der Praxis, die allen Frauen seit Angedenken oblag, für Leben und Lebenserhalt zu sorgen und damit unser aller Existenz zu begründen.
Das sei mir gestattet.
2. Alles im Leben...
Darf ich einen Satz so apodiktisch, so unumstößlich und verallgemeinernd, formulieren, ohne belegen zu können, dass er wirklich auf alles anwendbar ist? Sicher wird man ihn widerlegen und mich darauf hinweisen können, dass er so nicht ausgesagt werden darf. Aber das würde diesem Satz die „Hallo-Funktion" nehmen, die gerade im Widerspruch zwischen der Zusammensetzung aus banalem Handeln und philosophischem Urteilen sich erklärt. „Alles im Leben ist wie Suppe kochen". Das passt nicht zusammen. Das eine gehört mit den Händen praktizierend in die Küche, das andere denkend in einen Diskurs über den Sinn des Lebens. Doch gerade deshalb ist er für mich aussagekräftig.
Ich will diesem Satz auf den Grund gehen und fange an, ihn zu analysieren. Das „Wie" macht ihn zu einem Vergleich, das „Kochen" bezieht sich auf ein Handeln. Also versuche ich das „Alles" dadurch zu begründen, indem ich mir verschiedene Handlungsabfolgen vorstelle und miteinander vergleiche. Und beginnen muss ich natürlich mit der Suppe.
1. Ich nehme mir vor eine Suppe zu kochen:
Aus welchem Grund?
Für wen?
Kann ich das leisten?
Habe ich dazu die nötige Ausrüstung?
Will ich das überhaupt oder wird es von mir verlangt?
Für welche Art Suppe entscheide ich
mich?
Meine Antworten darauf könnte ich mit einem Idealfall beschreiben:
Ich habe Appetit auf eine Suppe, aber der Topf ist groß und fasst eine Menge an Inhalt. Viele könnten davon satt werden, und so möchte ich zum Suppenessen einladen. Ich kann das leisten mit meiner Erfahrung und der Zeit, die ich dafür bereitstellen kann. Die nötige Ausrüstung bietet mir meine Küche. Ich stelle es mir vergnüglich vor, viele an meinem Tisch sitzen zu haben, die diese Suppe behaglich genießen. Wenn ich weiß, wen ich einlade, entscheide ich mich für eine Suppe, die allen möglichst schmecken könnte und deren Zutaten zu erhalten sind.
2. Ich führe den Vorgang aus:
Welches Rezept soll es sein?
Welche Zutaten benötige ich?
Wo bekomme ich sie her?
Wie muss ich sie verarbeiten?
Welche Reihenfolge verlangt der Zubereitungsvorgang?
Wie muss ich sie würzen und abschmecken?
Habe ich dabei die Gäste mit ihren Geschmackswünschen im Sinn?
Im Idealfall erhalte ich alle Zutaten, gehe nach dem vorgegebenen Rezept vor, schmecke die Suppe ab und bin überzeugt davon, dass sie auch den anderen schmecken könnte.
3. Ergebnis:
Ich lade viele zum gemeinsamen Suppenessen ein.
Meine Gäste essen die Suppe.
Im Idealfall löffeln sie die Suppe mit Behagen. Sie loben den Geschmack, aber auch die Möglichkeit, mit anderen dieses gemeinsame Essen teilen zu können. Sie unterhalten sich lebhaft, hören zu und kommen sich in den Gesprächen näher.
Und ich?
Mir gefällt es, für eine solche Stunde habe sorgen zu können. Mich macht das zufrieden, vielleicht sogar glücklich.
Das war die Suppe und jedem wird dieser Vorgang bekannt sein. Womit aber sollen wir ihn vergleichen können? Es könnte ein Schrank sein.
1. Ich nehme mir vor, einen Schrank zu bauen.
Aus welchem Grund?
Für wen?
Kann ich das leisten?
Habe ich dazu die nötige Ausrüstung?
Will ich das überhaupt oder wird es von mir verlangt?
Für welche Art Schrank entscheide ich mich?
Meine Wäsche/Bücher/Unterlagen versinken in einem Chaos. Den will ich beseitigen mit Hilfe eines Schrankes.
Ich habe einige Kenntnisse in der Holzverarbeitung und würde mir das zutrauen.
Meine Ausrüstung dazu finde ich in meinem Werkraum im Haus und für Dinge, die meine Kapazität überschreiten, nehme ich Hilfe in Anspruch.
Ich will diesen Schrank selber bauen, weil er eine spezielle Größe und Ausstattung haben und von mir besonders gestaltet werden soll.
2. Ich führe den Vorgang aus:
Welcher Schrank soll es sein?
Welche Materialien benötige ich?
Wo bekomme ich sie her?
Wie verarbeite ich sie?
Welche Reihenfolge verlangen die Arbeitsvorgänge?
Funktioniert die Ausführung oder muss ich sie abändern?
Trifft die Ausführung meinen Geschmack oder will ich den Schrank noch verschönern?
Im Idealfall habe ich einen Schrank im Sinn, für den ich das nötige Material bekommen kann. Ich verarbeite es nach Anleitung und Erfahrung in der gebotenen Reihenfolge.
Die Ausführung gefällt mir, aber ich muss noch einiges justieren und abschleifen, damit die Funktion reibungslos erfolgen kann.
3. Ergebnis:
Im Idealfall ist der Schrank so geworden, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich bin stolz und führe ihn anderen vor. Sie loben mich und ich bin froh, nicht mehr im Chaos der Unordnung zu versinken.
Ich möchte ein weiteres Beispiel anführen: eine Doktorarbeit.
1. Ich nehme mir vor, eine Doktorarbeit zu schreiben.
Aus welchem Grund?
Für wen?
Kann ich das leisten?
Habe ich dazu die nötige Ausrüstung?
Will ich das überhaupt oder wird es von mir verlangt?
Für welches Thema entscheide ich mich?
Ich stelle mir den Idealfall vor, diese Doktorarbeit anfertigen zu können. Sie würde mir einen besseren Start ins Berufsleben ermöglichen. Meine Person würde durch diesen Titel aufgewertet werden.
Ich könnte das leisten, da ich in meinen Prüfungen stets Bestnoten erhalten und mein Studium abgeschlossen habe.
Ich habe einen Doktorvater, eine Doktormutter gefunden, die mich in diesem Vorhaben begleiten. Das alles gibt mir Sicherheit, dieses Unterfangen auch wirklich durchführen zu wollen.
Ich möchte sie in einem Fachgebiet meiner Wünsche ansiedeln.
2. Ich führe sie aus:
Welches Thema soll es sein?
Welche Forschungsaufgaben stellen sich mir darin?
Wo kann ich die Forschung ausführen?
Wie gehe ich planvoll das Schreiben an?