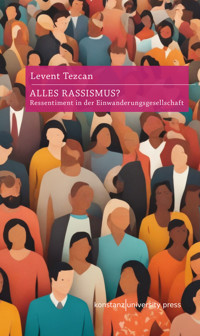
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konstanz University Press
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rassismuskritik ist allgegenwärtig. Aber was geschieht, wenn Vorwürfe systematisch überzogen und alltägliche Banalitäten mit der gleichen Verve beanstandet werden wie rassistisch motivierte Straftaten? Verliert dann nicht die Kritik ihre Wirkung und das Phänomen seine Konturen? Levent Tezcan legt eine pointierte Polemik gegen eine aufgeregte Debatte vor, die die Gemüter in Dauerschleife erhitzt. Alles Rassismus geht der Frage nach, warum rassische Unterscheidungen auch jenseits von fremdenfeindlichen Diskursen Konjunktur haben. Die medialisierte Rassismuskritik bietet sich derzeit als neue Großerzählung an, in der sich Subjekte als Marginalisierte gegenüber den Privilegierten in Stellung bringen und die Hautfarbe zum neuen Referenzpunkt wird. Tezcan stellt den zunehmenden Gebrauch von rassischen Unterscheidungen in den Zusammenhang der Affektökonomie westlicher Gesellschaften, in der eine Verschiebung von Stärke und Schwäche stattfindet. Gerecht sind nun die Vulnerablen, denen zur Sichtbarkeit verholfen werden soll, nicht zuletzt durch die Forderung nach Migrantenquoten. Gefördert wird aber tatsächlich, so die provokante These des Buches, vor allem das Ressentiment – und zwar bei den Minderheiten wie bei der Mehrheit. Die eigentliche Gefahr für die demokratisch verfassten Gesellschaften geht aber nicht vom »alltäglichen Rassismus« und seinen Mikroaggressionen aus, sondern von einer rassistischen Politik, die in Europa wieder auf dem Vormarsch ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Levent Tezcan
ALLES RASSISMUS?
Ressentiment in der Einwanderungsgesellschaft
Konstanz University Press
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Konstanz University Press 2024
www.k-up.de | www.wallstein-verlag.de
Konstanz University Press ist ein Imprint der
Wallstein Verlag GmbH
Umschlaggestaltung: Eddy Decembrino
ISBN (Print) 978-3-8353-9175-8
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-9768-2
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-9769-9
Inhalt
Einleitung
I. Zugehörigkeiten in der Einwanderungsgesellschaft
Reden über Rasse
Rasse oder race, »Weiße« und »Nichtweiße« – begriffstaktische Entscheidungen
Wer hat eine Hautfarbe? Türken jedenfalls nicht!
Unruhige Zugehörigkeiten: Migrant / Postmigrant /Einheimische u. a.
Warum nicht bedingungslos, warum irgendwie?
Wen gibt es noch alles in der »Völkerschau«?
Von der verkannten Kraft des Bindestrichs
Herkunft, Zugehörigkeit und das mobile Territorium
Der »globale Süden«
II. Tafelrunde der Einwanderungsgesellschaft
Affekte bei Tisch
Integration durch Konflikte
Geschichte und Gemeinwesen
Gemeinschaftsglaube
Ethnos und Demos
Exkurs: Kulinarische Zugehörigkeiten aus dem Alltag der Einwanderungsgesellschaft
III. Vulnerabilität
Genealogien der Verwundbarkeit
Schwäche als Tugend: »Kulturelle Aneignung«
Subtile Formen des Willens zur Macht
»Weiße Privilegien« und Ressentiment
IV. Sichtbarkeit und Repräsentation
Sichtbarkeit, Sensationslogik, Skandalisierungen
Gesicht und Stimme
Quoten
V. Und der Rassismus?
Exkurs: Ein Türke auf Wohnungssuche – hüben wie drüben
Diskriminierung
Statt eines Fazits: Migrationsgesellschaft bejahen
Dank
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Einleitung
Es ist eine fröhliche Runde, die in der WDR-Sendung Wie redest du?! versammelt ist. Seit 2021 wird sie vom Stand-up Comedian Khalid Bououar moderiert und es ist vor allem ein Thema, das die Sendung umtreibt: wie »Sprache und das Vokabular dazu beitragen, dass Rassismus in der Gesellschaft verwurzelt ist«.[1] Die Auswahl der Teilnehmer ist keineswegs zufällig. Sie verkörpert und verwirklicht schon rein äußerlich das Programm: eine schwarze Frau, deren Vater aus Ghana eingewandert ist, kommt aus Bonn, eine andere aus Ägypten oder aus Berlin – je nachdem wer fragt. Sie sticht mit ihrem Kopftuch hervor. Bereits diese Aussage läuft Gefahr, sie als die »andere« zu markieren, als Muslima, oder sie allein auf ihr Kopftuch zu reduzieren. Der Hinweis lässt sich aber nicht vermeiden, denn im Paradigma der Diversität geht es ja gerade darum, den bislang Unsichtbaren der Gesellschaft zur Sichtbarkeit zu verhelfen. Sie verkörpert also die »Muslima mit Kopftuch«. Der Mann, der zur Volksgruppe der Roma gehört, und schließlich der Moderator, dessen Eltern aus Marokko und Algerien kommen, vervollständigen das Bild. Die Zusammensetzung der Runde ist bereits das Ergebnis einer Wandlung an Sichtbarkeiten und Sensibilitäten, die sich inzwischen auch in den öffentlichen Einrichtungen beobachten lässt.
Abgesehen von der Tatsache, dass alle Beteiligten der WDR-Sendung im Kulturbetrieb unterwegs sind, verbindet sie noch etwas anderes. Sie sind nicht »weiß«. »Nichtweiße«, ob direkt schwarz oder POC, definiert eine gemeinsame Erfahrungsgrundlage: »rassistische Diskriminierung«. »Nichtweiß« verweist auf Vulnerabilität. Die auf Hautfarbe referierende »Weiße / Nichtweiße«-Unterscheidung soll daher nicht bloß eine phänotypische Differenz markieren, sondern zugleich die Matrix für eine »strukturell angelegte, rassistische Diskriminierung« abgeben. Die soziale Existenz der »Nichtweißen« wird von ihrer Vulnerabilität her expliziert, im Zirkelschluss wird diese dann damit begründet, dass wir in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft leben.
Wie redest du?! führt auf exemplarische Weise vor Augen, wie in westlichen Demokratien etablierte Repräsentationsmodelle, Ordnungskonzepte und Subjektivitäten durch Diversitätsansätze radikalisiert und in Frage gestellt werden. Was zuvor als universalistisch vorgestellt war, wird nun als Partikularismus überführt; die bisher normgebende, jedoch unmarkierte Seite wird ans Licht gebracht, die hegemoniale Machtordnung problematisiert. Im Gegenzug melden sich Lebensformen und Identitäten als »anders« markiert mit ihren bisher nicht erzählten Geschichten zu Wort und fordern ihren Platz in den Repräsentationsordnungen ein. So jedenfalls lautet das neue Narrativ. Aus der unaufhörlichen Dynamik der Dekonstruktion hervorgegangen, gibt es paradoxerweise den Rahmen für neuere Identitätsbehauptungen mit Repräsentationsansprüchen vor.
War früher die Stimme für die Repräsentation entscheidend, kommt es jetzt auf das Gesicht an. Es reicht nicht mehr für eine gerechte Repräsentation, dass ich meine Stimme einem Vertreter gebe oder im Namen anderer spreche, deren Stimme zu sein ich verspreche – wie es noch für die bürgerliche Demokratie, aber auch für die Klassenkämpfe galt. Die brennende Frage lautet nunmehr, welchem Gesicht die Stimme gehört, die da sprechen darf. Dieses neue Repräsentationsmodell stellt die Realität und Effektivität des bisherigen Anspruchs auf demokratische Stellvertretung und Fürsprache in Frage. Jede universal begründete Sprecherposition wird jetzt auf ihren unhintergehbaren Partikularismus hin bloßgelegt. Ob damit aber nicht zugleich jeglichem Anspruch auf Universalität der Boden entzogen wird, bleibt eine wichtige Frage, über die es sich nachzudenken lohnt.
Ohne die Verkörperung, ohne die körperliche Präsenz, ohne die Sichtbarkeit der markierten Körper, deren Zusammenstellung anhand der sich weiter diversifizierenden Diversitätskategorien erfolgt, ist keine gerechte Repräsentation mehr möglich. Damit Gerechtigkeit herrscht, müssen möglichst alle Gesichter auf dem Selfie der Gesellschaft sichtbar sein. Ob die an bestimmte Diversitätsmerkmale geknüpfte Repräsentationsforderung tatsächlich zum dominanten Modell geworden ist oder zunächst einmal eher unterhalb der politischen Repräsentation, also bei Stellenbesetzungen in Verwaltung, Kunst / Film, bei den Werbebildern der Deutschen Bahn, bei der Verteilung von Redeanteilen und der Bestimmung der Übersetzer eines Gedichtes zur Geltung kommt, ist erst einmal nicht entscheidend. Auch die Frage, ob ältere Damen bei der Bundesgartenschau fremde Länder repräsentieren, mit Sombrero auftreten und Pharaonen nachahmen dürfen, soll erst einmal nicht weiter diskutiert werden. Das geschieht längst anderswo. Gerade solche Diskussionen sind aber nicht bloß skurrile Auswüchse eines ansonsten ungleich seriöseren Repräsentationsverständnisses. Sie sind ebenso symptomatisch wie die Sendung Wie redest du?! Und festzuhalten ist, dass der Rassismus eine immer wichtigere Rolle in diesen Diskussionen spielt.
Genau diese Rolle steht im Zentrum der folgenden Überlegungen. Sie befassen sich mit der wachsenden Bedeutung der Rassismuskritik in einer zunehmend sensibel auf Diversitätsangelegenheiten reagierenden Gesellschaft: Rassistische Strukturen und Praktiken, die bisher wie selbstverständlich gegolten haben sollen, werden nun offengelegt. Aber wird der Rassismusvorwurf dabei nicht so inflationär gebraucht, dass das Phänomen konturlos zu werden, die Kritik ihre Wirkung zu verlieren droht? Das ist die Spannungslinie, die die gegenwärtige Lage bestimmt.
Um sie genauer analysieren zu können, empfiehlt es sich, nicht bloß die Rassismuskritik in allgemeiner Form zum Thema zu machen, sondern sie in den Zusammenhang einer Verschiebung in der Affektökonomie westlicher Gesellschaften zu stellen. In dieser werden gegenwärtig die Verhältnisse von Stärke und Schwäche in Diversitätsdiskursen umgewertet. Nimmt man diese genauer in den Blick, so lassen sich auch einige konkrete Vorschläge zu den aktuellen Debatten über die Migrationsgesellschaft machen.
Das große Stichwort ist dabei die Vulnerabilität. Forderungen nach Gerechtigkeit werden durch die Referenz auf Vulnerabilität legitimiert, Kritik an Missständen im Namen der Vulnerablen geübt und Institutionen für die Bekämpfung der Vulnerabilität geschaffen. Vulnerabilität, kurzgeschlossen mit der Frage nach Sichtbarkeit, avanciert zur Leitwährung einer Politik der Gerechtigkeit, wird dadurch zum Referenzpunkt für Subjektivitäten und ihre Wahrnehmung. Sichtbarkeit bzw. Nichtsichtbarkeit einerseits und Vulnerabilität andererseits bilden die Grundlage einer Machtkritik, in der zugleich ein subtiler Machtwille zur Geltung kommt. Mit ihr werden nämlich zugleich Narrative der Einwanderungsgesellschaft produziert, die stets als Mangelerzählungen firmieren, den Wandel der Bundesrepublik Deutschland nicht würdigen und an den handfesten Errungenschaften der Einwanderungsgesellschaft vorbeizielen. Je weiter wir in Freiheit und Gleichheit vorankommen, umso schlimmer scheint alles zu werden. Je weiter diskriminierende Praktiken aus den Institutionen zurückgedrängt werden, umso schneller scheinen »rassistische Realitäten« ausgemacht. Der Missmut hierüber greift in den liberalen und linken Milieus um sich und trifft sich dabei ungewollt und spiegelbildlich mit demjenigen, den die AfD verbreitet.
Um es auf eine Formel zu bringen: Es kommt nicht alleine darauf an, dass endlich Rassismuskritik stattfindet, sondern es ist ebenso wichtig zu wissen, welche affektive Befindlichkeit die Analysen über und die Kritik an Rassismus trägt. Welche Art von Subjekten wollen wir sein, wenn wir uns auf die eine oder andere Art mit Rassismus befassen?
I Zugehörigkeiten in der Einwanderungsgesellschaft
Reden über Rasse
Die Rede von und über Rasse erfreut sich gegenwärtig einer Renaissance. Vielleicht ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nie so viel über Rasse gesprochen worden. Diese Aufmerksamkeit mag partiell mit den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten im Zuge der Black Lives Matter Bewegung in Verbindung stehen. Die rassische Differenz ist in den USA tatsächlich bis in die rechtlichen und politischen Strukturen hinein wirkmächtig gewesen, mit Folgen für andere Bereiche wie die (ökonomischen) Lebensverhältnisse, die auch dann noch die Spuren der rassistischen Sklaverei trugen, nachdem das System sich längst überlebt hatte.
Der amerikanische Soziologe McWhorter (2022) zeigt sich in seinem Buch Die Erwählten kritisch gegenüber den aktuellen Tendenzen des Antirassismus und hält diese für eine neue Religion. Man kann durchaus die These vertreten, dass auch in den USA eine Verschiebung der Rassismuskritik stattfindet. Es ist ein großer Unterschied, ob sich eine Bewegung über das Motto »Black is Beautiful« definiert oder über »I can’t breathe«. Haben wir es hier nicht mit unterschiedlichen Arten der Selbstaffirmation zu tun, die aus verschiedenen Affektlagen herrühren und wiederum unterschiedliche Affekte produzieren? Womit hängt diese Verschiebung in den Affektlagen zusammen? Der Aspekt der Vulnerabilität ist auch hier zentral. Wer »Black is Beautiful« sagte, erhob keinen Anspruch auf Vulnerabilität, sprach nicht als Vulnerabler, obwohl die Schwarzen unter dem systemischen Rassismus in den USA extrem zu leiden hatten. Die Luft, die sie zu atmen hatten, war unerträglich und doch riefen sie nicht: »I can’t breathe«. Ein solcher Ruf hätte keine Resonanz erzeugt.
Der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin (Peck 2017) berichtete, dass er und die Schriftstellerin Lorraine Hansberry sich bei einem Treffen mit dem Präsidentenbruder Senator Bobby Kennedy wünschten, dieser möge im Süden schwarze Schüler in die Schule begleiten. Das wäre ein wichtiges Signal gegenüber einem wütenden weißen Mob. Bobby Kennedy aber antwortete abfällig: »Das wäre eine bedeutungslose moralische Geste.« Hansberry sprach ihn daraufhin direkt an: »Wir hätten von Ihnen ein moralisches Bekenntnis« erwartet. Baldwin beschreibt weiter, dass sie damals Bilder davon vor Augen hatten wie ein weißer Polizist in Birmingham sein Knie auf den Hals einer auf den Boden geworfenen schwarzen Frau drückte.
Angesichts dieses historisch verbürgten Rassismus mit seiner schamlosen Offenheit nehmen sich die »rassistischen Realitäten«, die die vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor initiierte Studie (Foroutan et al. 2022) festgestellt haben will, als recht verträglich aus. 90,4 % der Befragten stimmen der Aussage »Gleiche Chancen für alle sozialen Gruppen muss oberstes Ziel sein« (S. 49) tendenziell zu. Ihr gesellschaftlicher Alltag sei aber, so die These der Studie, gleichwohl rassistisch strukturiert. In Deutschland sollen rassistische Realitäten vorherrschen, aber »insgesamt schätzen 79,1 % der Frauen und 70 % der Männer die Situationen als rassistisch ein«, die ihnen von den Forschern als Indikatoren für Rassismus vorgelegt wurden. Gibt es etwa einen Rassismus ohne Rassisten?
Wie kann man nun Rassismus problematisieren, wenn rassische Kategorien vermieden werden sollen, obwohl sie doch eine soziale Realität haben? Natürlich haben wir es hier mit dem unvermeidlichen Dilemma derjenigen zu tun, die sich zwar gegen rassistische Diskriminierung wehren, dabei aber zugleich die rassische Unterscheidung »Weiße / Schwarze« benutzen, um die Gründe der eigenen Diskriminierung offenzulegen. Das erinnert durchaus an das Problem, mit dem sich der bereits erwähnte James Baldwin in einer Diskussion mit seinem weißen Gegenüber, dem Philosophieprofessor Paul Weiss von der Yale Universität auseinandergesetzt hat (Peck 2017). Dieser hatte gefordert, dass man damit aufhören solle, stets von Hautfarbe und Rasse zu sprechen. Das spalte die Gesellschaft. Er, Weiss, habe mehr mit einem schwarzen Gelehrten gemeinsam als mit einem Weißen, der die Wissenschaft ablehnt. Baldwin, der seinerseits die realen, wirkmächtigen rassistischen Trennungen in den USA überwinden wollte, um endlich ohne Hautfarbe von Mensch zu Mensch zu sprechen, konterte, dass die Rasse, so traurig das auch sei, eine US-amerikanische Realität sei. Man könne darüber nicht schweigen. Die Spaltung der Gesellschaft reiche bis in die Institutionen hinein, selbst in jene der Nächstenliebe, die Kirche: Unübersehbar gebe es eine weiße und eine schwarze Kirche. In der Tat wird man dieser Paradoxie – oder besser gesagt: der eigenen Verwicklung in die bekämpfte Sache – nicht entkommen können. Doch sind aus den fraglos existierenden Fällen eines rechtlich verfestigten, politisch konsequent praktizierten und alltäglich omnipräsenten Rassismus Forderungen von heute wie Migrantenquoten oder Repräsentationsansprüche abzuleiten? Das ist eine wichtige Frage. Mir liegt daran, bei der Rassismuskritik diese Differenzierungen, die leicht aus dem Blick geraten, zu berücksichtigen.
Gleichwohl lässt sich die gegenwärtige Rede über Rasse nicht alleine mit diesem Dilemma erklären. Das Interesse an Fragen der Rasse ist nicht bloß deswegen groß, weil endlich der Rassismus offen und breit thematisiert wird. Es ist vielmehr zu beobachten, wie sich die Hautfarbendifferenz über die übliche Unterscheidung Schwarz / Weiß hinaus zu einer Leitunterscheidung der Migrationsgesellschaft entwickelt, die sich bisher selbst nicht so beschrieben hatte. Mitunter scheint es, als werde die unterstellte eigene Verwundbarkeit wie ein Wertstück gepflegt, das desto stärker genossen wird je mehr es den anderen vorenthalten bleibt. Eindrücklich beschreibt etwa Mithu Sanyals Roman Identititi (2021) das leidenschaftliche Festhalten der »People of Colour« nicht nur an dem Gebrauch der Hautfarbendifferenz, sondern auch an der Echtheit der Hautfarbenzugehörigkeit. Als herauskommt, dass die gefeierte Professorin für Postcolonial Studies gar nicht wie behauptet indischer Abstammung, sondern einfach eine Weiße ist, die sich verkleidet hat, verteidigen die Studierenden mit Händen und Füßen die klare Zuordnung der Hautfarbe, die zuvor von der Professorin zum Konstrukt erklärt worden war.[2] Tatsächlich fällt es auf, dass in ein und demselben Diskursfeld, in dem postkoloniale, rassismuskritische, neufeministische, gendersensible und nichtbinäre Ansätze eine Allianz der diskriminierbaren Gruppen eingehen, um bestehende Normvorstellungen und Identitätskonzepte als Konstrukte zu überführen und Geschlecht zu denaturalisieren, die Hautfarbe von der spielerischen Arbeit der Dekonstruktion nicht tangiert wird (Heintz 2017).
Rassismus wird heute mehr denn je wahrgenommen. Die Studie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa) Rassistische Realitäten bestätigt das auch für die bundesdeutsche Bevölkerung. Ob die Studie tatsächlich auch rassistische Realitäten gemessen hat, wie der Titel der Studie suggeriert, oder die Wahrnehmung von Rassismus, ist allerdings die entscheidende Frage. Doch selbst wenn diese Quantifizierung so nicht stimmen sollte, gibt es einen qualitativen Wandel in der Rede über und damit auch im Umgang mit Rasse. Das Interesse, von dem ich spreche, kommt allerdings diesmal nicht von rechts. Es sind überraschenderweise nicht die erklärten Rassisten mit ihren Rassentheorien, die ansonsten diesen Diskurs tragen und das bis heute noch tun, auch wenn sie ihn bisweilen im Wortlaut vermeiden und durch andere Begriffe wie »Kultur« oder »Religion« ersetzen.[3] Nun aber kommt der Rekurs auf den Rassediskurs aus einem anderen politischen Feld.
Wer Rassismus kritisiert, kommt um die Begrifflichkeit deshalb nicht herum, weil sie eine soziale Realität erhalten hat. Rassistische Unterscheidungen zu vermeiden, würde schließlich zur Nichtthematisierung des Rassismus führen. Ist denn der Rassismus, so heißt es, in Deutschland bisher nicht ein Tabuthema gewesen und als solches an die extremen Ränder abgeschoben worden? Hat man daher nicht Ersatzbegriffe wie »Ausländerfeindlichkeit« und »Rechtsextremismus« kreiert, bei denen es doch um nichts anderes gehe als um Rassismus (Attia 2013)? Von den alltäglichen Formen eines strukturellen Rassismus habe man erst recht nichts wissen wollen. Halten wir vorerst fest, dass die Hautfarbenreferenz, über die der Rassismus als Herrschaftsordnung etabliert worden ist, nun umgekehrt immer deutlicher in kritischer Absicht beansprucht wird. Das aber ist keine Angelegenheit der bloßen Selbst- und Fremdzuordnung, sondern zeitigt politische Folgen und institutionelle Umstellungen. Die Forderung nach einer Quotenregelung ist das beste Beispiel dafür. Sie legt die Sichtbarkeit der Bevölkerungsgruppen nach ihrer Größe fest, damit die »bisher nicht repräsentierten Nichtweißen« gerechter repräsentiert werden.
Was ist aber umgekehrt von der Vorstellung zu halten, dass diese neue Sensibilität für eine Kritik an Diskriminierung und Rassismus ihrerseits rassistisch sei? Das Argument würde so funktionieren: Die Rassismuskritik arbeitet mit einer unaufhörlichen Schuldzuweisung gegenüber den »Weißen«. Sie sind es daher, die aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Das wäre dann ein rassistisches Denken der Linken, die sich Rassismuskritik auf die Fahnen geschrieben hat.[4] Auch wenn dieser Vorwurf auf den ersten Blick plausibel klingen mag, der Sache wird er nicht gerecht. Gleiches gilt für eine Rassismuskritik, die lapidar behauptet, dass Minderheiten nicht rassistisch sein könnten, weil Rassismus mit Vermachtung zu tun habe, die ihnen gerade verwehrt bleibe. Die Machtlosen würden daher mit ihren vermeintlich rassistischen Positionen keine reale Gefahr darstellen, die Mehrheit zu beherrschen. Man muss aber, so ist zu entgegnen, nicht gleich an der Macht sein, wenn man rassistisch denkt und argumentiert. Und umgekehrt hegen diejenigen, die im Namen der marginalisierten Gruppen zu sprechen meinen und den »Weißen« Hegemonie vorwerfen, zumeist keine verdeckt operierenden rassistischen Gedanken gegen »Weiße«. Das erklärte Ziel ist und bleibt die Kritik an Rassismus und dessen Bekämpfung auf der Grundlage der Gleichheit.
Dieser letzte Punkt ist und bleibt von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, den Rassismus zu verorten. Kritik wird aus der Gemütslage der (tatsächlichen oder empfundenen) Ohnmacht derjenigen vorgetragen, die sich nicht allein gegen Missstände wenden, sondern diese Missstände (etwa einer evidenten Ungleichbehandlung aufgrund der Herkunft / Hautfarbe) als Zeichen eines Privilegierten-Status der »Weißen« deuten. Der Rassismus-Verdacht beeinträchtigt auch hier je nach Fall die analytische Schärfe des Begriffs. Man sollte hier zwar nicht vom reversen Rassismus der »Nichtweißen«, wohl aber durchaus vom Ressentiment der Minderheiten gegenüber der Mehrheit sprechen. Das Ressentiment, vielleicht die am besten verteilte Sache der Welt, ist aber nicht mit »Rasse« und einer rassistischen Entwertung einer Volksgruppe zu verwechseln. Letztere zielt politisch auf eine Unterwerfung bis hin zur Vernichtung.
Rasse oder race, »Weiße« und »Nichtweiße« – begriffstaktische Entscheidungen
Man kann den Begriff der Rasse im Deutschen nicht ohne Weiteres benutzen. Jeder Gebrauch führt über Auschwitz. Deshalb wird der Begriff meist vermieden oder in Anführungszeichen gesetzt. Diese historisch begründete Beunruhigung wird in den rassismuskritischen Texten mithilfe der englischen Schreibweise entschärft: Im Gegensatz zu Rasse kann man unumwunden von race sprechen. Ich habe die Vermutung, dass das von dem Gestus herrührt, der mit dem Gebrauch der englischen Schreibweise zusammenhängt.[5] Könnte man hier nicht davon sprechen, dass das englische Wort race mit dem Versprechen verbunden ist, an einer gewissen Weltläufigkeit zu partizipieren, die durch den Gebrauch der englischen Sprache allseits suggeriert wird, während das deutsche Wort »Rasse« seinen gerade durch den Nationalsozialismus geprägten historischen Erfahrungshorizont nicht verlassen kann? Ähnlich verhält es sich mit dem Ausdruck »People of Colour«, der keineswegs als »Volk / Leute der Farben« übersetzt werden darf, weil der Ausdruck »farbig«, »farbige Menschen«, ebenfalls unter Verdacht steht, aus dem rassistischen Vokabular zu stammen. Allerdings leuchtet das nicht so schnell ein wie bei dem Begriff »Rasse«. Farbe enthält ähnlich wie colour nicht nur negative, sondern auch positive Konnotationen.
Die Vermeidung des deutschen Rassenbegriffs durch den Einsatz des englischen race ist nicht unproblematisch. Denn race ist im Verhältnis zu Rasse eigentlich unspezifisch, er bezeichnet unabhängig von rassistischer Zuteilung jegliche Herkunft, die man im Deutschen besser mit »ethnisch« wiedergibt. Mit dem rassismuskritischen Gebrauch von race in deutscher Sprache meint man aber gar nicht die ethnische Herkunft, sondern die rassische Zuordnung, die demnach immer schon rassistisch wäre. Umgekehrt gilt scheinbar: Jeder Hinweis auf die fremdethnische Herkunft kann bereits auf einen wie auch immer gearteten »strukturellen« Rassismus hindeuten.
So verhält es sich bspw. mit der zu Unrecht bedeutungsüberfrachteten Frage »Woher kommst du?«. Mit der neuen Sensibilität sieht man hier eine rassistisch fundierte Mikroaggression, weil durch die Frage signalisiert werde, dass die Person nicht von hier stamme, was als Verweigerung der Zugehörigkeit gedeutet wird. Sie würde ver-andert (othering). Wie leicht man sich die Verweigerung der Zugehörigkeit vorstellt und davon ausgeht, dass die Betroffenen davon auch tatsächlich und ernsthaft betroffen wären, ist schon ein Thema für sich. An dieser Stelle begnüge ich mich mit dem Hinweis, dass die Differenzierungsmöglichkeit, die mit dem »Ethnischen« im Deutschen gegeben ist, nicht leichtfertig aus der Hand gegeben werden sollte.
Im Folgenden werde ich aus taktischen Gründen, immer wenn ich mich auf die Rassismuskritik oder -vorwürfe beziehe, den deutschen Begriff Rasse ohne Anführungszeichen benutzen. Die Diskriminierungsdebatte wimmelt nur so von sprachsensiblen, letztlich aber eigenmächtig getroffenen Entscheidungen. Ich möchte da ausnahmsweise mitmachen. Wenn wir ständig unbesorgt die Rede über Rasse befeuern, indem die Bevölkerung in »Weiße / Nichtweiße« aufgeteilt wird, Subjektivitäten von dort aus entwickelt werden, um dann Repräsentationsansprüche inklusive Ämterbesetzung geltend zu machen, dann sollten wir auch ganz offen den Begriff benutzen. Nicht etwa aus Gründen der Aufrichtigkeit, sondern – das ist das Taktische daran – damit wir jedes Mal zusammenzucken, wenn wir, die den Begriff ablehnen, ihn zu Beschreibungszwecken benutzen; damit wir nicht vergessen, was wir gerade tun und welche Beschreibungsregime wir fördern. So wird zumindest dem unbedachten Gebrauch der »Rasse« (hier doch mit Anführungszeichen, weil es um die Hervorhebung des Begriffs als Begriff im konkreten Gebrauchszusammenhang geht) ein Stück entgegengewirkt. Hinter dieser taktisch begründeten Entscheidung steht meine politische Sorge, dass sich die rassische Bezeichnung »Weiße / Nichtweiße« über die bildungsbürgerlichen Schichten hinweg verbreitet und am Ende auch zu einer anerkannten Formel der Selbst- und Fremdbeschreibung in der Gesamtgesellschaft wird. Wenn die Deutschen von den Migranten respektive deren Nachfahren anhaltend als »Weiße« markiert werden, dann werden sie irgendwann auch explizit und dauerhaft bejahend davon Gebrauch machen.
Eine mögliche Kritik an dieser Position könnte lauten, dass sie zu einseitig gefasst sei. Die Rassisten bzw. Nazis werden definitiv nicht zusammenzucken, sie werden sich des aktiven Gebrauchs der Rassenunterscheidungen gar erfreuen. Das stimmt zwar, der Einwand ist trotzdem haltlos. Nazis sind nicht die Zielgruppe dieses Textes. Und wer glaubt allen Ernstes, dass sie sich um Anführungszeichen scheren? Sie werden auf alle Fälle leichtes Spiel haben, wenn die Unterscheidung »Weiße / Nichtweiße« zu einer gesellschaftlich anerkannten wird. Vorarbeiten dazu sollten wir nicht leisten.
Der Ausdruck »Weiße / Nichtweiße« wird im Folgenden nicht als Beschreibungskategorie benutzt. Deshalb gehört er gemäß den Regeln der indirekten Rede in Anführungszeichen. Hier soll niemand angesichts der Begrifflichkeit zusammenzucken, sondern immer daran erinnert werden, dass es sich um eine Begrifflichkeit eines Diskurses handelt, der hier kritisiert werden soll. Das hat zwei Gründe: Der erste ist, dass die »Weißen« in Deutschland (die Deutschen / Europäer) sich nicht primär über diese Kategorie beschreiben. Die aktuelle Rassismuskritik spricht zwar in diesem Zusammenhang davon, dass »Weiß« als explizite Selbstbeschreibung nur deshalb kaum vorkomme, weil es die Norm darstelle, die folglich unmarkiert bleibt. In der Tat hat man überall, wo man auf einen »Schwarzen« als Schwarzen hinweist, implizit »Weiß« für sich in Anspruch genommen. Hinter diesem Gedanken liegt allerdings ein Problem. Er wird nämlich von der Überzeugung getragen, dass zwischen dem faktischen Arbeiten einer Unterscheidung und ihrer expliziten Anwendung kein Unterschied bestehe. Tut es aber wirklich nichts zur Sache, ob »Weiß« implizit im Hintergrund bleibt oder als kategoriale Zuschreibung explizit einen Diskurs begründet, von dem aus Sprecherpositionen verteilt und institutionelle Regelungen getroffen werden? Ich vertrete die Position, dass es einen entscheidenden Unterschied darstellt, ob etwas implizit oder explizit gehalten wird. Das explizit Gemachte ist nicht bloß Aufdeckung einer verdeckten Wesenheit, die implizit genauso wirkt, wie wenn sie aus der Unsichtbarkeit ans Tageslicht gebracht würde.[6]
Der zweite Grund, warum »Weiße / Nichtweiße« in Anführungszeichen verbannt wird, rührt ebenfalls an einem inneren Widerspruch aktueller Rassismuskritiken: Als Türke / Türkischstämmiger / Türkeistämmiger / Deutsch-Türke halte ich mich vom Rassenkrieg fern. Wenn an der viel bemühten These etwas stimmen sollte, dass wir jeweils aus unserer eigenen Positionalität heraus sprechen, dann gehört zu dieser Positionalität meine türkische Herkunft, deren Relevanz für die Frage »Wie zu sprechen?« ich hier in aller Kürze erhellen möchte. Das ist notwendig, weil bei den türkeistämmigen Bildungsaufsteigern mittlerweile Begehrlichkeiten geweckt wurden, die eigene soziale Existenz und Position mit der Unterscheidung »Weiße / Nichtweiße« zu bestimmen. Dieses Buch möchte dem entgegenwirken.
Wer hat eine Hautfarbe? Türken jedenfalls nicht!
Wenn wir uns die Selbst- und Fremdbeschreibungen von Migranten (teilweise auch ihrer Kinder) aus der zweiten Generation anschauen, finden wir über längere Zeiträume hinweg keine Referenz auf die kategoriale Unterscheidung »Weiße / Nichtweiße« – auch nicht in der »neuen deutschen Literatur« (Ezli 2021b), die von Migranten geschrieben worden ist. Das mag damit zusammenhängen, dass sie zum größten Teil aus Europa stammen: Italiener, Spanier, Portugiesen, Griechen und Jugoslawen konnten von den Deutschen nicht als »Weiße« sprechen. Aber auch für die Migranten aus der zivilisatorischen Grenzregion Türkei kam diese Begrifflichkeit nicht in Frage, obwohl ihr Verhältnis zum europäischen Kulturkreis keineswegs uneingeschränkt positiv war und ist. Während die innereuropäischen Migranten sich sowohl kulturell als auch politisch (EU) als Europäer verstehen können, bleibt das Verhältnis zu Europa für ein Großteil der Türkeistämmigen antagonistisch. Dafür lassen sich durchaus Belege finden. Schließlich ist das Schüren der Feindseligkeit gegenüber Europa eine unverzichtbare Zutat im Erfolgsrezept von Erdoğan und reiht sich in eine lange Tradition von Europafeindlichkeit ein.
Im Falle der Türken existierte bislang keine rassische Beschreibung seitens der Europäer und das nicht etwa, weil sie »Weiße« sind, sondern weil sie keine Hautfarbe besitzen. Hautfarbe ist keine biologische, sondern eine politische Kategorie, die in rassistischen Dominanzverhältnissen hergestellt wird. Türken haben im politischen Sinne keine Hautfarbe. Ihre nicht gerade zimperliche Hegemonie in der Vergangenheit (konkret im osmanischen Reich[7]) wurde anders als im Falle der europäischen Mächte der Neuzeit nicht durch Rassenunterscheidungen oder Rassentheorien, sondern mittels der Kategorien religiöser Zugehörigkeit legitimiert – genau wie im christlichen Europa des Mittelalters. Dieser geschichtliche Hintergrund ist entscheidend für die aktuellen Kämpfe um Bezeichnungen. Im Unterschied zu ehemaligen Kolonialisten und Kolonisierten in Afrika haben die osmanischen Herrscher ihre Beziehungen nicht nur zu ihren Untertanen, sondern auch zu den Europäern nicht mit rassischen Kategorien belegt. Europäer waren und sind weiterhin für sie keine »Weißen«. Weder sehen sie sich selbst als »Weiße«, noch beschreiben sie sich als die Gegenseite der »Weißen«. »Franken, Christen, Europäer« waren die gültigen Zuordnungen der Türken, die sie zum Teil auch von den muslimischen Arabern übernommen hatten. Wenn sie gelegentlich oder häufiger böse über die Europäer sprachen, dann waren diese eben keine »weißen Kolonialisten«, sondern »Kreuzfahrer«.
Auch die Nachfolgerin des osmanischen Reiches, nämlich die inzwischen über einhundert Jahre alte türkische Republik hat sich nie in einem auf Rassendifferenzen referierenden Diskurs nach innen und außen verortet. Der türkische Nationalismus der neuen Republik umfasste nichttürkische Muslime, schloss aber christliche Türken aus. Die nichtmuslimischen Bürger der Republik hatten einen durch internationale Abkommen geregelten Status, der mit ihrer Religionszugehörigkeit zusammenhing. Selbst die Fundamentalisten, die die Republik für einen Ableger Europas halten, haben in ihrem Hass gegen Europa nicht auf Herkunft oder Hautfarbe gesetzt, wenn sie über die Europäer (Amerikaner gehören dazu) durchweg negativ, als ihr antagonistisches Anderes, gesprochen haben. Erst in den 1990er Jahren, unter dem Einfluss des akademischen Postkolonialismus, tauchte die Unterscheidung »Weiße Türken – Schwarze Türken« im politischen Diskurs der Türkei auf. Die Soziologin Nilüfer Göle hatte die Begrifflichkeit mit dem Bedeutungsgehalt zu etablieren versucht, dass eine säkulare, westlich orientierte vermeintliche Elite die »Weißen« seien, die über die »religiösen schwarzen Türken« herrsche. Sie wollte eine Privilegien-Kritik entwickeln, wie sie in der postkolonial gefärbten, neueren Rassismuskritik inzwischen tonangebend geworden ist (ausführlich dazu: Tezcan 2022). Erdoğan nahm eilends die Rolle an, als Sprecher der »schwarzen Türken« gegen die säkularen »weißen Türken« anzutreten.
Dabei war die Unterscheidung »Weiße Türken – Schwarze-Türken« ursprünglich entstanden, um die Ressentiments der großstädtischen Bürgerlichen gegenüber den mehrheitlich, aber nicht ausschließlich kurdischen Zuwanderern anzuprangern. Dass sie sich nicht etablieren konnte, hat sicher mehrere Gründe, unter anderem den, dass sich die ethnische Differenzachse türkisch-kurdisch keineswegs mit der sozialen Achse von reich-arm deckt, während wiederum die gemeinsame religiöse Zugehörigkeit einen weiteren Cross-Cutting-Effekt erzeugt.[8] Der Republikanismus hat hier ebenfalls entschärfend gewirkt. Das Ergebnis lässt sich so deuten, dass sich die begrifflichen Zuordnungen nicht mit einem Kunstgriff etablieren lassen. Soviel ist für den vorliegenden Essay festzuhalten: Rassische Unterscheidung war weder für die Osmanen noch für die Republik ein Mittel der Selbst- und Fremdpositionierung.
Es wäre allerdings absurd, daraus die These abzuleiten, dass die Türken mehr oder weniger immun gegen Rassismus seien. Das ist eine völlig andere Frage. Gerade in den faschistischen Varianten des türkischen Nationalismus war die Feindseligkeit gegenüber bestimmten Volksgruppen, vor allem gegenüber christlichen Armeniern, rassistisch unterlegt. Während des Kampfs gegen die kurdische PKK hat sich in den 1990er Jahren über Parteigrenzen hinweg eine praxiswirksame Kurdenfeindlichkeit mit rassistischen Untertönen herausgebildet, auch wenn dieser Rassismus stets durch den Islam bzw. die gleiche Glaubenszugehörigkeit sowie durch den republikanischen Humanismus gedämpft wurde.[9]
Wie sieht es aber mit den Migranten aus der Türkei in Deutschland aus? Müsste sich hier nicht die rassische Differenz für die Gastarbeiter und deren Kinder anbieten, die sich auf drei Differenzachsen von der deutschen Mehrheitsbevölkerung unterscheiden: ethnisch fremd – religiös nicht nur fremd, sondern auch politisch Jahrhunderte lang die größte Konkurrenz zum christlichen Europa – schließlich sozial





























