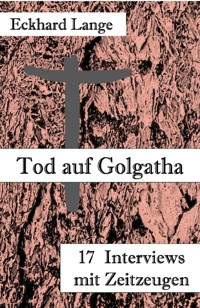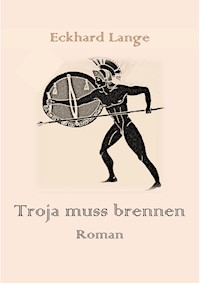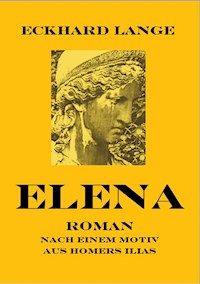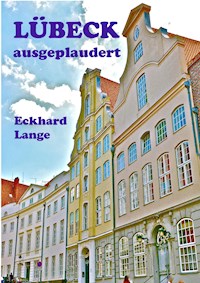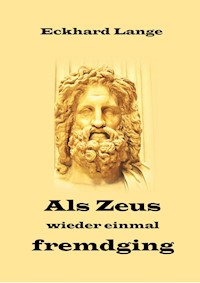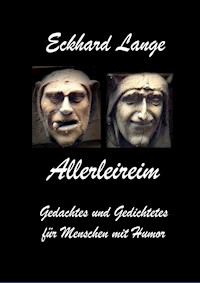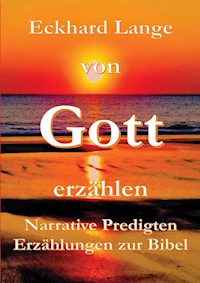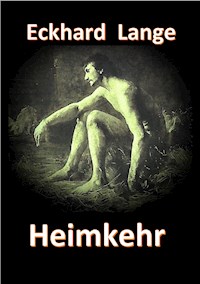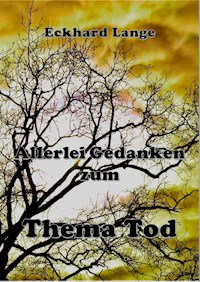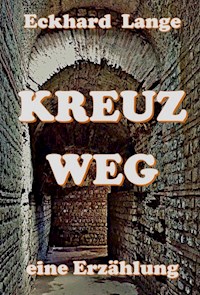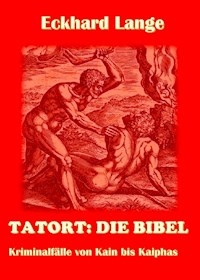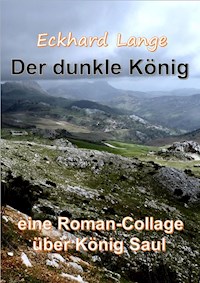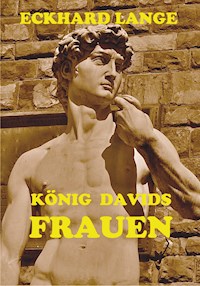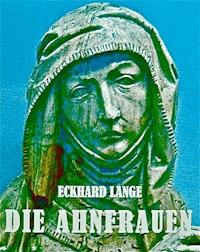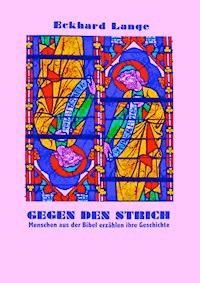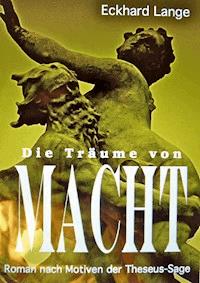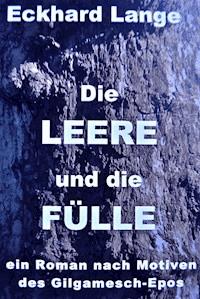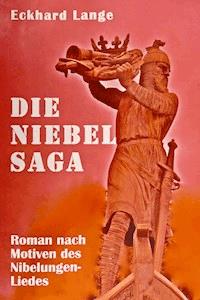Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Jahrhundertelang war Ostern als Feier der Auferweckung Jesu das höchste Fest der Christenheit, bis ihm Weihnachten den Rang ablief. Und wie dieses ist auch Ostern inzwischen eher zu einem Familienfest geworden. Doch es hat auch viele Bräuche bewahrt, die oft bis in vorchristliche Zeiten zurückreichen. Aber die Auferstehungsbotschaft stellt ja auch die grundsätzliche Frage: Wohin gehen wir? Was bleibt nach dem Tod? Glaube und Aberglaube, Hoffnungen und Ängste stehen so eng beieinander. Ein weites Feld also, das Ostern uns bietet und auf das dieses Buch eingehen möchte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eckhard Lange: Alles über Ostern
INHALT:
ERSTER TEIL: DAS BIBLISCHE OSTERZEUGNIS
1. Worum es geht
2. Das leere Grab
3. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen
4. Das Bekenntnis hinter dem österlichen Geschehen
ZWEITER TEIL: DIE KIRCHLICHE LEHRE VON DER AUFERSTEHUNG
1. Die Entstehung einer festen Bekenntnisformel
2. Die Frage nach der Auferstehung der Toten
3. Die christologische Frage: Was bedeutet "Sohn Gottes?"
4. Von Zeit und Kirchenjahr
DRITTER TEIL: OSTERN IM URTEIL MODERNER BIBELWISSENSCHAFT
1. Der Beginn der Bibelkritik
2. Die allgemeine Auferstehungshoffnung in der heutigen Zeit
3. Wie hältst du's mit der Religion?
VIERTER TEIL: DIE FEIER DER OSTERNACHT
1. Ostkirche
2. Die katholische Kirche
3. Der Protestantismus
FÜNFTER TEIL: ÖSTERLICHES BRAUCHTUM
1. Das Oster-Ei
2. Osterwasser
3. Osterlicht und Osterfeuer
4. Andere Osterbräuche
ERSTER TEIL: DAS BIBLISCHE OSTERZEUGNIS
1. Worum es geht
Was Sie jetzt in der Hand halten, liebe Leserin, lieber Leser, ist keine wissenschaftliche Abhandlung, die eine neue Erkenntnis über das Ostergeschehen vermitteln will, sondern entstand mit der Absicht, dem theologischen Laien all das wenigstens auszugsweise zu vermitteln, was die Bibelwissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten zusammengetragen hat, um das Ostergeschehen zu deuten. Denn dabei geht es ja nicht in erster Linie um ein bedeutsames Ereignis in der Geschichte, für den Christenmenschen geht es um die Begründung seines Glaubens: Was bedeutet das, was wir die Auferweckung Jesu nennen, für sein eigenes Dasein, für seine Hoffnungen, für sein Vertrauen in die Schöpfermacht eines Gottes? Auch davon wird also zu reden sein, ebenso wie über Zweifel und Verzweiflung, die mit dieser Geschichte verknüpft sind.
Denn es ist schon ein Unterschied, ob wir des Todes Christi am Kreuz gedenken, weil dort sein Blut vergossen wurde zur Vergebung der Sünden, wie es im Abendmahlsbericht des Matthäusevangeliums gedeutet wird (Matth. 26,28), oder auf die Osterbotschaft hören, von der Paulus sagt: Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube vergeblich (1. Kor. 15,17). Ob wir also - nur - ein innerweltliches, historisch greifbares Ereignis als Heilsgeschehen deuten, oder ein letztlich historisch nicht greifbares, weil außerhalb unserer Erfahrungswelt liegendes Geschehen zur Grundlage unserer Hoffnung machen - für den christlichen Glauben aber gehört beides zusammen, interpretiert und bestätigt das Ostergeschehen erst das, was am Kreuz geschehen ist. Darum müssen wir immer auch die Osterbotschaft mit bedenken, wenn es um Glauben oder Nichtglauben geht.
Denn letztlich ist erst der Ostertag, der 17. Nisan nach jüdischer Zeitrechnung, wenn die Angaben der drei sogenannten synoptischen Evangelien (Markus, Matthäus und Lukas) zutreffen, das Geburtsdatum einer neuen Weltreligion, die sich nach dem ins Griechische übersetzten Titel des jüdischen Messias Christentum nennt. Über das genaue Jahr allerdings herrscht Uneinigkeit, es wird zwischen 30 und 33 nach unserer Zeitrechnung angesetzt.
Was aber läßt sich nun historisch gesichert über das Ostergeschehen sagen? Eigentlich nur dieses eine: Es muß in diesen Tagen nach der Hinrichtung Jesu etwas Entscheidendes mit seinen Anhängern geschehen sein. Denn dieser schmähliche und grausame Tod hatte all ihre Erwartungen zunichte gemacht. Was immer im Einzelnen diese Hoffnungen auch waren, stets ging es um den Beginn der im jüdischen Volk lang ersehnten Herrschaft Gottes. Auch Jesus hatte sie ja verkündet, hatte sie zeichenhaft als schon im Entstehen begriffen verstanden. Mancher mag damals diese Erwartung politisch verstanden haben als Befreiung des Volkes von römischer Herrschaft, andere erhofften eine Weltenwende in der Offenbarung des einen und einzigen Gottes, wieder andere verstanden darin das Erscheinen eines himmlischen Gesandten in Gestalt eines "Menschensohnes," der über Lebende und Tote Gericht halten würde.
Es läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, welche dieser Vorstellungen die Jünger, also der engste Freundeskreis um Jesus, jeweils hatten, jedenfalls war dieser Tod ihres Meisters ein Zusammenbruch all ihrer Hoffnungen. Verzweiflung, Trauer, auch Furcht vor den Feinden Jesu bestimmte die Stunden nach seinem Tod. Für sie war es das absolute Ende aller Träume. Mit ihrem Meister war auch die Erwartung auf Gottes Eingreifen gestorben.
Und genau deswegen, so schließen auch kritische Historiker, ist es auch völlig unerklärlich, warum eben diese Menschen nur wenige Tage danach öffentlich auftraten, frohgemut ihrer Meister als gottgesandten Messias verkündigten, Anfeindungen und Verfolgung in Kauf nahmen. Kein Hinweis mehr auf Trauer oder gar Verzweiflung. Dafür gibt es keine psychologisch einleuchtende Erklärung wie Trauerarbeit, Verdrängung des Geschehens, Versuch einer Umdeutung. Was bleibt, ist die Feststellung, daß etwas Außergewöhnliches geschehen sein muß, das zu dieser so plötzlichen Verwandlung geführt hat. Was dabei geschehen ist, wodurch diese Verwandlung hervorgerufen wurde, bleibt für den Historiker Spekulation. Er kann die Osterberichte zur Kenntnis nehmen, kann sie wiederum psychologisch deuten oder ganz verwerfen, die Tatsache einer überraschenden, unerwarteten und letztlich unerklärbaren Veränderung der ersten Zeugen bleibt als solche bestehen. Das ist alles, was ein objektiv arbeitender Historiker zum Thema Ostern sagen kann, aber auch sagen muß.
Noch eine Vorbemerkung sei hier angefügt. Wir werden im Folgenden immer wieder von Gott reden, doch was unzählige Menschen darunter verstehen, ist so unterschiedlich wie kaum sonst ein Begriff sein kann. Darum soll kurz gesagt sein, was der Verfasser dieses Buches meint, wenn er von Gott spricht: Für ihn ist 'Gott' die schöpferische, sinnstiftende, transzendente und durchaus auch 'personale' Kraft hinter und zugleich in diesem Universum.
Schöpfung bedeutet dabei nicht einfach den Beginn des Kosmos, den wir heute mit dem Urknall gleichsetzen, sondern den Ur-Grund alles raumzeitlich Seienden. Und Transzendenz nicht etwas außerhalb dieses Universums, als gäbe es einen Raum und eine Zeit jenseits des Kosmos, der doch erst mit jenem Urknall Zeit und Raum entstehen ließ. Transzendenz läßt sich mit diesen Begriffen gar nicht beschreiben, bedeutet keinen anderen 'Raum' oder einfach eine Zeit vor der Zeit, weil beides undenkbar ist. 'Transzendenz' meint den Sinn( und damit einen Sinn-Stifter) jenseits dieser unserer Wirklichkeit, der alles 'Sein' erst begründet, der es bewirkt und zugleich durchdringt, denn alles Sein ist zugleich ein 'Sein in Gott.' Und doch ist ihm damit die Freiheit geschenkt, sich zu entfalten innerhalb der im Urknall angelegten Konstanten in den Naturgesetzen.
2. Das leere Grab
Anders sieht es für den Historiker aus bei den Berichten über den Prozeß Jesu und seine Hinrichtung. Hier kann er kritisch hinterfragen, mit anderen Quellen vergleichen, das Wahrscheinliche oder auch Gesicherte von möglicher Interpretation unterscheiden. Erstaunlich ist zunächst, daß Jesus nach nur wenigen Stunden am Kreuz bereits stirbt. Das mag an der vorher vollzogenen Geißelung liegen, die möglicherweise besonders brutal ausgefallen ist. Dafür spricht, daß er der durchaus glaubhaften Überlieferung nach nicht im Stande war, den schweren Kreuzesbalken bis zur Hinrichtungsstätte zu schleppen. Gewollt war eigentlich, daß derart Verurteilte möglichst viele Stunden und manchmal sogar Tage qualvoll auf ihren Tod warten sollten, den hier ging es nicht einfach um eine Hinrichtung, sondern um eine grausame Folter, um in den Augen Roms besonders gefährliche Subjekte möglichst qualvoll sterben zu lassen - meist Sklaven oder eben auch Staatsfeinde, Aufrührer und Guerillakämpfer wie die beiden mit Jesus Gekreuzigten.
Und hier kommt nun ein gewisser Joseph von Arimathia ins Spiel, der für den toten Jesus sein Grab zur Verfügung stellt. Er erbittet von Pilatus den Leichnam des Verstorbenen. Eigentlich ließ Rom die Gekreuzigten gerne dort oben hängen, der Verwesung und den Geiern ausgeliefert, oder doch einfach darunter liegen als Fraß für die Schakale. Auch das ein letzter Akt der Inhumanität. Warum der Prokurator diesem ungewöhnlichen Wunsch stattgibt, bleibt im Dunkel. Folgt man dem Bericht des Johannesevangeliums, war es die jüdische Verwaltung, die mit dem Blick auf eine Vorschrift der Thora verlangte, man solle auch die beiden anderen Hingerichteten töten, damit sie vor dem Feiertag bestattet werden könnten: Im 5.Mosebuch Kap. 21,22f findet sich eine solche Vorschrift. Allerdings gilt diese Passage im Johannesevangelium als ein recht später Einschub.
Möglich ist aber, daß auch Joseph von Arimathia sich auf diese Anweisung berufen hat, um Pilatus zur Freigabe des Leichnams zu bewegen. Und vielleicht hatte der Prokurator eingewilligt, weil er angesichts der aufgeheizten Stimmung in Jerusalem keinen Anlaß zu irgendwelchen Protesten geben wollte. Dann wäre Joseph auch zunächst einmal nur der gesetzestreue fromme Jude, der hier handelt. Alle Evangelien bezeichnen ihn jedoch als heimlichen Sympathisanten der Jesusbewegung und beziehen seine Bitte auch nur auf den toten Jesus.
Joseph hat sich laut den Berichten ein neues Felsengrab anlegen lassen, das noch ungenutzt war. Wie ist das im Einzelnen zu verstehen? Viele jüdische Grabstätten waren einfach in den Fels gehauene Stollen, in die man den Leichnam hineinschob. Hier ist aber offensichtlich von einem Kammergrab die Rede, also einem größeren, künstlich geschaffenen Raum, in den man hineingehen konnte und an dessen Wänden dann entweder einzelne Stollen oder doch Nischen ausgehauen waren, in die man die Verstorbenen bettete, manchmal auch Steinliegen in der Mitte, die von allen Seiten zugänglich waren. Also wohl eine Art Familien- oder Sippengrab, das Joseph bereits vorsorglich hatte anlegen lassen. Der Zugang mußte also verschlossen werden. Das geschah durch einen Rollstein, der mit ziemlicher Kraft vor die Öffnung oder wieder zur Seite gewälzt werden konnte. Soweit die grundsätzliche Übereinstimmung der Evangelien. Über die Person des Joseph gehen sie dann auseinander. Er wird als reich beschrieben (nur Begüterte konnten sich eine solche Grabanlage leisten), teils auch als Mitglied des Hohen Rates, der ja über Jesus geurteilt hat (was zu der Schwierigkeit führte, sein dortiges Abstimmungsverhalten zu erklären). Auch die genaue Lage des Grabes bleibt unbestimmt.
Jedenfalls gilt: Angesichts des nahenden Sabbats gibt es keine der üblichen Zeremonien bei der Grablegung, der Leichnam wird nur in ein Leinentuch gehüllt und drinnen abgelegt. Berichtet wird allerdings, daß einige Jüngerinnen das Geschehen auf dem Hügel Golgatha verfolgt haben und auch Joseph nachgegangen sind, um zu erfahren, wohin er den Leichnam ihres Meisters bringen würde. Sie beschließen zugleich, die notwendigen Bestattungsriten nach der Sabbatruhe nachzuholen. Schließlich ist während des Feiertages keine Arbeit erlaubt, auch können die erforderlichen Einkäufe von Salböl ebenfalls erst dann erledigt werden. Sie sind es dann auch, die als erste erschrocken feststellen, daß das Grab leer ist. Hier weicht allerdings die Darstellung der Evangelien erheblich voneinander ab.
Der erste, der das leere Grab erwähnt, ist Markus. Sein Evangelium entstand nach Meinung der Mehrzahl der Neutestamentler etwa um das Jahr 70, also rund vier Jahrzehnte nach dem Tod Jesu. Allerdings wird vermutet, daß der Verfasser seine Sammlung von Jesusgeschichten einer bereits vorhandenen zusammenhängenden Passionsgeschichte hinzugefügt hat, daß Markus damit die Erzählung vom Ende Jesu vielleicht sogar bereits schriftlich vorlag, also auf Überlieferungen der Urgemeinde in Jerusalem beruht. Matthäus und Lukas übernehmen in weiten Teilen das Markusevangelium und damit auch die Passionsgeschichte, allerdings nicht ohne Veränderungen. Übrigens auch in dem Bericht über die Frauen am leeren Grab.
Bedeutsam ist, daß das Markusevangelium ursprünglich mit Kap. 16, 8 endete. So findet sich dieser Schluß auch in den ältesten Handschriften, die der Wissenschaft vorliegen. Die folgenden Verse sind nach allgemeiner Überzeugung später angefügt, um das Evangelium an die anderen anzupassen. Markus schließt seine Erzählung also mit der Aussage, daß die Frauen voller Schrecken vom Grab fliehen und niemandem darüber berichten. Umstritten ist dagegen, ob es einen anderen, verlorengegangenen oder bereits früh gestrichenen Schluß des Markusevangeliums gegeben haben könnte.