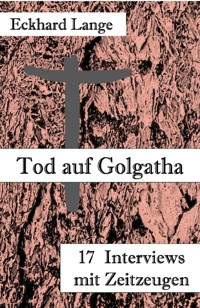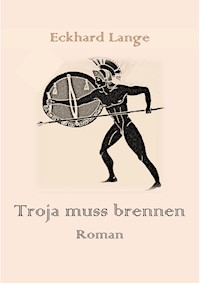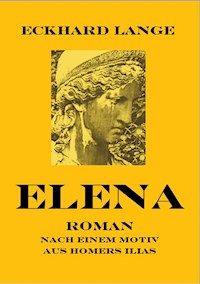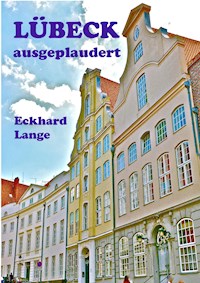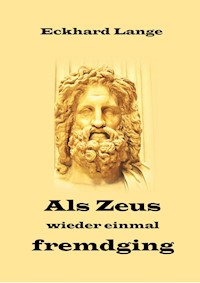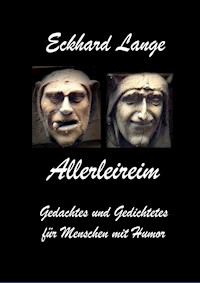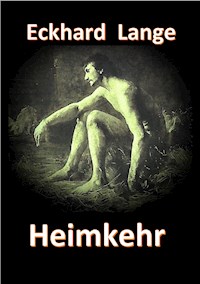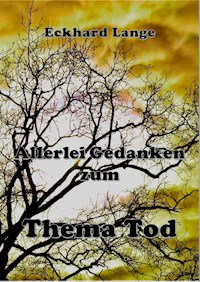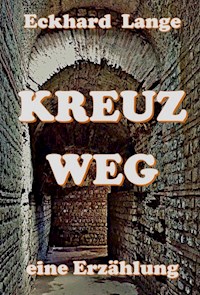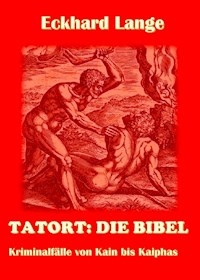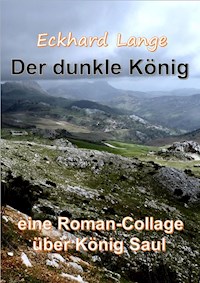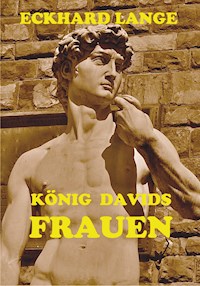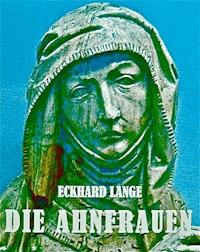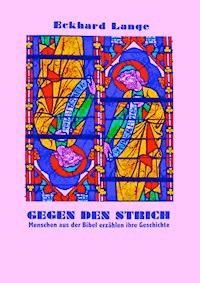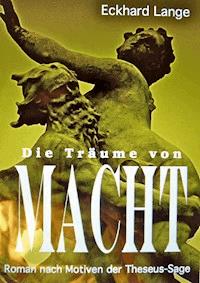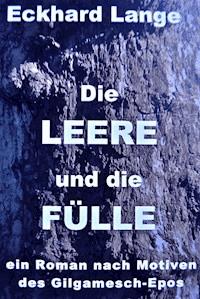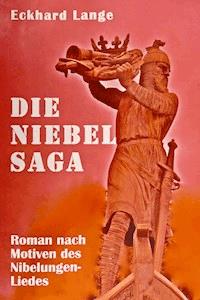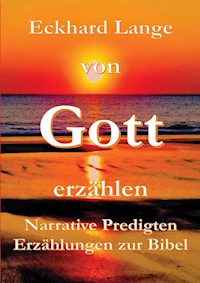
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Über Gott haben Menschen seit jeher nachgedacht und auch gestritten. Dennoch lässt sich ernsthaft Nachprüfbares nicht über ihn aussagen. Gott ist kein Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis. Angemessen von Gott reden, das heißt: Bilder gebrauchen, Geschichten erfinden. So wie Jesus es getan hat. Nur im Erfahrenen, Erlebten kommt Gott uns nahe. Und nur im Gleichnishaften lässt sich davon berichten. Man kann nicht "über" Gott reden. Aber man kann Geschichten von ihm erzählen. Alte Geschichten nacherzählen und neue hinzufügen. Und so wenigstens den Saum seines Gewandes entdecken, wie Jesaja einmal erzählt hat. Eckhard Lange, dreißig Jahre lang Gemeindepastor, hat das in vielen Predigten und manchen Erzählungen versucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eckhard Lange
Von Gott erzählen
Narrative Predigten - Erzählungen zur Bibel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ZUR BEDEUTUNG DES NARRATIVEN - EINIGE ÜBERLEGUNGEN VORWEG
1. DIE ENTFALTENDE ERZÄHLUNG
2. PERSPEKTIVISCHE ERZÄHLUNG
3. DISKURSIVE ERZÄHLUNG
4. TRANSZENDIERENDE ERZÄHLUNG
5. SITUATIVE ERZÄHLUNG
6. TRANSFORMIERENDE ERZÄHLUNG
7. EXEMPLARISCHE ERZÄHLUNG
8. INTERAKTIVE ERZÄHLUNG
VORBERKUNGEN ZUM TEIL "ERZÄHLUNGEN"
1. JAKOB IN BETHEL (1. Mose 28, 10-22)
2. DIE RICHTERIN (Richter 4)
3. NABOTHS WEINBERG (1. Kön. 21, 1-20)
4. DIE VERSUCHUNG (Matth. 4, 1-11)
5. DER RABBI UND DIE TRÄUME - BARTIMÄUS (Mark. 10, 46-52)
6. DER KOMPROMISS (Matth. 27, 1)
7. BARABBAS (Lukas 23, 13 - 47)
ANHANG: EIN RÜCKBLICK AUF DAS HANDWERKSZEUG
VOM GLEICHEN VERFASSER ERSCHIENEN:
Impressum neobooks
ZUR BEDEUTUNG DES NARRATIVEN - EINIGE ÜBERLEGUNGEN VORWEG
Eckhard Lange:Von Gott erzählen - narrative Predigten + Erzählungen zur Bibel
Erster Teil: Narrative Predigten
Erzählen und Erfahrung
Die älteste und elementarste Form, eigene Lebenserfahrungen an andere weiterzugeben, besteht darin, von ihnen zu erzählen.
Fähigkeiten und Fertigkeiten lerne ich, indem ich anderen zuschaue, sie dabei nachahme. Wie Beute gejagt und gefangen, Nahrung gesucht und zubereitet, Werkzeug genutzt und gefertigt wird - das konnte der Mensch bei seinen älteren und erfahreneren Zeitgenossen miterleben, er konnte mitmachen und nachmachen. Und später konnte er das Erlebte vielleicht auch verbessern und selber den Jüngeren vormachen. Darin unterscheidet er sich nicht eigentlich vom Tier.
Doch daneben gibt es andere, einmalige und unwiederholbare Lebenserfahrungen: Was ich erlebt, was ich erlitten oder errungen habe, was mich reifer und weiser werden ließ - diese Einsichten lassen sich nicht einfach wiederholen und anderen vorführen. Ich muß sie auf andere Art vermitteln. Das gleiche gilt für alle sinnstiftenden Erlebnisse in der Geschichte der Menschheit, für die Begegnungen mit dem Absoluten, Transzendenten - also für religiöse Erfahrungen, in welcher Form auch immer sie gewonnen wurden.
Das alles ist nur durch Sprache möglich. Erst sie macht das Vergangene, das Einmalige wieder lebendig und vergegenwärtigt es, denn der Mensch kann davon erzählen: Er kann dem anderen ein lebendiges, begreifbares Bild davon vor das innere Auge zeichnen. So werde ich - trotz meiner Distanz zu dem Geschehenen - hineingenommen: Ich kann miterleben, was doch eigentlich Vergangenheit ist. Indem ich höre, was mir erzählt wird, fühle ich mit, fürchte oder freue mich mit, entdecke Unbekanntes - so, als wäre ich es selbst, der hier handelt oder leidet; so, als wäre das früher Geschehene, das Einmalige und Unwiederholbare gegenwärtige, zeitlose Wirklichkeit. Wer solche Erfahrungen weitergeben, überliefern will, muß davon erzählen.
Erzählen bedeutet, Erfahrungen zu tradieren
Stärker als alle abstrakt gewonnene Einsicht prägt es den Menschen, wenn er hineingenommen wird in diese eigentlich fremden Erfahrungen, wenn er sie noch einmal selbst in seiner Fantasie nachvollzieht und sich damit aneignet. Verändern kann mich nur, was mich wirklich ergreift, berührt, was ich selber erlebe. Erzählen erst, Erzählen allein macht das Erlebnis eines anderen ganz zu meinem eigenen.
Ja, mehr: Indem ich so hineinschlüpfe in diese fremden Erfahrungen, indem ich sie so nachvollziehe, als wären es meine eigenen, mache ich zugleich neue, nur mich betreffende Erfahrungen: Ich entdecke an mir und in mir Dinge, Einsichten, Erkenntnisse, die dem Erzählenden selbst verschlossen geblieben sind. Erzählen nimmt also nicht nur hinein in die Vergangenheit und vergegenwärtigt sie, es verändert auch den, der zuhört, und eröffnet ihm so eine neue Zukunft.
Darum ist Erzählen nicht einfach Wiedergabe tatsächlicher Ereignisse: Wer sie erzählt, verdichtet sie zugleich. In jedem Akt des Weitererzählens sammelt sich neue Erfahrung an, er verändert die Geschichte, indem er sie bereichert und vertieft. Und: Jeder weitere Erzähler fordert seine Zuhörer heraus, ebenfalls eigene Erfahrungen mit dieser Geschichte zu machen.
Erzählen bedeutet, Erfahrungen zu provozieren
Jede Erzählung ist also nicht bloß Berichterstattung von früheren Geschehnissen, sie ist zugleich auch deren Verarbeitung:
Erzählen bedeutet, Erfahrungen zu reflektieren
So entstanden die Sagen und Sagenkreise früher Gesellschaften. Sie sind durch Generationen hindurch angereicherte Erfahrungen, sie sind Dichtungen - durch Reflexion verdichtetes Erleben: Was ganze Gruppen - Familienverbände, Sippen, Volksstämme - an geschichtlichen Einsichten gewonnen haben, wird nicht einfach weitererzählt; es wird verdichtet auf beispielhafte Schicksale. Erst und gerade im scheinbar Einfachen, in der Personifizierung von gesellschaftlich gewonnener Erfahrung, wird diese nachvollziehbar und damit zum Lernstück für kommende Generationen.
Aber diese Form geschichtlicher Überlieferung beschränkt sich nicht auf frühe, vorwissenschaftliche Gesellschaften, sie ist eine grundsätzliche Möglichkeit der Kommunikation. Eine eigene Erfahrung mag dies verdeutlichen:
Zurückgekehrt von einem Besuch unterschiedlicher amerikanischer Kirchengemeinden, begann ich, das Erlebte zu erzählen - einzelne, letztlich zufällige Begebenheiten aus dem Gemeindealltag wurden als Beispiele berichtet. Bald aber setzte eine Reflexionsphase ein. Um grundsätzliche Auskünfte gebeten, die als Modell für die eigene Praxis dienen konnten, wurden die unterschiedlichen Beobachtungen zusammen-gefaßt zu abstrakten Erkenntnissen, zu theoretischen Überlegungen.
Dabei wäre es wohl geblieben, hätte nicht ein Verlag mich aufgefordert, für einen Berichtsband einen kurzen Beitrag zu schreiben, der möglichst anschaulich meine Erkenntnisse über "die" lutherische Gemeinde in den USA wiedergibt. So entstand eine Geschichte, ein in Ich-Form geschildertes Wochenende in St. Anna: eine Geschichte, die ich nie erlebt hatte, verdichtet aus vielen Einzelzügen unterschiedlicher Gemeinden - eine erfundene Handlung mit erfundenen Personen, in denen sich an verschiedenen Stellen Erlebtes widerspiegelte und konzentrierte. Und doch glaube ich: Diese erdachte Geschichte ist "wahrer" als all die vielen, die ich zunächst erzählt hatte.
Erzählen bedeutet, Erfahrungen zu komprimieren
Ganz ähnliches gilt vom Mythos: Was Menschen jeweils neu und doch oft vergleichbar erlebt haben in der Begegnung mit den Ur- gründen des Seins, mit dem Jenseitigen, was sie aber eben auch bedacht und gedeutet und verarbeitet haben, das wird in der Bildersprache einer Erzählung zur Grundlage dessen, worauf man vertrauen, wodurch man Leben deuten und begründen kann. Mythen sind erzählte Transzendenz - oder umgekehrt: Erst die Erzählung macht das religiöse Erlebnis tradierbar, eröffnet dem Einzelnen die Möglichkeit, seine eigenen, begrenzten Lebenserfahrungen zu hinterfragen und zu überschreiten:
Erzählen bedeutet, Erfahrungen zu transzendieren
Erzählen als Predigt
Ich erzähle eine Geschichte nicht deshalb, weil sie in der Bibel steht, obwohl es seinen Grund hat, daß die Bibel voll von Geschichten ist. Ich erzähle sie auch nicht, weil ich damit etwas von Gott erklären möchte. Ich erzähle sie,
weil Gott mir begegnet ist in dieser Geschichte,
weil ich darum anderen Menschen ebenso von Gott erzählen möchte, damit er auch ihnen begegnet in meiner Geschichte.
Darum erzähle ich in meiner Geschichte von mir und von dem anderen, der mir zuhört, und er wird in meiner Geschichte ebenso drin sein wie ich selbst. Und darum wird am Ende diese Geschichte seine Geschichte sein, seine ganz eigene Geschichte - so, wie meine Geschichte einmal die eines anderen gewesen ist: die von Jesus und danach die von Markus und dann die von Lukas oder Matthäus. Immer aber ist es eine Geschichte, in der Gott den Menschen begegnen will.
Ich predige ja nicht über eine Geschichte, sondern ich predige, indem ich eine Geschichte erzähle. Es läßt sich auch umgekehrt sagen: Wenn ich erzähle, dann "illustriere" ich damit nicht meine Predigt, sondern dann predige ich.
Erzählen ist also eine Form von Verkündigung, nicht die einzige, aber sie steht zumindest gleichberechtigt neben den anderen. Und es ist, wie wir sahen, eine sehr elementare Form, weil sie Erfahrungen - auch und gerade Erfahrungen mit Gott - weitervermittelt.
Eine "narrative" Predigt hat in meinen Augen darum ganz wesentliche Vorteile:
• Sie gibt ganz unmittelbar solche Erfahrungen weiter und ermöglichst es dem Zuhörenden, ebenso unmittelbar eigene Erfahrungen zu machen. Erzählung zieht ihn gleichsam hinein in das Leben und in die Deutung des Lebens. Darum ist Erzählung auch eine sachgemäße Form, Glauben zu wecken: weil Glaube auf Erfahrungen beruht und neue Erfahrungen ermöglichen will.
• Die narrative Predigt bietet so dem Zuhörer Möglichkeiten der Identifikation. Sie ist eindringlicher als jede Argumentation, aber sie läßt ihm die Freiheit, ob er sich diese fremden Erfahrungen zueigen machen will oder nicht. Sie will seine Zustimmung nicht erzwingen wie eine logische Beweiskette. Wo dagegen erzählt wird, ist der Hörer eingeladen, sich seinen eigenen Ort in der Geschichte zu suchen. Geschichten erlauben Distanz, aber sie überwinden zugleich Distanz.
• Narrative Predigten können durchaus auch verschiedene Möglichkeiten der Identifikation anbieten, statt in eine dogmatische Engführung zu verfallen: Menschen können im gleichen Geschehen durchaus unterschiedliche Erfahrungen machen. Ihnen bleibt die Freiheit, sich das an Erfahrung anzueignen, was ihrem eigenen Lebensschicksal nahekommt, was auf ihre eigenen Fragen eine Antwort bietet.
• Narrative Predigten müssen also keinen "Skopus" haben, auch wenn sie eine Sache "auf den Punkt" bringen wollen: Es ist ja allzuoft eine intellektuelle Überheblichkeit, von einem normalen (nicht akademisch trainierten) Zuhörer die Konzentration zu verlangen, einem Gedankengang über vielleicht zwanzig Minuten hinweg auf ein einziges Ziel hin zu folgen. Eine Erzählpredigt dagegen bietet viel eher eine Mehrzahl von Einsichten und erlaubt es so dem Gemeindeglied, assoziativ zu hören, das auszuwählen und mitzunehmen, was ihm jeweils bedeutsam ist.
Zu den folgenden Predigten
• Alle diese Beispiele sind nicht nach langer Reflexion und mit Blick auf eine spätere Veröffentlichung entstanden, sondern unter den Alltagsbedingungen des Pfarramtes für den Gottesdienst am kommenden Sonntag geschrieben - also unter dem üblichen Zeitdruck, aber auch unter dem Einfluß bestimmter Geschehnisse in der eigenen Gemeinde. Benutzt wurden dabei die gerade zugänglichen exegetischen Hilfsmittel, vor allem die schnell lesbaren Predigthilfen. Das alles kann im Nachhinein meist nicht mehr dokumentiert werden.
Ich kann hier nur all denen danken, die jeweils exegetische Kenntnisse geliefert und homiletische Hilfestellung gegeben - und manches Mal auch Anregungen zur narrativen Gestaltung der Predigt geboten haben. Und ich muß um Entschuldigung bitten, wenn ich die Urheber vieler übernommener Ideen nicht mehr benennen kann.
• Einige Leserinnen und Leser werden bei diesen Predigten auch kritische Einwände haben. Manches ist sicherlich exegetisch angreifbar, anderes mag theologisch nicht genügen - ganz abgesehen von der jeweils eigenen "theologischen Existenz" des Predigers. Aber darum sind diese Beispiele ja auch nicht veröffentlicht. Sie sollen nur zeigen, wie aus einer Perikope eine narrative Predigt erwachsen kann.
• Die folgende Gliederung in unterschiedliche Formen des Narrativen ist ebenfalls erst der nachträgliche Versuch einer Systematisierung. Ich will damit keine "literarischen Gattungen" einführen, sondern auf - wie ich meine - recht unterschiedliche Möglichkeiten hinweisen, erzählend zu predigen. Die Beispiele belegen selbst, daß sich diese Formen nicht schematisch eingrenzen lassen. Sie gehen immer wieder ineinander über und ergänzen sich. Ich kann zum Beispiel eine "Wirkungsgeschichte" einfach entfaltend, aber auch perspektivisch oder diskursiv erzählen.
• Unterschiedlich ist auch, wie ich mit solchen Erzählpredigten auf die Gemeinde zugehe. Teils habe ich ganz ohne jede Hinführung einfach erzählt - vor allem in der eigenen Gemeinde, die an diese Form gewöhnt war und sie oft regelrecht erwartete. Teils habe ich eine Erklärung vorweggeschickt, warum ich jetzt erzählend predigen möchte, und/oder eine Schlußbemerkung angefügt, die aus der Erzählung wieder herausführte. Das lag auch an der jeweiligen Perikope, oder daran, ob eine Lesung des Textes vorausgegangen war oder nicht.
• Zu jedem Predigtbeispiel möchte ich im Nachtrag - und auch wirklich erst "nachträglich" - Rechenschaft geben über die gewählte Form, über den Zielgedanken und dessen inhaltliche Gestaltung. Ich möchte die Leserin und den Leser dieses Buches teilhaben lassen am Werkstattgeschehen, soweit dies noch möglich ist, und damit Mut machen zu eigenen Versuchen mit dieser besonderen Form des Predigens.
1. DIE ENTFALTENDE ERZÄHLUNG
Zur Form:
Sozusagen die klassische Form des Erzählens ist, daß die Handlung von einem "allwissenden Erzähler" berichtet wird. Jenseits von Raum und Zeit des Geschehens beobachten wir, was sich abspielt, welche Gefühle die Akteure bewegen, welchen Gedanken sie nachhängen. Wir können zurückspringen in die Vergangenheit, Zukunft vorwegnehmen, Orte wechseln, Blickpunkte verändern.
Für die Predigt bedeutet das: Die biblische Geschichte mit ihrem Inhalt, mit Anfang und Ende bleibt vorgegeben.
Wir entfalten sie, gliedern sie in Szenen, beschreiben Orte und Personen. Dieses "Ausmalen" des vorhandenen Bildes ist nicht Selbstzweck, sondern soll die Hörenden hineinnehmen in das, was damals geschehen ist oder was doch von damals erzählt wird: Es soll Imagination wecken und damit Identifikation ermöglichen.
Wir vertiefen sie, indem wir die Empfindungen - Hoffnungen und Wünsche, Ängste und Nüte - aussprechen, die die Personen unserer Geschichte bewegt haben mögen. Wir nehmen an den Gedanken teil, die hinter dem ausgesprochenen Wort stehen, und machen so Konflikte, Ansichten, theologische und existentielle Fragen deutlich.
Wir deuten sie aber auch, indem wir unsere exegetischen und systematischen Überlegungen (die ja keinesfalls überflüssig geworden sind mit der Entscheidung, narrativ an einen Text heranzugehen) zurückprojizieren auf die Ebene des Geschehens: Die Erzählung selbst ist zugleich Deutung des Erzählstoffes. Wir legen also - simpel ausgedrückt - unsere Fragen und unsere Antworten den Personen der Geschichte in den Mund.
Das alles vollzieht sich in der Geschichte, und es muß damit im historischen Umfeld dieser Geschichte bleiben. Ohne daß ich jedes einzelne Detail forschungsgeschichtlich absichern muß (unsere Predigtgemeinde erwartet schließlich keinen Fachvortrag über archäologische oder historische Befunde) - genauere Kenntnis dieses geschichtlichen Umfeldes sind notwendige Voraussetzung für das Erzählen.
Der "garstige Graben" zwischen damals und heute muß und kann innerhalb der Geschichte überbrückt werden; denn das ist ja gerade der Sinn des Narrativen: den unmittelbaren Zugang zurückzugewinnen, die Erfahrung anderer zu meiner eigenen zu machen.
Beispiel 1: Matthäus 13, 44 - 46
Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
Wie an jedem Abend haben sich die Männer auf dem Dorfplatz zusammengefunden, während die Sonne langsam hinter den Bergen Galiläas versinkt. Sie hocken in einer großen Runde auf dem Boden, sprechen über dieses und jenes - all die kleinen Ereignisse des Tages - schweigen dann wieder und beobachten, wie die Schatten der Feigenbäume länger werden.
Eben hatte Jizchak, der alte Schuster, davon erzählt, daß unten am See in Kapernaum ein Kaufmann mit einer besonders wertvollen Perle vom Basar in Bagdad zurückgekehrt war. So sprechen sie eine Weile vom unverhofften Reichtum, von geheimnisvollen Schätzen, bis Josafat, ein Kleinbauer, sie unterbricht: "Ihr könnt alle nur träumen," sagt er abschätzig. "Aber - nicht wahr, unser Leben sieht anders aus: Den ganzen Tag habe ich auf dem Feld gearbeitet, mir Schwielen geholt unter der heißen Sonne. Stein für Stein habe ich wieder zur Seite geräumt, damit der Pflug überhaupt durch den harten Boden gehen kann. Das sind die Schätze, die wir finden! Und die finden wir Tag für Tag - mehr, als uns lieb ist."
"Du hast recht, Freund!" Aus dem Schatten des Feigenbaumes ist ein Mann hervorgetreten. Sie kennen ihn nicht. Er sieht aus wie einer jener Rabbis, die mit ihren Schülern gelegentlich durchs Land ziehen und predigen. Er saß dort mit seinen Freunden und hatte ihnen zugehört. Nun ist er aufgestanden und setzt sich zu ihnen. "Du hast recht, Freund," wiederholt er. "Der Acker ist oft steinig und hart. Er ist ein gutes Bild für unser Leben: Viele mühen sich ab, aber sie werden nur enttäuscht."
"Richtig," sagt ein Bauer in einem braunen Wollrock. "Die ganze Welt kommt mir manchmal vor wie solch ein Acker. Jeden Morgen beginnst du dein Tagwerk, du tust deine Pflicht nach den guten Geboten des Ewigen - gelobt sei sein Name! - aber was bringt es dir ein? Irgendwann kommt der Abend, und du bist müde geworden, alt und verbraucht und einsam. Und dann fragst du dich: Wozu nur all diese Plage? Was habe ich schon erreicht im Leben? Wofür überhaupt leben, wenn es doch nur auf das Ende, das Abschiednehmen zugeht..." Seine Stimme war leise geworden. Nun verstummt sie ganz. Auch die anderen schweigen. Der Rabbi hat sie nachdenklich gemacht.
"Die ganze Welt ist wie solch ein Acker," nimmt schließlich der alte Jizchak den Faden wieder auf. "Du säst und pflanzt, aber was geht schon auf und bringt Frucht? Der Acker ist ungerecht - wie diese Welt." Der fremde Wanderprediger blickt den Sprecher an und nickt ihm zu, daß er weiterrede. Da fährt er fort: "Seht ihr, als ich jung war, da habe ich mich aufgelehnt gegen die Ungerechtigkeit: Ich war in den Bergen beim Widerstand gegen die Römer. Aber das ist lange her. Und was hat es gebracht? Die Mächtigen sind an der Macht geblieben - wie immer. Wir aber hatten von Gottes Reich geträumt, von Gerechtigkeit auf Erden. Wir wollten den Acker umpflügen und der Erde ein neues Antlitz geben. Er ist voller Steine geblieben."
"Aber du hattest ein Ziel, eine Hoffnung," sagt ein junger Mann. "Ja," antwortet der Alte, "aber sie ist längst vergessen. Was läßt sich schon ändern! Wenn man so oft enttäuscht wird, dann verliert man die Hoffnung - und den Glauben. Und es bleiben nur die Steine auf dem Acker deines Lebens. Es bleibt der Alltag mit seiner Mühe, es bleibt der Schmerz und das Leid... Ja, so ist es mit dem Acker des Lebens." - Und wieder liegt Schweigen über der Runde. Da ergreift auf einmal der Rabbi das Wort. "Ich will euch eine Geschichte erzählen," beginnt er, "eine Geschichte vom Acker, der ein Bild des Lebens ist:
Da lebt in einem Nachbardorf ein Mann. Er ist Tagelöhner, und ihr wißt, was das bedeutet. Er besitzt noch nicht einmal den Boden, den er bearbeitet - so wie du es doch von dir sagen kannst, Josafat. Was hat er schon für eine Chance im Leben! Eines Tages nun kommt ein Fremder ins Dorf und sucht nach einem Arbeiter. Er sieht den Tagelöhner auf dem Platz am Brunnen sitzen und gibt ihm einen Auftrag: „Ich habe da ein Stück Land geerbt, draußen bei den beiden Eichen. Das möchte ich gerne wieder herrichten lassen als Ackerland. Vielleicht läßt es sich dann besser verkaufen.“
Der Tagelöhner nickt. Er kennt das Stück: Nichts als Disteln und Dorngestrüpp wächst dort. Aber er macht sich an die Arbeit, reißt die Dornen heraus und verbrennt sie, und dann beginnt er den Boden umzupflügen. Bei der sechsten oder siebenten Furche stößt sein Pflug gegen etwas Hartes, knirscht über Widerstand hinweg. „Wieder einer von diesen verdammten Steinen,“ denkt er bloß. Aber als er wendet und an die Stelle zurückkommt, da spiegelt etwas das Licht der Sonne zurück: Ein glasierter Tonscherben liegt vor ihm. Neugierig schaut er näher hin, und da sieht er es: Ein großer Krug steckt dort im Boden; und da, wo die Pflugschar den Hals zerbrochen hat, leuchtet es metallen aus der dunklen Höhlung: Silberstücke! Hundert, hundertzwanzig vielleicht und noch mehr.
Blitzschnell durchfährt es ihn: Wem dieser Acker gehört, der ist ein reicher Mann, der besitzt einen Schatz, ein Vermögen! Mitten zwischen den Steinen des Ackers liegt er. „Wie oft mag hier schon jemand gepflügt haben,“ denkt er, „ohne etwas davon zu ahnen - so wie ich. Aber nun ist er sichtbar. Ich habe ihn entdeckt.“ Er schaut sich um, er bückt sich. Rasch scharren seine Hände den Boden über die Öffnung: „Ein Schatz im Acker, und niemand weiß es."
Der Rabbi macht eine Pause. Seine Jünger blicken sich an: Ja, das ist wieder einmal eine seiner Geschichten, die er da so plötzlich herbeizaubert. Ob die Leute merken, was er damit sagen will?
Der alte Jizchak schaut nachdenklich auf den Lehmboden zu seinen Füßen: "Du willst also behaupten, Meister, daß es wirklich Schätze gibt im Acker unseres Lebens - und daß wir sie nur nicht entdecken?" Der Rabbi lächelt, aber er antwortet nicht. "Mitten zwischen den Steinen, die uns Tag für Tag das Leben schwermachen; mitten auf dem Acker, den wir Tag für Tag bestellen und der uns nichts Neues, nichts Besonderes mehr schenken kann; mitten in unserm Alltag mit seiner Mühe, seinen Enttäuschungen, seinem Leid - sollen wir... das Unerwartete finden?" Jizchak schüttelt zweifelnd den Kopf.
Der Bauer im braunen Rock ist aufgestanden und geht auf und ab, als wollte er seinen Gedanken nachlaufen: "Das große Geheimnis Gottes - es ist in unserem eigenen Leben verborgen? Seine Liebe - wir können sie in unserem Alltag, ja sogar in unserem Leiden, unseren ungelösten Fragen entdecken? ER ist uns... so nahe, daß er uns auch in Schmerz und Tod nahe ist - willst du das sagen?"
Auch der junge Mann springt nun auf: "Also gibt es eine Hoffnung auf eine gerechtere Welt - gibt es ein Ziel für unser Leben?" Noch immer schweigt der Rabbi. "Ich beginne zu begreifen," sagt nun Josafat leise. "Gott ist da, aber wir sehen ihn nicht. Wir zögern, wir wagen es nicht, den Schatz zu heben. Wieviel Vertrauen könnten wir haben, wieviel Liebe - wenn wir wirklich ernst damit machen würden! Dann wären unsere Träume doch keine Träume - wir könnten wieder hoffen auf... das Leben. Nicht nur im Sterben, aber auch da. Gottes Gabe, dieser Schatz, ist größer als alles, was wir selber zusammenbringen an Leistung. Und doch gehört er uns! Und wir könnten selber leben... Leben bringen, andern... vielleicht..." Er gerät ins Stocken. Er schaut den Fremden an, der diese merkwürdige Geschichte erzählt hat, fragend und doch zugleich immer sicherer. Der läßt ihm Zeit, ihm und den anderen. Dann streckt er die Hand aus.
"Seht, meine Geschichte ist noch nicht zuende. Laßt mich erzählen: Der Tagelöhner läuft zurück ins Dorf, in seine armselige Hütte. Er zerrt die Ziege aus dem Stall, steckt die Hühner in einen Korb und läuft auf den Markt. „Was gebt ihr dafür,“ ruft er. „Ich will es verkaufen!“ Verstört eilt seine Frau ihm nach: „Was tust du,“ ruft sie. Aber er läßt sich nicht beirren. „Rasch, hol auch die Schlafmatten, die Töpfe! Verkaufe alles!“ Sie zögert. Doch sie sieht, wie seine Augen leuchten vor Freude. Da gehorcht sie. Dann ist alles verkauft. Er eilt ins Gasthaus, trifft auf den Fremden, der ihm den Auftrag gegeben hat: „Du wolltest den Acker doch verkaufen,“ fragt er. „Ich könnte ihn gebrauchen. Hier - soviel könnte ich dir geben.“ Erstaunt blickt der Fremde auf das Geld. Ein guter Preis, denkt er. Er hält die Hand hin, und der andere schlägt ein. Nun ist der Acker sein Eigentum. Der Acker - und der Schatz darin."
Der alte Jizchak lächelt verschmitzt: "Ganz schön schlau, dieser Mann in deiner Geschichte. Aber es war doch ein Risiko."
Da fällt ihm Josafat ins Wort: "Ja, er war klug. Aber er wußte, was er tat. Dieser Schatz war es wert. - Ein solcher Schatz ist es allemal wert," fügt er leise hinzu. "Nicht wahr, Meister, das meinst du doch? Wenn wir Gott entdecken - da, wo wir ihn gar nicht erwarten, mitten in unserem Alltag; wenn wir plötzlich eine Hoffnung spüren, die uns durchdringt - dann wird alles andere unwichtig. Der Tagelöhner konnte von diesem Schatz leben - ja, er konnte abgeben, seine Freude teilen. So ist es doch: Plötzlich ist mein Leben etwas wert. Nein - nicht ich habe ihm diesen Wert gegeben, sondern er ist ein Geschenk. - Das ist stärker als alle Enttäuschungen, als meine Verzweiflung. Plötzlich gibt es eine Hoffnung: Wir können etwas ändern, auch in dieser Welt, denn der Schatz und der Acker... Gott und die Welt gehören zusammen. Gott gehört in unsere Welt."
Er hält einen Augenblick inne, selbst erstaunt über das, was er sagt. Doch dann fährt er fort: "Die Steine im Acker bleiben, und der Boden bleibt oft hart. Das ist wahr. Aber es gibt da nun etwas, was mir Mut machen kann. Das habe ich verstanden: Ich kann mich offenhalten für das Unerwartete, und das ist kein Traum. Ich kann sogar mittun bei dem, was erst noch Hoffnung ist. Willst du das sagen, Meister? Wir haben Gott nicht. Aber wir können ihn immer neu entdecken - denn er ist uns ganz nahe."
Der Rabbi ist aufgestanden. "Ich habe euch nur eine Geschichte erzählt," sagt er. "Aber ihr habt recht: Es ist eine Geschichte von Gott. Nun ist es nicht mehr meine, sondern eure Geschichte. Und das ist gut." Er wendet sich. Er geht. Aber sie sind nun nicht mehr allein.
Kommentar
Die Perikope besteht aus zwei gleichsam in Telegrammstil formulierten Gleichnissen ähnlichen Inhalts: Um einen glücklichen Fund in Besitz zu bekommen, muß das vorhandene Eigentum verkauft werden. Ich habe drei wichtige Vorentscheidungen getroffen:
1. Diese knappe Angabe muß in eine echte Geschichte zurückverwandelt werden: Ich versetze mich dafür in die Zeit Jesu zurück, um ein Szenario zu entwickeln, so wie es Jesus sicherlich ähnlich geschaffen hätte, damit seine Erzählung das erforderliche Interesse und die nötige Spannung erzeugt, um als Gleichnis zu dienen.
2. Ich kann nur eine Geschichte entfaltend erzählen, muß also ein Gleichnis auswählen. Ich entscheide mich für das erste.
3. Ich muß in meiner Erzählpredigt Jesus für seine Geschichte eine Ausgangssituation, einen Anknüpfungspunkt schaffen, auf die hin er erzählen kann. Ich muß mich also auf die Suche nach einem "Sitz im Leben" machen.
Aus diesen vorab getroffenen Entscheidungen ergeben sich folgende Konsequenzen:
1. Auf der Suche nach einem Anknüpfungspunkt prüfe ich das Bildmaterial des Gleichnisses: Der Acker als Lebensgrundlage der bäuerlichen Gesellschaft Palästinas kann zum Bild für das Leben überhaupt werden. Er ist Symbol der Erwartungen und Hoffnungen des Menschen im Warten auf das Aufgehen der Saat und das Reifen der Ernte. Er ist zugleich Symbol für alle Mühe und Anstrengung ("Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen"), aber auch für Enttäuschung und Resignation ("Dornen und Disteln soll er dir tragen"). Da es um den im Boden verborgenen Schatz geht, wähle ich als Gegenbild die Steine, die in vielen Äckern Palästinas in großer Zahl zu finden sind, oft dicht unter dem dünnen Mutterboden.
2. Ich muß weiterhin einen Zuhörerkreis schaffen, der die damaligen Erwartungen und Enttäuschungen artikuliert und somit die Frage nach der kommenden Herrschaft Gottes stellt, auf die Jesus mit seinem Gleichnis antwortet.
3. Schließlich muß diese historische Situation transparent werden für den heutigen Menschen, der ja eben nicht in Hoffnung auf den Messias und die lebt, wohl aber nach Gerechtigkeit, Frieden und Lebenssinn fragt und der ähnliche Enttäuschungen kennt. Erst dann wird ja aus einer Erzählung auch eine Erzählpredigt.
So entwickelt sich meine Geschichte: Repräsentanten unterschiedlicher Lebenshaltungen benutzen und entfalten das vorgegebene Bild des steinigen Ackers als "Acker des Lebens", und an dieses Bild knüpft Jesus an, um seine Hörer langsam zu einer neuen und überraschenden Erkenntnis zu führen. Indem sie Zweifel äußern, hellhörig und nachdenklich werden und letztlich selbst die Schlußfolgerung aus der Gleichniserzählung ziehen, können sich meine Predigthörer mit ihnen identifizieren und ihren Weg zu einer neuen Einsicht mitgehen. Wenn ich es recht erinnere, hat für die Ausgestaltung der Gleichniserzählung Jürgen Seim Pate gestanden, auf dessen Band ich gerne und empfehlend hinweise. (Seim, Jürgen: Die große Entdeckung. Geschichten von Jesus, Göttingen 1980)
Beispiel 2: 1. Mose 3, 1 - 19 (in Auszügen)
Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß? Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.
Es war ein Garten voller Blütenduft. Ringsum wuchsen Früchte und Beeren an Bäumen und Sträuchern. Sonnenlicht flutete hindurch, reine Luft lud zum Atmen ein. Aus einer Quelle sprudelte kristallklares Wasser. Zwischen den Zweigen bewegten sich zwei Menschen, ein Mann und eine Frau. Mit leichter Hand schlug der Mann die Hacke in den weichen Boden, lockerte die Erde zwischen den Büschen, an denen leuchtende Trauben hingen. Er pfiff leise vor sich hin. Die Frau lachte und winkte ihm zu. Sie trug lange Blätter in ihrem Arm, um daraus eine Matte zu flechten.
"Es ist schön in unserer Welt," sagte sie und schaute einem bunten Vogel zu, der sein Gefieder putzte. "Ja," antwortete der Mann, "wir haben alles, was wir brauchen zum Leben. Und wir haben uns gegenseitig. Es ist wunderbar. ER hat alles wunderbar gemacht." Die Frau nickte: "Er hat uns alles gemacht, was wir brauchen. Er ist uns gut."
Es schien, als ob die beiden von Gott sprachen. Aber sie nannten ihn nicht so, sie nannten ihn einfach mit seinem Namen: "Jahwe" sagten sie, und sie redeten ganz ohne Furcht von ihm, ganz ohne Abstand - wie von einem guten Freund. Sie kannten ihn ja. Er hatte ihnen dieses blühende Land überlassen, und sie hatten sich dort eingerichtet. Sie hatten sich ein Dach gegen den Regen gebaut, sie hatten die Bäume und Büsche gepflegt und ihre Früchte geerntet. Sie schöpften das klare Wasser aus der Quelle gegen ihren Durst; und abends, wenn die Dämmerung den Himmel buntfärbte, gingen sie Hand in Hand durch den lichten Wald, der ihnen gehörte: lachten, sangen, tanzten, bis die Sonne unterging. Sie hatten keine Angst, wenn sie sich zur Ruhe legten - ER war ja ihr Freund. Sie empfanden keine Sorge, wenn sie an die kommenden Tage dachten: Das Land brachte ja reichlich Früchte hervor.
Sie hatten auch keine Angst voreinander: Sie sprachen miteinander über alles, was sie bewegte. Sie brauchten keine Geheimnisse zu haben voreinander. Sie freuten sich gemeinsam an dem, was sie miteinander geschaffen hatten. Sie berühren sich ohne Erschrecken, denn sie waren sich vertraut - ganz und gar.
Die Frau hatte die Blätter zu ihrer Hütte getragen. Nun ging sie zum Bach hinunter. Ihre Finger glitten zärtlich über die Rinden der Bäume, dann streifte sie ein paar Beeren von dem Zweig, der sich ihr entgegenstreckte. Die Frau sang leise, erfand eine eigene Melodie. Plötzlich blieb sie stehen. Dort, am Ufer, stand ein Baum. An seinen Ästen hingen gelbbraune Früchte. "Das ist Jahwes Baum," sagte die Frau zu den Vögeln, die sich auf den Zweigen sonnten. Es klang fast ein wenig vorwurfsvoll. Die Vögel rührten sich nicht. Die Frau trat näher heran. Zum ersten Mal betrachtete sie den Baum. Wie oft war sie hier schon vorübergegangen, ohne ihn zu beachten. Merkwürdig, dachte sie, ich habe ihn noch nie richtig angesehen. Aber es war ja auch Jahwes Baum.
"Ihr habt überall Nahrung genug," hatte Jahwe zu ihnen gesagt, damals. "Diesen einen Baum laßt unberührt. Es ist nicht gut für euch, von seinen Früchten zu essen. Laßt sie hängen. Es ist mein Baum." So hatte er geredet, freundlich wie immer. Die Frau erinnerte sich ganz deutlich an jenen Tag, an dem sie mitten in diesem Garten erwachte. Kein Zaun umgab den Baum, kein Schild war aufgestellt. Wozu auch? Er hatte es ihnen ja gesagt.
Nur sein Wort stand zwischen der Frau und den Früchten. Nur sein Vertrauen. War das nicht genug? Warum sollte er den beiden ein Stück ihrer Freiheit nehmen, wenn er es ihnen doch sagen konnte: "Das ist mein Baum." Nein, Jahwe hegte kein Mißtrauen gegenüber den beiden Menschen - er war ihr Freund, er war für sie da, all die vielen Bäume und Büsche in dem großen Garten hatte er ihnen geschenkt, warum sollt ein einziger davon nicht auch für ihn sein?
Die Frau strich vorsichtig mit der Hand über den Stamm: Glatt und fest fühlte er sich an. "Das ist Jahwes Baum," sagte sie noch einmal. Dachte sie dabei an die Vögel, oder sagte sie es nur so? Ein Sonnenstrahl fiel auf eine der Früchte, ganz dicht vor ihren Augen. Schön sieht sie aus, dachte die Frau. Ganz leicht berührte sie die gelbe Schale. Dann umspannten ihre Finger die Frucht. Warum hat er gerade diesen Baum für sich behalten, dachte sie. "Er ist doch unser Freund, er hat uns doch so viel geschenkt!" Sie sagte es so laut, als wollte sie es selber hören, wie sie ihm vertraute. Aber sie ließ die Frucht nicht los.
"Warum soll dieses kleine Ding nicht gut für uns sein? Wir haben ja noch garnicht davon probiert. Wir können es ja garnicht wissen." Die Frau blickte sich erschrocken um: Es war, als ob eine andere Stimme neben ihr so sprach. Aber da war niemand, nur ein Tier raschelte im Gras. Plötzlich zuckte ihr Arm ein wenig, und die Frucht lag leicht und frei in ihrer Hand. Da lief sie den Weg zurück, dorthin, wo der Mann vor der Hütte saß. "Schau, was ich habe," rief sie schon von weitem. "Ist das nicht von Jahwes Baum?" fragte er erstaunt. "Hat er es dir geschenkt?"
"Nein." Sie sagte es jetzt ganz atemlos, und das lag nicht daran, daß sie eben gelaufen war. "Nein. Ich habe sie genommen. Es ist doch unser Garten, nicht wahr? Wie sollen wir hier leben, wenn wir nicht selber entscheiden dürfen, was wir essen können." Der Mann hatte aufmerksam zugehört. Er nahm die Frucht in die Hand und betrachtete sie. "Aber Jahwe ist unser Freund," sagte er. "Er vertraut uns."
"Mag sein," antwortete sie. "Ich jedenfalls will wissen, ob dieses Ding gut oder schlecht ist. Ich will mich nicht immer nur auf einen andern verlassen. Wir können das auch allein bestimmen. Dazu brauchen wir keinen Freund." Und sie nahm die Frucht und biß hinein, und dann gab sie sie dem Mann, und er machte es ebenso. Während er aß, blickte er die Frau an: Merkwürdig, dachte er, habe ich das vorher denn noch nie bemerkt? Sie schaut mich so kühl an, so abschätzend. Und plötzlich lief ein Frösteln über seinen Körper: Sie hat die Freundschaft Jahwes ausgeschlagen - wie lange wird sie dann noch zu mir halten? Noch nie hatte er so etwas gedacht. Aber jetzt war sie auf einmal so anders - oder war er es selbst? Ich will in die Hütte gehen, dachte er. Ich will mir den besten Platz aussuchen. Ich muß mehr an mich selber denken.
Die Frau blickte ihm nach: Er hat gar nicht begriffen, was ich wirklich gewollt habe. Früher hatten wir einander doch immer gleich verstanden. Er ist auf einmal anders als sonst. Er ist so fremd - oder bin ich es selbst? Der Mann lag in der Hütte, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Sie hat damit angefangen, dachte er. Eigentlich ist es ihre Schuld. Ja, das werde ich sagen, wenn mich einer danach fragt. Da hörte er Schritte im Garten. Erschrocken sprang er auf und lief auf das Gebüsch zu. Er duckte sich unter die Zweige.
"Warum versteckst du dich?" Es war Jahwes Stimme, ruhig und freundlich wie immer. "Hast du kein Vertrauen mehr?" - "Ich habe Angst," sagte der Mann. "Angst?" fragte Jahwe. "Was traust du mir zu?" - Auf einmal war Jahwes Stimme ganz traurig. Der Mann spürte es ganz deutlich, auch wenn er ihn nicht sah. "Du hast dich also anders entschieden."
"Sie war es," sagte der Mann. "Nein. Ihr wart es beide," antwortete die Stimme. "Ihr wollt also ohne mich leben. Ich werde euch nicht daran hindern. Ohne Vertrauen mag ich nicht bei euch sein." Und dann verhallten Jahwes Schritte langsam im Garten.
Noch nie war ihnen die Nacht so kalt vorgekommen. Wie frierend standen der Mann und die Frau neben der Hütte. "Wir werden es schon schaffen," sagte er zu ihr und griff nach seiner Hacke. Aber der Boden war hart, als wäre er gefroren. Er schlug zu, immer und immer wieder. Angst überkam ihn: Ich muß für Nahrung sorgen, einen Vorrat anlegen, dachte er. Ich muß die Hütte abdichten, damit die Kälte draußen bleibt, dachte er. "Wir werden es schon schaffen," sagte er noch einmal, während der Schweiß von seiner Stirn perlte. Die Frau sagte nichts. Sie hatte die Lippen fest aufeinandergebissen und preßte die Hände gegen den Leib. Auf einmal fühlte sie sich sehr einsam. War das erst heute morgen gewesen, als sie noch singend zum Bach hinunterging
Ihr habt euch entschieden, hatte Jahwe gesagt. Jetzt waren sie also allein. Und jetzt hatten sie auch Angst - vor den kommenden Tagen, und vor einander. Aber sie hatten ihr Schicksal ganz in die eigene Hand genommen. Jetzt war der Garten erst ganz ihr Eigentum. Aber er war ihr auf einmal fremd geworden - wie Gott, zu dem sie einmal freundschaftlich und vertrauensvoll "Jahwe" gesagt hatte - und wie der Mann neben ihr.
"Ob er wohl jemals wieder ganz mein Freund wird, dem ich mich anvertrauen kann?" sagte sie leise vor sich hin. Und man wußte nicht recht: Meinte sie nun den anderen Menschen neben sich - oder jenen Gott, den es einmal gab in ihrer Welt, ganz nah und ganz vertraut?
Ich habe nur eine Geschichte erzählt. Natürlich ist so etwas nie passiert, irgendwann einmal in grauer Vorzeit. Und doch kann diese Geschichte immer wieder wahr werden, denn es ist eine Geschichte über den Menschen und über seine Entscheidung. Und so bleibt die Frage immer wieder offen: Wie mag unsere eigene Geschichte einmal erzählt werden?
Kommentar
Genesis 3 ist eine mythische Erzählung. Sie reflektiert in Bildersprache die Herkunft des Bösen in der Welt, die Entstehung von Schuld und Entfremdung. Sie ist zugleich, das hat Gerhard von Rad in seinem Genesiskommentar gezeigt, als Teil des jahwistischen Erzählwerkes eine hochrationale Erzählung, die religiöse Ur-Einsichten mit anthropologischen Kenntnissen verbindet.
Der Verlust des Vertrauens in den freundschaftlich-liebenden Gott und der Anspruch des Menschen auf Selbstbestimmung mit seinen verheerenden Folgen auch für das menschliche Miteinander sind die eigentlichen Themen der Erzählung.
Von daher stellt sich die Frage: Darf man eine so meisterhaft hintergründige Geschichte zerreden durch Erklärungen oder Ermahnungen? Zugleich aber: Kann man diese Geschichte überhaupt neu und entfaltend nacherzählen, ohne daß ihre wunderbare Ver-Dichtung zerstört wird?
Ich habe deshalb versucht, sie in ihrer zeitlos-schwebenden Gültigkeit zu belassen und das vorhandene Material behutsam zu deuten für den heutigen Menschen: Das Paradies soll nicht zu einem unvorstellbaren Dasein werden, zu einem jenseits der Wirklichkeit liegenden Land: Es ist unsere Welt unter dem Aspekt der Gottesnähe und des Gottvertrauens. Vertreibung aus dem Paradies ist Verwandlung und Zerstörung unserer Welt durch unseren Verzicht auf Gott. Dafür bedarf es keines Engels, der das Tor mit dem Schwert bewacht.
Daß meine Geschichte "psychologisiert", etwa indem das Wort der Schlange zum denkbaren Gedanken des Menschen wird, folgt der Tendenz des Jahwisten. Damit wird der eigentliche "Sündenfall" zu einem inneren Ereignis ebenso wie seine Folgen ebendort - im Selbstverständnis des Menschen, und dann erst auch in seinem Verhältnis zu Mitmensch und Natur.
Das wollte ich erzählen: als "Mythos" - als bildhaft erlebbares Ur-Bild menschlicher Existenz unter Aufnahme der Bildelemente von Gen. 3, als Geschichte von Gottesnähe und Gottesferne: Das "Paradiesische" am Garten Eden sollte so geschildert werden, daß seine Grundlage - das ungestörte Vertrauen in den Schöpfer - erkennbar wird. Die - falschverstandene, weil gegen Gott gerichtete - "Selbstverwirklichung" des Menschen wollte ich nachvollziehbar aufzeigen als Anfrage an uns heute, indem ich den inneren Prozeß der Entfremdung von sich selbst und voneinander behutsam nachmale, aber auch das dadurch veränderte Verhältnis zur uns umgebenden Natur - ohne die "mythische" Form der Geschichte zu zerstören. Daß Gott nicht zürnt, sondern trauert - und damit auf unsere Umkehr wartet, aus der selbstherrlichen zurück in die vertrauensvolle Freiheit - sollte als Botschaft weitergegeben werden.
Beispiel 3: Lukas 17, 11 - 19
Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern! Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen.
"Mutter, Mutter, komm rasch!" Der kleine Daniel stürzt aufgeregt ins Haus. Atemlos stößt er hervor: "Vater ist im Dorf! Er kommt nach Hause!" Kopfschüttelnd blickt die Frau den aufgeregten Jungen an, ein trauriges Lächeln steht auf ihren Lippen: "Ach, Dan, du träumst mal wieder! Vater darf nicht ins Dorf. Wie oft habe ich dir das schon erklärt: Er ist krank. Niemand darf ihn berühren."
"Aber er kommt wirklich; ich habs doch gesehen! Er ist nicht mehr krank!" Die Mutter will etwas erwidern, da wird es plötzlich laut auf der Straße. Stimmengewirr kommt näher, freudige Rufe. Und immer wieder klingt ein Name hindurch: "Jona," rufen sie, "willkommen! Hallo Jona! Jona ist gesund!
Die Frau ist an die Tür getreten, zitternd lehnt sie sich gegen die Wand. Es ist nicht wahr, denkt sie. Ich habe ihn doch gesehen, oft genug - von weitem, wenn ich ihm Essen hinaustrug und an den Wegrand stellte. Ich habe seine Hände gesehen, sein Gesicht. Nein, das geht nicht fort - nicht von heute auf morgen. Vielleicht nie mehr.
Aber da steht er plötzlich vor ihr, ihr Mann, faßt sie zärtlich mit beiden Händen an den Schultern, drückt sie an sich. Ja: Es sind seine Hände, und sie sind gesund. Es ist sein Gesicht, das sie strahlend anlacht - ohne diese aufgequollenen Stellen. Tränen treten ihr in die Augen. "Jona!" Sie flüstert es nur. "Ja, ich bins wirklich! Gesund und munter, Gott sein Dank! Ich bin so froh, wieder bei euch zu sein - froh und dankbar. Jetzt kann ich es ja sagen, wie sehr ich euch vermißt habe: dich und den Jungen. Aber nun bin ich gesund. Nun ist alles vorbei - dieses Leben da draußen, ausgestoßen wie ein Tier." Seine Hand fährt durch die Luft, als wollte sie etwas beiseite schieben: "Vergessen wirs!"
Er sieht ihren fragenden Blick: "Denk dir nur, der Rabbi aus Nazareth hat uns geholfen. Ein großer Rabbi! Ein guter Rabbi! Gott möge es ihm lohnen." Er sieht sich um: "Mein Gott, wie lange war ich fort! Wieviel ist hier in Ordnung zu bringen! Aber nun kann ich wieder für euch sorgen, für dich - und für unseren Dan. Das ist das schönste!"
Ein Mann ist heimgekommen, von schwerer Krankheit genesen. Glücklich kehrt er zu seiner Familie zurück, glücklich, wieder unter Freunden und Nachbarn zu sein. Voller Tatendrang macht er sich daran, das Liegengebliebene in Angriff zu nehmen, dieses neugeschenkte Leben sinnvoll auszunutzen, seine Pflichten zu erfüllen in seiner kleinen Welt. Er will nicht bestaunt werden, er will wieder leben wie früher. Er weiß, was Gesundheit wert ist.
Ist er undankbar? Denkt er nur an sich? Nimmt er das Geschenk, wieder gesund zu sein, ungerührt entgegen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß so etwas geschehen könnte, daß auch nur einer von den zehn Aussätzigen nicht dankbar und fröhlich heimgegangen ist. War es nicht ganz natürlich, was sie wohl alle getan haben, nachdem sie gesund geworden waren - alle neun?
Aber es gab da noch einen, der tat etwas anderes: Er war mit ihnen fortgegangen, den Gefährten seines Elends. Voller Hoffnung, voller Erwartung hat er sich auf den Weg gemacht, weil der Rabbi aus Nazareth es gesagt hatte - genau wie sie alle. Und dann entdeckten sie plötzlich, daß sie gesund waren. Glücklich fielen sie sich in die Arme, lachten und weinten. Sie begannen zu laufen, hastig und atemlos, um ihre Haut dem Priester zu zeigen nach den Vorschriften, um endlich dieses Leben abzuschütteln, das doch kein Leben war.
Zuerst ist er mitgelaufen. Aber dann werden seine Schritte langsamer. Nun ist er stehengeblieben. Die freudige Aufregung der anderen verklingt in der Ferne. Er hat es nicht mehr eilig. Er muß plötzlich nachdenken. Er betrachtet seine Hände, seinen Körper: Es ist wie - ja, wie ein neues Wesen, denkt er. Seltsam: Was die Menschen sonst nur in den uralten Bildern vom Werden und Entstehen der Welt weitererzählen über das Leben, was sie erzählen vom Grund und Ziel dieser Welt - man kann es selbst erfahren. Ich bin ihm doch begegnet, diesem Grund der Welt, den wir Gott nennen. Ich bin ihm begegnet - jetzt, hier: auf jenem Acker dort am Weg.
Erschrocken hält er inne. Was ist schon geschehen, sagt die Stimme des Zweifels in ihm. Du bist gesund geworden von einer schlimmen Krankheit - das ist schön; das ist überraschend und wunderbar. Du kannst froh sein, sicher. Aber es kann doch geschehen. Allen ist es geschehen, allen zehn - und anderen vorher auch. Doch er schüttelt seine Zweifel ab. Seine Gedanken kommen nicht davon los, von diesem einen: Ich bin gesund geworden, ja. Es war nichts, was andere nicht auch erleben können, ja. Aber - es ist doch ein Zeichen des Lebens, des wirklichen Lebens, das hinter allem steht. Es erfüllt ihn auf einmal mit grenzenlosem Staunen.
Mit zitternder Freude steht er da, irgendwo auf dem Weg ins Dorf. Ich bin dieser unendlichen Güte begegnet, die alles trägt, was ist, der wir alles verdanken. Ich habe erfahren, daß sie Wirklichkeit ist! Mein Leben - es ist nicht leer, nicht sinnlos, nicht trostlos, nicht ziellos. Es hat einen Grund.