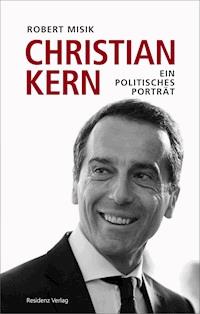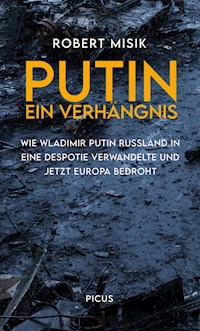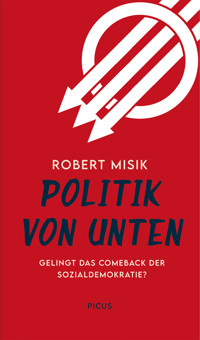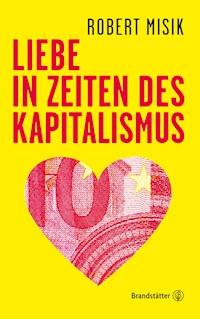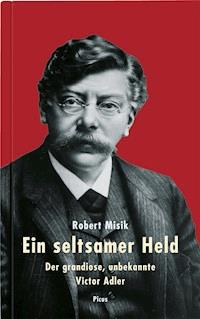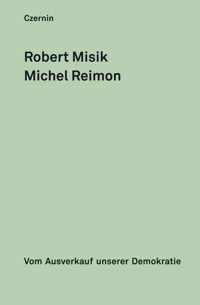7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob Auto, Sonnenbrille, Sportschuh oder MP3-Player – wir erwerben Güter heute längst nicht mehr ihres Gebrauchswerts wegen, sondern weil sie einen Lifestyle verkörpern. Güter repräsentieren Identität. Und die Güter, die darin besonders gut sind, werden „Kult“. Das Spiel mit den Zeichen, früher allein in der Kunstwelt dominant, ist heute auch für die Wirtschaftswelt entscheidend. Robert Misik zeigt, dass die allseits beklagte „Ökonomisierung der Kultur“ und die „Totalkulturalisierung der Ökonomie“ zwei Seiten einer Medaille sind. Die Wirtschaft investiert immer mehr Gefühle und Affekte in die Produktion von Bedürfnissen und Waren. Virtuelle Welten („Second Life“) werden zu Kommerzschlagern. Künstlertugenden ziehen ins Wirtschaftsleben ein („Sei kreativ!“), die Wirtschaft wird kulturalisiert und moralisiert („Fair Trade“). Last but not least ist auch der „Kampf der Kulturen“ ohne den globalisierten westlichen Way of Life nicht zu verstehen. Robert Misik beschreibt, was es mit dem Kulturkapitalismus auf sich hat. Und was der mündige Konsument tun kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Robert Misik
Alles Ware
Glanz und Elend der Kommerzkultur
Impressum
Mit 20 Abbildungen
ISBN 978-3-8412-0059-4
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel»Das Kult-Buch« bei Aufbau
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigungund Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das giltinsbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitungin elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachenz.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung und Illustration© capa, Anke Fesel
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsübersicht
Vorwort
1. Kulturkapitalismus
2. Was ist Shopping?
3. Theorie der Shopping Mall
4. Künstler sollst Du sein!
5. Re-Branding of a Nation
6. Retro-Chic
7. »Gute Geschäfte«
8. Oberchic und Unterchic
9. Die Norm und die Anderen
Schluss: »Was soll ich tun?«
Anmerkungen
Bildnachweis
Vorwort
Konsumkritik – aber richtig!
Unter den bezaubernden Kindergeschichten vom kleinen Nick, die der legendäre französische Autor René Goscinny vor 35 Jahren schrieb, findet sich eine, die regelrecht zeitdiagnostische Kraft besitzt. Sie handelt davon, wie der kleine Nick kurz vor Schulbeginn mit seiner Mama die notwendigen Dinge für die Schultasche einkaufen geht. »Dann hat Mama mir ein Mäppchen gekauft, das aussieht wie das Halfter von einer Pistole, aber an Stelle von einer Pistole ist ein Bleistiftspitzer drin, der aussieht wie ein Flugzeug, und ein Radiergummi, der so aussieht wie eine Maus, und ein Bleistift, der aussieht wie eine Flöte, und eine Menge kleiner Dinge, die aussehen wie irgendwelche anderen Dinge.«
In einem gewissen Sinne sind alle Dinge heute Dinge, die aussehen wie irgendwelche anderen Dinge. Nicht, dass ein Turnschuh nicht aussähe wie ein Turnschuh. Das natürlich keineswegs. Aber doch ist in der »designer capitalist society« kaum ein Ding mehr auf seine nackte Dinghaftigkeit reduziert. Die Dinge repräsentieren gleichzeitig Bedeutung. Der Turnschuh repräsentiert Fitness, die abgewetzte Trainingsjacke repräsentiert Hipness, der iPod Trendyness, die Obstpresse repräsentiert gesunde Ernährung, das zierliche Teeservice repräsentiert Entspannung, das Perrier-Mineralwasser Lebensart, und der Fair-Trade-Kaffee annonciert, dass der Käufer ein guter Mensch ist. Dinge, die besonders gut sind beim Repräsentieren, nennt man im allgemeinen »Kult«: der Adidas-Schuh, die Ray-Ban-Brille, der Latte macchiato, der iMac, das gerade angesagte Kult-Buch, die Toskana-Reise, das hippste Handy der Saison, das Stück von Prada, das Accessoire von Dolce&Gabana – die Liste ist endlos. Alles Dinge, die viele Leute haben wollen, weil sie gerne möchten, dass die Attribute, mit denen die Dinge verbunden sind, auch mit ihnen verbunden werden. Im Lifestyle-Kapitalismus ist der Stil eines Menschen, seine Identität, unmittelbar verbunden mit den Dingen, die er konsumiert.
Der praktische Gebrauchswert der Dinge gerät in den Hintergrund, was nicht heißt, dass er keine Rolle mehr spielt – aber dass die Güter ihren praktischen Nutzen erfüllen, wird ohnehin vorausgesetzt. Dass jeder MP-3-Player Musik wiederzugeben vermag, ist keine Frage, was aber den einen MP-3-Player von anderen unterscheidet, ist das, was man seine Kultur nennen könnte. Deshalb wird die Kultur in der Güterproduktion immer bedeutender. Ich spreche deshalb im Folgenden vom »Kulturkapitalismus« – ein Begriff, der vom amerikanischen Trendforscher Jeremy Rifkin geprägt wurde.
All das ist irgendwie bekannt, aber in seiner Dimension noch gar nicht richtig begriffen. Gewiss, die Postmoderne hat ihren Frieden mit der Populärkultur gemacht und instinktiv die Unterscheidung zwischen »wichtig« und »unwichtig« verworfen. Die Analyse des unbedeutendsten Gutes galt ihr als ebenso relevant wie die Auseinandersetzung mit den alten, großen Fragen. Ja, mehr noch: Die alten großen Themen – »Geschichtsphilosophie«, »Arbeiterklasse«, »Fortschritt« – schleppten einen prallvollen Rucksack an Bedeutung mit, schienen aber zunehmend irrelevant zu werden, während die unbedeutendsten Dinge an Relevanz zu gewinnen schienen. Man kann das auch als paradoxe Volte der Verdinglichung beschreiben: Die Bedeutung wandert in die Dinge ein. Man kann es freilich auch mit Hinweis auf die Psychoanalyse beschreiben, die uns schließlich gelehrt hat, dass die nebensächlichsten Handlungen einer Person Symptom grundlegender psychischer Störungen sein, also auf sehr Bedeutendes verweisen können. So ähnlich ist auch mit der Konsumkultur: Die Analyse der Dinge, die wir kaufen, die Analyse der Gründe, warum wir sie kaufen, hat fundamentale Bedeutung für das Verständnis unserer Gesellschaften.
Die klassische Kapitalismuskritik und die klassische Ökonomie haben dies noch längst nicht wirklich begriffen. Die linke Konsumismuskritik unterstellt, die Werbung manipuliere den Verbraucher, der nicht weiß, was er tut – wohingegen die Konsumenten durchaus selbstbewusst aus dem Fundus der Stil-Angebote auswählen und gerade die Lifestyle-Attribute der Waren nachfragen. Es ist die Bedeutung der Güter, die die Kunden konsumieren – man muss sie da nicht manipulieren, im Gegenteil, sie wissen das sehr gut.
Die klassische Ökonomie kann mit den Realitäten der kulturalisierten Märkte womöglich noch viel weniger anfangen. In ihren Modellen geht sie vom Homo oeconomicus aus, der stets streng seinem Eigennutz folgt – und deshalb, beispielsweise, auf Kostenminimierung Wert legt. Doch längst wird eine Ökonomie, die allen Ton auf die materielle Rationalität legt, dem realen Geschehen auf den Konsummärkten nicht mehr gerecht. Der Kulturtheoretiker Nico Stehr hat jüngst in seinem Buch »Die Moralisierung der Märkte« ausführlich beschrieben, welch entscheidende Rolle »nicht-ökonomische Werte«, »kulturelle Werte« in der »angeblich kulturfreien Welt … der modernen Wirtschaftssysteme spielen«.1 Die moralischen Erwägungen der Konsumenten müssten darum »auf der gleichen Nützlichkeitsebene« lokalisiert werden wie rein materielle Erwägungen.2
Soll heißen: Wenn ich zu einem Gut immer »etwas dazu« bekomme, dann ist das nicht bloß eine nebensächliche Zugabe, sondern für meine Kaufentscheidung durchaus bedeutsam. In einer Welt, in der in weiten Segmenten die lebensnotwendige Basisausstattung mit den Dingen des täglichen Bedarfs vorhanden ist (und in der selbstverständlich auch diese Basisgüter durch Bedeutung unterscheidbar gehalten werden), bekommt der Konsument zu den Dingen immer auch etwas mitgeliefert: ein gutes Gefühl, gelegentlich auch ein gutes Gewissen. In gewissem Sinn ist das Gut das Accessoire des symbolischen Mehrwerts.
Leicht einzusehen ist das beim Konsum ökologisch nachhaltiger oder fair gehandelter Güter. Wer ein Auto mit niedrigem Schadstoffausstoß und geringem Treibstoffverbrauch erwirbt, der freut sich über den schicken Schlitten und zudem auch noch darüber, dass er der Natur etwas Gutes getan hat. Wer eine Ware mit Fair-Trade-Zertifikat erwirbt, der darf sich als guter Kerl fühlen. Und da es natürlich viel angenehmer ist, ein gutes Gewissen zu haben als ein schlechtes, können wir es logischerweise auch als »nützlich« für den Konsumenten bezeichnen. Hin und wieder hat man den Eindruck, die politischen Aktivisten seien nicht mehr wiederzuerkennen: Statt auf die Demo gehen sie einkaufen – nur dass sie eben die korrekten Güter kaufen. Buycott statt Boykott.
In einer Welt, in der wesentlich Bedeutung und gute Gefühle konsumiert werden, gerät vieles in Bewegung. Die Wellness-Industrie hat ganze Produktpaletten von Gütern und Dienstleistungen im Angebot, deren einziger Zweck die Gefühlsökonomie zweiten Grades ist – dass der Verbraucher das Gefühl hat, sich gut zu fühlen. Mineralwässer etwa, die »Balance«, »Emotion« oder »Sensibility« versprechen; Wohlfühl-Hotels, die den Mahagonifurnier-Charme von Kur- und Rehakliniken längst abgelegt haben. Oft wird nicht einmal mehr der Inhalt eines Produkts beworben, »sondern die Stimmung, in die der Kunde beim Konsum versetzt wird«3. Traditionelle Medizin wird angeboten, sogar der Coca-Cola-Konzern brachte unlängst einen Wellness-Drink auf den Markt. »Gesundheit und Wellness sind die hauptsächlichen Wachstumsgeneratoren der Soft-Drink-Industrie«, postuliert der Economist.4 Diesem Veränderungsdruck unterliegt natürlich auch die Pharmaindustrie. Die Entwicklung teurer Medikamente, die möglicherweise gegen echte, aber seltene Krankheiten helfen würden, ist längst weniger profitabel als Investment in den boomenden Wellness-Markt.
Wenn wir den zeitgenössischen Kapitalismus und die heutige Warenproduktion verstehen wollen, reicht es nicht mehr (wenn es überhaupt jemals gereicht hat), die Prozesse von der Produktionsseite her zu analysieren. Wir müssen uns der Konsumtionsseite zuwenden und uns ansehen, was diese »produziert« – wie sie auf unsere Lebenswelten einwirkt und wie sie auf die Produktionsseite zurückwirkt. Monetär bewertete Güter sind offen für individuelle Gebrauchsweisen und können somit sogar einer ambivalenten De-Kommodifizierung unterworfen werden. Sammler können Güter in Gaben und in Schätze verwandeln. Jedes Gebrauchsgut kann zum Kultgegenstand werden. Deswegen habe ich dieses Buch »Das Kult-Buch« genannt – natürlich nicht ohne Augenzwinkern und Ironie angesichts des doppelten Sinns dieses Titels.
Der Untertitel »Glanz und Elend der Kommerzkultur« mag manche schon mehr verstören. »Warum Glanz?«, fragt womöglich der gewohnheitsmäßige Kapitalismuskritiker. »Warum Elend?«, mag wiederum der glückliche Shopper grübeln. Nun, es ist ein hartnäckiges kulturkritisches Vorurteil, dass der Massenkonsum die Welt eintöniger und notwendigerweise schlechter macht. Schon frühere Kritikergenerationen beklagten das Verschwinden der Individualität als Folge der Massengesellschaft. Für den Kulturkapitalismus lässt sich das freilich nur schwer behaupten. Im Wettbewerb um Marktanteile werden immer mehr Zielgruppen erfunden und immer mehr Güter angeboten, die die Angehörigen unzähliger Zielgruppen unbedingt haben müssen, um sich von den Angehörigen anderer Zielgruppen zu unterscheiden. Der zeitgenössische Kapitalismus befördert keineswegs Konformismus, im Gegenteil: Jede Form der Individualität ist ihm willkommen, gerne auch Patchwork-Identitäten, denn für fast jeden denkbaren Lifestyle hat er die zugehörigen Gadgets schon im Angebot – und wenn nicht, schickt er seine Trendscouts los, um entsprechende Waren zu entwickeln. Das macht die Welt auch bunter. So viel zum Thema Glanz.
Aber so, wie das Konsumgut meist nicht gratis ist, ist auch die Konsumkultur nicht ohne Preis zu haben. Sie formt sich unsere Städte, sie richtet sich die Subjekte her, sie schreibt sich ein in unser Innerstes. Mit unserer Umwelt interagieren wir, indem wir kaufen. Innenstädte sind von Shopping Malls nur mehr schwer zu unterscheiden. Wer etwas erleben will, wählt aus den Angeboten der Erlebnisindustrie aus. Die Jagd nach dem Neuen ist dem Konsumbürger zur zweiten Natur geworden. Wenn’s mit den Freunden nicht so klappt – weg mit ihnen, man kann sich ja neue suchen (so sind wir es von den Waren gewohnt). Um die nächste Ecke wartet bestimmt ein noch aufregenderer Mensch. Der Homo shoppensis ist doch ein recht eindimensionales Wesen. Der Konsumkapita-
Öffentlicher Raum ist Werbe-Raum.
Fassadendeckende Handywerbung in Berlin, Rosenthaler Platz
lismus hat, bei allem Glanz, zweifelsfrei auch etwas Elendes.
Gewiss bin ich nicht der Erste und Einzige, der sich darüber Gedanken macht. Ziel dieses Buches ist es, erstmals umfassend darzulegen, was aus der Ökonomisierung der Kultur, die gleichzeitig eine Kulturalisierung der Ökonomie ist, folgt. Die Kultur selbst ist, wie Franz Schuh mit unverwechselbarer Ironie schreibt, »eine Wachstumsbranche«5. Kreativität ist heute eine der wichtigsten Produktivkräfte.
Der Kreative wird zum Leitmodell des flexiblen Arbeitnehmers. Künstlertugenden, einst Gegenteil der Charaktereigenschaften, die in der Wirtschaftswelt erwartet wurden, werden heute in jedem Büro großgeschrieben. Der Kampf um Aufmerksamkeit tobt. Die Symbol- und Zeichenmächtigen sind gefragt – und hoch bezahlt – im Kulturkapitalismus. Noch die Subkultur wird gewinnbringend vermarktet. Ein kreatives Leben ist heute nichts, was sich eigenwillige Naturen gegen widrige Umstände zu erkämpfen hätten, Kreativität ist etwas, was von allen gefordert wird – bisweilen gar auf etwas herrische Art und Weise.
Wenn heute wieder von der »Unterschicht« die Rede ist, dann liegt schnell aller Ton auf der Kultur der Unterschichten, auf dem Unterschichten-Lifestyle, dem Unterchic – über die materielle Bedrängnis der da unten wird dann deutlich weniger geredet. Schließlich ist ja jeder für seinen Lebensstil selbst verantwortlich. Und auch der »Kampf der Kulturen« hat mehr mit »Kultur« in engem Sinn zu tun, als man beim saloppen Gebrauch der Metapher ahnt – er ist nämlich ohne die universelle Verbreitung eines kulturellen Zeichensystems und die Revolte gegen dasselbe kaum hinreichend erklärbar.
Konsum von Stil und Kultur hat eine ebenso wichtige Bedeutung für die Bearbeitung und Veränderung der äußeren Lebenswelt wie für die Selbstbearbeitung der Innenwelt der Subjekte – womit aber auch Konsumieren eine »Produktionsform« ist. Das, kurzum, ist die zentrale These dieses Buches. Altbackene Konsumkritik, die dem Verbraucher einerseits ein schlechtes Gewissen macht und ihn andererseits entlastet, indem sie unterstellt, er sei nur Marionette böswilliger Konzerne, ist meine Sache nicht – über retrolinke Plumpheiten dieser Art ist die Zeit hinweggegangen. Für eine dürre Apologie des Kulturkapitalismus und der Konsumkultur gibt es freilich noch viel weniger Anlass.
Wenn man die Konsumkultur kritisieren und ihre
schlimmsten Auswirkungen korrigieren will, muss man sie zunächst in all ihren Ambivalenzen verstehen, auch um differenzieren zu können, welche Korrekturen notwendig sind, welche die Welt womöglich ärmer machen würden – und welche überhaupt kurzfristig möglich sind. Darum ist, wenn man so will, das geheime Motto dieses Buches: »Konsumkritik – aber richtig!«
1. Kulturkapitalismus
Warum wir heute immer weniger den Gebrauchswert von Gütern und zunehmend ihren kulturellen Mehrwert konsumieren.
In früheren Zeiten pflegten gediegene Blätter, die etwas auf sich hielten, unter ihrem Zeitungskopf zu annoncieren, es handele sich bei ihnen um eine Zeitschrift »für Politik, Wirtschaft und Kultur« (die Hamburger Zeit hält bis dato an dieser Übung fest, hat aber neulich das Wort »Wissen« hinzugefügt). Doch blättert man heute dieselben Zeitungen durch, wächst der Eindruck, Wirtschaft und Politik lösten sich zunehmend in »Kultur« auf. Die Schlagzeilen der Politikseiten beherrscht das, was man so gemeinhin den »Kampf der Kulturen« nennt. Auch die Berichte über Wahlen, Parteien und Spitzenpolitiker treffen kaum das Wesentliche, wenn sie von umstrittenen Sachfragen handeln – schließlich entscheidet heute über den Erfolg und Misserfolg eines Politikers oder einer Politikerin zuvorderst deren »persönlicher Stil«, ihr »Image«. Die Wirtschaftsseiten sind ohnehin Kulturseiten anderer Art, gibt es doch kaum mehr eine Ware, deren praktischer Gebrauchswert wirklich das Entscheidende wäre. Sanfte Konsumfaktoren wie das Image der Ware, die »Persönlichkeit« der Marke sind in den meisten Fällen viel wichtiger. Umgekehrt ist auch die »Kultur« ein ökonomisch wichtiges Gut – nicht nur als Anlagevermögen wie etwa in der bildenden Kunst oder als marktgängige Massenware wie im Pop. Als gebaute Kunst ist die Architektur ein wichtiger Faktor für unternehmerischen Erfolg, weshalb sich die globalen »Power-Brands« ihre Konzernzentralen und »Flagship Stores« zu regelrechten Markentempeln ausbauen lassen. Inszenierungen internationaler Regiestars in den führenden Theatern und Opernhäusern, die großen Kunstmuseen, aber auch ein lebendiges Klein- und Subkulturleben sind für Städte, Regionen und Staaten vor allem ökonomisch wichtig – das macht sie als Wirtschaftsstandort attraktiv, als begehrte Destination des Tourismus ohnedies.
Schon fragen sich Kulturredakteure gelegentlich, ob die Berichterstattung über manchen Kunstevent ehrlicherweise nicht besser von der Wirtschaftsredaktion übernommen würde.
Keine Firma kann es sich heute mehr leisten, ein Produkt einfach so auf den Markt zu werfen. Das moderne Unternehmen ist ein Kulturunternehmen; der zeitgenössische Kapitalismus, nach einem Wort des amerikanischen Trendforschers Jeremy Rifkin, ein »Kulturkapitalismus«. Eigentlich würde schon die Formulierung, das Image ist so bedeutend wie der Gebrauchswert, zu kurz greifen. Denn oft ist das Image der eigentliche Gebrauchswert. Design ist nicht nur Reklame, die den Verkauf befördern soll, das Design ist das eigentliche Produkt. »Was wir auf dem Markt kaufen«, meint der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, »sind immer weniger Produkte und immer mehr Lebenserfahrungen wie Essen, Kommunikation, Kulturkonsum, Teilhabe an einem bestimmten Lebensstil«6. Die materiellen Objekte sind lediglich »Requisiten« dessen, was eigentlich verkauft wird.
Es ist das Geschäftsmodell der Firma Nike, das Žižek so perplex machte.
Nike ist das reinste Exempel für eine Firma, die einen Lebensstil verkauft, nicht Produkte. Denn die Güter, die Nike verkauft – etwa die Turnschuhe mit dem berühmten Swoosh, dem Logo der Firma –, werden von »unabhängigen« Zulieferern in Sweatshops in der Dritten Welt produziert. Sie sind natürlich das Simpelste an der gesamten Operation. Was Nike, also die Unternehmenszentrale, »produziert«, ist im Wesentlichen die Eroberung der Märkte – und das Instrument hierfür ist das Image der Marke. Weder Gebrauchswert noch Qualität des Dinges entscheiden über seinen Erfolg, sondern seine »Kultur«. Ist er Kult, dann läuft er, der Turnschuh.
All das ist nicht vollends neu, wird aber erst nach und nach in seiner gesamten Dimension begriffen. Natürlich hat die Kulturalisierung damit zu tun, dass sich heute viele Dinge in ihrer Gebrauchswertfunktion gleichen – das gilt für simple Produkte wie Waschmittel und Duschgel ohnehin, aber letztlich auch für raffiniertere Güter wie MP-3-Player oder Autos. Den Marktführer iPod unterscheidet von der Konkurrenz ja nicht so sehr, dass er bedienerfreundlicher oder leistungsstärker als seine Rivalen wäre, sondern dass es hip ist, zur iPod-Community zu zählen. Diese Hipness lässt die Apple-Kassen klingeln, und zwar nicht nur deshalb, weil der Technikkonzern dadurch höhere Preise durchzusetzen vermag, sondern vor allem wegen der viel höheren Marktdurchdringung. Wenn Produkte dagegen mehr auf der Gebrauchswertseite punkten wollen, etwa mit mehr Leistungsstärke, stoßen sie heute oft schnell in die »Sphäre des Unbrauchbaren«7 (so der Soziologe Gerhard Schulze) vor: Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit von Autos in lebensgefährliche Dimensionen, Erhöhung der Lautstärke von Boxen in Dezibel-Sphären, die, tatsächlich genutzt, sofortige Taubheit zur Folge hätten. Oft schaden sogar diese »marginalen Differenzen … der technischen Zweckmäßigkeit«8, wie Jean Baudrillard feststellte, etwa wenn das originelle Design eines Autos zwar gut aussieht, aber gegen die Normen der Strömungslehre verstößt.
Der amerikanische Werbekritiker Vance Packard, Autor der längst legendären, kanonischen Schrift »Die geheimen Verführer«, kam schon in den fünfziger Jahren zu dem Schluss: »Je größer die Ähnlichkeit zwischen den Produkten, desto geringer ist die Rolle der Vernunft bei der Markenwahl.«9 Die Vernunft werde gewissermaßen ausgeschaltet, indem die Güter mit produktfernen Charakteristika aufgeladen werden, die die Verbraucher zum Kauf der Marke »verführen« sollen. Dabei ist natürlich fraglich, ob die These vom »unvernünftigen« Kaufakt ganz überzeugend ist, unterstellt sie doch, die Verbraucher seien »in Wirklichkeit« bloß an dem Gebrauchsgut interessiert, ohne zu erwägen, dass sie womöglich gerade die kulturellen Faktoren nachfragen – ob es ihnen, kurzum, nicht eigentlich um die Konsumtion der »Markenidentität« geht, die sie für die Produktion ihrer eigenen Identität nutzen. »Heute«, schreibt der britische Marketingguru Wally Olins, »setzen wir die funktionellen Charakteristika eines Produkts einfach als garantiert voraus, was die Marke auszeichnet, ist ihr Image.«10 In der entwickelten Wohlstandsgesellschaft kommt es also zu einer »Verschiebung von der Warenproduktion zur Imageproduktion«, wie das Holger Jung und Jean-Remy von Matt, die Gründer der Werbeagentur Jung von Matt, formulieren.11 Bis hin zu den preiswertesten und banalsten Produkten, so der Berliner Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich in seinem Buch »Habenwollen«, in dem er die Funktionsweise der Konsumkultur zu ergründen versucht, »reicht das Bemühen der Hersteller, potenzielle Kunden nicht nur mit einem Gebrauchswert oder einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen, sondern ihnen dank der Warenästhetik eine Identifikationsmöglichkeit zu bieten«12.
Für die warenproduzierenden Firmen heißt dies, dass der alte Kalauer plötzlich eine eigene, tiefere, ja überlebenswichtige Wahrheit verliehen bekommt: Design oder Nicht-Sein.
Im klassischen Kapitalismus, mochte er auch die Lebenswelten mit seinem Geist, seiner Kultur durchdringen, wurden nicht in erster Linie kulturelle Güter produziert, sondern Gebrauchswerte. Nur dadurch machte die Aufrechterhaltung der Differenz zwischen der Welt der Kultur oder, wenn man so will, der Sphäre der »Werte« und der Welt der Dinge überhaupt Sinn. In der neuesten Etappe der kapitalistischen Produktionsweise, im Kulturkapitalismus also, ist diese Trennung aufgehoben: Kultur ist Kapital. Und vice versa: Kapital ist Kultur. Natürlich kann man kulturpessimistisch Klage führen – über die Totalökonomisierung, die auch die Kultur verdinglicht. Was solche molltönende Rede oft übersieht: Die Folge ist eben nicht nur die Verdinglichung der Kultur, wie allgemein beklagt, sondern gleichzeitig auch die Kulturalisierung der Dinge. Die Marke wird zum Kunstwerk. Das schleicht sich in die Alltagssprache ein und in die Managementdiskurse – sofern diese heute überhaupt noch leicht auseinanderzuhalten sind. Wir kennen alle die Schlagworte: Das »Management by Culture« in den multinationalen Konzernen, das »myth-making« zu Brandingzwecken, die Überhöhung des Wirtschaftens zu »Kaffeekultur«, »Körperkultur«, »Wohnkultur«, »Freizeitkultur« etc.
Totalökonomisierung heißt im Umkehrschluss also auch: Totalkulturalisierung.
Die Zeit, als man noch dem naiven Glauben anhängen konnte, Geschäftserfolg habe etwas mit materiellen Dingen zu tun, ja, als man noch, wie Karl Marx in Anlehnung an David Ricardo, ein »Wertgesetz« formulieren konnte, dem zufolge der »Wert« und folglich auch der »Preis« eines Produktes sich im Wesentlichen durch die in ihm materialisierte Arbeitskraft bestimme, ist ein für alle Mal vergangen. Gewiss hat dieses Wertgesetz noch in beschränktem Maße, quasi negativ, Gültigkeit – kein Produkt bleibt lange am Markt, wenn seine Produktionskosten seinen Preis übersteigen, und keine Firma bleibt längere Zeit solvent, wenn sie dieses »Gesetz« chronisch missachtet. Aber das ändert nichts daran, dass der »Wert« einer Firma eine zunehmend imaginär-materielle Größe ist: einerseits etwas wolkig, andererseits ganz real. So wird die Liste der internationalen »Top Brands«, gemessen an ihrem Markenwert, seit Jahren von der Firma Coca-Cola angeführt, gefolgt von Microsoft, IBM, General Electric, Intel, Disney, McDonald’s, Nokia, Toyota, Marlboro, Mercedes, Hewlett-Packard, Citibank, American Express, Gillette, Cisco, BMW, Honda, Ford, Sony, Samsung, Pepsi, Nescafe, Budweiser, Dell, Meryll Linch, Morgan Stanley, Oracle, Pfizer, J. P. Morgan, Nike …13
Auffällig ist zunächst eines: Hier finden sich Unternehmen, deren Erfolg auf avancierter Technik beruht, traut vereint mit solchen, die an sich recht simple Güter herstellen, Konzerne, die über großes Anlagevermögen und teure Fabriken verfügen, ebenso wie solche, die bloß Abfüllanlagen oder irgendwelche vergammelten Schneidereien brauchen, forschungsintensive Branchen ebenso wie solche, in deren Fabriken einfach Zigaretten gerollt und verpackt werden. Aber allen ist gemeinsam: Sie sind Marken, die jeder kennt. Und das ist ihr eigentliches Kapital. »Der monetäre Wert der Marke Coca-Cola wird auf ca. 70 Milliarden Dollar geschätzt, das waren 2003 über 60 Prozent des gesamten Unternehmenswertes«, schreibt Alexander Schubert über die »Brand Religion«. Dagegen ist das »materielle Anlagevermögen des Konzerns mit gut 10 Milliarden Dollar verschwindend gering«14. Brands, also die Identifizierung eines Produktes mit einer Marke, einem Logo und einem positiven Markenimage, stellen »das wirkliche Kapital einer Company dar«, urteilt deshalb Jean-Noël Kapferer, Professor für Marketing an der HEC-School of Management in Paris.15
Der Anteil von Markennamen im Wortschatz eines zweijährigen Kindes beträgt durchschnittlich 10 Prozent, wie Studien ergaben.16
Branding, der Begriff kommt übrigens von der bekannten Usance amerikanischer Viehzüchter, ihre Tiere mit glühenden Eisen zu markieren, ist simpel und kompliziert zugleich. Man markiert ein Produkt – oder gleich einen ganzen Konzern – mit einem Image, Werten, Tugenden, Sehnsüchten. Etwa mit Freiheit, mit Lebenslust, mit Gesundheit, mit roher Kraft, mit Natürlichkeit, mit Abenteuergeist, was auch immer – man kann sagen, mit irgendeinem »Anderen« des Kapitalismus, mit dem Gegenteil von berechnender Geschäftstüchtigkeit. Wir wissen alle »irgendwie«, womit die Marke Marlboro verbunden ist – mit dem »Archetypus Cowboy«, wie Mathias Horx schreibt, dieser eigentümlichen Mischung aus alten und neuen Werten. »Er ist der anarchische Spießer, der konservative Rebell, der wir in der Tiefe unserer Seele alle sind: Wir alle wollen Freiheit und Sicherheit, Wildheit und Kontinuität.« Camel wiederum ist mit Stärke und Risikobereitschaft verbunden. Perrier dagegen, ein simples Mineralwasser, ist stark darin, Gesundheit zu repräsentieren. Durch Werbung und Marketing, also durch nichts weiter als durch Kommunikation, wird das Wasser mit »Reinheit, Aktivität und Fitness verbunden«, so Wally Olins: »Es ist primär Kommunikation, die Perrier und andere so erfolgreich macht.«17
Gewiss, mit einem ordentlichen Werbeetat kann man beinahe aus jedem nützlichen – und manchmal auch unnützen – Gut ein Kultding machen. Dennoch ist Branding natürlich eine extrem komplexe Operation. Man muss ein Ding mit »Werten« aufladen – »Brand Values« –, ganz ohne Ironie ist in der Marketingliteratur von der »Persönlichkeit« der Marke, vom »Brand Statement« die Rede, von der Notwendigkeit, mit zwei oder drei Wörtern die »Essenz« der Marke zu beschreiben,18 damit diese sich regelrecht ins Bewusstsein des Publikums einbrennt.
Die Geschäftsregel des Kulturkapitalismus lautet gewissermaßen: Erst gewinnt die Firma den »Bewusstseinsanteil« und dann den »Marktanteil«. Dies funktioniert am besten, wenn jene Begriffe, die die Essenz der Marke beschreiben, auch noch bildlich repräsentiert werden. In einem visuellen Zeitalter muss der Konsument ein Bild von einer Marke gleichsam vor seinem inneren Auge haben, ein Bild, das gewissermaßen »für sich selbst« spricht. Gebraucht wird eine regelrechte »Rhetorik des Bildes«, eine sprachliche Botschaft von der Art einer unsichtbaren »Sprechblase«, wie das Roland Barthes erklärte. Er vertrat deshalb auch die Meinung, dass »es nicht sehr richtig ist, von einer Kultur des Bildes zu sprechen«19; schließlich sind die Bilder auch eine Art von Text. Eine Marke ist nur dann erfolgreich, wenn das Markenimage, die »Rhetorik der Marke«, das Produkt selbst und die »Kultur« des Unternehmens übereinstimmen. Da muss alles zusammenpassen, etwa die »Markenpersönlichkeit« des Produkts mit dem Image realer Personen, die für dieses werben. Ein ulkiger Entertainer wie Thomas Gottschalk passt ideal zu Gummibären, wohingegen er für eine distinguiertere Marke, etwa Mercedes oder Joop!, wohl eine glatte Fehlbesetzung wäre (ganz zu schweigen von Whisky oder Haarwuchsmittel).
Ein Unternehmen, das seine Marke mit dem kulturellen Image von Freiheit und Ungezwungenheit im Umgang auflädt, wird deshalb auch Schwierigkeiten bekommen, wenn in seinem Inneren eine autoritäre Kultur herrscht und es im Umgang mit Kunden schroffe Muffigkeit pflegt. Deshalb beschäftigen Unternehmen auch sogenannte »Marken-Evangelisten«, die die Botschaft der Unternehmenskultur in die Firma hinein predigen – oder, wie man heute besser sagt, kommunizieren. Die Mitarbeiter solcher Firmen sind angehalten, auch im Inneren einen ungezwungenen Umgang zu pflegen und ihre Vorstandsvorsitzenden zu duzen. Wenn sie morgens den Posteingang ihres E-Mail-Accounts öffnen, dann finden sie meist unzählige Botschaften folgender Art: »Wir« haben das ungemeine Glück, Frau Soundso als dritte stellvertretende Key Account Managerin gewonnen zu haben, daher können »wir« jetzt mit noch mehr Schwung und Engagement als ohnehin bereits vorhanden die gemeinsamen Anstrengungen zur weiteren Verbesserung der Präsenz der Marke in diesem oder jenem umkämpften Markt noch intensivieren und so weiter und so fort.
So erhielten im vergangenen Herbst alle Mitarbeiter eines Medienmultis ein Schreiben vom Vorstandschef, das hier auszugsweise wiedergegeben werden soll:
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Medienwelt befindet sich im Wandel, und auch … muss sich verändern …
Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr unser Programm »Expand your Brand« gestartet. … Vision und Mission wurde im Vorstand und dann in Diskussionsrunden mit Führungskräften … beraten. … Diese Mission haben wir auf ein verkürztes Statement gebracht: Life Enriching Media. …
Die neu formulierte Vision und Mission zeigt, dass … sich weiterentwickelt. Sie soll uns inspirieren und nach außen signalisieren, dass wir uns verändern. Wir werden uns bewegen, wir werden die Herausforderungen annehmen. … Denn bei … arbeiten kreative Menschen, die das, was sie tun, lieben, und die für Veränderungen bereit sind.
Mit freundlichen Grüßen
…