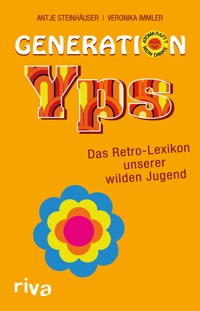7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Warum wirkt Schokolade als Schmerzmittel? Weshalb gehen Frauen immer zu zweit auf die Toilette? Und wie war das jetzt noch mal mit der Abseitsregel? Ob Psychologie, Mode, Klatsch, Kultur oder die Anleitung zur Eroberung vermeintlicher Männerdomänen – in diesem für jede Frau unverzichtbaren Accessoire finden Sie Nützliches, Wissenswertes und Unterhaltsames für alle Lebenslagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Veronika Immler / Antje Steinhäuser
Alles, was eine Frau wissen muss
Knaur e-books
Über dieses Buch
Warum wirkt Schokolade als Schmerzmittel? Weshalb gehen Frauen immer zu zweit auf die Toilette? Und wie war das jetzt noch mal mit der Abseitsregel? Ob Psychologie, Mode, Klatsch, Kultur oder die Anleitung zur Eroberung vermeintlicher Männerdomänen – in diesem für jede Frau unverzichtbaren Accessoire finden Sie Nützliches, Wissenswertes und Unterhaltsames für alle Lebenslagen.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Dass Sie sich benehmen können, setzen wir voraus, dass wir Ihnen über Küche und Haushalt allenfalls Ausgefallenes erzählen sollten, ebenso – aber wussten Sie, dass die alten Römerinnen den Wonderbra längst erfunden hatten? Und was es mit der langen, unhygienischen Geschichte der Unterwäsche auf sich hat? Welche besonderen Führungsqualitäten Legastheniker haben, welcher Frau als erster der Titel »Man of the Year« verliehen wurde, und mit welcher technischen Erfindung eine der schönsten Frauen der Welt, die Schauspielerin Hedy Lamarr, bis heute die Funktechnik geprägt hat?
»Wer nichts weiß, muss alles glauben«, stellte die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach klar. Damit Sie nicht so viel glauben müssen, sondern sich möglichst viel von dem ganzen bemerkenswerten und phantastischen Wissen, das man sich so aneignen kann, anhäufen können, aus purer Lust am Sammeln des Faszinierenden, möchten wir Sie zu einer Reise durch dieses Buch einladen.
Wir präsentieren Ihnen erstaunliche, anrührende, beeindruckende und erheiternde Fakten und Antworten. Warum bedeckt eine Frau aus Sumatra ihre Knie, wenn sie von Fremden überrascht wird? In welcher Disziplin konnten sich die Frauen bei den Olympischen Spielen im antiken Athen beweisen, und welcher Preis winkte ihnen? Wo leben die glücklichsten Menschen auf dieser Welt? Wie funktioniert luzides Träumen? Wie lange braucht die Nasenscheidewand, der Ohrknorpel oder die Schamlippe fürs Verheilen nach dem Piercen? Wie hilft die sogenannte Geräuschprinzessin, die »Otohime«, japanischen Frauen über peinliche Toilettengeräusche hinweg? Was sollten Sie bei Partnervermittlungen und Flirtbörsen im Internet beachten? Wie trainiert man die eigene Gehirnleistung? Wo lässt man sich vergorene Sojabohnen, geröstete Termiten und gegrilltes Gürteltier schmecken?
Und nicht zuletzt: Welche Domänen stehen Ihnen als Frau noch zur Eroberung offen? Werden Sie doch Bundespräsidentin, KSK-Mitglied, oder denken Sie über eine gefährliche Idee nach …
Veronika Immler & Antje Steinhäuser
Große Staatsfrauen
Dass Frauen wählen durften, hieß lange Zeit nicht, dass sie als Politikerinnen Posten übernahmen.
Die dänische Erziehungsministerin Nina Bang war 1924 das erste weibliche Kabinettsmitglied weltweit.
Khertek Anchimaa-Toka war die erste gewählte weibliche Regierungschefin der Welt: In der Volksrepublik Tannu-Tuva, in sibirischer Ferne, kam sie 1940 an die Macht, aber nur für vier Jahre, dann wurde ihr Land von der Sowjetunion annektiert.
In Deutschland war Luise Albertz 1946 die erste Oberbürgermeisterin einer Großstadt (Oberhausen, immerhin).
1961 war Elisabeth Schwarzhaupt die erste Frau auf einem Bundesministerposten (Gesundheitswesen).
1993 war Heide Simonis die erste deutsche Ministerpräsidentin (Schleswig-Holstein).
Inzwischen regiert eine Frau das bevölkerungsreichste Land der EU (Angela Merkel), in Argentinien (Cristina Kirchner), Indien (Pratibha Patil) und Liberia (Ellen Johnson-Sirleaf) behaupten sich Frauen als Regierungschefinnen, und in den USA (Hillary Clinton) und Frankreich (Christine Lagarde) spielen Frauen immerhin ganz oben in der Politik mit. In Deutschland ist ein knappes Drittel der PolitikerInnen weiblich, weltweit sind es immerhin 18 Prozent. Zwar sind Frauen in den Parlamenten immer noch eher die Ausnahme von der männlichen Regel, aber sie sind auf dem Weg dahin, kein Erstaunen mehr auszulösen.
Golda Meir
Sie gehörte im Mai 1948 zu den Unterzeichnenden der Proklamation des neuen Staates Israel. Millionen Dollar Spendengelder hatte sie vor allem in den USA für ihren Traum gesammelt: dem jüdischen Volk eine jüdische Heimat zu verschaffen.
Antisemitische Pogrome gehörten bereits für die 1898 in Kiew Geborene zu ihren frühen Kindheitserlebnissen. Als sie fünf Jahre alt war, floh die Familie in die USA. Meir arbeitete als Lehrerin und Bibliothekarin in Chicago und New York. Ihr Interesse an Politik brachte sie in die sozialistisch-zionistische Bewegung, bis sie 1921 mit ihrem Mann Morris Myerson nach Palästina zog, wo sie ihrem Namen eine hebräische Anmutung gab: Meir heißt »jemand, der Licht bringt«. Zunächst lebte die Familie in einem Kibbuz, dann in Tel Aviv und Jerusalem. 1923 wurde Golda Meir Mitglied der Arbeiterpartei Mapai, ab 1928 war sie Aktivistin und später politische Leiterin in der Gewerkschaft Histadrut, für die sie sich in den USA mit Frauenorganisationen befasste, um dann, zurück in Israel, die zionistisch-sozialistische Frauenbewegung aufzubauen. Meir wurde Mitglied des Zionistischen Weltkongresses und stand der politischen Abteilung der Jewish Agency vor. 1948 war Meir die erste Botschafterin Israels in Moskau, von 1949 bis 1974 Abgeordnete der Knesset, von 1949 bis 1956 israelische Arbeitsministerin, von 1956 bis 1965 Leiterin des Außenministeriums. Im März 1969 wurde sie nach Levi Eshkols Tod die erste Premierministerin Israels. Nach bewegten fünf Jahren (Unruhen am Suezkanal, Jom-Kippur-Krieg) wurde sie 1974 von Jitzhak Rabin abgelöst. 1978 starb sie an Krebs. Der Staatsmann Ben Gurion nannte sie einmal den »einzigen Mann im Kabinett«. Sie gilt als große Persönlichkeit der israelischen Gründergeneration, die ihr Leben ganz in den Dienst ihres Volkes gestellt hat. Allerdings wird ihr mitunter vorgeworfen, sie habe Chancen beim Friedens- und Stabilisierungsprozess vertan.
Indira Gandhi
Das Volk setzte seine ganze Hoffnung in sie und nannte die Frau mit der aristokratisch-beherrschten Ausstrahlung Bharat Mata, Mutter Indiens. Schließlich hatte sie sich ein Ziel von historischen Dimensionen gesteckt: soziale Gerechtigkeit für ihr Land.
1917 wurde Indira als Tochter von Jawaharlal Nehru und Kamala Nehru in Allahabad geboren. Ihr Vater war Pandit-Brahmane aus Kaschmir und gehörte damit einer der höchsten Kasten an. Es prägte die junge Indira, dass ihr Großvater Motilal und ihr Vater zusammen mit Mahatma Gandhi (der kein Verwandter war) zur Unabhängigkeitsbewegung Indiens gehörten und gegen die englische Kolonialherrschaft aufbegehrten. Ihre Schulausbildung genoss sie in Europa. 1942 heiratete sie Feroze Gandhi, einen Freund der Familie, mit dem sie 1944 und 1946 die Söhne Rajiv und Sanjay bekam. Ab 1946 arbeitete Indira in Delhi eng mit ihrem Vater, dem Premierminister, zusammen. Als sie 1955 selbst den Parteivorsitz der Kongresspartei übernahm, sah ihr Mann ihre Ehe endgültig als gescheitert an. Es mag eine Rolle gespielt haben, dass Feroze, der 1960 starb, der niedrigeren Kaste der Parsen entstammte. 1964, kurz nach dem Tod ihres Vaters, wurde Indira Ministerin für Information und Rundfunk. Im Januar 1966 wurde sie als Premierministerin vereidigt. 1972, nach der Befreiung Bangladeschs gegen Pakistan, stand sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Nach einer Wahlniederlage 1977 zog sie sich zurück, um 1980 erneut als Premierministerin anzutreten. Im Oktober 1984 wurde sie von zweien ihrer Sikh-Leibwächter erschossen. Sie hatte die beiden Männer bewusst nicht entlassen, da sie Unabhängigkeit von religiösen Zugehörigkeiten demonstrieren wollte. In den Tagen danach wurden Tausende Sikhs ermordet, hunderttausend flohen nach Punjab.
Margaret Thatcher
Ihre Wirtschaftspolitik war rigoros, wirkte mit strengem Monetarismus der Inflation entgegen und erhielt mit »Thatcherismus« sogar einen eigenen Namen. Die Briten nannten sie »Milchdiebin«, weil sie als Kultusministerin 1971 die Gratismilch an Grundschulen abgeschafft hatte.
1925 wurde sie in Lincolnshire geboren. Sie studierte Chemie und Jura und arbeitete mehrere Jahre in beiden Berufen. Sie heiratete einen Unternehmer, und als die gemeinsamen Zwillinge sechs Jahre alt waren, trat sie im Norden Londons für die Conservative Party an und wurde ins Unterhaus gewählt. 1961 wurde sie Parlamentssekretärin im Ministerium für Sozialversicherungen, 1970 Ministerin für Erziehung und Wissenschaft im Kabinett von Edward Heath, 1975 errang sie dessen Posten als Parteivorsitzende in einer Kampfabstimmung. 1979 gewann sie mit ihrer Partei die Parlamentswahlen und wurde Premierministerin. Thatcher bekämpfte die Inflation, schaffte der Wirtschaft Freiräume und privatisierte etliche Staatsunternehmen, sie setzte gegen den Willen einiger Gewerkschaften Reformen und technische Innovationen durch; Kritiker werfen ihr jedoch vor, sie habe zu wenige Sozialinvestitionen vorgenommen, das bürgerliche Gemeinschaftsgefühl für unwichtig erachtet und das Gesundheitswesen nachhaltig geschwächt. Als EU-Mitglied fuhr sie stets einen ganz eigenen Kurs, etwa wenn es um Beitragsgelder ging. 1982 setzte sie sich in einem Krieg gegen Argentinien im Kampf um die Falklandinseln durch. 1984 entging sie knapp einem Anschlag der IRA. Sie gab vertragsgemäß Hongkong an China zurück, kürzte den Bildungsetat (weswegen Oxford ihr den Ehrendoktor verweigerte) und löste heftige Proteste aus, als sie eine Personensteuer einführte. Die deutsche Wiedervereinigung lehnte sie strikt ab. 1990 erklärte sie ihren Rücktritt, nachdem der Rückhalt in der Partei zu wanken begann.
Den Spitznamen »Eiserne Lady« verpasste ihr ein Mitarbeiter von Radio Moskau, nachdem sie die »bolschewistische Sowjetunion« scharf kritisiert hatte.
Madeleine Albright
Als Tochter eines tschechoslowakischen Diplomaten 1937 in Prag geboren, hatte sie bereits zweimal ihre Heimat eingebüßt, einmal durch Hitler, einmal durch die Kommunisten, als sie mit elf Jahren in die USA kam, wo ihr Vater als Politikprofessor in Denver lehrte. Albright wurde 1957 US-amerikanische Staatsbürgerin. Sie studierte Politik- und Rechtswissenschaften, 1976 promovierte sie. Bereits als Studentin engagierte sie sich politisch für die Demokratische Partei, in den siebziger und achtziger Jahren war sie Beraterin des Senators von Maine, Edmund S. Muskie, und der demokratischen Kandidaten Walter Mondale und Michael Dukakis; bis 1981 war sie drei Jahre Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates und tätig im Stab von Präsident Jimmy Carter, ab 1993 Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen. In dieser Zeit setzte sie sich bereits stark für weltweite Frauennetzwerke ein, weil sie wusste, dass nur in der Gemeinschaft bahnbrechende Erfolge zu erzielen sind; so besuchte sie etwa die burmesische Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi und setzte sich bei der Militärregierung für Kyis Demokratiekurs ein. Im Januar 1997 war sie die erste Frau, die als Außenministerin der USA vereidigt wurde. Sie hatte diesen Posten bis zum Ende der Amtszeit Bill Clintons im Jahr 2001 inne.
Albrights persönliches Markenzeichen auf Staatsreisen waren ihre auffälligen Broschen, die durchaus politische Botschaften transportierten: Dem irakischen Vize-Premier Tarik Aziz trat sie mit einer Schlange am Revers entgegen, nachdem die irakische Presse sie als solche bezeichnet hatte. Serbengeneral Ratko Mladić hatte angeblich eine Ziege aus seiner eigenen Herde nach ihr benannt – Albright heftete sich eine an die Brust. Zu Abrüstungsverhandlungen mit Russland erschien sie mit angesteckter Rakete.
Benazir Bhutto
»Nur die Demokratie kann uns retten, und wir sind bereit, dafür unser Leben zu riskieren«, verkündete sie unerschrocken, nachdem sie den Anschlag eines Selbstmordattentäters überlebt hatte, der 2007, kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Exil, 140 Menschen das Leben kostete.
1953 wurde sie in Karatschi, Pakistan, als Tochter des ehemaligen pakistanischen Premiers Zulfikar Ali Bhutto und einer iranischen Kurdin geboren. Benazir studierte in Harvard und Oxford. Schon zu Studienzeiten unterstützte sie ihren Vater bei den Vereinten Nationen in New York. Nach der Ermordung ihres Vaters 1979 ging sie ins Exil nach Großbritannien und wurde dort Führerin der Partei ihres Vaters. 1988, nachdem der Militärdiktator Zia ul-Haq bei einer bis heute ungeklärten Flugzeugexplosion ums Leben gekommen war, fanden wieder freie Wahlen statt: Von 1988 bis 1990 und von 1993 bis 1996 war Benazir Premierministerin Pakistans und damit die erste Regierungschefin in der islamischen Welt. Sie trat an, um die Ehre ihres Vaters zu retten, den sie damals nicht aus den Fängen des Militärs hatte befreien können. Als die Islamische Demokratische Allianz unter Nawaz Sharif an die Macht kam, verließ Benazir das Land. Im Oktober 2007 kehrte sie gegen den Willen von General Pervez Musharraf aus ihrem Exil in Dubai zurück, um 2008 bei den Präsidentschaftswahlen anzutreten, über Musharraf einen demokratischen Sieg zu erringen und die Macht, an der ihr durchaus viel lag, für sich zurückzugewinnen. Den ersten Anschlag, für den sie Zia ul-Haqs Anhänger verantwortlich machte, überlebte sie. Im Dezember 2007 kam sie jedoch zwei Wochen vor der geplanten Parlamentswahl bei einem erneuten Attentat ums Leben. Welche Gruppierung hinter dem Anschlag steckt, ist noch nicht geklärt.
Angela Merkel
Wenn sie nicht mit dem denkwürdigen Beinamen »Kohls Mädchen« bedacht und gerade deswegen reichlich unterschätzt worden wäre, hätte sie womöglich nicht so viel Energie darauf verwendet, sich den Respekt ihrer Parteikollegen zu verdienen. Ihr Vorbild ist Katharina die Große – und zwar weniger deren wüste Seiten als vielmehr die der verantwortungsbewussten und modernen Staatsfrau.
Die Pfarrerstochter wurde 1954 in Hamburg geboren und wuchs in Templin in der ehemaligen DDR auf. Sie studierte Physik in Leipzig. Ab 1978 arbeitete sie in Ostberlin am Institut für Physikalische Chemie. Nach der Wende engagierte Merkel sich bei der sozial und ökologisch eingestellten Bürgerinitiative Demokratischer Aufbruch (DA) – weswegen einige ihr nahestehende Menschen sich auch verwundert darüber äußerten, dass sie sich später der CDU und nicht etwa den Grünen oder der SPD zuwandte. Stattdessen wurde Merkel Regierungssprecherin der ersten und zugleich letzten frei gewählten Regierung der DDR. Im Dezember 1990 wurde Merkel Abgeordnete des Deutschen Bundestags, nachdem sie im Wahlkreis Stralsund-Rügen-Grimmen gewonnen hatte. Von 1994 bis 1998 war sie Bundesumweltministerin. Nach der für die CDU vernichtenden Bundestagswahl 1998 bekam Merkel das wichtige Oppositionsamt der Generalsekretärin. Nach Wolfgang Schäubles Rücktritt im Zuge der CDU-Spendenaffäre 1999 wurde Merkel 2000 zur neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Bis 2005 arbeitete sie als Oppositionsführerin. Aus der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 ging sie knapp als Siegerin hervor. Seit dem 2. November 2005 ist sie die erste Regierungschefin Deutschlands.
Condoleezza Rice
Das Forbes Magazine schätzte sie 2004 und 2005 als mächtigste Frau der Welt ein. Sie gilt unter Präsident Bush als Gehirn des Weißen Hauses in Washington. Und letztlich setzt sie wohl doch weniger auf Diplomatie als auf ein demokratisches Sendungsbewusstsein à la Bushs USA, komme, was da wolle.
1954 wurde sie als Tochter eines Pastors und einer Musiklehrerin in Alabama geboren. Sie lernte eher Noten als Schrift zu lesen und war bereits 1964 eine der ersten afroamerikanischen Schülerinnen des Birminghamer Musikkonservatoriums. Eigentlich wollte sie Konzertpianistin werden, wandte sich dann aber doch den Politikwissenschaften zu und schloss ihr Studium mit Bravour ab; 1981 promovierte sie. Sie wurde die erste weibliche, erste schwarze, jüngste und äußerst effektive Provost (Vizekanzlerin) der Elite-Universität Stanford. Sie arbeitete unter anderem für den Ölkonzern Chevron, für RAND, eine Institution für Forschung und Entwicklung, die gesellschaftlich brisanten Themen nachgeht, sowie im Investmentbanking. Als Spezialistin für die Sowjetunion wurde sie Beraterin von Präsident George Bush senior. 1990 befürwortete sie die deutsche Wiedervereinigung. Im Januar 2001 wurde sie Nationale Sicherheitsberaterin der USA unter Präsident George W. Bush, im November 2004 US-Außenministerin. 2006 lehnte sie es höflich ab, als Präsidentschaftskandidatin der Republikaner anzutreten. Rice gilt als ungemein gebildet, intelligent und eloquent, hat aber wegen ihres Kurses im Irakkrieg, ihrer Haltung in der Diskussion zur sogenannten Achse des Bösen und ihrer Strategie der Präventivschläge nicht nur Anhänger.
Recht und Emanzipation
Emanzipation
Über Jahrhunderte hinweg hatten Frauen grundsätzlich die dem Mann nachgeordnete Rolle. Die Männer herrschten über die Welt und bestimmten über deren Belange. Frauen trugen hinter den Kulissen zum Funktionieren des Lebens und des Alltags entscheidend bei, traten aber in den großen Bereichen Politik, Wissenschaft und Kunst nur in Einzelfällen in bemerkenswerte Erscheinung.
Ab 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, einem der wirkmächtigsten Ereignisse der modernen Weltgeschichte, änderte sich die europäische Gesellschaft: Das französische Volk rief »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« und verjagte den König. Die »Erklärung der Menschenrechte« wurde veröffentlicht.
Olympe de Gouges (1748–1793), eine Revolutionärin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin, wusste, dass es sich im Grunde um »Männerrechte« handelte. Deswegen verfasste sie 1791 die »Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin«, mit der sie die soziale und rechtliche Gleichstellung der Frauen forderte. Artikel 1 lautete: »Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten.« Gouges stellte die mutige Frage: »Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Wer hat dir die selbstherrliche Macht verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken?« Weiter forderte sie, dass einer Frau – wenn sie ja auch das Recht hat, aufs Schafott zu steigen – ebenso das Recht gebührt, auf eine Rednertribüne zu treten. Olympe de Gouges bezahlte mit ihrem Leben: Das Revolutionstribunal ließ sie köpfen. Sie habe sich die Rolle eines Staatsmannes angemaßt und ganz vergessen, was sich für ihr Geschlecht gehört, hieß es. Aber den Gedanken von Freiheit und Gleichheit hatte sie in der Welt gesät.
Die Revolutionärin Emma Herwegh (1817–1904) unterstützte 1848 während der Deutschen Revolution die Aufständischen im Kampf für Demokratie.
Die Schriftstellerin Louise Otto-Peters (1819–1895) forderte nach der Deutschen Revolution die Organisation der Frauenarbeit, um weniger Frauen in die Prostitution zu treiben. Sie gilt als Mitbegründerin der Frauenbewegung, weil sie 1849 die »Frauenzeitung« herausgab, Dienstboten- und Arbeiterinnenvereine sowie Frauenbildungsvereine gründete.
Die Pädagogin und Frauenrechtlerin Helene Lange (1848– 1930) hielt zwar Haushalt und Kinder durchaus für die Domäne der Frauen, setzte sich aber als bürgerliche Frauenrechtlerin für eine bessere Ausbildung von Frauen sowie für deren Zulassung an Universitäten und in akademischen Berufen ein.
Die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831–1919) wehrte sich gegen die Lehre der biologischen Determination und sprach von kultureller Prägung der Geschlechterrollen. Sie stellte die provokative Frage: »Warum ist die Frau gleichgestellt Idioten und Verbrechern?« (Denn die durften auch nicht wählen.)
Mit einsetzender Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts brauchte man viele billige Arbeitskräfte: Frauen und Kinder bekamen die geringsten Löhne. Die bedeutendste Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung, Rosa Luxemburg (1871– 1919), und die Frauenrechtlerin Clara Zetkin (1857–1933) setzten sich vor allem für die Rechte der Arbeiterinnen ein. Vor und während des Ersten Weltkriegs gehörten sie zur internationalen Frauen-Antikriegsbewegung.
1918 bekamen die Frauen das Wahlrecht in Deutschland.
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die SPD-Politikerin Elisabeth Selbert (1896–1986) dafür ein, dass der schlichte Satz »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« im Grundgesetz festgeschrieben wurde.
In den sechziger Jahren begehrten Studenten und Studentinnen gegen weiterhin verkrustete Strukturen auf. Sie forderten ein modernes Land mit mehr Toleranz gegenüber Bürgerrechten, Fremden und Frauen. Frauenrechtlerinnen nannten sich Feministinnen. Die bekannteste ist die Journalistin Alice Schwarzer (*1942), die vor allem für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, finanzielle Unabhängigkeit der Frauen und gegen Pornographie kämpft. 1977 gründete sie die Frauenzeitschrift »EMMA«.
Übrigens: Dass Frauen zuvörderst Mütter sind und die Mutterschaft dementsprechend besondere Wertschätzung braucht, ist eine speziell deutsche Sicht der Dinge. In keiner anderen europäischen Sprache gibt es etwa das Schimpfwort »Rabenmutter« für die Frauen, die sich im Beruf besonders stark engagieren wollen.
Neues Scheidungsrecht 2008
»Wann immer ich mit einem Mann ausgehe, frage ich mich: Ist das der Mann, von dem ich möchte, dass meine Kinder ihre Wochenenden mit ihm verbringen?«
Rita Rudner,US-amerikanischer Comedy-Star und Autorin
Unterhalt
Jahrzehntelang herrschte eine klare Aufgabenteilung zwischen Ehepartnern: Er verdiente das Geld, sie – die klassische Hausfrau – kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder. Und wenn es zur Scheidung kam, musste der Mann seine Ex-Familie weiterhin finanzieren. Doch Gesellschaft und Politik haben sich im Lauf der Zeit geändert, Emanzipation, gewandeltes Familienbild und Arbeitsmarkt haben gewirkt: Frauen, die über Jahre zu Hause bleiben und die Erziehung ihrer Kinder selbst übernehmen, manövrieren sich ins Abseits. Die traditionelle Mutterrolle ist politisch nicht mehr gefragt und wirkt sich im Fall einer Scheidung negativ auf die Situation der Betroffenen aus. Junge Frauen müssen das gewisse Risiko, das die Hausfrauenrolle birgt, bedenken; der Status der Ehefrau bedeutet im Scheidungsfall keine Existenzsicherung mehr, bietet nicht mehr den traditionellen »Schutzraum«. Eine gesicherte Existenz hat eine Frau nur mehr durch die eigene, möglichst unterbrechungslose Erwerbstätigkeit. Folgende Neuregelungen gelten dementsprechend im Unterhaltsrecht:
Kinder stehen an erster Stelle, wenn es um Unterhaltszahlungen geht: Wenn der Unterhaltspflichtige nicht genug Geld hat, um die Forderungen komplett zu erfüllen, bekommen die Kinder zuerst ihren Teil.
Die Geschiedenen sollen mehr Eigenverantwortung übernehmen und sich selbst versorgen. Das funktioniert, wenn junge Mütter rasch wieder ins Arbeitsleben zurückkehren. Maximal ein Jahr lang nach der Geburt erhalten sie eine Lohnersatzleistung in Form von Elterngeld. Der Höchstbetrag liegt bei 1800 Euro. Diese Regelung ist günstig für eine gut ausgebildete Frau, die trotz eines Kleinkindes voll erwerbstätig bleibt. Hausfrauen erhalten den Mindestbetrag von 300 Euro, gegebenenfalls ergänzt durch einen Geschwisterbonus.
Weiterhin Anspruch auf finanzielle Unterstützung durch den Ex-Ehepartner hat nur, wer zu krank oder zu alt ist, um zu arbeiten, oder wer Kleinkinder betreut.
Die Neuregelung betrifft auch rückwirkend Ehen, die bereits geschlossen wurden, und es können Fälle, die bereits von einem Gericht entschieden wurden, neu aufgerollt werden. So besteht für etliche Ex-Ehemänner, die längst eine nächste Familie gegründet haben, die Möglichkeit, sich von der Verpflichtung zur teuren Unterhaltszahlung zu befreien.
»Künftig wird man nach einer Scheidung so gestellt, als ob die Ehe nie geschlossen worden wäre«, informiert die Berliner Familienanwältin Ingeborg Rakete-Dombek. »Früher wurde man so gestellt, als ob man nie geschieden worden wäre.«
Umstritten ist die Gleichstellung von Ex-Ehefrauen und unverheirateten Müttern hinsichtlich des Unterhalts im Zusammenhang mit Kinderbetreuung. Vor dem achten Geburtstag des Kindes musste eine Geschiedene bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Frühsommer 2007 nicht arbeiten, während einer unverheirateten Mutter nach der Trennung lediglich eine Frist bis zum Kindergartenalter des Kindes (mit drei Jahren) gewährt war. Diese Regelung fußte auch auf dem besonderen Schutz, unter dem die Ehe verfassungsgemäß steht. Nun müssen Rechtsprechung und Gesetzgeber in der Praxis klären, ob die Drei-Jahres-Regel für unverheiratete Mütter hinfällig ist – oder ob die Regel auch auf geschiedene Mütter angewendet wird. Möglicherweise werden Richter auf der Grundlage einer Billigkeitsklausel Unterhaltsansprüche im Einzelfall abweichend von der grundsätzlichen Regelung festsetzen.
Vaterschaft
Juristisch betrachtet ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, der Vater des Kindes. Den Kindern unverheirateter Mütter wird der Vater per Vaterschaftsanerkennung oder per gerichtlicher Vaterschaftsfeststellung zugeordnet. Denn ein Kind soll a) wissen, wer seine beiden Eltern sind, b) hat es einen Unterhaltsanspruch und c) einen Erbanspruch. Freiwillig kann ein Mann seine Vaterschaft bei jedem Jugendamt, Notar, Amtsgericht, Standesamt oder jeder Auslandsvertretung beurkunden lassen. Ein Mann kann seine Vaterschaft per Klage anfechten; Mutter und/oder Kind ihrerseits können die Vaterschaft in Frage stellen. In beiden Fällen sorgt ein Abstammungsgutachten (Bluttest) für Klarheit. Seit dem 18. April 2008 können Väter, die Unterhalt für Kinder gezahlt haben, die gar nicht ihre leiblichen sind, das Geld von den mutmaßlich leiblichen Vätern einklagen und diese dafür zu Vaterschaftstests zwingen.
Kurioses Recht
Bis 1998 gab es in Deutschland den »Kranzgeld«-Paragraphen (so benannt nach dem Strohkranz, den nicht jungfräuliche Bräute anno dazumal trugen): Der verbriefte einer unbescholtenen Frau das Recht, eine Entschädigung zu verlangen, wenn ihr Verlobter bereits Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt hatte, sie dann aber doch nicht heiratete.
Das 1880 eingeführte Lehrerinnenzölibat (solange Frauen an Schulen unterrichteten und damit die »geistige Mutterschaft« für ihre Schüler übernahmen, mussten sie unverheiratet bleiben – sobald ein Mann durch Heirat die Versorgung der Frau übernahm, sollte sie die Stelle frei machen) wurde erst 1956 vollends abgeschafft.
In Vermont schreibt ein Paragraph den Frauen vor, dass sie die schriftliche Einverständniserklärung ihres Mannes einholen, bevor sie sich falsche Zähne anfertigen lassen.
In Kentucky ist es einer Frau untersagt, denselben Mann viermal zu heiraten.
In Pennsylvania muss ein Mann, der Alkohol erwerben möchte, die schriftliche Genehmigung seiner Gattin vorweisen.
Einheimische Frauen gingen gerichtlich dagegen vor, dass im Distrikt Banke des westlichen Himalaya ein muslimischer Ehemann lediglich »talak, talak, talak« sagen musste, um seine Ehe scheiden zu lassen.
Psychologie
Die glücklichsten Länder der Welt
Wenn es eine Weltkarte des Glücks gäbe, hätten die großen Industrienationen wie Japan, Deutschland, Frankreich oder die USA darauf keinen Ehrenplatz. Sie liegen, aufgrund solcher Faktoren wie Stress, Überarbeitung, Geld-, Bildungs- und Zukunftssorgen, in der unteren Hälfte von knapp 180 Ländern, hinter ihnen kommen Indien und Russland, nicht weit vor Staaten wie Simbabwe und Burundi, deren Einwohner wegen existenzieller Ängste und Sorgen noch weniger Grund zu Gelassenheit, Zuversicht und Freude verspüren.
Kleine westliche Nationen wie Österreich, Dänemark und die Schweiz haben sich ein Stück Glück bewahrt, sie rangieren immerhin unter den ersten 30 Staaten. Inselbewohner äußern sich insgesamt positiver, wenn es um Zufriedenheit, Wohlstand, Gesundheit, das allgemeine Lebensgefühl und das Verhältnis zur Umwelt geht. So rangiert weit vorne Costa Rica, das man auch die Schweiz Mittelamerikas nennt. Der Lebensstandard des Landes, das seit fast sechzig Jahren neutral und armeelos geführt wird, ist relativ hoch. Es gibt nur vier Prozent Analphabeten und ein recht hohes Umweltbewusstsein (20 Nationalparks). Kolumbus gab dem Land einst seinen Namen (Costa Rica heißt »reiche Küste«), weil er dem Irrtum erlag, das Land verfüge über reiche Goldvorkommen. Vielleicht ist es gerade deswegen glücklich, weil dem nicht so ist!
Auch die kleine Inselrepublik Dominica, die zu den Kleinen Antillen in der östlichen Karibik gehört, nimmt einen der vordersten Plätze ein. Etwa 65000 Menschen leben mit einer außergewöhnlich vielfältigen und artenreichen Flora und Fauna. Der Bevölkerungsanteil der über Hundertjährigen auf der Naturinsel ist viermal so hoch wie in Deutschland.
Platz eins besetzt Vanuatu, eine Südpazifik-Republik im Nordosten Australiens. Über 200000 Menschen leben auf etwa 80 Inseln. Vanuatu wurde von Frankreich und England verwaltet, ist aber seit 1980 selbständig.
Träumen
»Doch gerade wenn wir untätig sind, wenn wir träumen, taucht die versunkene Wahrheit manchmal auf.«
Virginia Woolf, britische Schriftstellerin
Träume sind das nächtliche psychische Weiterleben und Verarbeiten von Eindrücken, Sorgen und Gefühlen. Ratio und Logik treten dabei in den Hintergrund. Alle Kulturen und Religionen messen dem Traum eine besondere Bedeutung bei, und viele von ihnen hielten Träume für verschlüsselte Botschaften höherer Mächte; die Bibel berichtet von zahlreichen prophetischen Träumen. Im alten Ägypten, bei den Babyloniern, Assyrern und den alten Griechen wurden bereits vor 3000 Jahren Traumbücher auf Pergament und Tontafeln geschrieben, in denen die Bedeutung der häufigsten Traumbilder und -symbole erläutert wurde. Den Zusammenhang zwischen dem körperlich-seelischen Befinden eines Menschen und seinen Träumen hatten bereits Hippokrates und Platon erkannt.
Die Traumforschung wartet mit verschiedenen Thesen zur Funktion des Traumes auf:
Die Individualität eines Menschen programmiert sich im Traum neu.
Träumen bedeutet, die Seele und das Gemüt von Ballast zu bereinigen und zu befreien.
Träumen ist eine Methode, Probleme aus der Wachphase zu verarbeiten und die Stimmung zu beruhigen.
Träumen erleichtert das Vergessen und Verdrängen belastender Erlebnisse.
Ganz überwiegend wird das Träumen zu Recht als ein Phänomen empfunden, das sich dem Einfluss des Menschen und seinem Willen entzieht. Es gibt jedoch einen Bereich, für den das nicht gilt: das sogenannte luzide Träumen, auch Klartraum genannt. Ein Mensch hat einen luziden Traum, wenn er tatsächlich träumt und sich zugleich dessen bewusst ist. Und ebendieses Bewusstsein versetzt ihn in die Lage, in den Trauminhalt einzugreifen. Das kann als angenehm empfunden werden, wenn etwa ein Alptraum durch gedankliche Steuerung seinen Schrecken verliert, aber auch besonders dann, wenn als angenehm empfundene Situationen im Traum heraufbeschworen werden.
Wenn Sie das luzide Träumen erlernen möchten:
sollten Sie sich mehrmals am Tag vorstellen, Sie würden träumen,
sollten Sie sich im Wachzustand immer wieder Umstände und Dinge vorstellen, die es gar nicht gibt, etwa dass Sie in Ihrem Auto umherfliegen; und dann stellen Sie sich wieder vor, Sie würden träumen,
nehmen Sie sich fest vor, in der Nacht einen Klartraum zu haben und etwas zu tun, wozu Sie in der Realität nicht in der Lage wären (z.B. eine steile Felswand hochzutanzen).
Übrigens: Im tibetischen Buddhismus nennt man das luzide Träumen Traumyoga. Ziel ist die geschärfte Wahrnehmungsfähigkeit des Geistes auch im Schlaf, so dass durch diese Bewusstseinserweiterung eine gesteigerte, aber gelassene und spirituell wertvolle Aufmerksamkeit im Alltag erreicht werden kann bis hin zur Erfahrung der wahren Natur des Geistes.
Nonverbale Kommunikation
Nonverbale Kommunikation bezeichnet alles nicht sprachliche Verhalten, ob es nun mit der Absicht, eine Botschaft auszusenden, geschieht oder nicht. Erröten oder Schwitzen etwa verraten Verlegenheit oder ein schlechtes Gewissen. Menschen können durch ihr unbewusstes Verhalten für andere wie ein offenes Buch sein. So verrät sich der Lügner etwa durch fahrige, unsichere Gesten (z.B. Hand vor den Mund halten) und Zubodenschauen, selbst wenn die Worte, die er spricht, eine vermeintlich verlässliche Auskunft geben. Lachen, Mimik, Augenkontakt und Gesten lassen sich zumindest teilweise über den Willen kontrollieren, aber nie ganz. Und sie verraten viel. Ebenso Stimmfärbung (paraverbal) oder Berührungen. Die Elemente, mit denen ein Mensch sein Äußeres gestaltet, sind auch Teile der nonverbalen Kommunikation: Accessoires, Tätowierungen, Kleidung, Frisur, aber auch Einrichtungsgegenstände geben einem Lebens- und einem Zugehörigkeitsgefühl Ausdruck.
Der bekannte Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick vertrat die Ansicht, ein Mensch könne gar nicht nicht kommunizieren. Und sein Gegenüber könne gar nicht anders, als beständig über alle Sinne Signale aufzunehmen und sie unwillkürlich auszuwerten, etwa die Pupillengröße seines Gegenübers, den Geruch, die Tonhöhe oder die Handhaltung. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass den meisten Menschen bereits wenige Sekunden reichen, um ein Vorurteil über den Mitmenschen zu fällen. Dabei hängt der Eindruck, den eine fremde Person macht, zu nicht einmal zehn Prozent von dem ab, was sie sagt. Zu 90 Prozent entscheidend ist, was nonverbal, also durch Mimik, Gestik, Körperhaltung, Kleidung, Schmuck etc., übermittelt wird. Selbst bei Menschen, die wir kennen, dominieren die nonverbalen Signale: Sie bestimmen immerhin noch 60 Prozent des Eindrucks.
80 Prozent der Informationen nimmt der Mensch über die Augen auf. Veränderungen in den Augen und Pupillen werden daher sehr schnell wahrgenommen, auch über weite Distanzen. Unter Menschen wird dieser Bereich der nonverbalen Kommunikation durch den Umstand betont, dass Menschenaugen im Gegensatz zu Tieraugen sichtbar Weißes haben. Der Mensch ist das einzige Tier, bei dem man die Sklera (das Weiße) sieht. Dadurch ergibt sich ein größerer Kontrast, und der macht die Augenveränderungen deutlicher. Zu diesem Zweck haben die menschlichen Augen auch um die Iris meistens einen dunkleren Rand. Wissenschaftler nehmen an, dass es sich dabei um ein reines Kommunikationsmittel handelt, das den Kontrast zur Sklera verstärkt.
Körpersprache
Wer die nonverbalen Signale kennt, kann sich in entscheidenden Situationen, etwa bei Prüfungen, bei Vorstellungsgesprächen oder Verhandlungen, geschickter verhalten. Je besser Sie die eigenen Signale zu kontrollieren und die ihres Gegenübers zu deuten in der Lage sind, desto erfolgreicher sind Sie mit Ihren Anliegen.
Die Hände sind das Aushängeschild und einer der Hauptbotschafter. Offen und unverkrampft nach oben zeigende Handinnenflächen wirken aufgeschlossen und, als hätte man etwas zu geben (z.B. eine gute Arbeitsleistung), aber auch selbstsicher, weil man sich nicht zurücknimmt und nicht verschüchtert wirkt. Wer dagegen die Fingerkuppen der einen Hand gegen die der anderen legt, scheint ein kleines Bollwerk der Abwehr aufzufahren. Man wirkt zwar auch konzentriert, aber vor allem negativ. Liegt der Zeigefinger vorn am Kinn, signalisiert das Handlungsbereitschaft. Der Finger kann jederzeit ausgestreckt werden, und das bedeutet: Gleich geht’s los! Der Ringfinger hingegen wird stets mit Emotionen in Verbindung gebracht. Wer innerlich aufgewühlt ist, knetet häufig diesen Finger.
Fährt sich jemand mit der Zunge über beide Lippen, so steht das für Zufriedenheit. Leckt ein Mensch sich hingegen nur über eine Lippe, bedeutet das, dass er nachdenkt, etwa die letzte Antwort seines Gegenübers kritisch hinterfragt, zum Beispiel, ob sie/er die letzte Firma wirklich aus freien Stücken verlassen hat? Spitzt eine Person die Lippen, prüft sie das soeben Gesagte ganz genau. Legt sich jemand den Finger auf die geschlossenen Lippen, hält er oder sie etwas zurück.
Grundsätzlich positive Zeichen sind ein dem Gegenüber zugeneigter Oberkörper, eine lockere, eher offene Beinhaltung, viel Blickkontakt, entspannte Lippen.
Zeichen für Ungeduld, Desinteresse, Unaufrichtigkeit oder gar Abweisung sind ein angespannter Unterkiefer, verschränkte Arme und Beine, ein fahriger Blick, unechtes (ohne Fältchenbildung um die Augen) Lächeln, Reiben von Augen, Nase, Nacken oder Kopf, in den Hosentaschen vergrabene Hände und häufiges nervöses Wechseln der Sitz- oder Stehhaltung.
Kulturelle Unterschiede
Bestimmte nonverbale Ausdrucksformen sind auf der ganzen Welt gleich. Etwa das Stirnrunzeln gilt in so gut wie allen menschlichen Kulturen als Zeichen von Skepsis und Verärgerung. Lächeln wird ebenfalls weltweit als Sympathiebekundung und positives Signal eingesetzt.
Das Übereinanderschlagen der Beine aber, in Europa eine völlig gängige Haltung, ist zum Beispiel für einen Araber eine Beleidigung, denn die Fußsohle, die dem Gegenüber auf diese Weise entgegengehalten wird, gilt im arabischen Kulturkreis als unrein. An diesem Umstand sind schon ganze diplomatische Konferenzen gescheitert.
Da sie in ihrer Kultur ein anderes Distanzempfinden entwickelt hat, könnte eine Japanerin eine Europäerin im Gespräch als aufdringlich empfinden, da diese unwillkürlich näher an sie herantreten möchte, als es der Japanerin angenehm ist. Die Europäerin dagegen empfindet die Japanerin womöglich als distanziert, da diese ständig vor ihr zurückweicht.
In Asien gelten das offene laute Lachen und das Zeigen der Zähne als ungehörig. Asiatinnen halten sich deshalb die Hand vor den Mund, wenn sie lachen. Was manchen Asiaten als unkontrolliertes, wüstes Gefuchtel vorkommt, empfinden Südamerikaner als engagierte und ausdrucksstarke Gestenrhetorik.