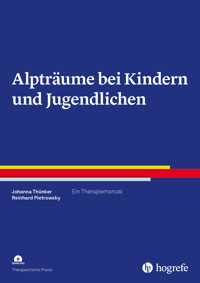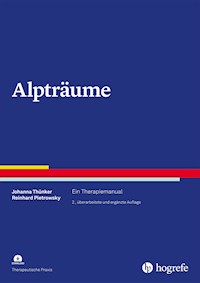
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Therapeutische Praxis
- Sprache: Deutsch
Das Manual bietet eine strukturierte Anleitung zur Behandlung von Patientinnen und Patienten, die unter häufigen und belastenden Alpträumen leiden. Die Alpträume können alleine auftreten, also ohne weitere komorbide psychische Störungen, oder im Kontext anderer psychischer Störungen, wie z.B. Depressionen, Angststörungen und vor allem der Posttraumatischen Belastungsstörung. Das Verfahren basiert auf der Imagery-Rehearsal-Therapie (IRT), die seit Jahren erfolgreich zur Behandlung von Alpträumen und Posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt wird. Wesentliche Elemente dieses Therapieansatzes sind die Modifikation des Alptraums in einen nicht bedrohlichen Traum und die Imagination dieses neuen Traumverlaufs. Das Therapieprogramm umfasst acht einstündige Therapiesitzungen im Einzelsetting mit den Elementen Psychoedukation, Entspannung, Imagination und Alptraummodifikation. Die Alptraumtherapie kann für sich alleine durchgeführt oder auch als Zusatztherapie in eine weitere therapeutische Intervention integriert werden. Das Manual liefert eine praxisorientierte Beschreibung des therapeutischen Vorgehens. Das Programm wurde bereits erfolgreich an verschiedenen Patientengruppen durchgeführt und in seiner Wirksamkeit überprüft. Es führt zu einem deutlichen Rückgang der Alptraumhäufigkeit und der Belastung durch Alpträume. Die Neubearbeitung berücksichtigt neue Forschungserkenntnisse und enthält nun zudem ein Kapitel zur Behandlung von Alpträumen bei Kindern und Jugendlichen. Die im Buch erwähnten Arbeitsblätter und Audio-Dateien können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Johanna Thünker
Reinhard Pietrowsky
Alpträume
Ein Therapiemanual
2., überarbeitete und ergänzte Auflage
Dr. Johanna Thünker,geb. 1985. 2003–2008 Studium der Psychologie in Münster und Düsseldorf. 2008–2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Düsseldorf. 2011 Promotion. 2013 Approbation als Psychologische Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie). 2014–2015 Weiterbildung zur Gruppenpsychotherapeutin und zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Seit 2013 niedergelassen in eigener Praxis in Bottrop.
Prof. Dr. Reinhard Pietrowsky,geb. 1957. 1978–1985 Studium der Psychologie in Tübingen. 1986–1990 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Physiologischen Institut der Universität Ulm. 1990 Promotion. 1990–1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Physiologische Psychologie der Universität Bamberg, 1992–1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Neuroendokrinologie der Medizinischen Universität zu Lübeck. 1996 Habilitation. 1999 Approbation als Psychologischer Psychotherapeut (Verhaltenstherapie). Seit 1997 Professor für Klinische Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2021
© 2011, 2021 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3106-2; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3106-3)
ISBN 978-3-8017-3106-9
https://doi.org/10.1026/03106-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
I Theoretischer Hintergrund
Kapitel 1 Beschreibung der Störung
1.1 Erscheinungsbild und Definitionskriterien
1.2 Erscheinungsformen und Inhalte von Alpträumen
1.2.1 Erscheinungsformen von Alpträumen
1.2.2 Inhalte von Alpträumen
1.3 Epidemiologie und Verlauf
1.4 Klassifikation
1.5 Differenzialdiagnose und Komorbidität
1.5.1 Abgrenzung zum Pavor nocturnus
1.5.2 Abgrenzung zum Schlafwandeln
1.5.3 Alpträume und Posttraumatische Belastungsstörung
1.5.4 Komorbiditäten
Kapitel 2 Störungstheorien und Ätiologiemodelle
2.1 Psychoanalytische Theorien
2.2 Kognitiv-Behaviorale Theorien
2.3 Neurophysiologische Theorien
2.4 Persönlichkeitsfaktoren
2.5 Aktuelle Stressbelastung
2.6 Medikamente und Drogen
2.7 Folgen der Alpträume
Kapitel 3 Diagnostik und Indikation
Kapitel 4 Stand der Therapieforschung
4.1 Entspannungsverfahren
4.2 Hypnotherapeutische Verfahren
4.3 Exposition
4.4 Luzides Träumen
4.5 Imagery-Rehearsal-Therapie (IRT)
4.5.1 Ergebnisse zur Wirksamkeit der Imagery-Rehearsal-Therapie
4.5.2 Ergebnisse zur Wirksamkeit der manualisierten Version der Imagery-Rehearsal-Therapie
4.5.2.1 Prä-post-Vergleich
4.5.2.2 Katamneseuntersuchung
4.5.2.3 Unterschiede im Behandlungsverlauf und in der Wirksamkeit abhängig von Komorbiditäten
4.5.2.4 Vergleich mit einer parallelisierten Wartelistengruppe
4.5.2.5 Vergleich mit einem Entspannungsverfahren
II Therapie
Kapitel 5 Allgemeine Informationen zum therapeutischen Vorgehen
5.1 Therapeutisches Setting
5.2 Zeitliche Struktur
5.3 Indikationen und Kontraindikationen
5.4 Arbeitsmaterialien
Kapitel 6 Einführung in die Alptraumtherapie
6.1 Informationsvermittlung: Inhalte und Ziele der Alptraumtherapie
6.2 Psychoedukation
6.2.1 Psychoedukation: Traum und Alpträume
6.2.2 Schlafhygiene
6.3 Alptraumrekonstruktion
6.4 Alptraumdokumentation
6.5 Hausaufgaben
Kapitel 7 Entspannungsverfahren
7.1 Progressive Muskelentspannung
7.2 Autogenes Training
7.3 Hausaufgaben
Kapitel 8 Imagination
8.1 Fantasiereisen
8.2 Vertiefungsübung: Veränderung von Szenen
8.3 Alternative Übungen
8.4 Hausaufgabe
Kapitel 9 Alptraummodifikation
9.1 Alptraumrekonstruktion
9.2 Identifikation negativer Elemente
9.3 Identifikation charakteristischer Elemente
9.4 Erarbeitung eines alternativen Traumhergangs
9.4.1 Alternative Traumelemente
9.4.2 Entwicklung einer vollständigen, alternativen Traumgeschichte
9.4.3 Erprobung des neuen Traumskripts
9.5 Imagination des neuen Traums
9.6 Reflexion des Vorgehens
9.7 Hausaufgaben
9.8 Beispielträume
9.8.1 Der Verfolgungstraum
9.8.2 Der bizarre Traum
9.8.3 Der Traum „ohne Handlung“
9.8.4 Der Täter-Traum
Kapitel 10 Abschlusssitzung
Kapitel 11 Besonderheiten bei der Behandlung traumatisierter Patientinnen und Patienten
11.1 Entspannung und Imagination
11.2 Alptraumrekonstruktion
11.3 Alptraummodifikation bei posttraumatischen Alpträumen
Kapitel 12 Alptraumtherapie bei Kindern und Jugendlichen
12.1 Alptraumtherapie bei jüngeren Kindern
12.1.1 Psychoedukation
12.1.2 Alptraumrekonstruktion und -dokumentation
12.1.3 Entspannung und Imagination
12.1.4 Alptraummodifikation
12.1.5 Fallbeispiel
12.2 Alptraumtherapie bei älteren Kindern und Jugendlichen
12.2.1 Psychoedukation
12.2.2 Alptraumrekonstruktion und -dokumentation
12.2.3 Entspannung und Imagination
12.2.4 Alptraummodifikation
12.2.5 Fallbeispiel
Literatur
Anhang
Arbeitsblatt 1 bis 7
Hinweise zu den Online-Materialien
|9|I Theoretischer Hintergrund
|11|Kapitel 1Beschreibung der Störung
Überblick
In diesem Kapitel werden Alpträume unter folgenden Aspekten näher beschrieben:
Was sind die Definitionskriterien klinisch relevanter Alpträume?
Welche Erscheinungsformen von Alpträumen gibt es?
Wie verbreitet sind Alpträume, wie ist der Verlauf und welche anderen epidemiologischen Merkmale der Störung gibt es?
Wie werden Alpträume klassifikatorisch eingeordnet?
Welche Beziehungen gibt es zwischen Alpträumen und anderen psychischen Störungen (Differenzialdiagnostik und Komorbidität)?
1.1 Erscheinungsbild und Definitionskriterien
Alpträume sind vermutlich den meisten Menschen aus eigenen Erfahrungen bekannt. Jedoch sind vereinzelt auftretende Alpträume keine klinische Störung, so wie auch das Erleben von Angst oder Trauer per se keine klinische Störung ist. Erst das gehäufte Auftreten einzelner Symptome, vor allem aber das damit verbundene Leiden (beim Betroffenen selbst oder seiner Umwelt) und die Unausweichlichkeit der Symptome machen diese zu einer klinisch relevanten Störung. Es kommt aber immer wieder vor, dass Menschen über einen längeren Zeitraum relativ häufig von Alpträumen heimgesucht werden. In diesen Fällen kann eine klinisch relevante Störung vorliegen. Dabei kann es sein, dass die Betroffenen außer ihren häufig wiederkehrenden Alpträumen keine weiteren psychischen Beschwerden oder Störungen aufweisen. Es ist aber auch möglich, dass die Alpträume ein weiteres Symptom einer anderen psychischen Störung sind; dies ist relativ oft bei Angststörungen oder Depressionen der Fall. Bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) kommt es sehr häufig zu Alpträumen, in denen das traumatische Ereignis immer wieder erlebt wird, sodass diese wiederkehrenden Alpträume ein wesentliches Kriterium der PTBS darstellen. Bei Kindern sind Alpträume relativ häufig und sie verschwinden in den meisten Fällen wieder spontan. Dieses Manual bezieht sich überwiegend auf Alpträume und ihre Behandlung bei Erwachsenen. In Kapitel 12 finden sich jedoch auch Hinweise für die Behandlung von Alpträumen bei Kindern und Jugendlichen.
Das im Begriff „Alptraum“ oder „Albtraum“ vorkommende Wort „Alp“ stammt aus dem Althochdeutschen und ist etymologisch mit dem Wort „Elfe“ verwandt. Als Alben oder Elfen wurden ursprünglich kleine, unterirdisch lebende Erdgeister bezeichnet. Alp war bereits im Mittelalter auch die Bezeichnung des Nachtmahrs, eines bösen (ursprünglich) weiblichen Geistes, der sich des Nachts, so die Annahme, auf die Brust des Schlafenden setze und ihm die Luft abdrücke. Durch diese Atemnot entstehen die angstbesetzten Träume, die Alpträume oder das Alpdrücken. In der englischen Bezeichnung für den Alptraum, „Nightmare“, ist der Name des Mahrs bis heute erhalten geblieben. Die Schreibweisen „Alptraum“ und „Albtraum“ werden seit der letzten Rechtschreibreform synonym verwendet. Im Folgenden wird der Einheitlichkeit wegen jedoch nur der Begriff „Alptraum“ verwendet. Der Begriff „Angsttraum“ wird oft auch synonym für Alptraum gebraucht und wurde noch bis zum DSM-III-R und in der ICD-10 für dieses Störungsbild verwendet.
|12|Die entscheidenden Kriterien für Alpträume sind:
Ein Alptraum führt häufig zum Erwachen.
Nach dem Erwachen besteht eine sehr detaillierte Erinnerung an den Trauminhalt.
Das Erleben des Alptraums führt zu massiver Angst, Schuldgefühlen, Trauer oder einer Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens.
Der Inhalt eines Alptraums handelt in der Regel von der Bedrohung des eigenen Lebens oder des Lebens nahestehender Personen durch Angriff, Verfolgung oder sonstige Formen der Ausübung körperlicher Gewalt, dem Erleben von Hilflosigkeit durch körperliche oder psychische Gewalt oder dem Beifügen von Gewalt oder Schädigung an anderen Personen durch den Träumenden selbst. Die Bedrohung kann dabei von Menschen, aber auch Tieren oder fiktiven Wesen (Monstern) ausgehen.
Alpträume werden allgemein nach den gängigen Klassifikationssystemen den Parasomnien zugerechnet, also zu jenen Formen der Schlafstörungen, bei denen nicht eine Störung der Schlafmenge oder des Schlaf-Wach-Rhythmus im Vordergrund steht, sondern eine Störung der Schlafqualität durch im Schlaf auftretende Ereignisse. In der ICD-10 werden sie im Kapitel F5 „Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren“ klassifiziert und mit der Nummer F51.5 kodiert (Dilling, Mombour & Schmidt, 1991). Analog finden sich die Alpträume im DSM-5 im Kapitel Schlaf-Wach-Störungen in dem Unterkapitel „Parasomnien“ als Alptraum-Störung, zusammen mit den Non-REM-Parasomnien und der REM-Schlaf-Verhaltensstörung (American Psychiatric Association, 2013). Ihre Kodierung im DSM-5 ist ebenfalls die F51.5. Die diagnostischen Kriterien der Alpträume unterscheiden sich zwischen der ICD-10 und dem DSM-5 geringfügig. Jedoch ist im DSM-5, im Gegensatz zum DSM-IV, das Erwachen aus einem Alptraum nicht mehr als Kriterium genannt.
Gemäß DSM-5 ist es nicht der einzelne Alptraum, der als Störung klassifiziert wird, sondern erst das wiederholte Auftreten von Alpträumen, das mit Beeinträchtigungen und Leiden verbunden ist, macht die Störung aus. In den Diagnosekriterien des DSM-5 wird darauf verwiesen, dass die Alpträume, um als solche klassifiziert zu werden, nicht ausschließlich die Folge einer anderen psychischen Störung oder körperlichen Erkrankung sein dürfen. Dieses Kriterium ändert aber nichts daran, dass beispielsweise die im Rahmen einer Posttraumatischen Belastungsstörung auftretenden Alpträume (posttraumatische Wiederholungen) Alpträume sind, auch wenn in diesem Fall die übergeordnete Störung, also die PTBS, klassifiziert wird. Das gleiche gilt für die vermutete Verursachung der Alpträume durch die Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors: Auch hier handelt es sich seitens des Erlebens der Alpträume und ihrer Konsequenzen um „echte“ Alpträume, allerdings werden sie, da die Verursachung klar auf medizinische Faktoren oder eine Substanz zurückführbar ist, unter diesen Störungen oder Krankheitsbildern klassifiziert.
Das DSM-5 gibt zudem an, dass die Chronifizierung und der Schweregrad der Alptraum-Störung bestimmt werden sollten (vgl. Tabelle 1). Ferner weisen ICD-10 und DSM-5 zurecht auf die Bedeutsamkeit der durch die Alpträume und die daraus folgende Schlafstörung verursachten Leidens hin. Wir wissen, dass das angstvolle Traumerleben auch zu vermehrter und fortgesetzter Besorgnis, Grübeleien und existenziellen Ängsten führen kann, die ihrerseits einen starken (zusätzlichen) Leidensdruck verursachen können. Es ist auch so, dass die meisten Menschen Alpträume viel ernster nehmen als andere Träume und dass Alpträumen eine höhere Vorhersagekraft für zukünftige Ereignisse zugeschrieben wird im Sinne eines schlechten Omens, als dies bei angenehmen Träumen als positives Omen geschieht (sogenannte präkognitive Träume).
Tabelle 1: Einteilung der Alpträume nach Schweregrad (Auftretenshäufigkeit) und Störungsdauer nach DSM-5
Schweregrad
Störungsdauer
leicht
Im Mittel weniger als ein Alptraum pro Woche
akut
Alpträume seit weniger als 1 Monat
mittel
Ein oder mehrere Alpträume pro Woche, aber nicht jede Nacht
subakut
Alpträume seit weniger als 6 Monaten
schwer
Alpträume in jeder Nacht
andauernd
Alpträume seit mehr als 6 Monaten
Auch wenn von den Diagnosesystemen nicht näher spezifiziert, kann das Auftreten der Alpträume und die Belastung durch sie anhand der Auftretensfrequenz und der Störungsdauer beschrieben werden. Im Allgemeinen wird zwischen gelegentlichen Alpträumen (weniger als zwölf Alpträume pro Jahr) und häufigen Alpträumen (mehr als zwölf Alpträume pro Jahr) unterschieden (Belicki, 1992). In vielen Unter|13|suchungen wird ein noch strengeres Kriterium angewandt, um von häufigen Alpträumen zu sprechen, welches von mindestens einem Alptraum pro Woche ausgeht (Levin & Fireman, 2002). Häufigkeit und Verlauf der Alpträume sind sehr individuell. Manchmal wird über mehrere Alpträume pro Woche oder gar pro Nacht berichtet, manchmal treten Alpträume über mehrere Wochen oder Monate gar nicht mehr auf. Was die Störungsdauer betrifft, so können Alpträume über Jahre und Jahrzehnte bestehen bleiben. Wenn die Alpträume länger als ein halbes Jahr auftreten, bezeichnet man sie als andauernd, bei einer Auftretensdauer unter einem halben Jahr werden sie als subakut bezeichnet (Krakow, Kellner, Pathak & Lambert, 1995). Inzwischen gibt es deutliche Hinweise, dass die eigentlichen Alpträume sich von den posttraumatischen Alpträumen in mehreren Merkmalen unterscheiden. Zur Abgrenzung von den posttraumatischen Alpträumen werden die anderen („normalen“) Alpträume auch als idiopathische Alpträume bezeichnet. Wir werden diesen Ausdruck im Folgenden aber nur dann verwenden, wenn explizit die Differenzierung zu den posttraumatischen Wiederholungen relevant ist. Ansonsten sind in der Regel immer idiopathische Alpträume gemeint, wenn von Alpträumen die Rede ist.
Idiopathische Alpträume treten in der Regel im letzten Drittel des Nachtschlafs auf. Dieser Schlaf zeichnet sich durch das Vorherrschen von langen REM-Schlafepisoden (Rapid Eye Movement-Schlaf) aus (Rechtschaffen & Kales, 1968), was bedeutet, dass es sich bei den idiopathischen Alpträumen um ein Phänomen des REM-Schlafs handelt. Auch wenn bekannt ist, dass in allen Schlafphasen geträumt wird, so besteht für Träume in REM-Phasen eine besonders hohe Traumerinnerung und eine leichte Erweckbarkeit, da während des REM-Schlafs das Gehirn, im Gegensatz zum Non-REM-Schlaf, sehr aktiviert ist (paradoxer Schlaf). Der Non-REM-Schlaf besteht aus vier Schlafstadien (Schlafstadien 1 bis 4), wobei die Schlafstadien 3 und 4 als Tiefschlaf bezeichnet werden. Nach der neueren Klassifikation der American Academy of Sleep Medicine (AASM) werden die Schlafstadien 3 und 4 zu dem Schlafstadium N3 (N steht für Non-REM) zusammengefasst. Der Tiefschlaf tritt überwiegend in der ersten Hälfte der Nacht auf. Da idiopathische Alpträume vorwiegend im REM-Schlaf auftreten, liegt die Annahme nahe, dass ein vermehrtes Auftreten von REM-Schlaf mit einem gehäuften Auftreten von Alpträumen einhergeht. Diese Annahme wird gestützt durch die Beobachtung, dass Kinder, die über mehr REM-Schlaf verfügen, auch häufiger Alpträume haben und auch bei Erwachsenen eine erhöhte REM-Dichte des Schlafs, wie sie etwa bei Depressiven oder künstlerisch und geistig tätigen Personen zu finden ist, mit einer erhöhten Alptraumfrequenz einhergeht. Allerdings wäre es zu vereinfacht, hier eine monokausale, lineare Funktion anzunehmen, da das Auftreten von Alpträumen natürlich durch viele andere Faktoren neben der REM-Schlaf-Dichte mitbestimmt wird. Zudem unterscheiden sich posttraumatische Wiederholungen von den idiopathischen Alpträumen darin, dass sie in früheren REM-Stadien oder sogar im Non-REM-Schlaf auftreten können (Davis, 2009; Schredl, 2008).
1.2 Erscheinungsformen und Inhalte von Alpträumen
1.2.1 Erscheinungsformen von Alpträumen
Die Erscheinungsform von Alpträumen lässt sich nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifizieren. Grundsätzlich ist zwischen den bereits genannten idiopathischen und posttraumatischen Alpträumen zu unterscheiden. Hinsichtlich der Auftretenshäufigkeit von Alpträumen wird, wie wir gesehen haben, zwischen dem gelegentlichen und dem häufigen Auftreten von Alpträumen unterschieden. Dabei wird die Auftretenshäufigkeit in der Regel retrospektiv eingeschätzt. Hinsichtlich der Dauer des Auftretens der Alpträume, also der Chronizität, wird zwischen akuten, subakuten und andauernden Alpträumen unterschieden. Als weiteres Merkmal neben Häufigkeit und Störungsdauer lässt sich noch die Alptraumschwere oder -intensität nennen. Diese wird im Allgemeinen über die Häufigkeit des Auftretens von Alpträumen operationalisiert (vgl. Tabelle 1). Es ist aber empirisch eindeutig gesichert, dass die Alptraumschwere und der daraus resultierende Leidensdruck mit der Alptraumhäufigkeit nur schwach korreliert sind. Die erlebte Alptraumintensität scheint viel eher mit Persönlichkeitsmerkmalen in Zusammenhang zu stehen (vgl. Kapitel 2). Schließlich kann die Erscheinungsform von Alpträumen hinsichtlich des Kontextes ihres Auftretens unterschieden werden: Alpträume können isoliert auftreten oder zusammen mit anderen psychischen oder somatischen Störungen (idiopathische Alpträume) oder als wiederkehrende Alpträume (posttraumatische Wiederholungen, posttraumatische Alpträume) bei der PTBS.
Von isoliert auftretenden Alpträumen sprechen wir, wenn die betroffene Person unter Alpträumen leidet, diese in der Regel häufig und schon seit längerer Zeit auftreten aber sonst keine weiteren psychischen oder körperlichen Störungen vorhanden sind, die das Auf|14|treten der Alpträume erklären könnten. Die betreffenden Personen sind im allgemeinen nicht in ihren sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen beeinträchtigt, haben aber oft Angst vor dem Einschlafen, weil sie befürchten, es könnte wieder ein Alptraum auftreten oder sie machen sich Sorgen, ob mit ihnen „etwas nicht in Ordnung“ sei, weil sie wiederholt diese schrecklichen Träume haben. Charakteristisch sind Träume von Verfolgung, Angriffen oder dem Erleben schwerer Krankheiten. Die Betroffenen haben jedoch keine weitere klinisch relevante Störung, die im Alptraum auftretende Bedrohung nie als tatsächliches Trauma erlebt und sind nicht überdurchschnittlich im sozialen oder beruflichen Bereich belastet. Nachfolgend ist ein Beispiel für einen typischen Verfolgungstraum bei einer ansonsten psychisch unauffälligen Person geschildert.
Fallbeispiel: Frau E.
Frau E. ist eine 24-jährige Erzieherin in einem Kindergarten, die wiederholt (etwa einmal pro Woche) von Alpträumen heimgesucht wird. Alpträume hat sie schon solange sie sich erinnern kann, also bereits seit der Kindheit. In den letzten Jahren hätten sich die Alpträume aber auf ein Thema fokussiert. Sie träumt immer davon, dass in ihre Wohnung eingebrochen wird, während sie allein zu Hause ist und sie bedroht wird. Ein typischer Traum war, dass sie träumte, dass ihr Freund morgens aufgestanden sei, um zur Arbeit zu gehen, während sie noch im Bett lag. Sie hörte, wie ihr Freund dann die Wohnungstür zuzog und hört auch die Haustür ins Schloss fallen. Kurze Zeit später hörte sie, wie die Haustür aufging. Sie dachte sich noch, ihr Freund hätte etwas vergessen und sei deshalb wieder zurückgekommen. Dann aber hörte sie, wie ihre Wohnungstür aufging und plötzlich stand auch schon ein fremder Mann in ihrem Schlafzimmer. Der bedrohte sie mit einer Pistole und zwang sie, ihm alles Geld und die Wertsachen, die sie zu Hause hatte, auszuhändigen. Dann nahm er ihr Handy und schloss die Wohnungstür von außen zu, sodass sie keine Hilfe holen konnte. Nachdem er weg war, konnte sie zuerst vor Angst nicht klar denken, dann allerdings fiel ihr sein, dass sie in irgendeiner Schublade noch ein altes Handy hatte. Dieses holte sie und rief damit ihren Freund an. Der kam auch gleich von der Arbeit nach Hause und zusammen gingen sie dann zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Als sie zu dem Beamten in das Zimmer kam, der die Anzeige aufnehmen sollte, erkannte sie voller Entsetzen, dass das der Einbrecher war. Aus Angst vor ihm und seiner Rache beschrieb sie dann eine ganz andere Person. Sehr deutlich erinnerte sie sich daran, dass der Polizist sie ständig angrinste. Als die Aufnahme des Protokolls fertig war, zischte er ihr zu: „Ich krieg dich noch“. Dann sei sie voller Angst und Entsetzen aufgewacht.
Alpträume treten oft auch zusammen mit anderen psychischen Störungen, etwa Angststörungen oder Depressionen, auf. Sind sie eine direkte Folge dieser anderen Störungen, können sie als ein Symptom dieser betrachtet werden und werden in der Regel nicht eigenständig klassifiziert, außer die Alpträume würden ein zusätzliches Leiden verursachen, das über das Leiden oder die Belastung der komorbiden Störung hinausgeht. Stehen die Alpträume in keinem vermuteten kausalen Zusammenhang mit den anderen psychischen Störungen, werden sie ebenfalls als idiopathische Alpträume betrachtet. In den Alpträumen von Patientinnen und Patienten mit anderen psychischen Störungen spiegelt sich oft das zentrale Thema dieser anderen Störung wider. Bei Personen mit phobischen Störungen ist häufig das phobische Objekt oder die phobische Situation Gegenstand des Alptraums. Depressive Patientinnen und Patienten berichten davon, dass in ihren Alpträumen das Thema Tod und Sterben sehr zentral ist, dass sie sich schuldig machen und schuldig fühlen am Leid oder Schicksal anderer. Ein charakteristischer Traum eines depressiven Patienten, in dem Hilflosigkeit, Schuld und Tod dominieren, ist nachfolgend kurz beschrieben.
Fallbeispiel: Herr P.
Herr P., ein 46-jähriger freischaffender Architekt, der unter einer mittelgradigen Major Depression leidet, berichtet von häufigen Alpträumen, in denen er sich als klein, schwach und hilflos erlebt. In einem für ihn charakteristischen Alptraum träumte Herr P., dass er mit seinen zwei kleinen Kindern im Wald unterwegs war. Erst war alles schön, er habe die Natur und das Wandern mit seinen Kindern genossen. Plötzlich aber seien Wölfe aufgetaucht und es sei dunkel und kalt geworden. Die Wölfe kamen immer näher und kreisten ihn und seine Kinder ein. Sie starrten ihn mit leuchtend grünen Augen an. Er bekam Angst um seine Kinder und wollte sie schützen, sie in die Arme nehmen und sich vor sie stellen. Da sei er aber plötzlich geschrumpft und kleiner geworden als seine Kinder, sodass er sie nicht einmal mehr umarmen konnte. Er habe gewusst, dass er nun seine Kinder nicht retten |15|könne und dass er die Wölfe nicht mehr abwehren könne. Die Wölfe seien dann über seine Kinder und ihn hergefallen. Sie hätten ihm in die Arme gebissen, ihn weggetragen und einen Abhang hinuntergeworfen. Am Grund dieses Abhangs lag ein morastiger Teich, in den er gefallen sei. Dort sei es noch grässlicher gewesen. Tote Tiere und Menschen seien herumgelegen. Er habe noch gedacht, das seien alles die Opfer der Wölfe. Er habe mit Schlamm und Leichenteilen bedeckt in dem Morast gesteckt und sich nicht mehr richtig bewegen können. Dann sei er voller Grauen und Abscheu aufgewacht.
Auch im Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen können Alpträume häufig auftreten. So ist es allgemein bekannt, dass z. B. unter Fieber sehr häufig Alpträume auftreten (Fieberträume). Aber auch nach großen oder schweren Operationen werden vermehrt Alpträume berichtet. Ebenso treten oft vor einer großen Operation (z. B. Organtransplantation) gehäuft Alpträume auf, in denen sich vermutlich die Sorge um den Erfolg der Operation und der eigenen Gesundheit widerspiegelt. Eine Sonderform dieser Alpträume stellt das so genannte Oneiroid dar (Schmidt-Degenhard, 1992), bei dem es sich um traumartig veränderte Wachbewusstseinszustände handelt, die vor allem nach Lähmungen, aber auch schweren und langanhaltenden Operationen auftreten können und sich neben den halluzinatorischen Zuständen im Wachen auch in Träumen und Alpträumen manifestieren können. Ebenso können Drogen oder Medikamente zum Auftreten von Alpträumen führen, wie z. B. Amphetamine, Kokain, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder Beta-Blocker (vgl. Kapitel 2).
Schließlich und häufig finden sich Alpträume bei Patientinnen und Patienten mit einer PTBS, wo die Alpträume zu einem wesentlichen Kriterium der Störung selbst zählen (nach ICD-10 und DSM-5). Im Rahmen einer PTBS können zwei Formen von Alpträumen auftreten, zum einen sogenannte posttraumatische Wiederholungen, zum anderen auch „normale“ bzw. idiopathische Alpträume. Auch Mischformen, in denen das Thema des Traumas zwar eine Rolle spielt, es sich aber in der Handlung des Alptraums nicht direkt widerspiegelt oder in abgewandelter Form auftritt, sind möglich. Das Besondere an den wiederkehrenden Alpträumen im Sinne von posttraumatischen Wiederholungen ist, dass diese Träume in der Regel gleich sind und das erlebte Trauma immer wieder geträumt wird; ähnlich wie dies in den Flashbacks der PTBS-Patientinnen und Patienten geschieht. In der abgewandelten Form der posttraumatischen Alpträume ist das erlebte Trauma das Grundmotiv, das aber in variierender Form in den Träumen auftritt. Zum Beispiel träumt eine Person, die einen Verkehrsunfall mit einem Auto hatte, von Unfällen mit Autos, aber auch, dass sie als Fußgängerin von Autos überfahren wird. Auch wenn die idiopathischen Alpträume häufig zwar bei einer Person ein bestimmtes Thema zum Inhalt haben (z. B. Verfolgung oder Versagen), so unterscheidet sich die Ausgestaltung dieses Themas in der Regel von Traum zu Traum. Das ist bei den posttraumatischen Wiederholungen in der Regel seltener der Fall, wo der Alptraum die traumhafte Wiederholung eines tatsächlich erlebten Ereignisses ist. Ein typischer Traum einer Patientin, in dem sie ihre Traumatisierung immer wieder erlebte, ist in dem nachfolgenden Beispiel geschildert.
Fallbeispiel: Frau T.
Frau T., eine Frau mittleren Alters, wurde in ihrer Wohnung von zwei Männern überfallen, einen Tag festgehalten, wiederholt vergewaltigt und sadistisch gequält. In ihren fast jede Nacht auftretenden Alpträumen träumt sie die Situation, wie sie gefesselt ist und vergewaltigt wird. Besonders intensiv träumt sie immer wieder die Situation, in der sie nackt und gefesselt auf ihrem Bett liegt und einer der beiden Männer ein Messer aus ihrer Küche holt und ihr damit Schnitte in den Oberschenkel macht. Als sie aufschreit, steckt ihr der andere Mann einen Knebel in den Mund. Dann machen die Männer auch Schnitte in den Bauch. Sie sieht ihr Blut auf das Bettlaken fließen, dann wacht sie auf.
1.2.2 Inhalte von Alpträumen
Die ältere Bezeichnung „Angstträume“ für die Alpträume lässt schon klar erkennen, dass Angst ein wesentlicher Affekt während der Alpträume ist, sodass angstauslösende Themen einen zentralen Inhalt von Alpträumen darstellen. Allerdings sind angstauslösende Situationen nur ein – wenn auch ein sehr wichtiges – Thema, das in Alpträumen auftreten kann. Daneben können auch Themen, die zu intensiver Schuld, Verzweiflung, Ekel, Traurigkeit oder Ärger führen, Gegenstand von Alpträumen sein (Rose, Perlis & Kaszniak, 1992). Während in Alpträumen häufig das eigene Leben oder das eigene Ich bedroht sind, sind Alpträume, in denen der Träumende Zeuge von Gewalt oder Aggressionen gegen andere wird, ebenfalls nicht selten (Schredl, 2008). Da neben der Angst auch viele andere aversive Emotionen in Alpträumen auftreten können, schlagen |16|Zadra, Pilon und Donderi (2006) vor, dass alle Trauminhalte, die zu negativen Affekten führen, unter die Alpträume zu subsumieren sind.
Aber was unterscheidet den Inhalt von Alpträumen eigentlich vom Inhalt normaler Träume? Das wesentliche (psychologische) Moment der Alpträume, das sie von anderen Träumen unterscheidet, ist die erlebte Bedrohung der Person, des Selbstkonzepts oder der Identität des Träumenden (McNamara, 2008). Dies äußert sich aber nicht nur in den berichteten Inhalten selbst, sondern auch in dem sprachlichen Report der Alpträume. So ist etwa die Anzahl der Worte, mit denen Alpträume berichtet werden, um etwa ein Drittel geringer als bei anderen Träumen. Auch dürfte es nicht überraschend sein, dass die Berichte über Alpträume in kürzeren Sätzen erfolgen, deutlich seltener als Frage formuliert sind, deutlich mehr negative Emotionen und weniger positive Emotionen beinhalten, häufiger im Präsens berichtet werden und mehr körperliche Zustände benennen als die Traumberichte anderer Träume.
Auch wenn die Inhalte von Alpträumen sehr verschiedenartig sind, so lassen sie sich doch bestimmten Bereichen zuordnen. Studien zu den Inhalten von Alpträumen kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass die häufigsten Alptraumthemen Verfolgung, Tod anderer, der eigene Tod, Fallen, eigene Verletzungen, furchterregende Personen und furchterregende Monster sind (Schredl, 2007/2008). Damit unterscheiden sich Alpträume nicht nur in den eigentlichen inhaltlichen Themen von anderen Träumen, sondern auch in differenzierteren inhaltlichen Aspekten. Hall und van de Castle (1966) haben Normen zur Inhaltsanalyse von Träumen vorgelegt. Entsprechend dieser Normen kommen in Alpträumen im Vergleich zu anderen Träumen signifikant häufiger Männer vor, die auftretenden Personen sind seltener bekannte oder vertraute Personen, sehr selten sogar tatsächliche Freunde, die sozialen Interaktionen sind häufiger durch Aggression und Feindseligkeit gekennzeichnet. Diese Merkmale kommen dadurch zustande, dass in Alpträumen häufig Aggressoren auftreten, die männlichen Geschlechts sind, diese sind oft auch nicht menschliche Kreaturen. Bei den von Hall und van de Castle (1966) aufgeführten großen Traumthemen (Aggression, Freundlichkeit, Sexualität, Unglück, Glück, Erfolg, Versagen und Anstrengung, ein bestimmtes Ziel zu erreichen), unterscheiden sich die Alpträume von anderen Träumen im Sinne signifikant erhöhter Aggressivität, Sexualität, erhöhten Unglücks, Erfolgs (durch aggressive Akte), Versagen und Anstrengung, ein bestimmtes Ziel zu erreichen (McNamara, 2008). Die geplanten aggressiven oder sexuellen Angriffe in Alpträumen, die oft mit hoher Beharrlichkeit durchgeführt werden und eine Anstrengung erkennen lassen, ein bestimmtes (aggressives) Ziel zu verfolgen, führen oft zu dem intendierten Ziel, sodass dies zu der hohen Quote an Erfolg bzw. Versagen seitens des attackierten oder verfolgten Träumers führt.
Eine besondere Form der aggressiven Akte in Alpträumen stellen die sogenannten Täteralpträume dar. Während in den meisten Alpträumen die träumende Person das Opfer der gewalttätigen und aggressiven Akte ist, wird sie in den Täteralpträumen selbst zum Aggressor und verletzt, beleidigt oder tötet andere Personen im Traum (Mathes et al., 2018). Täteralpträume sind gar nicht so selten und machen etwa 18 % der Alpträume von Menschen aus, die häufig unter Alpträumen leiden (Mathes et al., 2018). Es ist naheliegend, dass das Erleben der eigenen Person als Täter in einem Traum zu einer besonderen Belastung führen kann.
1.3 Epidemiologie und Verlauf
Die epidemiologischen Angaben über die Prävalenz von Alpträumen in der Bevölkerung variieren je nach Untersuchung. Spoormaker, Schredl und van den Bout (2006) kommen nach einer Übersicht über Studien zur Prävalenz der Alpträume zu dem Resultat, dass die Prävalenzraten für die erwachsene Allgemeinbevölkerung zwischen 1 und 8 % liegen. Eine mittlere Prävalenzrate von 5 % für das wiederholte Auftreten von Alpträumen bei Erwachsenen scheint ein sehr realistischer Wert für die Allgemeinbevölkerung zu sein und wurde mehrfach in verschiedenen Ländern repliziert (Bixler, Kales, Soldatos, Kales & Healey, 1979; Janson et al., 1995; Ohayon, Morselli & Guilleminault, 1997). Im Gegensatz zur Allgemeinbevölkerung liegt die Prävalenzrate bei Studierenden höher (das durchschnittliche Alter der Studierenden ist aber auch geringer). So gaben 10 Prozent einer großen studentischen Stichprobe an, mindestens einmal pro Monat einen Alptraum zu haben (Belicki & Belicki, 1982; Levin, 1994). Bei klinischen Stichproben, beispielsweise bei Patientinnen und Patienten mit Substanzmissbrauch, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder einer Störung aus dem schizophrenen Formenkreis sind die Prävalenzraten weit höher (Krakow & Zadra, 2006). Trotz der nicht geringen Prävalenzraten ist die Rate derer, die wegen ihrer Alpträume Hilfe suchen, gering (Schredl & Göritz, 2014; Thünker, Norpoth, von Aspern, Özcan & Pietrowsky, 2014).
Die Häufigkeit berichteter Alpträume ist bei Kindern sehr hoch und geht nach der Pubertät und Adoleszenz deutlich zurück. Retrospektiv geben 70 bis 90 % aller jungen Erwachsenen an, sich an Alpträume in |17|ihrer Kindheit zu erinnern. Die Prävalenz von Alpträumen ist bei Kindern zwischen sechs und zehn Jahren am höchsten, wobei Mädchen etwa ab dem Alter von zehn Jahren öfter unter Alpträumen leiden als Jungen (Schredl & Pallmer, 1998). Allerdings gelten Alpträume bei Kindern nicht als pathologisch. Im Erwachsenenalter nimmt die Alptraumhäufigkeit mit zunehmendem Lebensalter weiter ab (Schredl, 1999) und im hohen Erwachsenenalter treten Alpträume bei ansonsten gesunden Personen sehr selten auf.