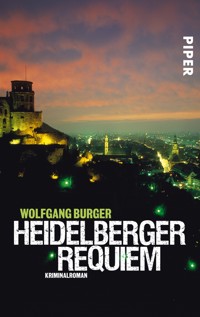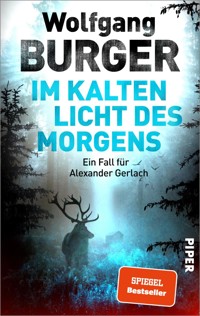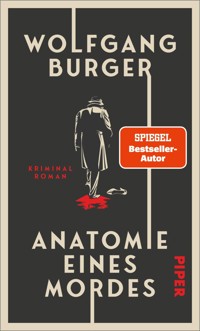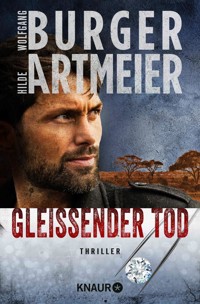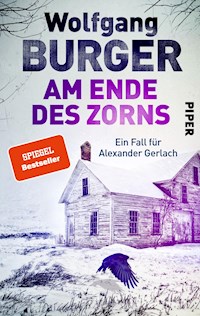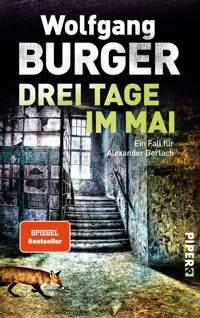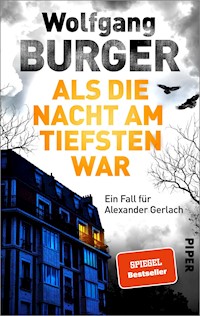
17,48 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Gerlachs Leben ist in Gefahr!
Nach einem Date erwacht Kripochef Gerlach verwirrt und mit Erinnerungslücken im Hotel. Seine Begleitung Nora Vestergaard ist offenbar abgereist und reagiert nicht auf seine Anrufe. Irritiert von Blutspuren im Bad, wäscht Gerlach diese fort. Zu spät fragt er sich, ob sie von Nora stammen. Ist ihr etwas zugestoßen? Kurz darauf hat Gerlach einen schweren Autounfall, der sich schon bald als Mordversuch entpuppt. Wegen seiner Verletzungen dienstunfähig, macht er sich im Alleingang auf die Suche nach der verschwundenen Nora. Was er herausfindet, verschlägt selbst dem erfahrenen Ermittler den Atem.
»So schreibt man Krimis!« Badische Neueste Nachrichten
Wolfgang Burger lebt in Karlsruhe und Regensburg, ist promovierter Ingenieur und seit 1995 als Autor tätig. Seine Gerlach-Krimis wurden bereits zweimal für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Als die Nacht am tiefsten war« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildung: Jordi O. Romero/Getty Images und Shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meine treuesten Fans Mechthilde und Gaby
Er ist ein hässlicher, ein angsterregender Riese.
Eine Fratze wie vom Plakat eines billigen Zombiefilms.
Der Riese scheint überall zugleich sein zu können, schwebt mal über mir, mal unter mir. Als segelten wir durch einen grenzenlosen Raum. Umkreisten einander wie eine Sonne und ihr verrückt gewordener Planet. Oder fallen wir? In einen bodenlosen Abgrund?
Sogar seine Form kann er verändern, nach Belieben größer und kleiner werden. Manchmal sieht er fast aus wie ein Mensch, dann wieder wie die missratene Karikatur eines Monsters. Nur seine Miene, die bleibt immer gleich – von Hass verzerrt.
Er scheint mich anzuschreien.
Aber, seltsam, ich höre gar nichts.
Bin ich plötzlich taub?
Ist er stumm?
Und weshalb hat er nur ständig diese lächerliche Pistole auf meine Stirn gerichtet?
Mir ist so übel.
Ich will schlafen.
Er soll endlich seine blöde Waffe wegtun.
Ich will meine Ruhe haben. Und dieses schreckliche Gewirbel soll aufhören.
Da drückt er ab.
Aber ich lebe einfach weiter.
Merkwürdig.
Nur mein Kopf scheint ins Unermessliche zu wachsen. Eine Weltkugel, angefüllt von einem dumpf pulsierenden, ungeheuren Schmerz. Sie bläht sich weiter und weiter auf, wird gleich zerspringen.
Mit einem Mal kommt auch noch Licht dazu. Ein kristallscharfes, hundsgemeines Licht, das meine Netzhäute zu zerschneiden droht.
Wird nicht, wenn man stirbt, alles dunkel?
Dunkelheit, ja, das wäre herrlich. Keine Kopfschmerzen mehr. Kein Licht, kein …
1
Ich schwebte keineswegs als Halbtoter durchs Weltall, sondern lag in einem Bett. Allerdings nicht in meinem eigenen, wie mir erst allmählich bewusst wurde. Der Raum um mich herum war mir fremd, schien ein Hotelzimmer zu sein. Durch einen schmalen Spalt zwischen schweren Vorhängen stach mir Licht in die Augen, Sonnenlicht. Das mich aus dem Schlaf gerissen hatte. Und glücklicherweise auch aus diesem abscheulichen Albtraum.
Da war kein Riese.
Und natürlich auch keine Waffe.
Ich lag fest und sicher auf einer für meinen Geschmack ein wenig zu weichen Matratze und hatte mörderische Kopfschmerzen. Höllische, apokalyptische Kopfschmerzen. Außerdem war da diese Übelkeit, die leider nicht Teil eines Traums, sondern sehr real war. Das Bett begann zu schwanken, sich von allein zu drehen.
Ging das etwa schon wieder los?
Nur nicht noch einmal einschlafen. Wach bleiben! Außerdem musste ich … dringend …
Benommen strampelte ich die Decke weg, wälzte mich von meinem Lager, kam auf die Füße, ohne zu verunglücken, wusste merkwürdigerweise sofort, wo das Bad war, erreichte stolpernd die Kloschüssel und übergab mich mit einem heftigen Schwall.
Noch einmal.
Und noch einmal.
Seit dem legendären Besäufnis nach der letzten Prüfung an der Hochschule der Polizei war mir nicht mehr so schlecht gewesen.
Schon wieder begann ich zu würgen und zu spucken, obwohl mein Magen längst leer war.
Irgendwann, nach quälend langen Minuten, ließen Übelkeit und Schwindel nach. Schweiß stand auf meiner Stirn. Meine Hände waren eiskalt und zitterten. Ich trat zum Waschbecken, warf mir mit fahrigen Bewegungen kaltes Wasser ins Gesicht. Hielt einen der beiden roten Zahnputzbecher unter den Hahn, wollte trinken, doch er entglitt meiner Hand, kullerte irgendwo am Boden herum. Wie gut, dass das dumme Ding nicht zerbrechlich, sondern aus solidem Kunststoff war. Ich ließ es liegen, füllte den anderen Becher, trank gierig.
Noch einmal.
Und noch einmal.
Dann erst wagte ich einen Blick in den Spiegel und erschrak. Das Gesicht des Penners, der mich aus trüben Augen anstierte, war grünlich fahl und unrasiert, um die Augen dunkle Schatten, der Blick einer gequälten Kreatur. Die Erinnerung an die tödliche Angst in meinem Albtraum steckte mir noch in den Knochen.
Wo, zur Hölle, war ich überhaupt?
Nur zögernd und widerwillig kehrte die Erinnerung zurück.
Nora.
Unser Wochenende zu zweit.
Ein verschwiegenes Hotelzimmer weit entfernt von Heidelberg. Darauf hatte sie merkwürdigerweise Wert gelegt, dass das Hotel nicht in der Stadt war, in der wir beide lebten, nicht einmal in der näheren Umgebung. Mir war alles recht gewesen, wenn ich nur endlich eine Nacht mit Nora verbringen durfte. Wenn diese merkwürdige Sperre endlich durchbrochen wurde, die bisher verhindert hatte, dass wir uns so nah kamen, wie es sich für ein Liebespaar nun einmal gehört.
Moment mal!
Ich riskierte es, das Waschbecken loszulassen, stand immer noch unsicher auf den Beinen. Ein letzter Kontrollblick. Sämtliche Verwüstungen beseitigt? Das Waschbecken sah ordentlich aus. Auch am Boden war nichts, abgesehen von der Wasserpfütze, die ich verursacht hatte. Nur zur Sicherheit drückte ich die Toilettenspülung ein zweites Mal. Dann zurück ins dunkle Schlafzimmer, und tatsächlich: keine Nora.
Hatte sie beschlossen, mich meinen Rausch ausschlafen zu lassen, und war allein frühstücken gegangen? Oder hatte sie versucht, mich zu wecken, jedoch keinen Erfolg gehabt?
Ein Blick auf die Uhr – halb elf. So lange hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Bestimmt kam sie gleich zur Tür herein, satt, fröhlich und zufrieden. Glücklich nach dem harmonischen Abend gestern, unserem kleinen Verdauungsspaziergang in der milden Luft des ersten Frühlingsabends, der diesen Namen verdiente. Ich war nackt, der Pyjama lag zerknäult am Fußende des Betts. Das Laken war zerwühlt. Waren wir …? Hatte ich überhaupt noch gekonnt, so besoffen, wie ich gewesen war?
Denn das war ja der unausgesprochene Plan gewesen: Nachdem wir uns nun schon fast fünf Monate kannten, endlich intim zu werden. So hatte ich mir die Sache zumindest vorgestellt. Und natürlich war ich davon ausgegangen, dass Nora dieselben Erwartungen mit unserem Kuschelwochenende verband.
Und nun also das.
Was war ich nur für ein Idiot!
Stöhnend sank ich aufs Bett.
Gestern Abend unser Candle-Light-Dinner im urigen Restaurant im Erdgeschoss. Lustig war es gewesen, heiter, stimmungsvoll. Alles, wie es sein sollte: weiches Licht, leise Musik, feines Essen, Wein. Von Letzterem offenbar entschieden zu viel.
Was für ein Absturz, was für eine Blamage! Immer noch schwankte das Zimmer. Immerhin hatte die Übelkeit nachgelassen. Das kalte Wasser hatte gutgetan.
Endlich wären wir ein Paar geworden, aber ich Hornochse hatte es wohl gründlich vermasselt. Dabei konnte ich mich gar nicht erinnern, so viel getrunken zu haben. Was aber auch kein Wunder war, ich konnte mich ja ohnehin an kaum etwas erinnern, was gestern Abend geschehen war. Nach dem Essen hatten wir beschlossen, uns noch ein wenig die Beine zu vertreten, das immerhin wusste ich noch. Aber weder, wie wir ins Hotel zurückkamen, noch, wann wir unser Zimmer betraten, hatte Spuren in meinem Gedächtnis hinterlassen.
Was musste Nora nur von mir denken? Zum Glück kannten wir uns schon ein wenig länger, waren öfter zusammen ausgegangen, sodass sie wusste, dass sie sich nicht mit einem Alkoholiker eingelassen hatte. Bisher hatte sie nicht viel Glück mit Männern gehabt. Beim Essen gestern Abend hatte sie ungewohnt freimütig erzählt. Von diversen Katastrophenbeziehungen, zu denen sie offenbar neigte. Von zwei Ehen, die beide nicht lange hielten …
Aber …
Was war das?
Ihr Koffer war weg!
Noras Koffer war nicht mehr da.
Auch ihre diversen Tübchen, Flakons und Döschen im Bad waren verschwunden.
Mein Köfferchen lag dagegen noch auf dem Stuhl, auf dem ich es gestern deponiert hatte. Da Noras Koffer größer war als meiner, hatte ich ihr die dafür vorgesehene Ablage überlassen und …
Mit zwei unsicheren Schritten war ich am Fenster, schob den Vorhang ein wenig zur Seite und blinzelte in die immer noch schmerzhafte Helligkeit hinaus. Der Parkplatz. Dort, in der zweiten Reihe hatte sie ihren kleinen Volvo abgestellt. Die Sonne hatte sich gnädigerweise gerade hinter einer Wolke versteckt, weshalb die Helligkeit meinen empfindlichen Augen nicht mehr gar so sehr zusetzte.
Auch der Volvo war nicht mehr da.
Nora war nicht frühstücken gegangen, sondern hatte es vorgezogen, das Weite zu suchen. Es würde mich einen ziemlich großen Blumenstrauß und eine Menge zärtliche Worte kosten, mich wieder mit ihr zu versöhnen.
Erschüttert sank ich aufs Bett zurück. Hielt mir den Kopf, der mit einem Mal wieder heftiger schmerzte. Mein Puls holperte, und mein Magen begann schon wieder, unruhig zu werden.
Nora hatte darauf bestanden, dass wir unsere erste gemeinsame Nacht auf neutralem Boden verbrachten. Weder in ihrer Wohnung noch in meiner könne sie sich so unbeschwert fühlen wie in diesem Hotel, wo wir mit Sicherheit niemanden treffen würden, der uns kannte. Vielleicht wurde sie laut beim Orgasmus, vielleicht war es einfach nur ein Spleen, eine Schrulle. Vielleicht wollte sie, dass es beim ersten Mal besonders feierlich zuging. Mir war alles von Herzen gleichgültig gewesen, wenn nur endlich dieser unfreiwillige Zölibat ein Ende fand, unter dem ich seit Monaten litt. Genau genommen seit der überraschenden Trennung von Theresa Anfang Januar. Jetzt war Mai. Wenn ich nicht irrte, der elfte. Sonntag? Richtig, Sonntag.
Sollte ich frühstücken gehen? Unsinn. Ich würde jetzt ohnehin nichts herunterbekommen. Am besten, ich packte meinen Kram zusammen und verschwand so unauffällig wie möglich von der Bildfläche. Es war nicht besonders ruhmreich, mit einer schönen Frau zusammen ein Hotelzimmer zu beziehen und es am nächsten Morgen allein wieder zu verlassen. Das Zimmer war zum Glück schon bezahlt, das hatte Nora gleich bei der Ankunft erledigt, per Kreditkarte. Eigentlich hatte ich das übernehmen wollen, aber sie meinte lachend, Anwältinnen verdienten mehr als Polizeibeamte, und ich könne ja als Ausgleich später das Essen bezahlen.
Außerdem, fiel mir ein, dürfte es nach zehn ohnehin kein Frühstück mehr geben. Nein, besser, ich sah zu, dass ich wegkam. Irgendwo unterwegs würde ich einen starken Kaffee trinken. Zu essen brauchte ich vorerst nichts.
Ich erhob mich, atmete einige Male tief durch. Das Kind war in den Brunnen gefallen, und Selbstmitleid brachte mir Nora nicht zurück. Das Hammerwerk in meinem Kopf schien zu neuen Höchstleistungen aufzulaufen.
Die Sachen, die ich gestern Abend getragen hatte, hingen über der Lehne des Sesselchens am Fenster. So ordentlich und akkurat gefaltet, wie ich es nie im Leben tun würde. Hatte Nora mich zu allem Elend auch noch ausziehen und wie ein lallendes Kleinkind ins Bett bringen müssen? Gott im Himmel, wie konnte ein Mensch nur so dämlich sein!
Wütend stopfte ich den Pyjama in meinen Rollkoffer und spürte dabei einen Schmerz an der rechten Hand. Die Knöchel waren ein wenig gerötet und druckempfindlich. Fast, als hätte ich jemandem einen kräftigen Faustschlag verpasst … Doch nicht etwa …?
Schon wieder musste ich mich setzen, knetete die schmerzende Hand, wodurch nichts besser wurde. Was, um alles in der Welt, war hier vorgefallen? Sollte ich Nora wirklich geschlagen haben?
Das war …
Das konnte nicht …
So etwas hatte ich noch nie …
Schon wurde mir wieder schlecht.
Minuten später war ich – nach einer eher symbolischen Dusche – fertig angekleidet. Inzwischen konnte ich schon wieder, fast ohne zu schwanken, stehen und gehen. Ich zog den Reißverschluss des bordeauxroten Koffers zu, wollte … doch halt! Leise fluchend ging ich ein letztes Mal ins Bad. Zahnbürste, Zahnpasta, Deoroller, Kamm …
Aber was war das?
An den Fliesen über und neben dem für meinen Geschmack etwas zu pompösen, möglicherweise sogar echt vergoldeten Wasserhahn waren rote Spritzer zu sehen. Nicht viele, einige kleine Spuren nur. Ich suchte meine Brille, fand sie nach weiteren Flüchen in der Brusttasche meines Jacketts, das ordentlich auf einem Bügel an der Garderobe hing. Es schien tatsächlich Blut zu sein. Eingetrocknetes Blut. Auf der Ablage war sogar ein etwas größerer Spritzer. Das Becken selbst schimmerte blütenweiß.
Sicherheitshalber überprüfte ich, ob das Blut von mir stammen könnte. Nicht auszuschließen, dass ich mich verletzt hatte in meinem desolaten Zustand. Meine Hände waren bis auf die wunden Knöchel unversehrt, die Arme, auch im Gesicht keine Schrammen, nichts tat mir weh. Abgesehen vom Kopf, natürlich.
Das Rote konnte also nur Noras Blut sein.
Ein Klopfen an der Zimmertür riss mich aus meiner Erstarrung.
Die Putzfrauen.
Ich hörte sie im Flur reden und lachen, hätte das Zimmer vermutlich längst räumen sollen.
»Jetzt nicht!«, rief ich erschrocken und begann hastig, mit zwei, drei Händen voll Wasser die verräterischen Flecken wegzuspülen. »Noch fünf Minuten, bitte!«
Ich wischte mit einem der weißen Handtücher nach. Nun sah das Bad fast wieder aus wie neu.
Nichts lag mehr herum, sämtliche Bügel und Fächer im Schrank waren leer.
Dann also auf in den Kampf. Hoffentlich lief ich nicht allzu vielen Menschen über den Weg. Das Letzte, was ich jetzt brauchte, waren Fragen nach meinem Befinden und ob ich gut geschlafen hatte. Jackett an, Mantel über den Arm, Koffer greifen, Tür auf, todesmutig hinaus in die feindliche Welt.
Den Schlüssel ließ ich stecken. Die beiden weiblichen Reinigungsfachkräfte hatten gerade am Ende des langen Flurs zu tun, unterhielten sich fröhlich in einer slawisch klingenden Sprache, lachten in gedämpfter Lautstärke. Über den frisch gesaugten, die Geräusche meiner Schritte schluckenden Teppichboden schlurfte ich zu den Lifts, drückte mit immer noch eiskaltem Finger den Knopf. An der Anzeige sah ich, wie der linke Aufzug sich in Bewegung setzte. Er kam von oben, aus dem dritten Obergeschoss. Ich befand mich im ersten. Hoffentlich war er leer. Er stoppte im zweiten. Fuhr kurz darauf weiter, hatte wohl jemanden aufgenommen, der ebenfalls nach unten wollte.
Als der Gong ertönte und die golden glänzende, makellos saubere Tür zur Seite fuhr, war ich schon im Treppenhaus. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich hier, hundertfünfzig Kilometer von Heidelberg entfernt, jemand erkannte, war zwar gering, aber sicher war sicher. Nach diesem Desaster wollte ich überhaupt niemandem begegnen, gleichgültig, ob er mich kannte oder nicht. Ich erreichte das Erdgeschoss, wo sich Restaurant und Rezeption befanden, roch Kaffeeduft, hörte Geschirrgeklapper, stieg weiter ins Tiefgeschoss hinab, das den Pool, die Saunen und andere Wellnesseinrichtungen beherbergte. Dort gab es eine Tür ins Freie, hatte ich gestern Nachmittag gesehen, als ich mit Nora zusammen hier war. Erst in der Sauna und später im Whirlpool. Lange Zeit waren wir ganz allein dort gewesen, und es war sehr lustig und am Ende sogar ziemlich erotisch zugegangen.
Gott, war das lange her!
Auch jetzt schien der Wohlfühlbereich verwaist zu sein. Der einzige Mensch, den ich sah, war eine dralle Frau, die den edel gefliesten Boden wischte. Glücklicherweise hatte sie Stöpsel in den Ohren, hörte ihre Musik und nicht mich.
Die Tür war unverschlossen, halleluja! Die Luft, die mir entgegenströmte, herrlich kühl und frisch, und meinem Kopf ging es gleich ein wenig besser. Eine kleine Treppe führte zum Parkplatz hinauf, fünf Stufen nur, dennoch eine Herausforderung für meinen geplagten Schädel, dann stand ich auf dem Asphalt. Ein Hahn krähte in der Nähe, ein Hund bellte irgendwo weiter weg, landwirtschaftliche Gerüche strichen mir um die Nase. Und dort stand er, mein Citroën, zwischen einem schwarzen Protzmercedes und einem blauen Kleinwagen. Schon saß ich drin. In der Ferne bimmelte eine Kirchenglocke.
Es war Noras Vorschlag gewesen, mit zwei Autos zu fahren. Als ich sie fragte, weshalb, hatte sie spitzbübisch grinsend geantwortet, für den Fall, dass wir uns zerstritten. Darüber hatte ich herzlich gelacht.
Nun noch ein kräftiger Kaffee und dann nach Hause. Vielleicht gelang es mir sogar, bei dieser Gelegenheit eine Schmerztablette zu schnorren? Wie viel Alkohol ich wohl noch im Blut hatte? Gleichgültig jetzt, ich musste weg von hier. Allzu weit konnte es ja nicht sein bis zum nächsten Café. Der Bayerische Hof lag zwar am Rand des Städtchens, am Hang mit Blick auf den Main und die Hügel am anderen Ufer, aber irgendetwas würde sich auf dem Weg zur Autobahn schon finden.
Während ich mich in den spärlichen Verkehr auf der Durchgangsstraße einreihte, kam mir endlich der naheliegende Gedanke, dass Nora natürlich ihr Handy mit sich führte. Warum hatte ich sie nicht längst angerufen? Je eher ich das peinliche Gespräch hinter mich brachte, desto besser.
Auf den Gehwegen rechts und links sonntäglich herausgeputzte Menschen, überwiegend Ältere, vermutlich unterwegs vom Gottesdienst zum Sonntagsbraten. Links entdeckte ich einen Bäckerladen mit Stehcafé. Kein Licht. Sonntags geschlossen. Rechts noch ein Hotel, ein kleineres, lauschigeres, das mir besser gefallen hätte als der anonyme Kasten, den Nora ausgewählt hat. Bald darauf ein großer Supermarkt, ein Baumarkt, das Ortsschild, vielen Dank für Ihren Besuch in Marktheidenfeld.
Dann eben im nächsten Ort. Oder im übernächsten.
Ich war immer noch ziemlich angeschlagen, stellte ich fest, hatte Probleme, klar zu sehen und die Spur zu halten. Ließ das Fenster herunter. Frische Luft wirbelte herein, Kalte Luft. Gut. Ich schüttelte den Kopf. Nicht gut.
Nach zehn Minuten Fahrt hatte ich immer noch kein Café gefunden, dafür kam die Autobahnauffahrt in Sicht. Fast hätte ich die falsche Einfahrt genommen, aber im letzten Moment wurde mir klar, dass Frankfurt nicht meine Richtung war. Auf dem Weg wäre ich zwar ebenfalls nach Hause gekommen, möglicherweise sogar schneller, aber ich scheute das vielspurige Autobahndurcheinander rund um die Mainmetropole. Richtung Würzburg und von dort auf der A 81 nach Heilbronn war besser. Dort kannte ich mich aus.
Die A 3 war hier dreispurig, breit, nur wenig Verkehr, genau richtig für mich. Bloß die Sonne war ein Problem, kam immer wieder von vorn und schmerzte in meinen trockenen Augen. Schließlich schaffte ich es, die Sonnenbrille aus der Ablage zu kramen und aufzusetzen, ohne von der Straße abzukommen. Im Grunde hätte ich in meinem Zustand überhaupt nicht Auto fahren dürfen. Aber auf der fast leeren Autobahn war die Gefahr gering, in eine kritische Situation zu geraten, und die nächste Gelegenheit für einen Kaffee und vielleicht auch eine Kopfschmerztablette konnte nicht mehr weit sein.
Unversehrt erreichte ich das Autobahndreieck Würzburg West, Richtung Heilbronn, eine lang gezogene Kurve, geschafft!
Wenn ich mich richtig erinnerte, sollte nun bald ein Rasthof kommen, und Rasthöfe hatten auch sonntags geöffnet. Auf der A 81 war ebenfalls wenig Betrieb. Netterweise bewölkte sich der Himmel mehr und mehr, sodass ich die Sonnenbrille wieder abnehmen konnte.
Das Geradeausfahren wollte mir immer noch nicht so recht gelingen. So ging ich vom Gas und hielt mich brav rechts. Offenkundig war es doch weiter bis zur nächsten Kaffeequelle, als ich gehofft hatte. Ich dachte an Nora, an gestern Abend, an meine Schande, meine Dummheit, und übersah bei all der Grübelei die Ausfahrt zum Rasthof Ob der Tauber.
Ich ärgerte mich ein Weilchen, was mir half, mich wach zu halten, fuhr weiter und weiter, und erst nachdem ich fast eine halbe Stunde im Rentnertempo dahingezuckelt war, kam das ersehnte Hinweisschild – noch fünf Kilometer bis zur nächsten Kaffeemaschine. Dieses Mal würde ich nicht vorbeifahren.
2
Ein großer Cappuccino und ein noch größeres Glas Wasser standen vor mir. Der Rasthof war angenehm schwach besucht, und mein Kopf schien allmählich wieder wie gewohnt zu funktionieren. Nur der Magen war noch ein wenig verstimmt. Vielleicht sollte ich doch einen Happen essen? Später. Erst musste ich telefonieren. Inzwischen war es halb zwölf, und Nora würde Gott weiß was von mir denken, wenn ich nichts von mir hören ließ.
Ich wählte ihre Nummer, trank einen Schluck brühheißen Kaffee, während es tutete. Und tutete. Und tutete. Schließlich die Automatenstimme: »Sie sind verbunden mit der Mailbox der Rufnummer …«
Sie schien ja mächtig sauer auf mich zu sein. Jetzt half nur Beharrlichkeit. Zeigen, dass es mir ernst war, dass es mir leidtat. Auch wenn ich noch immer nicht wusste, was ich mir eigentlich hatte zuschulden kommen lassen. Dass ich mich in meinem Überschwang sinnlos betrunken hatte, klar. Aber sonst? Wenn ich mich doch nur erinnern könnte, was in der vergangenen Nacht vorgefallen war, verflucht noch eins! Sicherheitshalber schrieb ich Nora noch eine Nachricht mit der Bitte um Rückruf und vielen Blümchen, Herzchen und Smileys.
Es roch nach Reinigungsmitteln und Gebratenem. Bald war Mittag, offenbar wurde auf Vorrat gekocht. Aus der Küche drangen scheppernde Geräusche und grobe Stimmen.
Hinter dem Tresen wurde dagegen gelacht und geschäkert.
Leuchtende Bildschirme priesen farbenfroh die Angebote des Tages an. Hin und wieder gab die große, chromblitzende Kaffeemaschine zischende Geräusche von sich. Ein junges Pärchen stolperte herein, fragte, ob es vegane Hamburger gebe. Gab es nicht. Sie trollten sich wieder.
Ich war sonst wirklich nicht der Typ, der sich bis zur Besinnungslosigkeit betrank. Und noch nie im Leben hatte ich eine Frau geschlagen. Ich hatte so darauf gebrannt, endlich mit Nora zu schlafen. Immer, wenn ich dachte, wir wären so weit, hatte sie einen Rückzieher gemacht. Behauptete, sie brauche noch Zeit nach der Trennung von ihrem zweiten Ehemann. Nun waren wir zu diesem Hotel gefahren, auf Noras Wunsch in zwei Fahrzeugen. Vielleicht eine Marotte von ihr, hatte ich gedacht, vielleicht brauchte sie wirklich die Gewissheit, jederzeit ihre Sachen packen und abreisen zu können. Was sie nun ja auch getan hatte.
Natürlich hatten wir Wein getrunken. An den Hängen des Mainufers wuchsen Reben, und die Produkte der dortigen Winzer konnten sich sehen und schmecken lassen. Wir waren abwechselnd heiter, zärtlich und ernst gewesen. Nora hatte mir vieles von sich erzählt, was ich bislang nicht wusste. Für mich hatte es sich angefühlt, als wollte sie unsere Beziehung auf eine neue Stufe heben. Auf eine Stufe des Vertrauens, das sie offenbar brauchte, bevor sie sich hingab. Im Grunde war mir das sogar sympathisch gewesen. Ich war zu alt für diese Tinder-Kultur, sich per Handy zu einem halbstündigen Spaziergang zu verabreden, anschließend zusammen in die Kiste zu springen – und dann Ciao, Bella. Das war etwas für meine Töchter beziehungsweise für Sarah, denn Louise war ja schon seit Längerem in festen Händen.
In den vergangenen Monaten waren Nora und ich über erotisches Geplänkel nicht hinausgekommen. Nur selten hatte die hungrige Zärtlichkeit zweier einsamer Menschen uns fast übermannt, aber am Ende hatten wir doch nicht zusammenfinden können. Ja, ihr Zögern hatte mich zu ihr hingezogen, mein Begehren gesteigert. Mich irgendwann aber auch genervt.
Auch ich hatte erzählt. Von Vera, der Mutter meiner Zwillinge, die vor vier Jahren völlig überraschend gestorben war. Von Theresa, die mir vor wenigen Monaten wegen eines Krimiautors namens Jörg den Laufpass gegeben hatte, eine Kränkung, die ich noch immer nicht ganz verwunden hatte. Nora hatte ich bei der Suche nach der neunjährigen Marie kennengelernt, die aus gewissen Gründen über Weihnachten bei uns wohnte, mehrfach davonlief und wieder eingefangen werden musste. An dem Abend, als ich zum ersten Mal in Noras hypnotische Augen sah, war Marie gerade wieder einmal verschwunden gewesen, und ich hatte an den Türen der Nachbarhäuser geläutet, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der das freiheitsliebende Mädchen gesehen hatte. Der mir sagen konnte, in welche Richtung es dieses Mal gelaufen war.
Bei dieser Gelegenheit hatte ich bei Nora geklingelt und mich praktisch auf den ersten Blick in sie verliebt. Ein Mann von fünfzig Jahren! Schon in der folgenden Nacht hatte ich zum ersten Mal von ihr geträumt, und …
Schluss damit! Es half nichts, in wehmütigen Erinnerungen zu schwelgen. Ich musste irgendwie herausfinden, was geschehen war, nachdem mein Gedächtnis den Dienst quittiert hatte. Wie das Blut ins Waschbecken kam, weshalb die Knöchel meiner Rechten immer noch druckempfindlich waren.
Der gestrige Abend war tatsächlich anders gewesen als sonst. Nora war offener gewesen, unbeschwerter, lockerer. Da war etwas in ihrem Blick, das erotische Sensationen versprach. Vereinigung nicht nur der Körper, sondern auch der Seelen. Ich hatte fast gezittert vor Gier, Noras weiche, heiße Haut zu berühren, sie zu streicheln und bis zur Besinnungslosigkeit zu liebkosen.
Schon unser nachmittägliches Geturtel im Whirlpool hätte um ein Haar dazu geführt, dass wir in aller Öffentlichkeit übereinander herfielen. Erst im letzten Moment konnten wir uns bremsen, konnte Nora mich bremsen, und wir beschlossen, den Sex auf später zu verschieben, wenn wir in unserem Zimmer waren. Dort angekommen, hatte Nora dann verkündet, sie sei jetzt zu hungrig für eine so anstrengende körperliche Betätigung, und mich einmal mehr vertröstet. Erst wollte sie zu Abend essen, sich ein wenig in Stimmung trinken, später vielleicht eine Flasche Sekt mit aufs Zimmer nehmen …
Das Vier-Gänge-Menü dauerte seine Zeit. Wir hatten geredet und geredet, waren unter dem Tisch immer wieder in Kontakt, konnten am Ende kaum noch die Hände voneinander lassen. Erst um kurz vor elf kamen wir überein, uns in unser Zimmer zurückzuziehen. Die Blicke hin und her waren immer flammender und eindeutiger geworden, am Nachbartisch steckten die Leute schon die Köpfe zusammen und schielten zu uns herüber. Zu diesem durchgedrehten, nicht mehr jungen Paar, das ganz gewiss nicht verheiratet war. Zumindest nicht miteinander.
So bat ich um die Rechnung, ging noch einmal kurz zur Toilette, leerte anschließend mein Weinglas im Stehen, und wir zogen los. Eng umschlungen, in gelöster Stimmung und voller Vorfreude auf das Kommende. Aber wieder hatte Nora plötzlich gekniffen, wollte erst noch ein wenig an die frische Luft, nur ein winzig kleiner Spaziergang, fünf Minuten, ein paar Schritte in dieser so herrlich milden, sternklaren Nacht.
Irgendetwas war da …
Etwas stimmte nicht, wurde mir bewusst, als ich das Handy zum zweiten Mal ans Ohr nahm. Dieses Mal sprach ich Nora auf die Voicebox, bat sie mit Pathos und reichlich Zerknirschung in der Stimme um Verzeihung und Rückruf. Schickte noch eine zweite Nachricht mit weiteren Küssen und Herzchen hinterher.
Nora war anders gewesen, als ich von der Toilette zurückkam. Stiller. Sie hatte auch kaum noch gesprochen, als wir Arm in Arm zwei-, maximal dreihundert Meter die nächtliche Straße entlangschlenderten, bei einer architektonisch restlos uninteressanten Kirche kehrtmachten und zum Bayerischen Hof zurückgingen. Sie hatte sich nicht gesperrt, als ich den Arm um sie legte, sie an mich zog, an ihrem herrlich vollen rötlich braunen Haar schnupperte. Aber so anschmiegsam wie am Nachmittag und später im Restaurant war sie plötzlich nicht mehr gewesen, kam es mir im Rückblick vor. Sollte ich etwas Falsches gesagt haben? Manchmal genügte ja ein Satz, ein Wort, um die Stimmung zu zerstören. Aber sosehr ich auch grübelte, mein Gewissen war rein. Ich hatte sie geneckt, gestreichelt, versucht, unter ihrem sandfarbenen Kaschmirmantel den Pullover hochzuschieben, aber sie hielt meine Hand fest, als genierte sie sich. Obwohl weit und breit niemand auf der Straße war.
Der Cappuccino war leer. Ich ging zum Tresen, um Nachschub zu besorgen. Dazu eine Butterbrezel zur Besänftigung meines nervösen Magens. Als ich mich wieder an meinen Platz setzte, stellte ich fest, dass der Kaffee zu wirken begann. Die Kopfschmerzen hatten nachgelassen, der Blick war klarer geworden. Meine Erinnerungen leider nicht.
Was hatte ich gesagt, als ich von der Toilette zurückkam und die letzten zwei Schlucke von meinem Bacchus hinunterstürzte? Vermutlich etwas wie: »Lass uns gehen, meine Schöne. Sonst fange ich noch an, dir hier vor allen Leuten die Kleider vom Leib zu reißen.«
Nora hatte sich sofort erhoben, allerdings nicht gelacht. Hätte ich besser nichts von Theresa erzählen sollen? Die Eifersucht der Frauen ging ja manchmal seltsame Wege und Umwege. Jedenfalls – in diesem Punkt war ich mir sicher –, sie war anders gewesen als zuvor. Stiller. Sollte ihr plötzlich bewusst geworden sein, wie viel sie von sich preisgegeben hatte?
Von ihren gescheiterten Ehen hatte sie mir erzählt, von ihrem offenbar ein wenig verrückten und sprunghaften Vater, der seine Familie mit kreativen Geschäftsideen mehr als einmal um ein Haar in den Ruin gestürzt hätte. Immer wieder hatte er Firmen gegründet, um die Welt mit neuen genialen Produkten zu beglücken. Er hatte Schulden angehäuft, ohne Sinn und Verstand Personal eingestellt und war nach wenigen Monaten regelmäßig wieder einmal pleite gewesen. Nur die Tatsache, dass die Mutter in Hannover ein florierendes Geschäft für Kunsthandwerk und Wohnaccessoires betrieb, hatte der Familie ein Leben ohne Armut gesichert.
Vor gut zehn Jahren war der Vater gestorben, bei einem etwas rätselhaften Verkehrsunfall, der, wenn ich Noras Andeutungen richtig verstand, auch ein Selbstmord gewesen sein könnte. Zu dieser Zeit hatte sie längst ihr Studium beendet und finanziell auf eigenen Beinen gestanden.
Ich hatte Nora in ihren teuren Mantel geholfen, dabei wie zufällig ihre Brüste berührt. Ich erinnerte mich, dass uns beim Verlassen des ruhigen Restaurants eine Gruppe aufgekratzter Menschen entgegenkam. Drei Paare, alle schon in gesetztem Alter, ausgelassen schwatzend und lachend. Die sechs grüßten uns launig und wünschten uns noch eine unterhaltsame Nacht. Auf dem Gehweg hatte ich den Arm um Noras Schulter gelegt, sie hatte mich angelächelt – und von da an versagte meine Erinnerung. Den Sternenhimmel sah ich noch vor mir, die langweilige Kirche nur noch schemenhaft, dann überhaupt nichts mehr.
Aus.
Kompletter Filmriss.
Vor den Fenstern der Raststätte hielt ein weißer, schon ein wenig angerosteter und beeindruckend schmutziger Lieferwagen. Der Beifahrer, ein junger, athletisch gebauter Mann in ungepflegter Kleidung, sprang heraus, lief zum Eingang und verschwand im Gang zu den Toiletten. Der Motor des Lieferwagens brummte im Leerlauf weiter, und die hässliche Kiste versperrte mir die Aussicht auf den Parkplatz.
Abgesehen von Theresa, an die ich jetzt nicht denken mochte, war es Jahrzehnte her, dass ich so verknallt gewesen war wie jetzt in Nora. Auch damals war das Ziel meiner Leidenschaft ein weibliches Wesen, an das ich nicht herankam. Alizia hieß sie, Alizia von Irgendwas. Den Nachnamen hatte ich vergessen. Ich war in der Zehnten, sie eine Klasse über mir, fast zwei Jahre älter und für mich so unerreichbar, als lebte sie auf dem Mars. Umso rasender und mit der Zeit auch verzweifelter liebte ich sie. Bei ihrem Anblick wurde mir klar, dass Gott ein Mann sein musste. Keine Göttin hätte eine solche Pracht neben sich geduldet. Goldrote Locken, eine Haut so durchsichtig und rein wie ein unschuldiger Sommermorgen. Dazu seegrüne Augen und ein Mund zum … ach! Sogar Gedichte hatte ich geschrieben für sie, die ich ihr nie zu zeigen gewagt hätte. Über die Jahrzehnte waren sie gnädigerweise verloren gegangen. Ich war unglücklich, wenn ich sie einen Tag lang nicht zu Gesicht bekam, und noch unglücklicher, wenn ich sie sah, meist in der großen Pause, zusammen mit Kerlen, die älter waren als ich, erwachsener und ausnahmslos sehr viel dümmer. Nichtswürdige Proleten, deren Aussehen und dummes Geschwätz Alizias Schönheit beleidigten, ihre Aura beschmutzten. Mich nahm sie nie auch nur zur Kenntnis, sosehr ich auch um sie herumschlich. Oft fuhr ich an den Wochenenden nach Durlach, wo ihre Eltern ein fast schlossähnliches Anwesen am Geigersberg besaßen, nur um wenigstens einen Blick auf die Angebetete zu erhaschen. Nur selten hatte ich Glück. Einmal lag sie in einem aufregend knappen Bikini auf einer Liege am Pool, ohne männliche Begleitung und mit einem Buch in der Hand, in dem sie jedoch nicht las. Einmal sah ich sie am Fenster ihres Zimmers im zweiten Stock stehen und versonnen, vielleicht sogar ein wenig traurig, wenn nicht sehnsüchtig in die Ferne blicken. Ein anderes Mal, da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, sogar mit entblößtem Oberkörper, sodass ich nächtelang kaum Schlaf fand vor Aufregung. Morgens wurde sie von einem Chauffeur im Mercedes zur Schule gefahren. Ab dem Beginn der Zwölften kam sie im eigenen Wagen, einem Alfa Romeo Spider, rot wie die Liebe, den ihr wohl der Herr Papa zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte.
Damals hatte ich es zum Glück schon geschafft, sie von ihrem Logenplatz in meinem Kopf zu verdrängen. Ein anderes Mädchen, Judith, war an Alizias Stelle getreten, konnte ihr zwar in keiner Hinsicht das Wasser reichen, war eher ein Trostpreis als ein Ersatz, dafür jedoch zu haben.
Nach dem zweiten Cappuccino und der Butterbrezel war ich wieder so weit hergestellt und bei Sinnen, um zu begreifen, dass noch etwas anderes nicht stimmte. Ich zückte mein Portemonnaie, fand den Kassenbeleg des Restaurants.
Winzermenü für zwei Personen, vier Gänge, einhundertsechsundsechzig Euro plus Getränke und Trinkgeld. Nora hatte die vegetarische Variante gewählt, ich die mit dem Steak. Eine Flasche Wasser, medium. Zwei Gläser Riesling-Schorle für Nora, zwei Viertel Bacchus für mich.
Nach einem halben Liter Wein sollte ich mich vielleicht nicht mehr hinter das Steuer eines Autos setzen, aber ich war immer noch imstande, grammatikalisch korrekte Sätze zu formulieren und auszusprechen. Nie und nimmer erklärte der Alkoholpegel meine plötzliche Besinnungslosigkeit und die Übelkeit am Morgen. Sollte mit dem Essen etwas nicht in Ordnung gewesen sein? Eine Lebensmittelvergiftung? Oder … hatte mir etwa jemand etwas in den Wein getan?
K.-o.-Tropfen?
Die Symptome würden passen.
Nora?
Wer sonst?
Aber wozu, um alles in der Welt? Um mich auf Abstand zu halten? War ihr meine Anhänglichkeit unheimlich geworden? Lästig vielleicht sogar? Hatte sie sich vor dem, was ich so sehr herbeisehnte, plötzlich gefürchtet und sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als mich … zu vergiften? Und später? Das Blut im Bad, meine wunden Knöchel? Sollte ich etwa versucht haben, sie zu …? Ich mochte das schreckliche Wort nicht einmal denken.
Schließlich erhob ich mich, fühlte mich immer noch oder schon wieder ein wenig benommen, verließ das jetzt nicht mehr ganz so stille Lokal gerade noch rechtzeitig, denn der komplette Inhalt eines großen Reisebusses aus Amsterdam strebte mir voller Tatendrang und mit entsprechender Lautstärke entgegen. Der weiße Lieferwagen war längst weitergefahren.
Wieder auf der Autobahn. Immer noch spärlicher Verkehr und dieser seltsame Nebel im Kopf. Und immer noch wollte es mir nicht gelingen, längere Zeit die Spur zu halten. Wieder ließ ich die Fenster herunter, dieses Mal alle vier. Kalte Luft verwirbelte mein Haar. Was war nur los mit mir? Und was war los mit Nora? Alle zwei Minuten wählte ich jetzt ihre Nummer, abwechselnd Festnetz und Handy, und jedes Mal vergeblich. Allmählich beschlich mich das Gefühl, dass hinter ihrem Schweigen mehr steckte als nur verstocktes Beleidigtsein.
Erneut kam mir Alizia in den Sinn. Warum? Nora hatte weder äußerlich noch von ihrem Wesen her Ähnlichkeit mit ihr. Alizia war gertenschlank gewesen, Modelfigur, Prinzessinnengehabe. An ihr hatte mich neben körperlichen Reizen vor allem ihre Unnahbarkeit angezogen. Nora hingegen hatte weibliche Rundungen, war weich und warm. Sie strahlte Ruhe aus, Besonnenheit, vielleicht sogar Mütterlichkeit, obwohl sie keine Kinder hatte. Aber da war immer auch ein Hauch von Traurigkeit gewesen, Verlorenheit und Einsamkeit, selbst wenn wir eng umschlungen auf der Couch lagen und uns abknutschten wie außer Rand und Band geratene Teenager.
Von Alizia hatte ich nach dem Abitur nur noch selten gehört. Wenn mich meine Erinnerung nicht trog, dann hatte sie einen Langweiler von Studienrat geheiratet und zwei Söhne geboren, um dann zügig im Ozean der Mittelmäßigkeit zu versinken. Judith hatte irgendwo im Norden ein Studium begonnen, irgendwas Geisteswissenschaftliches. Später hatte ich gehört, sie lebe mit einer Frau zusammen. Was manche Probleme erklärte, die wir miteinander hatten. Ich selbst bewarb mich bei der Polizei Baden-Württembergs für den gehobenen Dienst, bestand die Eignungstests zu meiner Verblüffung mit Glanz und Gloria und erlebte bald viele für einen jungen Mann spannende und aufregende Dinge wie Autofahren im Grenzbereich, Schießtraining, Selbstverteidigung mit und ohne Waffe, Verhalten bei Gefahr für Leib und Leben, Deeskalation kritischer Situationen, bald auch nächtliche Streifenwagenfahrten mit echten Einsätzen.
Nach wie vor gelang es mir nicht, längere Zeit geradeaus zu fahren. Schlingerte ich etwa noch mehr herum als zuvor? Zudem machte mein Auto auf einmal seltsame Geräusche, die jedoch nicht bedrohlich klangen. Vor mir tauchte ein weißer Lieferwagen auf, alt, rostig, schmutzig. Vermutlich der, den ich vorhin beim Kaffeetrinken gesehen hatte. Er fuhr noch langsamer als ich. Ein Weilchen zuckelte ich hinter ihm her, dann wurde mir die Sache zu dumm, und ich überholte.
Als ich zum hundertsten Mal versuchte, Nora zu erreichen, kam der weiße Kastenwagen im Rückspiegel näher, fuhr jetzt plötzlich schneller, setzte seinerseits zum Überholen an. Zum hundertsten Mal hörte ich den Anfang des Automatensprüchleins: »Sie sind verbunden mit der Mailbox der Rufnummer …«
Da krachte es, ein Ruck, ein Holpern, die Welt begann sich zu drehen, und das Letzte, was ich sah, war der rasch größer werdende Kühler des Lieferwagens.
3
Gleißende Helligkeit. Neonröhren an der Decke. Viel Weiß um mich herum. Wieder einmal kam ich in einem fremden Bett zu mir, und wieder einmal hatte ich keinen Schimmer, wie ich dort hingekommen war. Menschen neben mir, ein Mann, eine Frau. Der Mann – ich schätzte ihn auf Anfang dreißig – war ganz in Weiß gekleidet und beschäftigte sich mit irgendwelchen Geräten neben meinem Bett. Die Schwester war noch jünger, trug einen blauen Kittel zur weißen Hose und tippte geschäftig auf einem großen Tablet herum.
Offenbar befand ich mich in einem Krankenhaus.
Warum?
Ich fühlte keine Schmerzen, war allerdings benommen, hörte die Stimmen der beiden nur gedämpft. In meiner rechten Armbeuge steckte eine Nadel, daran ein Schlauch, ein Tropf. Und mit meinem linken Arm schien etwas nicht in Ordnung zu sein. Er ließ sich nicht bewegen.
»Schönen guten Abend«, begrüßte mich der Arzt mit sonorer, heiterer Männerstimme. »Wie geht es Ihnen?«
»Keine Ahnung«, krächzte ich wahrheitsgemäß.
»Sie hatten einen Unfall. Erinnern Sie sich? Auf der Autobahn.«
Ich wollte den Kopf schütteln, ließ es jedoch vorsichtshalber bleiben.
»Na, jedenfalls haben Sie einen topfitten Schutzengel, das muss ich sagen. Nur Ihr linker Arm ist leider beschädigt, die Ulna, ein nicht ganz unkomplizierter Trümmerbruch. Wir mussten operieren. Ihr rechtes Fußgelenk hat auch etwas abbekommen. Die Bänder sind ein wenig überdehnt, aber gerissen ist zum Glück nichts. Außerdem haben Sie sich kräftig den Kopf gestoßen. Aber das wird alles wieder, keine Bange. In ein paar Tagen dürfen Sie nach Hause, wenn sich keine Komplikationen einstellen.«
Was mochte wohl eine Ulna sein? Wie der Arzt guckte, kein allzu wichtiger Teil meines geschundenen Körpers. Er sprach mit leichtem schwäbischen Akzent und schien mit einem gesunden Optimismus gesegnet zu sein. Die Schwester nickte ernst zu jedem seiner Sätze.
Er hob seine Rechte.
»Wie viele Finger sehen Sie?«
»Vier.«
»Oh!«
»Zwei sind ausgestreckt und zwei gebeugt.«
»Aber hat der Mensch nicht für gewöhnlich fünf Finger?«
»Den fünften nenne ich Daumen. Den sehe ich auch.« Das Sprechen fiel mir schwer. Mein Mund war völlig ausgetrocknet.
Der Arzt schmunzelte nachsichtig, hielt mir den Zeigefinger vor die Nase, bewegte ihn hin und her, forderte mich auf, ihm mit den Augen zu folgen. Das Resultat des Experiments stellte ihn sichtlich zufrieden.
Sicherheitshalber erkundigte er sich noch, ob ich hin und wieder Dinge doppelt sah, was ich verneinte, ob mir manchmal schwindlig war, was ich bejahte.
»Fühlen Sie sich imstande, einige Fragen zu beantworten?«, wollte er wissen, als er mit seinen Untersuchungen fertig war.
»Was für ein Tag ist heute?«, fragte ich zurück.
»Immer noch Sonntag. Ihr Unfall war gegen Mittag, jetzt ist …« Er hob den linken Arm, zählte zu den selten gewordenen Menschen, die noch eine Armbanduhr trugen. Seine war schwarz, eine Taucheruhr. Schien teuer gewesen zu sein. »Kurz nach fünf. Die Operation an Ihrem Unterarm war ein wenig umständlich.«
»Und wo bin ich?«
»Im Marienkrankenhaus in Bad Friedrichshall.«
»Wer will mir Fragen stellen?«
»Draußen warten schon seit einiger Zeit zwei Herrschaften. Kollegen von Ihnen. Sie sind doch Polizist, ist das richtig?«
Ja, vor langer Zeit war ich das wohl einmal gewesen, meinte ich mich zu entsinnen. Als ich noch nicht ständig ohne Erinnerung in fremden Betten aufzuwachen pflegte.
»Geht klar«, murmelte ich. »Die Herrschaften, meine ich. Sie können kommen.«
»Sie sind noch etwas benebelt«, wurde ich aufgeklärt. »Das ist aber kein Grund zur Beunruhigung und kommt von der Betäubung und dem Schmerzmittel, das wir Ihnen verabreicht haben. Sie scheinen sich auch eine Gehirnerschütterung zugezogen zu haben, allerdings zum Glück keine besonders schwere. Und wie schon gesagt, das wird alles wieder, keine Bange. Vorerst brauchen Sie vor allem eines, und das ist Ruhe. Nur Ihre Kollegen machen es leider dringend.«
Ich duselte kurz weg, und als ich die Augen wieder öffnete, hatten die angekündigten Herrschaften den Platz des Arztes und der Schwester eingenommen. Eine schmale, ganz hübsche und noch recht junge Frau und ein massiger Kerl mit Fast-Vollglatze und Pferdegesicht in meinem Alter. Beide waren in Zivil. Die Frau duftete nach einem billigen Blümchenparfüm, der Mann, der mit dröhnender Stimme das Wort führte, roch deftig nach Zigarrenrauch.
Er stellte sich als Hauptkommissar Baumgartner vor.
»Ich hab Ihnen Ihren Koffer mitgebracht, schauen Sie her, ich stell ihn ans Fußende von Ihrem Bett. Und Ihren Mantel häng ich an die Garderobe. Die schöne junge Frau an meiner Seite ist übrigens die Kommissaranwärterin Großklaus.«
»Habe ich was verbrochen?«
Er lachte so schallend, dass das Schmerzmittel vorübergehend an seine Leistungsgrenze kam. Im linken Arm fing es an zu ziehen, in meinem Kopf zu pochen. Jetzt nur keine hastigen Bewegungen!
»Überhaupt nichts haben Sie verbrochen, werter Herr Kollege. Sie sind nicht der Täter, sondern das Opfer.«
»Was ist denn eigentlich passiert?«
Die Radbolzen am linken Vorderrad meines Citroëns hatten sich gelöst. Drei davon waren verschwunden, einen fanden die Kollegen etwa zweihundert Meter vor der Unfallstelle, der fünfte war abgebrochen.
»Das Vorderrad ist dann allein weitergefahren«, erklärte mir Baumgartner aufgeräumt. »Ist ganz schön weit gekommen, das eigensinnige Ding. Meine Leute haben lang suchen müssen, bis sie es im Wald gefunden haben.«
Die noch ein wenig scheue Kollegin Großklaus ergriff das Wort: »Haben Sie in letzter Zeit vielleicht mal die Räder wechseln lassen?«
Sie trug ein azurblaues Kleid, das gut zu ihren goldblonden Haaren passte.
»Ja. Vor zwei Wochen ungefähr.«
»Und Sie haben die Bolzen nach fünfzig Kilometern nachziehen lassen?«
»Natürlich.«
Drei Tage nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerreifen war ich in der Werkstatt gewesen. Eine energische Azubine hatte sämtliche Bolzen in meinem Beisein mit einem beeindruckend langen Drehmomentschlüssel nachgezogen.
»Dann sollten Sie vielleicht mal mit den Leuten reden«, meinte Baumgartner. »Wegen Schadenersatz oder so.«
»Sie denken, die haben es nicht richtig gemacht?«
»Vielleicht nicht an allen vier Rädern? Kommt schon mal vor im Eifer des Gefechts.«
Ich konnte mich tatsächlich nicht erinnern, ob die junge Frau auch am linken Vorderrad ihres Amtes gewaltet hatte.
»Na ja«, dröhnte der Kollege mit seinem meine Schädeldecke erschütternden Organ. »Wird Ihnen ja wohl niemand nach dem Leben trachten, oder?«
»Ich hoffe nicht«, erwiderte ich, ohne irgendetwas an dieser Vorstellung lustig finden zu können.
Obwohl man als Kriminaler natürlich immer Feinde hat, das lässt sich nicht vermeiden. Manch einer, der mir die Schuld an seiner Verurteilung gab, hatte schon Rache geschworen und mir dies und jenes angedroht. Nach dem zehnten oder zwanzigsten Mal nahm ich solche Sprüche nicht mehr ganz so ernst.
»Der Lieferwagen, der Sie auf die Hörner genommen hat, was wissen Sie über den?«
»Nichts.«
Der weiße Wagen war nur noch eine schemenhafte Erinnerung.
»Auch nicht, dass er aus Rumänien kommt?«
Manchmal hatte ich doch Sehstörungen, stellte ich fest. Sah die beiden neben meinem Bett doppelt, als könnten meine Augen sich nicht einigen, in welche Richtung sie schauen sollten. Außerdem war ich benommen, als hätte mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen.
»Dass er weiß war, der Lieferwagen, das wissen Sie aber schon noch?«, fragte die Kollegin bestürzt.
Ich nickte betont vorsichtig, weil mir beim letzten Mal schwindlig geworden war. Dieses Mal ging alles gut.
»Ist er etwa …?«
»Genau. Abgehauen ist er«, röhrte Hauptkommissar Baumgartner. »Und zwar wie ein geölter Blitz. Bloß seine Stoßstange mit dem Nummernschild, die hat er praktischerweise dagelassen. Hat ein paar Meter zurückgesetzt, und dann ab durch die Mitte. Eine Zeugin hat ihn zum Glück gesehen. Die hat dann auch den Krankenwagen gerufen und die Kollegen von der Autobahnpolizei.«
»Aber … er kann doch eigentlich nichts dafür, der Lieferwagen, oder?«
Ich erinnerte mich dunkel, ihn beim Kaffeetrinken gesehen zu haben. Später hatte ich ihn überholt und bald darauf er mich. Beziehungsweise, er hatte es versucht, war jedoch offenbar in meinen schleudernden und sich überschlagenden Citroën gekracht.
»So richtig vorstellen kann ich’s mir eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt«, gestand Baumgartner. »Wo hatten Sie Ihren Wagen denn zuletzt geparkt?«
»An der Raststätte Jagsttal. Da habe ich Kaffee getrunken und gefrühstückt.«
»Wär schon ein ziemlich blödsinniger Zufall, wenn die Kerle im Lieferwagen Ihr Vorderrad losgeschraubt hätten, und sie kommen Ihnen ausgerechnet dann in die Quere, als das Rad wegfliegt.«
Das leuchtete mir ein. Hätten die Rumänen gewusst, dass mein Vorderrad lose war, dann hätten sie schon im eigenen Interesse Abstand gehalten.
»Aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen, nicht wahr?«, brüllte der Kollege voller Begeisterung über diesen klugen Satz. »Haben Sie vielleicht in letzter Zeit mal Stress mit Rumänen gehabt? Dienstlich, meine ich.«
Das hatte ich tatsächlich. Im vergangenen Herbst war uns eine Räuberbande ins Netz gegangen, nach der seit Längerem deutschlandweit gefahndet wurde. Sie waren generalstabsmäßig vorgegangen, hatten die anspruchsvolle und komplizierte Tätigkeit des Eindringens in fremde Häuser auf verschiedene Teams von Spezialisten verteilt.
Team eins hatte die Anwesen, in die Team zwei später eindrang, gründlich und mit erheblichem technischen Aufwand ausgekundschaftet, bis die Bande genau wusste, wann die Bewohner zu Hause waren und wann nicht. Die Männer fürs Grobe waren Tage später zum passenden Zeitpunkt in einem dunklen Kastenwagen vorgefahren, durch das von Team eins festgelegte Fenster eingebrochen und hatten – gerne auch bei plärrender Alarmanlage – weggeschleppt, was sich in fünf Minuten wegschleppen ließ. Team drei hatte die Beute kurze Zeit später auf einem ruhigen und nicht allzu weit entfernten Parkplatz übernommen und zur nächsten Sammelstelle transportiert, wo sie dann in Container verladen wurde. Das Pech dieser so hervorragend organisierten Truppe war gewesen, dass neben einer Villa oberhalb von Schriesheim, die sie sich Mitte Oktober vorgenommen hatten, ein pensionierter Oberstaatsanwalt wohnte. So hatten wir insgesamt fünf junge, schlanke und gelenkige Burschen verhaften können und über ihre Handykontakte innerhalb weniger Stunden ein weiteres Dutzend. Gut möglich, dass die ersten der Übeltäter inzwischen schon wieder auf freiem Fuß waren. Oder dass Komplizen, die uns durchs Netz geschlüpft waren, mir ein Killerkommando auf den Hals gehetzt hatten. Bei der Vorstellung gruselte mir.
»Ihr schöner C5 ist leider hinüber«, erklärte der lautstarke Kollege, als er mir zum Abschied so vorsichtig die rechte Hand drückte, als wäre sie zerbrechlich. »Aber Sie haben ja jetzt Zeit, sich in aller Ruhe um Ersatz zu kümmern.«
Den Citroën besaß ich erst seit einem Dreivierteljahr. Meinen geliebten Peugeot, der nur wenige Monate älter war als meine Töchter, hatte ich im vergangenen Sommer zu Schrott gefahren, durch eine Unachtsamkeit an einer roten Ampel. Den gebrauchten Citroën hatte Sönnchen mir besorgt, Sonja Walldorf, meine Sekretärin, Assistentin und Beraterin in allen Lebenslagen. Ich beschloss, sie gleich morgen früh anzurufen und zu bitten, ihren Bekannten zu kontaktieren, der den Wagen aus Frankreich importiert hatte. Eine Version, die auf dem deutschen Markt gar nicht angeboten wurde, da sie mit zu wenig elektronischem Schnickschnack ausgestattet war. Ich hatte ihn gemocht, den Citroën. Nicht geliebt wie den Peugeot, gemocht aber schon.
Was für ein Elend, das alles.
Das Zimmer, in dem ich lag, sah aus wie tausend andere Krankenhauszimmer auch. Links von mir war die Wand mit Holz imitierendem Kunststoff verkleidet. Genau in der Mitte befand sich die breite Tür zum Flur, rechts daneben gab es eine weitere schmale Tür, die vermutlich ins Bad führte. An der Wand mir gegenüber hing ein Fernseher, in dem eine Nachrichtensendung lief. Zum Glück war das Gerät stumm geschaltet. Darunter standen ein quadratisches Tischchen aus hellem Holz und zwei mit rotem Kunstleder bezogene Stühle.
Rechts bot ein großes Fenster Aussicht auf Bäume, die sich im Wind wiegten. Lustig bunt gestreifte Vorhänge. Draußen war es immer noch hell.
Nach dem ersten Zusammentreffen mit Nora in ihrer Wohnung, nur gut hundert Meter von meinem eigenen Zuhause entfernt, war zunächst einmal nichts weiter geschehen, als dass sie mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Unser Gespräch hatte kaum länger als zwei, drei Minuten gedauert, und am Ende waren zwei merkwürdige Dinge geschehen. Als sie mir beim Abschied lächelnd anvertraute, sie sei Anwältin für Familienrecht, und falls ich mich einmal scheiden lassen wolle, dürfe ich mich gerne an sie wenden, hatte ich mit alberner Hast versichert, ich sei nicht verheiratet. Und bevor sie ihre Tür hinter mir schloss, hatte sie mit ihrer angenehm dunklen Stimme gesagt, sie heiße Nora mit Vornamen, was in dieser Situation überhaupt keine Rolle spielte. Ich hörte es noch, als wäre es gestern gewesen. Sie war mir von der ersten Sekunde an sympathisch gewesen, sehr sympathisch sogar. Schon in der ersten Nacht hatte ich ziemlich unanständig von ihr geträumt. Und danach immer wieder. Als hätte mein Unterbewusstsein bereits eine Entscheidung getroffen, obwohl ich damals noch – so bildete ich mir zumindest ein – in festen Händen war.
Der große Krach mit Theresa war ja erst eine gute Woche später gekommen. Das Geständnis ihrer Untreue mit diesem verfluchten – wie hieß er noch? Egal. Immer noch kochte meine Galle über, wenn ich daran dachte. Dabei war ich doch verdächtig bald froh gewesen, Theresa los zu sein. Offenbar war in unserer Beziehung schon länger nichts mehr so gewesen, wie es hätte sein sollen. Regelrecht befreit hatte ich mich nach dem ersten Schock gefühlt. Und dennoch nagte bis heute hin und wieder die Eifersucht an mir. Die Erinnerung an die bittere Kränkung, als Theresa mir eröffnete, sie liebe nun einen anderen.
Ende der Leseprobe