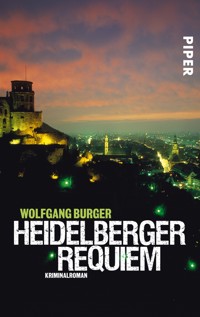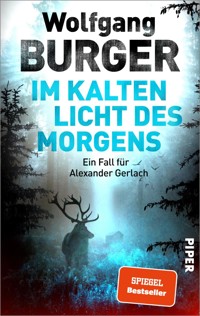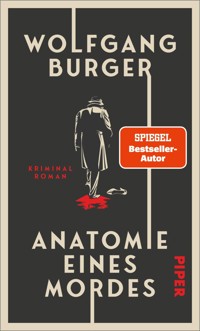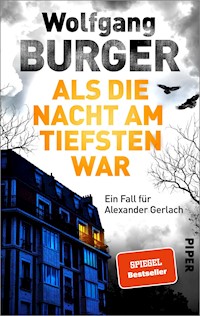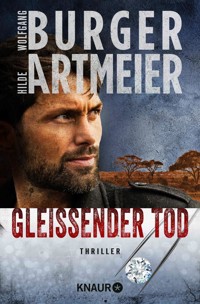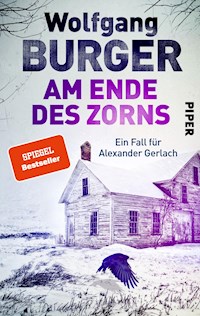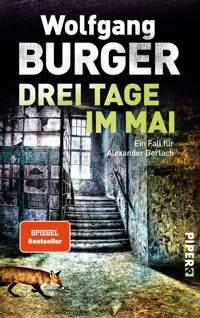9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Heidelberger Polizeidirektion gleicht einem aufgescheuchten Hühnerhaufen: Im Vorfeld einer internationalen Wirtschaftstagung verdichten sich die Hinweise auf einen bevorstehenden Terroranschlag, und Kripochef Alexander Gerlach versucht fieberhaft, den Tätern zuvorzukommen. Als eine Zielfahnderin vom BKA eintrifft, die auf eine untergetauchte Terroristin angesetzt ist, soll sich die neue Kollegin das Büro ausgerechnet mit Gerlach teilen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt man sich näher, und während in der Bevölkerung der Unmut wächst und sich Gerlachs halbwüchsige Töchter mit den radikalen Globalisierungsgegnern solidarisieren, meint seine Geliebte Theresa plötzlich, ernsthaft Grund zur Eifersucht zu haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Hilde
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage April 2012
ISBN 978-3-492-95410-5
© der deutschsprachigen Ausgabe: 2012 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von plainpicture / Arcangel Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Unser deutsches Strafrecht definiert Mord als »Tötung eines Menschen aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken«.
Keines dieser Motive trifft auf mich zu. Viele sagen sogar, ich hätte aus einem der besten Motive gehandelt, nämlich um einem Menschen das Leben zu retten. Das ist aber nicht wahr. Als ich abdrückte, war es bereits zu spät. Da gab es schon nichts mehr zu retten. Ich habe einen Menschen getötet. Sinnlos. Ohne jeden vernünftigen Grund. Wie ich es auch drehe und wende – mein Gewissen nennt es Mord.
»Wir sind hier nicht in Heiligendamm!«, stieß ich hervor und hätte um ein Haar mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen. »Sie können nicht einfach einen Zaun um die Stadt herum bauen und jeden, der hineinwill, einem Sicherheitscheck unterziehen.«
»Die Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftsgespräche sind ja auch nicht mit einem G8-Gipfel zu vergleichen«, erwiderte Keith Sneider mit seinem undurchschaubaren und immer eine Spur überheblichen Grinsen. »Und niemand hat vor, Ihr schönes Heidelberg einzuzäunen.«
Seine freundliche Herablassung war mir noch bei jeder dieser ebenso lästigen wie langweiligen Vorbereitungssitzungen auf die Nerven gegangen. Was mich jedoch noch mehr ärgerte, war, dass ich mich bei diesen Veranstaltungen regelmäßig unwichtig und überflüssig fühlte. Und wer fühlt sich schon gerne unwichtig und überflüssig?
»Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Sie die Lage im Griff behalten wollen, wenn hier ein paar Tausend Anarchos aufkreuzen – und sie werden kommen, darauf können Sie Gift nehmen. Angenommen, die ziehen vors Tagungshotel, um es in Brand zu stecken?«
Ich hielt es für eine ausgemachte Schnapsidee, diese Wirtschaftsgespräche ausgerechnet mitten in Heidelberg abzuhalten.
Dr. Fred Höger, ein junger Schnösel und, wenn ich richtig verstanden hatte, Vertreter des persönlichen Referenten von irgendjemandem, der ungeheuer wichtig war, klopfte mit gepflegten Knöcheln auf den blank polierten Tisch. »Meine Herren«, sagte er betreten. »Meine Herren, bitte.«
Wir saßen in einem der größeren Besprechungsräume des Heidelberger Rathauses. Der Tisch, um den herum sich heute knapp fünfzehn Personen mit sorgenvollen Mienen versammelt hatten, war aus vornehm schimmerndem Mahagoni.
Ich beschloss, für den Rest der Sitzung den Mund zu halten, nahm die Brille ab und lehnte mich zurück. Ich dachte an Theresa, meine Geliebte. Gestern war Dienstag gewesen, unser Abend. Wie üblich hatten wir uns in unserer kleinen Zweizimmerwohnung getroffen, die wir einzig zu dem Zweck angemietet hatten, um einen Ort zu haben, wo wir uns treffen und lieben konnten. Theresa hatte mir von ihrem neuen Buchprojekt erzählt, das keine rechten Fortschritte machte. Schon zum dritten Mal hatte sie wieder von vorn begonnen, und wieder war sie nach zehn Seiten stecken geblieben, weil sie die Geschichte plötzlich doof fand. Wir hatten gelacht und herumgealbert und später lange geschwiegen. Es gab diese Abende, da fühlte unsere Liebe sich immer noch und immer wieder jung an wie am ersten Tag. Ich schrieb ihr – das Handy sittsam unter dem Tisch – eine ausführliche und ziemlich gefühlvolle SMS, und sie antwortete so postwendend, als hätte sie mit den Daumen auf der Tastatur gewartet.
Derweil wurde eifrig weiterdiskutiert, aber die Stimmen schienen in den letzten Minuten leiser geworden zu sein. Das Gerede perlte von mir ab, und plötzlich fühlte ich mich wie vor dreißig Jahren im Schulunterricht. Fünfte Stunde, stickige Luft, draußen Regen, die leiernde Stimme der Mathelehrerin weit, weit weg. Das Leben, das, worum die Welt sich eigentlich drehte, unerreichbar fern.
Erst vor wenigen Monaten war Theresas erstes Werk erschienen, ein historisches Sittengemälde, in dem es im Wesentlichen um die Frage ging, wer es am Heidelberger Hof des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts wie oft mit wem getrieben hatte.
Heute war Mittwoch, der achte September. Noch fünf Wochen bis zum Beginn der Wirtschaftsgespräche, zu deren Vorbereitung ich zurzeit nahezu täglich in irgendwelchen Besprechungen meine Zeit totschlug.
Noch fünf Wochen und zwei Tage – bis zu der Stunde, in der ich zum Mörder werden sollte.
2
»Paps, warum ist auf einmal so viel Polizei in der Stadt?«, fragte Sarah am Abend, ehe sie herzhaft in ihr Käsebrötchen mit dicken Gurkenscheiben biss. Mit zu vollem Mund sprach sie weiter: »Stimmt es, dass der amerikanische Präsident nach Heidelberg kommt?«
»Um Himmels willen, nein! Nur der Wirtschaftsminister kommt. Und sein deutscher Kollege und, wenn wir Pech haben, auch noch die Bundeskanzlerin. Es ist eigentlich eine ziemlich kleine und unwichtige Tagung, und sie dauert auch bloß zwei Tage.«
»Es geht um die Wirtschaftskrise, stimmt’s?«
»Ja. Es geht darum, dass die Amerikaner aus Sicht der deutschen Regierung zu viele Schulden machen und wir aus Sicht der Amerikaner zu wenige.«
»Und wieso ausgerechnet bei uns?«
»Ich nehme an, weil alle Amerikaner Heidelberg toll finden.«
»Hast du viel Stress deshalb?«, erkundigte sich Louise mitfühlend, die zweite und eine halbe Stunde jüngere meiner Zwillingstöchter.
In zehn Tagen würden die beiden endlich das magische Alter von sechzehn Jahren erreichen, und ich hatte noch kein einziges Geburtstagsgeschenk für sie gekauft. Schon vor Wochen hatten sie mir ihre Wunschzettel überreicht, die überwiegend Kleidung mit exakt angegebenen Quellen, Größen und Preisen auflisteten, was mir die Sache sehr erleichtern würde. Was mir jedoch immer noch fehlte, waren Ideen für einige dem Anlass würdige Überraschungsgeschenke. Etwas, womit sie nicht rechneten und worüber sie sich freuten. Laptops wünschten sie sich sehnlichst, hatten sie in letzter Zeit immer wieder durchblicken lassen. Aber ein halbwegs ordentliches Gerät kostete vier- bis fünfhundert Euro, und der Nachteil bei Zwillingen war, dass man alles immer gleich doppelt brauchte. Schmuck war riskant, auf der anderen Seite nicht so teuer. Geld fand ich pietätlos, Gutscheine eine Bankrotterklärung der väterlichen Phantasie, auf die ich nur im äußersten Notfall zurückgreifen würde. Bücher schätzten sie nicht so, und CDs waren nicht mehr angesagt. Musik kam heute auch in Polizistenhaushalten irgendwie aus dem Nichts.
»Stress eigentlich nicht«, beantwortete ich Louises Frage. »Bisher wird nur viel geplant und noch mehr geredet.«
»Musst du die Politiker beschützen, wenn sie da sind?«
Ich hatte den Mund schon offen, um die Frage zu verneinen, entschied mich jedoch anders: »Im Prinzip schon, ja.« Wenigstens vor meinen Töchtern wollte ich mich ein wenig groß und wichtig fühlen. »Natürlich nicht allein. Da kommen jede Menge wichtige Leute vom BKA. Und die Amis haben auch schon eine halbe Kompanie Sicherheitskräfte geschickt, die sich Sorgen um das Leben ihres Ministers machen.«
»Haben sie Angst vor Terroranschlägen?«
»Amerikaner haben heutzutage immer Angst vor Terroranschlägen.«
Wegen der Geschenke musste ich unbedingt Sönnchen fragen, meine Sekretärin. Ich machte mir eine Notiz mit Ausrufezeichen im Kopf und fragte mich, ob es nicht allmählich an der Zeit war, mir eines dieser elektronischen Hosentaschengedächtnisse zu kaufen, wie sie heute fast jeder mit sich herumtrug. Bisher war ich immer zu stolz gewesen, mir diese Blöße zu geben. Auch sein Erinnerungsvermögen muss man regelmäßig trainieren, verkündete ich, wenn ich darauf angesprochen wurde. Das Dumme war nur, dass mein Training anscheinend nicht fruchtete und ich immer öfter etwas vergaß. Hin und wieder auch Wichtiges.
3
Längst glich unsere sonst eher friedliche Polizeidirektion einem überfüllten Hühnerstall. Zweiundzwanzig Beamtinnen und Beamte des Bundeskriminalamts beglückten uns inzwischen mit ihrer Anwesenheit und ließen uns tagtäglich fühlen, dass wir Landpomeranzen keinen Schimmer von den Problemen und Gefahren des politischen Lebens hatten. Etwa die Hälfte kam von der Abteilung Polizeilicher Staatsschutz in Wiesbaden, der Rest von der Sicherungsgruppe Berlin. Die zweite Gruppe umfasste auch die Kolleginnen und Kollegen, die während der Tagung für den unmittelbaren Personenschutz zuständig sein würden. Und natürlich – jeder sah es ein – brauchte jeder zumindest ein Eckchen in irgendeinem Büro, einen Schreibtisch, einen Stuhl, ein Telefon. Außerdem – jeder verstand es – benötigten sie für den Fall der Fälle die Nähe der örtlichen Polizeibehörde, Zugriff auf unsere Infrastruktur, Ortskenntnis, EDV und Kantine. So waren meine Untergebenen ohne allzu lautes Murren zusammengerückt, hatten Möbel gerückt, in jede freie Ecke noch einen alten Schreibtisch gequetscht. Es würde ja nicht ewig dauern.
»Guten Morgen, Herr Gerlach«, begrüßte mich Sönnchen wie immer strahlend.
Ihr bürgerlicher Name lautete Sonja Walldorf, aber sie hatte vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit an darauf bestanden, auch von mir Sönnchen genannt zu werden, weil jeder sie so nannte. Meine treue Sekretärin schien die Einzige im Haus zu sein, die sich ihre gute Laune von der Enge und Hektik nicht verderben ließ.
»Stellen Sie sich vor, jetzt wollen sie noch wen schicken!«
»Wer?« Ich hängte mein Jackett an den Garderobenständer und krempelte die Ärmel meines Hemds hoch. »Wer schickt wen?«
»Wiesbaden. Vorhin haben sie angerufen, ob wir nicht noch irgendwo ein Plätzchen frei hätten.«
»Die haben Nerven. Im Keller vielleicht?«
Sie lachte herzlich. »Ich hab auch gesagt, dass wir jetzt schon aus allen Nähten platzen. Außerdem hat eine Frau für Sie angerufen.«
»Hoffentlich nicht schon wieder jemand vom Fernsehen?«
»Nein, keine Journalistin diesmal. Cappuccino wie immer?«
Ich nickte. »Und was will diese Frau von mir?«
Sie sprang auf und machte sich an unserem Kaffeecomputer zu schaffen, der in den paar Monaten, die er nun bei uns stand, schon drei Mal für teures Geld hatte repariert werden müssen. »Wollt sie mir nicht verraten. Sie ruft später wieder an.«
»Liebekind hat schon gewusst, warum er sich rechtzeitig abgesetzt hat!«
Sönnchen lachte schon wieder. Die Maschine begann, geschäftig zu brummen. Mein direkter Vorgesetzter, Leitender Polizeidirektor Doktor Egon Liebekind, hielt zurzeit seine jährliche Blockvorlesung an der Hochschule der Polizei in Münster und hatte mich mit der Last der Verantwortung allein gelassen. Als Chef der Kriminalpolizei fungierte ich während seiner Abwesenheit automatisch als sein Stellvertreter. Immerhin hatten wir so ein wenig Platz gewonnen und in seinem Büro vorübergehend einen aufgeblasenen Polizeidirektor aus Berlin namens von Lüdewitz einquartieren können. Leider hatte dies schon nach wenigen Tagen dazu geführt, dass Petra Ragold – Liebekinds Sekretärin – begann, öffentlich über ihre fristlose Kündigung nachzudenken. Interkulturelle Verständigungsprobleme gab es offenbar nicht nur zwischen Deutschen und Amerikanern, sondern auch zwischen Badenern und Preußen.
Auf dem Flur draußen begannen ein Mann und eine Frau zu streiten. Offenbar wurde man sich nicht einig, wer zuerst am Kopierer gewesen war.
»Vergessen Sie Ihre Sitzung nicht, Herr Gerlach«, ermahnte mich Sönnchen. »Um neun im Rathaus, wie üblich.«
»Wie lange dauert das denn noch mit unserem Dach?«
Während eines der ungezählten Gewitter, die uns den August verdorben hatten, war das Flachdach unserer noch gar nicht so alten Polizeidirektion undicht und unser großer Besprechungsraum Opfer eines verheerenden Wassereinbruchs geworden.
»Gestern sind wieder mal zwei Männer da gewesen und haben ein bisschen Kies hin und her geschaufelt. Nächste Woche wollen sie fertig werden, heißt es.«
Während ich eilig meinen Cappuccino schlürfte, blätterte ich im Stehen die Post durch. Irgendwo im Haus fiel etwas klirrend zu Boden. Eine Frau fluchte auf Hessisch.
»As you can see on … ähm … my first slide …«, stotterte eine sehr schlanke Kollegin vom BKA und fuchtelte mit einem grünen Laserpunkt herum. Ihr langes, glattes Haar leuchtete in einem Rot, das viel zu schön war, um echt zu sein. Sie trug ein Kostüm, dessen Tannengrün fast schmerzhaft perfekt zur Haarfarbe passte, und sprach ein ganz grauenerregendes Englisch.
Heute ging es wieder einmal um mögliche Bedrohungsszenarien für unsere hohen Gäste. Das BKA präsentierte seine Sicht der Dinge. »The darker the red background of a group, the higher we … ähm … suppose the risk …«
Der Laserpunkt zuckte und zitterte von Kästchen zu Kästchen. Natürlich konnte man islamistische Terroranschläge nicht ausschließen. Das konnte man seit Nine Eleven schließlich nie. Um tibetische Protestgruppen brauchten wir uns dagegen weniger Gedanken zu machen, da keine Chinesen anwesend sein würden. Mit massivem Auftreten autonomer Gruppen, Randalierer und Berufsdemonstranten – auch aus dem Ausland – war dagegen in jedem Fall zu rechnen. Zudem war zu befürchten, dass sich im Fahrwasser der Chaoten auch Einzeltäter bewegten, die zu allem Möglichen und Unmöglichen entschlossen waren. Verrückte, Fanatiker, von irgendeinem Gott Berufene.
»Diese Sorte macht mir keine Sorgen«, fiel Keith Sneider der Polizeirätin gelassen ins Wort. Obwohl US-Amerikaner, sprach er perfekt Deutsch, witzigerweise mit Kurpfälzer Akzent. Wie ich von Sönnchen erfahren hatte, war er vor Jahren für einige Zeit als GI in Heidelberg stationiert gewesen. »Potenzielle Attentäter werden eine Menge Know-how, Infrastruktur und Intelligenz benötigen, um sich den Ministern auch nur auf Sichtweite zu nähern. Chaoten und Spinner haben keine Chance. Die können wir vergessen.«
Womit er vermutlich recht hatte. Mit denen würden nämlich wir, die Heidelberger Polizei, uns herumprügeln dürfen.
Sneider war älter als ich, schon weit über fünfzig, hatte strohblondes, achtlos geschnittenes Haar und wirkte im Gegensatz zu seinen jungen, vor Kraft und Ehrgeiz strotzenden Begleitern wie ein Mensch, der das Leben zu genießen wusste und keinen Spaß dabei fand, sich in aller Herrgottsfrühe mit sportlicher Betätigung zu quälen. Bisher war ich nicht recht schlau aus dem Mann geworden. Einen Tag gab er sich freundlich und entspannt, am nächsten konnte er gereizt und arrogant sein bis zur Ungenießbarkeit.
»Therefore the background is only … ähm … lightred, as you can see«, versetzte die Kollegin leicht gekränkt.
So ging das nun schon seit Wochen: Jede der an den Vorbereitungen beteiligten Organisationen musste unentwegt ihre Wichtigkeit unter Beweis stellen. Jeder musste jeden Tag aufs Neue sich selbst und alle anderen davon überzeugen, wie ungeheuer klug und unverzichtbar er war. Ein ständiges Gehacke und Gespreize und Gepluster.
Ich tat, was ich inzwischen immer öfter tat: Ich hielt den Mund und sah hin und wieder auf die Uhr. Als stellvertretender Chef der ortsansässigen Polizei war ich ohnehin nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Für die Sicherheit der Politiker waren in erster Linie die BKA-Leute zuständig. Dabei wurden sie unterstützt von der Delegation aus den USA, welche von Keith Sneider angeführt wurde. Längst waren zur Abwehr gewaltbereiter Demonstranten tonnenweise Absperrgitter geordert. Hundertschaften Bereitschaftspolizei aus ganz Deutschland würden herangekarrt werden, für die zurzeit immer noch händeringend Massenunterkünfte gesucht wurden.
Aber all das ging mich im Grunde wenig an. Die Verantwortung trugen andere, und ich war nicht eine Sekunde traurig deswegen. Meine Leute und ich halfen mit unserer Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und Eigenheiten und würden selbst im unwahrscheinlichen Krisenfall nur flankierend tätig werden.
Keith Sneider saß links neben mir. Er kam aus Washington, DC, und laut seiner Visitenkarte arbeitete er für irgendeine Abteilung des US-Außenministeriums mit dem Kürzel »SHG«. Das »S« stand für »Security«, vermutete ich. Den Rest hatte ich noch nicht herausgefunden. Schon am ersten Tag hatte ich gemutmaßt, er stehe in Wirklichkeit im Dienst der CIA oder der NSA. Im Gegensatz zum Rest der eitlen Meute hatte ich Sneider von Beginn an nicht gerade gemocht, aber doch geschätzt, auch wenn er mir hin und wieder mit seiner herablassenden Art auf die Nerven ging. Er schien mir der einzige Vernünftige zu sein in diesem Hühnerhof der Eitelkeiten.
Vorhin hatte er mir erzählt, weshalb er so gut Deutsch sprach: Während seiner Stationierung in Heidelberg als Offizier der US-Army hatte er seine Frau gefunden, eine in der Wolle gefärbte Handschuhsheimerin, und sie später in die Staaten exportiert. Deshalb sprach er Deutsch mit kurpfälzischem Einschlag und kannte die Stadt vermutlich besser als mancher Einheimische.
Neben ihm aufgereiht saßen vier seiner Mitarbeiter, alle gut gebräunte und athletisch gebaute Kerle, die auf Surfbrettern eine wesentlich bessere Figur gemacht hätten als in ihren dunklen Anzügen. Daneben zwei interessiert dreinblickende Damen mittleren Alters in marineblauen Kostümen. Die sechs blieben die ganze Zeit stumm. Ich war mir nicht einmal sicher, ob sie der Diskussion folgen konnten, die teils auf Englisch, teils auf Deutsch geführt wurde. Dennoch wirkten sie auch nach anderthalb Stunden Langeweile immer noch hellwach, jede Sekunde bereit, zur Waffe zu greifen und sich für irgendwen ins Feuer zu werfen.
Mir gegenüber saß eine Reihe ernster Herren vom BKA, blasser als die Amerikaner und wesentlich unsportlicher, aber selbstverständlich ebenfalls in gepflegten Anzügen. Ich selbst trug aus stillem Protest Jeans zu einem legeren Sakko und war offenbar auf die falsche Seite geraten.
Die rothaarige Kollegin kam endlich zur letzten Folie und bedankte sich für unsere Aufmerksamkeit.
»Well«, ergriff Sneider das Wort. »Thank you very much for your brilliant presentation …«
Nun wurde eine Weile diskutiert und abgewogen, und am Ende kam man zu dem Ergebnis, zu dem ich gleich zu Beginn gekommen war: Man konnte nichts sagen. Vieles war möglich, manches bedenklich, weniges wahrscheinlich. Die Amerikaner sahen die größte Gefahr in militanten Islamisten, in Selbstmordattentätern, die sich auf die Zärtlichkeiten von siebzig Jungfrauen freuten, in erzwungenen Flugzeugabstürzen, Raketenangriffen von den Höhen des Heiligenbergs. Die BKA-Leute hielten mehr oder weniger alles für möglich, sahen jedoch bisher keine ernst zu nehmende Bedrohung von irgendeiner Seite.
Um Angriffe aus der Luft praktisch unmöglich zu machen, würde der zivile Luftverkehr für die Dauer der Tagung Umwege fliegen müssen. Auf Militärflugbasen der Amerikaner in der Pfalz würden voll bewaffnete Abfangjäger in ständiger Alarmbereitschaft stehen. All das war nicht neu und schon seit Monaten beschlossen. Meine Augenlider sanken herab. Das Hin und Her der Stimmen wurde leiser und dumpfer.
Als ich hochschrak, lächelte Sneider mich in einer Mischung aus diebischem Mitgefühl und Neid an. Ich lächelte verwirrt zurück und bemerkte erst mit Verzögerung, was mich aus meinem wohlverdienten Sitzungsschlummer gerissen hatte: Das Handy surrte aufgeregt in der Brusttasche meines Jacketts. Es war Sönnchen. Wenn sie mich auf dem Handy anrief, dann war es wichtig. Außerdem war der Anruf eine prima Gelegenheit, ein wenig frische Luft zu schnappen. So nickte ich wichtig in die Runde und sprang auf.
»Sie ist schon da«, raunte meine Sekretärin, als ich die schwere Tür hinter mir ins Schloss zog.
»Wer?« Ich räusperte mich. Meine Stimme war noch nicht ganz wach. »Wer ist da?«
»Die Kollegin vom BKA, von der wir vorhin gesprochen haben.«
»Und um mir das zu sagen, rufen Sie mich aus einer Besprechung?«
»Wir wissen nicht, wohin mit ihr. Wir haben im ganzen Haus keinen einzigen Schreibtisch mehr frei. Und da haben wir gedacht, die Petra, also die Frau Ragold, und ich …«
»Warum stecken Sie die Frau nicht einfach zu diesem Herrn von … wie heißt er noch gleich?«
»Von Lüdewitz.«
»Liebekinds Büro ist ja wohl groß genug für zwei.«
»Haben wir auch gedacht. Aber der Herr möchte das nicht. Ist anscheinend unter seiner Würde.«
»Und jetzt?«
Sönnchen atmete tief durch.
»Also, Herr Gerlach, wir haben gedacht, Sie haben doch auch ein ziemlich großes Büro. Und die Frau vom BKA sagt, sie braucht bloß einen ganz kleinen Schreibtisch und einen Stuhl und ein Telefon und ein Eckchen, wo sie sitzen kann. Sogar ihren eigenen Laptop hat sie dabei. Ich hab mir auch schon überlegt, wo …«
»Haben Sie sie schon gesehen?«
»Gesehen? Wen?«
»Diese Kollegin.«
»Ja klar.«
»Und wie ist sie so?«
»Nett. Sehr sympathisch. Und eher von der stillen Sorte. Sonst hätt ich mich auch gar nicht getraut, Sie zu fragen.«
»Und Sie finden, meine Würde ist nicht so hoch wie die von Herrn von Lüdewitz? Mir kann man schon irgendwelche Fremden ins Büro setzen?«
»Ich finde, Sie sind ein vernünftiger Mensch, Herr Gerlach.«
»In Gottes Namen«, seufzte ich, da genau in diesem Moment die Doppeltür des Sitzungsraums aufsprang und die angeregt plaudernden Damen und Herren herausströmten. »Aber wenn sie mir auch nur das kleinste bisschen auf den Geist geht, dann finden Sie eine andere Lösung, versprochen?«
Ich winkte Keith Sneider, er möge auf mich warten.
»Sie wird Ihnen nicht auf die Nerven gehen. Frau Guballa ist wirklich eine Ruhige. Und hässlich ist sie übrigens auch nicht.« Aus irgendeinem Grund schien meine Sekretärin plötzlich böse mit mir zu sein.
Sneider stand breit grinsend vor mir und sah mich erwartungsvoll an.
»Was machen Sie eigentlich so an den Abenden?«, fragte ich und steckte das Handy ein.
»Oh, wir … will sagen, meine Frau hat eine Menge Verwandtschaft hier und alte Freunde. Mir wird nicht langweilig, falls Sie das befürchten.«
»Hätten Sie trotzdem Lust, mal gelegentlich ein Glas mit mir zusammen zu trinken?«
Sneider zeigte zwei Reihen bestens gepflegter Nussknackerzähne und schlug mir kräftig auf die Schulter.
»Aber gerne. Sagen Sie einfach, wann und wo. Ich freue mich auf einen zünftigen Männerabend und ein gutes Glas Wein. Allmählich kann ich keine Verwandtschaft mehr sehen, und außerdem trinkt Margots Anhang nur Bier.«
4
»Diese Frau hat schon wieder angerufen«, eröffnete mir Sönnchen mit abgewandtem Blick, als ich mein Vorzimmer betrat. »Es sei wichtig, sagt sie. Soll ich ihr beim nächsten Mal Ihre Handynummer geben?«
Aus meinem Büro kam gerade der schwitzende und schnaufende Hausmeister, gefolgt von einer unscheinbaren, ebenfalls ein wenig atemlosen dunkelhaarigen Frau in dunkelbraunen Cordjeans und einer Bluse in etwas hellerem Braun. Die Farbe ihres halblang und praktisch geschnittenen Haars lag irgendwo dazwischen. Auf der kleinen Nase trug sie eine schmale Brille mit rehbraunem Horngestell. Im Kinn hatte sie ein kleines Grübchen.
»Auf gar keinen Fall!«, fuhr ich Sönnchen an. »Auf keinen Fall geben Sie irgendwelchen Leuten meine Handynummer!«
»Sie klingt …« Sönnchen sah die Fremde an und nickte ihr übertrieben freundlich zu. »Ich glaub, sie ist ziemlich verzweifelt. Sie sagt übrigens, Sie kennen sich.«
Die braune Frau stand mit ausgestreckter Hand und verlegenem Lächeln vor mir.
»Guballa«, sagte sie mit dunkler Stimme. »Danke, dass Sie mir Asyl gewähren. Helena, wenn Sie mögen.«
Ich drückte ihre warme, weiche Hand und sagte gleichzeitig zu Sönnchen: »Wie heißt diese Frau denn, die mich angeblich kennt?«
»Will sie nicht sagen.«
Ich ließ die Hand wieder los. Der Hausmeister, der wegen irgendetwas wütend zu sein schien, knallte brummelnd die Tür hinter sich zu.
»Sie behauptet, sie kennt mich, aber ihren Namen will sie nicht verraten?«
Sönnchen zuckte verstockt die Achseln, wies auf die Frau neben mir. »Sie haben sich ja schon bekannt gemacht, sehe ich.«
Die Frau in Cordjeans lächelte inzwischen nicht mehr.
»Entschuldigung«, sagte ich und reichte ihr ein zweites Mal die Hand. »Hier geht’s gerade ein bisschen drunter und drüber, wie Sie sehen. Sie sind also meine neue Bürogenossin. Na dann, auf gute Koexistenz.«
Jetzt lächelte sie wieder. »Guballa. Helena, wenn Sie mögen.«
Sie roch nach nichts. Nicht nur ihre Hand war weich, auch ihre Bewegungen, ihr ganzer Körper schien es zu sein. Die Jeans spannte ein wenig um die Hüften.
»Gerlach«, sagte ich. Das fehlte noch, dass irgendwelche wildfremden Kolleginnen mich gleich am ersten Tag mit dem Vornamen anredeten. »Was wird Ihre Aufgabe sein, wenn ich fragen darf?«
Ich bat Sönnchen um einen zweiten Cappuccino und betrat, gefolgt von meiner neuen Mitbewohnerin, mein Büro, wo mittlerweile zwischen Fenster und Wand gequetscht ein kleiner Schreibtisch stand. Schon mit Telefon, aber noch ohne Stuhl. Kurz entschlossen packte ich einen meiner vier Besucherstühle und stellte ihn vor den Schreibtisch, der aussah, als hätte er schon einige Jahre im Keller seiner Entsorgung entgegengemodert.
»Ich bin Zielfahnderin«, sagte die Frau in meinem Rücken schüchtern.
»Und nach wem werden Sie fahnden?«
»Judith Landers. Der Name sagt Ihnen etwas?«
»Da war mal irgendwas mit der RAF, nicht wahr?«
Helena Guballa trug keinen Schmuck. Kein Ring, nichts an den Ohren, nicht einmal ein dünnes Kettchen um den Hals. Ihre Nägel waren kurz geschnitten und unlackiert. An manchen Fingern waren sie so kurz, als würde hin und wieder an ihnen genagt.
»Ich bin hier in Heidelberg«, erklärte sie ernst, »weil es gewisse Signale gibt, dass sie einen Anschlag plant.«
»Auf wen?«
»Vermutlich auf Ron Henderson.«
»Den amerikanischen Wirtschaftsminister?«, fragte ich ungläubig und setzte mich hinter meinen Schreibtisch, während sie stehen blieb. »Sie meinen … einfach so? Im Alleingang?«
In diesem Augenblick summte mein Telefon.
»Die Dame, die ihren Namen nicht verraten will«, sagte Sönnchen knapp und stellte durch.
»Guten Tag, Herr Gerlach«, hörte ich im nächsten Augenblick eine Frauenstimme sagen, die mir tatsächlich bekannt vorkam. »Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie einfach so überfalle, aber … ich …«
Ich beobachtete, wie Helena Guballa sich probeweise auf ihren blauen Polsterstuhl setzte, ihn zurechtrückte und dann begann, aus einem schwarzen Aktenkoffer einen weißen Laptop herauszunehmen und auf ihrem Schreibtischchen aufzubauen.
»Hallo?«, sagte ich in den Hörer, aus dem Geräusche drangen, als würde die Frau am anderen Ende der Leitung um Atem ringen. »Sind Sie noch da?«
»Es ist so entsetzlich«, erwiderte meine namenlose Gesprächspartnerin mit erstickter Stimme. »Ich … Bitte verzeihen Sie …«
Der Laptop wurde mit einer Steckdose verbunden, wozu die Zielfahnderin auf allen vieren unter den Tisch krabbeln musste und sich heftig den Kopf stieß. Offenbar hatte sie vor, unverzüglich mit dem Fahnden zu beginnen.
»Es geht um meinen Sohn«, sagte die Frau am Telefon mit plötzlich wieder fester Stimme. »Er ist verschwunden. Seit Wochen.«
Ihr akzentfreies Hochdeutsch und ihre Ausdrucksweise ließen mich vermuten, dass sie zu den sogenannten besseren Kreisen zählte.
»Dann empfehle ich Ihnen, sich ans nächste Polizeirevier zu wenden.«
»Das habe ich natürlich längst getan.«
Endlich fiel mir ein, woher ich diese Stimme kannte. Ich hatte schon einmal mit ihr telefoniert, vor einem knappen Jahr. Damals war es um einen verschwundenen kleinen Jungen gegangen, Gundram Sander. Und auch damals hatte die Frau sich geweigert, ihren Namen zu nennen.
Helena Guballa verließ mit lautlosen Schritten unser gemeinsames Büro. Sie trug braune Pumps fast ohne Absätze, deren Farbe einen Stich zu rötlich war, um mit dem restlichen Outfit zu harmonieren. In der Tür wäre sie um ein Haar mit Sönnchen zusammengestoßen, die meinen zweiten Cappuccino des Tages hereinbrachte. Die beiden lachten sich an. Man schien sich zu mögen. Frauensolidarität. Meine untreue Sekretärin hatte offensichtlich schon die Fronten gewechselt.
»Mehr als die Kollegen werde ich leider auch nicht für Sie tun können«, sagte ich ins Telefon.
Sönnchen stellte die Tasse vor mich hin und nickte mir zu, ohne mich anzusehen.
»Ich bitte Sie!« Die Frau am Telefon klang wirklich verzweifelt. »Ich bin bereit, Sie an jedem Ort zu treffen außer in Ihrem Büro. Ich werde alles tun, was Sie verlangen, ich habe Geld, ich …«
Ich lehnte mich zurück, schloss für einen kurzen Moment die Augen und versuchte, mich zu entspannen. »Wie alt ist denn Ihr Sohn?«
»Zweiundzwanzig.«
»Ist er in irgendeiner Form behindert? Orientierungslos?«
»Diese Fragen habe ich schon mindestens zehn Mal beantwortet«, erwiderte sie scharf. »Nein! Peter ist nicht behindert! Peter ist ein intelligenter Junge. Er studiert. Aber verstehen Sie doch, es ist einfach zu kompliziert, um es am Telefon …« Ein Schluchzen hinderte sie am Weitersprechen.
Ich trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte herum. Sah auf die Uhr. Halb elf, und ich hatte noch nichts gearbeitet an diesem verhexten Donnerstag. Kollegin Guballa kam zurück, ein aufgerolltes Datenkabel in der Hand, setzte sich wieder an ihren Schreibtisch und verband ihren Edellaptop mit dem Internet. Offenbar hatte sie das leider viel zu seltene Talent, sich völlig lautlos zu bewegen. Aus dem Telefon hörte ich den stoßweisen Atem der deprimierten Mutter. Ich hatte große Lust, den Hörer aufzulegen und nach Hause zu gehen.
»Bevor wir weiterreden, würde ich gerne Ihren Namen erfahren«, sagte ich unfreundlich.
»Hagenow«, stieß sie nach Sekunden hervor. »Anna-Katharina Hagenow.«
»Kann es sein, dass man Ihren Mann kennt?«
»Ja.«
»Er ist irgendwas an der Universität, richtig?«
»Burkhard ist … ziemlich bekannt, ja. Auch über die Fachwelt hinaus.«
Prof. Dr. mult. Burkhard Hagenow. Mehr als einmal hatte ich sein immer ein wenig blasiertes, jedoch nicht unfreundliches Juristengesicht in den Nachrichten gesehen. Meist, wenn es um verfassungsrechtliche Fragen ging. Um Fragen der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel und des Schutzes der Privatsphäre des Bürgers vor der angeblich unstillbaren Neugier der Strafverfolgungsbehörden.
»Ich habe um zwölf Mittagspause«, sagte ich plötzlich entschlossen. »Wir treffen uns im Red. Das ist ein vegetarisches Restaurant nicht weit von hier.«
Das ich immer schon einmal ausprobieren wollte.
»Also, ich find, Sie könnten ruhig ein bisschen netter zu ihr sein«, meinte Sönnchen, als die neue Kollegin wieder einmal irgendwohin verschwunden war. »Die arme Frau kann ja schließlich nichts dafür, dass man sie zu uns abkommandiert hat.«
»Ich habe ihr eigenhändig einen Stuhl hingestellt! Und zweimal die Hand gegeben.«
»Sie wissen genau, was ich meine.«
»Wenn sie so ruhig bleibt wie bisher, dann werde ich nett zu ihr sein«, versprach ich und reichte ihr einige Akten zur Ablage über den Tisch. »Haben Sie schon mal was von dieser Judith Landers gehört?«
Sönnchen nickte. »Sie ist in Heidelberg aufgewachsen. Und später ist sie bei der RAF gewesen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. In der Stadt ist damals viel über sie geredet und geschrieben worden. Sie hat mindestens drei Menschen umgebracht. Darunter zwei Polizisten. Und seither ist sie spurlos verschwunden.«
»Sie ist nie gefasst worden?«
»Doch«, antwortete Helena Guballa hinter mir, die unbemerkt und ungehört zurückgekehrt war. »Drei Mal sogar. Aber sie ist uns jedes Mal wieder entwischt. Beim ersten Mal konnte sie durch ein idiotischerweise unvergittertes Fenster eines Polizeireviers in Eschweiler entkommen. Zwei Jahre später wurde sie wieder gefasst, in einem Vorort von Beirut. Aber bei der Überstellung nach Deutschland ist einiges schiefgelaufen. Bei der Zwischenlandung in Rom konnte sie entkommen. Das war zweiundneunzig. Ein Jahr später hat sie dann beim dritten Versuch, sie festzunehmen, zwei Polizisten erschossen.«
»Und seither ist sie verschwunden? Seit fast zwanzig Jahren?«
Die Zielfahnderin schlug die braunen Augen nieder, als hätte ich ihr einen Vorwurf gemacht. »Es gab immer wieder Hinweise aus allen möglichen Gegenden der Welt, aber nichts davon hat einer Überprüfung standgehalten. Manche denken, sie sei tot.«
Ich beugte mich vor und faltete die Hände auf dem Tisch. »Sie aber nicht?«
»Nein«, erwiderte Helena Guballa fest und sah mir zum ersten Mal in die Augen. »Ich nicht.«
»Und nachdem diese Frau zwanzig Jahre lang friedlich war, sich vielleicht irgendwo eine bürgerliche Existenz aufgebaut hat, vielleicht auch tot ist, da vermuten Sie, dass sie plötzlich einen Anschlag auf den amerikanischen Wirtschaftsminister plant?«
Ihr Blick blieb ruhig. Offenbar war sie es gewohnt, sich verteidigen zu müssen. »Es gibt einen sehr ernst zu nehmenden Hinweis aus Italien. Von einem V-Mann, den die Mailänder Kollegen bei den Brigate Rosse einschleusen konnten.«
»Und das ist alles?«
»Ich finde, es ist genug.«
5
Als ich sie vor einem Jahr zum ersten Mal traf, war Anna-Katharina Hagenow eine stolze Frau gewesen, die ein klein wenig Ähnlichkeit mit Theresa hatte. Damals hatte ich sie als Zeugin kennengelernt, als Nachbarin der verzweifelten Eltern des seit Wochen vermissten kleinen Gundram. Auch damals wollte sie mich unbedingt unter vier Augen sprechen und hatte sich geweigert, die Polizeidirektion zu betreten. Ihre Aussage lenkte den Verdacht auf die Eltern selbst, was sich später glücklicherweise nicht bewahrheitete.
Heute war die stolze Frau von damals ein Schatten ihrer selbst. Das Gesicht nachlässig geschminkt, das marineblaue Leinenkleid zerknittert, die halbhohen, farblich perfekt abgestimmten Schuhe staubig, der Blick aus den früher beeindruckenden dunklen Augen waidwund. Sie erwartete mich vor der Tür des kleinen Restaurants.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte sie heiser, als wir uns die Hände reichten. »Ich werde selbstverständlich die Rechnung übernehmen. Wo Sie schon Ihre wohlverdiente Mittagspause für mich opfern.«
»Das ist nicht nötig, danke.«
Wir setzten uns an einen der Tische unter den roten Sonnenschirmen, von denen man eine hübsche Aussicht auf die Großbaustelle um das ehemalige Heidelberger Hallenbad hatte. Der September schien uns für den verregneten August entschädigen zu wollen. Pünktlich zum Monatswechsel war es warm und sonnig geworden. Dennoch roch es hin und wieder schon ein wenig nach Herbst. Die Speisekarten lagen auf dem Tisch, der Kellner stand bereits erwartungsvoll grinsend neben uns. Ich wählte überbackene Pasta mit gemischten Gemüsen. Meine Gesprächspartnerin bestellte ihr Risotto mit einer Achtlosigkeit, als hätte sie nicht vor, es anzurühren. Seit meine Töchter kein Fleisch mehr aßen, hatte auch ich mehr und mehr die vegetarische Küche schätzen gelernt. Es sei gut für die Gesundheit, hatte ich gelernt. Und für die Umwelt auch.
»Was ist das nun für eine Geschichte mit Ihrem Sohn?«, fragte ich, als der Kellner verschwunden war. »Sie haben Angst, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte?«
»Ich habe eher Angst, dass er Dummheiten macht.« Mit starrer Miene sah sie auf den Tisch. »Peter ist in den letzten Jahren sehr … politisch geworden. Er versteht sich nicht sonderlich gut mit seinem Stiefvater. Burkhard und er … Die beiden sind wie Feuer und Wasser. Peter entstammt meiner ersten Ehe. Er war immer – entschuldigen Sie, aber es fällt mir kein bescheideneres Wort ein – ein Musterkind. In der Schule immer unter den Besten. Nie gab es Grund zur Klage, nie. Aber dann ist mein erster Mann gestorben, an einer bis heute nicht heilbaren Nervenkrankheit. Damals war Peter dreizehn, mitten in der Pubertät, und dieser Schicksalsschlag hat ihn sehr getroffen. Er hat seinen Vater geliebt. Nein, das trifft es nicht, er hat ihn vergöttert. Später dann war er einige Zeit in Therapie und hat sich wieder gefangen. Er ist so sensibel. Ich … ich habe … Burkhard und ich haben uns damals schon einige Zeit gekannt, und – nun ja. Das war dann der nächste Schicksalsschlag für meinen kleinen Peter.«
Unsere Getränke kamen. Frau Hagenow hatte ein Fläschchen stilles Wasser bestellt, ich eine Cola. Wir nickten uns zu, nippten an unseren Gläsern.
Wieder schlug sie die dunklen Augen nieder. »Anfangs habe ich Burkhard meinem Sohn einfach als alten Freund vorgestellt. Wollte ihn schonen. Erst später mit der Wahrheit herausrücken. Aber er hat es dann selbst herausgefunden. Er hat zufällig ein Telefonat belauscht. Es war meine Schuld. Ich dachte, er sei bei Freunden, und war unvorsichtig. An diesem Tag ist zum zweiten Mal die Welt für ihn eingestürzt. Und von diesem Tag an hat er Burkhard gehasst, bis aufs Blut. Mich seltsamerweise nicht. Niemals. Aber alles, was Burkhard sagte, wurde von nun an angezweifelt, hinterfragt, bekämpft.«
»Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn ist sehr eng?«
»Nach dem Tod meines ersten Mannes haben Peter und ich uns aneinandergeklammert. Vielleicht enger, als es gut war, ja.«
»Seit wann ist Ihr Sohn verschwunden?«
»Etwa seit acht Wochen. Ich kann es nicht genau sagen.«
»Davor hat er bei Ihnen gewohnt?«
»Aber nein. Peter studiert. Er hat ein Zimmer in Schlierbach. Er hat gesagt, er brauche Abstand. Ich habe es akzeptiert, auch wenn es mich schmerzte. Am Ende wollte er nicht einmal mehr Geld von mir annehmen. Lieber hat er gejobbt, um sich seinen Unterhalt und sein Studium zu verdienen. Immerhin haben wir da noch regelmäßig telefoniert, uns hin und wieder auch gesehen. Bei einem kleinen Lunch in der Stadt zum Beispiel. Aber jetzt habe ich schon wochenlang nichts mehr von ihm gehört. Überhaupt nichts. Sein Handy ist aus. Wenn ich ihm auf die Mailbox spreche, antwortet er nicht. Gestern habe ich seine Vermieterin angerufen. Die sagte mir, Peter habe sein Zimmer schon zum dreißigsten Juni gekündigt.«
»Das wären dann ja schon fast zehn Wochen.«
Sie nickte mit gesenktem Blick. An manchen ihrer Nägel war der blassrosa Lack abgeplatzt.
»Denken Sie, der Konflikt mit seinem Stiefvater hat etwas mit dem Verschwinden Ihres Sohnes zu tun?«
»Ich kann es nicht sagen.« Hilflos hob sie die schlanken Hände. »Ich weiß ja nichts. Nichts. Nur, wenn die beiden zusammentrafen, dann gab es Streit. Immer. Nach fünf Minuten.«
»Und dabei ging es um Politik?«
»Politik, Umweltzerstörung, soziale Gerechtigkeit. Letzteres vor allem. Sie machen sich keine Vorstellung, was bei uns los war, als weltweit die Banken zusammenbrachen und die leitenden Herren für ihr Versagen und Missmanagement auch noch fürstlich belohnt wurden.«
Unser Essen kam. Frau Hagenow schien es nicht einmal zu bemerken, dass die pummelige Bedienung einen appetitlich angerichteten Teller vor sie hinstellte.
»Ich fürchte, Peter hat sich irgendwelchen Gruppen angeschlossen«, sagte sie leise.
Ich ergriff die Gabel und begann zu essen. Schließlich hatte ich nicht ewig Mittagspause.
»Politischen Gruppen?«, fragte ich zwischen zwei Bissen.
»Sehr radikal denkenden Gruppen. Vielleicht sogar terroristischen Gruppierungen, wenn es so etwas zurzeit überhaupt gibt bei uns in Deutschland. Sie sehen, ich halte alles für möglich. Sie haben selbst Kinder, oder? Dann können Sie sich vorstellen, wie verzweifelt ich bin.«
»Seit die RAF Ende der Neunziger offiziell ihre Auflösung verkündet hat, ist es an dieser Front eigentlich ruhig geworden.«
»Jede Zeit scheint ihre eigene Form von Terrorismus hervorzubringen, nicht wahr? Jetzt sind offensichtlich die Muslime an der Reihe.«
»Ihr Sohn ist aber nicht etwa zum Islam konvertiert?«
»Aber nein.« Energisch schüttelte sie den Kopf. »Zum Thema Religion hat Peter immer gerne Marx zitiert: Opium fürs Volk. Auch so ein Thema, bei dem er sich regelmäßig mit seinem Stiefvater in die Haare gekriegt hat.«
Endlich ergriff sie doch ihre Gabel und begann, in ihrem Risotto herumzustochern. Sie verschlang einige Happen, legte ebenso plötzlich die Gabel auf die Serviette zurück. Ihr Gesicht war in ständiger Bewegung, die Augen kamen nicht zur Ruhe, der schön geschwungene Mund machte seltsame Zuckungen. Die Frau war am Ende ihrer Kräfte.
»Könnte es nicht sein, dass Ihr Sohn einfach nur ein bisschen Urlaub macht, ohne Ihnen etwas davon zu sagen?«
»Natürlich könnte das sein. Peter hat etwas Geld. Er hat einen Teil des nicht besonders großen Vermögens meines ehemaligen Mannes geerbt. Aber sonst hat er mich immer informiert, wenn er vorhatte zu verreisen.«
»Es gibt da leider ein Problem, Frau Hagenow«, sagte ich, als ich meine Pasta bis auf die letzte Erbse aufgegessen hatte. »So gerne ich würde, ich kann Ihnen nicht helfen.«
»Aber das weiß ich doch«, murmelte sie mit gesenktem Kopf. »Mir ist bewusst, dass Sie von Amts wegen nichts unternehmen können. Nichts unternehmen dürfen.«
»Es sei denn, ich hätte einen begründeten Verdacht, dass Ihr Sohn in Gefahr ist oder tatsächlich eine kriminelle Aktion plant. Gibt es denn Hinweise darauf, dass er etwas Derartiges vorhat?«
»Es gibt überhaupt keine Hinweise.« Mutlos schüttelte sie den Kopf. »Ich dachte, dass Sie vielleicht privat … Sie haben die Erfahrung. Sie haben die Möglichkeiten. Geld wird keine Rolle spielen. Nennen Sie mir Ihren Preis, und ich werde Ihnen hier und jetzt die Hälfte als Anzahlung übergeben.«
»Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Ich kenne einen guten Privatdetektiv. Er wird Ihren Sohn hundertmal schneller finden, als ich es könnte. Privatdetektive sind nicht an Dienstvorschriften gebunden. Sie müssen nicht jedes Mal die Staatsanwaltschaft um Erlaubnis bitten, bevor sie einen Finger krumm machen.«
»Es wäre mir aber wichtig, dass nichts davon an die Öffentlichkeit dringt. Stellen Sie sich vor … bei Burkhards Position …«
»Da kann ich Sie beruhigen. Ein Privatdetektiv, der nicht absolut diskret ist, wird bald keiner mehr sein. Der Mann, den ich Ihnen empfehle, ist wirklich seriös und vertrauenswürdig.«
»Wie heißt er?«
»René Pretorius. Seine Nummer finden Sie im Telefonbuch.«
Zu meiner Verblüffung zückte sie ein modernes Handy, zog einen Stift heraus und begann, die Zunge spitz im Mundwinkel, auf dem Display herumzupiksen. Sekunden später hatte sie ihn schon gefunden. Einmal mehr fühlte ich mich alt und von gestern.
Auf dem Schild neben meiner Tür stand ein zweiter Name: Unter »A. Gerlach, Kriminaloberrat« stand in derselben Schriftgröße: »H. Guballa, Kriminalrätin«
»War das wirklich nötig?«, fragte ich Sönnchen, die todsicher hinter dem Komplott steckte.
»Selbstverständlich ist das nötig«, erwiderte sie patzig. »Frau Guballa arbeitet hier, und drum steht jetzt ihr Name an der Tür.«
»Ich habe gedacht, es ist nur, bis Sie einen freien Schreibtisch für sie gefunden haben?«
»Sobald wir einen freien Schreibtisch für Frau Guballa gefunden haben, kommt der Name ja auch wieder weg«, erwiderte sie spitz und machte sich an ihrem Regal zu schaffen, damit sie mir den Rücken zuwenden konnte.
Die Tür zu meinem Büro stand meist offen, wenn ich nicht anwesend war. Heute war sie geschlossen. Um ein Haar hätte ich angeklopft. Meine Bürogenossin saß vornübergebeugt an ihrem Laptop und tippte konzentriert. Sie tippte mit zehn Fingern und fast so schnell wie Sönnchen.
»Hallo«, sagte ich bemüht jovial. »Wie läuft’s?«
»Nun ja«, antwortete sie, ohne den Kopf zu heben. »Fusselarbeit.«
»Ich dachte, Zielfahndung ist eher Puzzlearbeit?«
Okay, es war kein Weltklassescherz. Aber ein klein wenig hätten ihre Mundwinkel schon zucken können, fand ich. Doch diese Frau war offenbar genauso humorlos, wie sie aussah.
»Beides ist richtig«, erklärte sie ernsthaft. »Puzzeln heißt, Teile, die auf dem Tisch liegen, richtig zusammenzufügen. Fusseln heißt, die richtigen Teile in einem gigantischen Berg von Müll überhaupt erst zu finden.«
»Wonach suchen Sie zurzeit, wenn man fragen darf?«
»Nach Namen. Namen von Menschen, mit denen Judith Landers in der Vergangenheit irgendwann einmal zu tun hatte. Alte Schulfreundinnen, erste Lieben, Kommilitonen …«
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und nahm mir die Unterschriftenmappe vor, die Sönnchen für mich bereitgelegt hatte.
»Hat man das nicht alles schon vor zwanzig Jahren erledigt?«
»Vielleicht nicht mit der gebotenen Gründlichkeit.«
»Weshalb machen Sie das nicht von Wiesbaden aus? Sollte doch heutzutage mit Internet und Telefon kein Problem sein.«
Sie hörte keine Sekunde auf zu tippen. Offenbar schrieb sie etwas von einer handschriftlichen Liste ab, die neben dem Laptop lag.
»Sie hätten Ihr Büro gerne wieder für sich alleine?«
»So meine ich das nicht.«
Endlich kamen ihre etwas zu kurz geratenen Finger zur Ruhe. Sie wandte den Kopf, sah mich an.
»Judith ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Später hat sie hier studiert. Ich möchte mit möglichst vielen Menschen sprechen, mit denen sie damals Kontakt hatte. So etwas geht nicht per Telefon. Am Telefon entsteht kein Vertrauen. Und ohne Vertrauen erfährt man die wirklich wichtigen Dinge nicht. Die kleinen Details, die uns vielleicht einen entscheidenden Schritt weiterbringen. Judith war zum Beispiel einige Zeit im Libanon. Warum sollte sie dort nicht zufällig eine alte Kindergartenbekanntschaft wiedergetroffen haben? So etwas kommt vor.«
»Sie nennen sie beim Vornamen?«
Sie tippte schon wieder. »Sie ist Judith für mich, weil ich sie inzwischen vermutlich besser kenne als jeder andere Mensch auf der Welt. Ihre Mutter eingeschlossen.«
Ich blätterte die Unterschriftenmappe durch und signierte, wo Sönnchen ihre gelben Kleberchen angebracht hatte. Helena Guballa tippte und tippte. Das leise Geräusch störte mich. Ihre Anwesenheit störte mich. Ihr Atmen fand ich zu laut. Ihr gelegentliches Räuspern beunruhigend. Hin und wieder telefonierte sie leise. Auch das nervte mich. Vor allem nervte mich jedoch, dass ich meist nicht verstehen konnte, worum es bei diesen Telefonaten ging, weil sie so leise sprach. Einmal schien sie mit einem Kollegen in Wiesbaden irgendwelche Informationsschnipsel auszutauschen. Einmal klang es, als spräche sie mit einer Frau, die der Terroristin vor Jahrzehnten einige Monate lang ein Zimmer vermietet hatte.
6
Keith Sneider war schon in der Susibar, als ich einige Minuten zu spät eintraf. Es war noch früh am Abend. Wir waren bisher die einzigen Gäste. Der Amerikaner unterhielt sich angeregt mit Susi, die mich sofort wiedererkannte.
Ihr herzliches Lachen wirkte echt. »Ich hoffe, Sie kommen nicht wieder zur Verbrecherjagd zu mir, Herr Gerlach!«
Ich hängte meinen feuchten Mantel an die Garderobe neben der Tür. Nachdem in den vergangenen Tagen prächtiges Altweibersommerwetter geherrscht hatte, mit dunkelblauem Himmel und einer Sonne, die die Farben zum Leuchten brachte, waren im Lauf des Nachmittags Wolken aufgezogen, und ein fieser Nieselregen hatte eingesetzt.
»Heute bin ich ausnahmsweise mal nur zum Vergnügen hier«, erwiderte ich lachend.
Susi war ein Phänomen. Man brauchte sie nur anzusehen, um sich sofort besser zu fühlen. Sie strahlte eine unverwüstliche gute Laune aus. Sie mochte die Menschen, sie mochte ihre Gäste, jeden Einzelnen von ihnen. Wen sie nicht mochte, der blieb nicht lange ihr Gast. Die schwarze Löckchenpracht war seit meinem letzten Besuch um einiges kürzer geworden, ansonsten sah sie genauso aus wie immer. Schlank, gerade, flink, mit buntem Schmuck behängt.
»Durbacher Weißherbst, wie üblich? Es ist ein neuer Jahrgang, aber ich finde ihn fast noch besser als den letzten.«
Sneider hatte ein langstieliges Weißweinglas vor sich stehen und schien sich wohlzufühlen.
»Keith«, sagte er lächelnd, als wir kräftig Hände schüttelten. »In den Staaten haben wir es nicht so mit den Nachnamen.«
»Alexander.«
Susi stellte ein großzügig eingeschenktes Glas vor mich hin. Aus den Lautsprecherboxen klimperte ein schon tausend Mal gehörter Bossa Nova von Stan Getz, dessen Titel mir nicht einfallen wollte.
»Wie gefällt Ihnen Heidelberg?«, fragte ich.
»Wunderbar.« Sneider lächelte immer noch. »Für uns Amerikaner ist das nun mal etwas Besonderes, eine Stadt, die fast tausend Jahre alt ist. Häuser, die schon den Dreißigjährigen Krieg überstanden haben. Bei uns gilt ja ein fünfzig Jahre altes Gebäude schon als Sehenswürdigkeit.«
»Ich nehme an, es hat sich manches verändert, seit Sie hier stationiert waren?«
»Die Menschen vor allem. Sie sind lockerer geworden. Amerikanischer, wenn Sie so wollen. Man duzt sich schneller. Man gibt sich nicht mehr bei jeder Gelegenheit die Hand.«
Wir machten Small Talk, erzählten von unseren Frauen und Kindern. Sneiders Frau war Dozentin für deutsche Sprache an irgendeiner Highschool. Meine Frau, Vera, war seit mehr als zwei Jahren tot. Sneiders Kinder, drei Söhne, studierten praktische Dinge, mit denen sie später leicht einen gut bezahlten Job finden würden. Meine Töchter wurden in etwas mehr als einer Woche sechzehn und hatten nicht den leisesten Schimmer, was sie dereinst mit ihrem Abitur anfangen sollten. Falls sie es überhaupt schaffen sollten, wonach es zurzeit nicht unbedingt aussah. Irgendwann landeten wir unweigerlich bei unserer gemeinsamen Arbeit. Inzwischen waren wir beim Du.
»Ihr fürchtet also wirklich, man trachtet eurem Wirtschaftsminister nach dem Leben?«
Sneider zog den Mund schief. »Wir müssen mit allem rechnen. Das ist unser Job.«
Ron Henderson war erst seit wenigen Monaten im Amt, nachdem sein Vorgänger wegen irgendwelcher Aktiengeschäfte hatte zurücktreten müssen.
»Er ist ein harter Hund, heißt es.«
»Henderson ist der Prototyp des amerikanischen Konservativen, wenn du so willst, ein typischer Vertreter des American way of life: vom Pizzaboten zum Milliardär. Und jetzt zum krönenden Abschluss auch noch in ein hohes Regierungsamt.«
»Bei so einer Karriere macht man sich vermutlich viele Feinde.«
»Mir ist bisher nicht zu Ohren gekommen, dass er irgendwelche Freunde hätte.« Sneider grinste mich an, als hätte er einen obszönen Witz gemacht.
Unsere Gläser waren leer. Nach einem freundlich-fragenden Blick schenkte Susi nach.
Mehr und mehr Gäste trafen ein. Die Plätze am Tresen wurden allmählich knapp. Sneider war ein angenehmer und intelligenter Gesprächspartner, stellte ich fest. Ich mochte seine ruhige, unaufgeregte Art. Er erzählte von seiner Heimat, den Wäldern Oregons, dem Städtchen, wo er aufgewachsen war, in dem es nur eine einzige Kneipe, dafür aber drei Kirchen gab, von seiner Studienzeit in San Francisco, Paris und Berlin, von seinen Jahren in Heidelberg. Ich ließ ihn reden und hörte zu. Meiner eingestreuten Frage, welche Behörde denn nun eigentlich sein Gehalt bezahlte, wich er mit einem Lächeln aus. Irgendwann entdeckte ich Pretorius im Gewühl neben der Tür. Ich legte Sneider kurz eine Hand auf die Schulter, nickte ihm zu und ging hinüber.
»Hallo«, sagte der Privatdetektiv, der sich an einem bunten Cocktail festhielt. »Danke für den Job!«
»Frau Hagenow hat sich schon bei Ihnen gemeldet?«
»Kommen Sie, um mit mir über die Provision zu verhandeln? Üblicherweise zahle ich zehn Prozent für die Vermittlung. Allerdings erst, wenn der Kunde bezahlt hat.«
»Warum so kratzbürstig? Ich dachte, wir hätten Frieden geschlossen?«
Pretorius hatte unverkennbar schlechte Laune. Außerdem hatte er schon beträchtliche Schlagseite. Er nahm einen großen Schluck aus seinem hohen Glas, stellte es auf einem der Stehtische ab, nahm es aber gleich wieder zur Hand, als hätte er Angst, es könnte ihm abhandenkommen.
»Entschuldigung. War nicht mein Tag heute.«
»Was halten Sie von der Geschichte?«
»Vom verlorenen Sohn? Was soll ich davon halten? Die Frau ist bereit, jeden Preis zu bezahlen, wenn ich ihr Wunderkind zurückbringe.«
»Ich denke, der arme Kerl hat die Fürsorge seiner Mutter nicht mehr ertragen und gönnt sich ein paar Wochen Urlaub ohne Familienanschluss.«
Der Geräuschpegel war inzwischen so hoch, dass wir die Köpfe zusammenstecken mussten, um uns zu verstehen.
»Passt nicht ganz.« Pretorius leerte sein Glas. Offenbar hatte er vor, sich in der nächsten Viertelstunde ins Koma zu trinken. »Vergessen Sie nicht: Er hat sein Zimmer gekündigt.«
»Sie meinen, er hat seine Zelte hier komplett abgebrochen?«
Der Privatdetektiv sah mit einer Miene an mir vorbei, als hätte er hinter mir jemanden entdeckt, den er nicht leiden konnte.
»Wären Sie so nett, mich ein wenig auf dem Laufenden zu halten?«, fragte ich.
»Natürlich nicht.« Er lachte gallig. »Was denken Sie von mir?«
»Sie sind diskret bis in die Haarspitzen, ich weiß. Wären Sie trotzdem so nett? Vor allem, falls sich herausstellen sollte, dass der Junge tatsächlich irgendwelche Dummheiten plant?«
Plötzlich grinste er. »Ich werde Ihnen nichts versprechen«, sagte er mit schwerer Zunge. »Aber man ist ja kein Unmensch.«
Ich drängelte mich zu Sneider zurück, der inzwischen friedlich vor sich hin lächelnd seinen Wein ausgetrunken hatte. Er schien eine Menge zu vertragen und wirkte auch nach dem zweiten Glas nicht im Mindesten betrunken. Ich dagegen spürte den Alkohol inzwischen stärker, als mir lieb war. Als ich fragend auf sein Glas deutete, erklärte er in ruhigem Ton, er müsse allmählich nach Hause zu seiner geliebten Margot. Wir nickten uns zu, er klopfte mir auf die Schulter und war Sekunden später verschwunden. Bald darauf beschloss ich, ebenfalls den Heimweg anzutreten. Ich zückte mein Portemonnaie, aber Susi bedeutete mir fröhlich, das Finanzielle habe mein amerikanischer Freund bereits erledigt.
»Netter Typ«, meinte sie. »Wo haben Sie den her? Was macht er hier?«
»Das weiß ich selbst nicht so genau«, gestand ich. »Ich vermute, er arbeitet für die CIA.«
Ausnahmsweise war sie sprachlos.
Als ich auf die dunkle und angenehm stille Krämergasse hinaustrat, hatte sich der Nieselregen zu einem kräftigen Wolkenbruch gemausert. Ausgerechnet jetzt fiel mir ein, dass ich immer noch keine Geburtstagsgeschenke für meine Töchter hatte.
7
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren drei Wohnungen in Heidelberg und zwei in Mannheim durchsucht worden. Wohnungen von Menschen, welche die Staatsschützer des BKA aus irgendwelchen Gründen als potenziell gefährlich einstuften. Es hatte fünf vorläufige Festnahmen gegeben und zwei Verhaftungen. Als ich morgens in die Direktion kam, liefen bereits die Vernehmungen, zu denen weder ich noch einer meiner Mitarbeiter geladen war.
An meinem schwarz lackierten Garderobenständer hingen ein kamelbrauner Dufflecoat, der neu wirkte, und eine schwarze, schon etwas abgenutzte Handtasche. Die Besitzerin dieser Dinge saß an ihrem Schreibtisch, über den Laptop gebeugt, als hätte sie die Nacht durchgearbeitet.
»Guten Morgen«, sagte ich und hängte mein Jackett neben ihren Mantel.
»Hallo«, antwortete sie, ohne aufzusehen. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, die Tür zum Vorzimmer offen zu lassen?«
»Gerade eben war sie noch zu.«
»Gerade eben war ich auch noch allein.«
»Haben Sie Angst, ich würde Sie irgendwie … belästigen?« Ich machte keinen Hehl daraus, dass die Vorstellung mich erheiterte.
»Ich fühle mich einfach wohler so.«
»Die Tür bleibt zu, weil sie immer zu ist, wenn ich in meinem Büro bin. Genauso, wie sie immer offen steht, wenn ich nicht hier bin.«
Sie schwieg.
»Ich mag nun mal keine offen stehenden Türen«, fügte ich nach einigen Sekunden eine Spur verbindlicher hinzu.
Sie antwortete nicht.
Wie kam ich dazu, mich für meine Gewohnheiten zu verteidigen? Sie war hier Gast und hatte sich gefälligst anzupassen. Sie hatte nett zu sein, nicht ich, verdammt. Wütend setzte ich mich an meinen Schreibtisch und ergriff irgendein Papier, während sie unentwegt weitertippte.
»Wo sind Sie eigentlich untergekommen?«, fragte ich, als mir die Spannung auf die Nerven zu gehen begann. »In Heidelberg gibt es zurzeit nicht mehr allzu viele freie Hotelzimmer, nehme ich an.«
»In einer kleinen Pension in Walldorf. Sie gehört einem alten Ehepaar, das ein paar Zimmer im oberen Stockwerk vermietet. Sie sind sehr freundlich.« Endlich sah sie von ihrem blöden Computerchen auf und in mein Gesicht. »Ich werde auch gleich verschwinden und ein paar Besuche machen. Dann haben Sie Ihr Büro wieder für sich allein. Ich werde vor dem Abend nicht zurück sein.«
Im Vorzimmer stieß Sönnchen einen spitzen Schrei aus, eine halbe Sekunde später flog die Tür auf.
»Er ist da!«, rief sie mit leuchtenden Augen.
»Wer bitte schön?«
»Der kleine Konstantin!«
Meine aufgelöste Sekretärin sah um sich, als suchte sie jemanden, dem sie um den Hals fallen konnte.
»Der Kleine von der Frau Vangelis! Dreitausendachthundert Gramm! Fünfundfünfzig Zentimeter! Vor zwei Stunden erst!«
»Eine Ihrer Mitarbeiterinnen?«, fragte Helena Guballa, nachdem Sönnchen davongelaufen war, um die sensationelle Neuigkeit in der Direktion zu verbreiten.
»Meine beste«, seufzte ich. »Sie ist seit sechs Wochen im Mutterschutz und fehlt mir vorne und hinten. Wen werden Sie heute besuchen?«
Sie nahm ein Blatt von ihrem Schreibtisch und rückte ihre Brille zurecht. »Judiths ehemalige Deutschlehrerin, die sie in den letzten zwei Jahren am Gymnasium unterrichtet hat. Die Frau ist inzwischen achtundsiebzig, erinnert sich aber noch verblüffend gut an ihre Schülerin. Anschließend will ich bei einer Schulfreundin vorbeischauen, neben der sie einige Monate gesessen hat und von der ich mir weitere Kontakte erhoffe. Und falls die Zeit reicht, noch jemanden vom Roten Kreuz, wo sie zweiundachtzig während ihres Studiums …«
Ich hob abwehrend die Hände. »So genau wollte ich es gar nicht wissen.«
Ungerührt legte sie die Liste auf den Schreibtisch zurück und wandte sich wieder ihrem Laptop zu.
Heute stand erfreulicherweise keine Besprechung im Rathaus an, verriet mein Terminkalender. Eine gute Gelegenheit, mich endlich mit dem Thema Töchtergeburtstag auseinanderzusetzen. Nachdem ich eine halbe Stunde lang erfolglos im Internet nach originellen Geschenkideen zur Beglückung weiblicher Teenager gestöbert hatte, meine Bürogenossin immer noch keine Anstalten machte zu verschwinden und ich kurz davor stand, in einer väterlichen Vorgeburtstagsdepression zu versinken, summte mein Telefon.
»Wir haben eine Brandsache mit nicht identifizierter Leiche, Chef«, sagte Sven Balke, mein zweitbester Mitarbeiter. »Fremdeinwirkung ist nicht auszuschließen. Wer soll hin?«
Nicht identifizierte Leichen waren eigentlich nicht meine Angelegenheit als Kripochef. Meine Angelegenheit waren so aufregende Themen wie Urlaubsanträge, Statistiken, Budgetplanung und Dienstreiseabrechnungen. Alles Dinge, ohne die ich problemlos leben konnte. Außerdem machten mich die endlose Tipperei der Zielfahnderin und ihr hartnäckiges Nichtverschwinden allmählich rasend. Natürlich war das Geräusch sehr leise, störte im Grunde kaum, aber sie schien einen Rhythmus gefunden zu haben, der mein Nervenkostüm in schlechte Schwingungen versetzte.
Fünf Minuten später war ich zusammen mit Balke auf dem Weg zum Brandort.
»Ein abgelegenes Häuschen am nördlichen Ortsrand von Sandhausen«, berichtete mein junger Untergebener aufgeräumt. »Die Feuerwehr ist heute Nacht um halb zwei alarmiert worden. Als sie ankamen, war das Haus schon fast komplett runtergebrannt. Die Leiche haben sie erst vor einer halben Stunde entdeckt.«
Als wir zwanzig Minuten später unser Ziel erreichten, waren aus einer Leiche zwei geworden. Von dem Haus standen nur noch die akut einsturzgefährdeten Außenwände. Alles Brennbare im Inneren war verbrannt.
»Wird schwierig werden, die beiden zu identifizieren«, verkündete der Brandsachverständige, der uns in weißem Schutzanzug und grünen Gummistiefeln durch das feuchte Gras entgegengestapft kam. »Ist nicht viel übrig von den beiden. Die Temperatur da drin muss irrsinnig hoch gewesen sein.«
Die immer noch qualmende und dampfende Ruine wurde von zwei großen Kastanienbäumen beschattet, die unter den hoch lodernden Flammen stark gelitten hatten. Das lange nicht gemähte Gras war an vielen Stellen niedergetrampelt oder von grobstolligen Reifen der Feuerwehrfahrzeuge zerwühlt. Es roch nach verbranntem Holz und verschmortem Plastik. Das Grundstück war von einem rostigen und an mehreren Stellen niedergetretenen Maschendrahtzaun umgeben. Überall standen und lagen Dinge herum, die sich im Lauf eines Lebens bei Menschen ansammeln, die ihr Geld zusammenhalten müssen. Zwei alte emaillierte Badewannen voll mit grünlich schillerndem Regenwasser sah ich. Einen zweirädrigen Fahrradanhänger mit platten Reifen, einen mit rostigem Wellblech abgedeckten und schon leicht vermoderten Stapel Brennholz, eine ausrangierte Kühltruhe ohne Deckel, aus der eine kleine Birke wuchs.
Wir traten so nah an das Haus heran, wie die Hitze es zuließ, und spähten durch eine der Fensteröffnungen hinein. Das Erdgeschoss hatte offenbar aus einem großen Raum, einem winzigen Flur, einer kleinen Küche mit angrenzender Vorratskammer und einer Toilette bestanden. Das Haus schien zumindest teilweise unterkellert zu sein. Von der Küche aus führte eine Steintreppe in die Tiefe. Beide Giebelwände hatten im oberen Bereich Fensteröffnungen. Vermutlich hatte es oben weitere Zimmer mit schrägen Wänden gegeben. Die Holztreppe, die einmal hinaufgeführt hatte, sowie der Fußboden des Obergeschosses waren spurlos verschwunden.
»Wo haben die Toten gelegen?«
Der Brandsachverständige hielt eine Grundrissskizze in der Hand und deutete auf den Raum, der etwa drei Viertel der Grundfläche einnahm.
»In ganz verschiedenen Ecken. Einer da und einer da. Es war nicht das Schlafzimmer, wie’s scheint. Das wird oben gewesen sein, nehme ich an.«
»Irgendwelche Hinweise auf Fremdverschulden?«
»Na, Sie sind lustig!« Er lachte müde. »Sehen Sie sich doch mal um!«
»Brandursache?«
Er hörte auf zu lachen. »Wir müssen warten, bis die Ruine so weit abgekühlt ist, dass wir ohne Sauerstoff und Vollschutz reinkönnen. Dann kann ich Ihnen hoffentlich mehr sagen.«
»Weiß man schon, wer die Toten sind? Wer hier gewohnt hat?«
»Das ist ja genau das Problem. Offiziell hat hier niemand gewohnt.« Er fuhr sich mit der schmutzigen Pranke über die breite Stirn. »Bis vor fünf Jahren hat ein altes Ehepaar hier gelebt. Die haben sich dann umgebracht. Mit dreiundachtzig. Der Mann hat Alzheimer gehabt. Die Frau hat erst den Mann erstochen und dann sich selber. Mit einem Küchenmesser. Seither steht die Hütte leer und verrottet.«
»Da haben Sie ja eine Menge rausgefunden in der kurzen Zeit«, sagte ich anerkennend.
»Ich bin damals dabei gewesen, wie man die alten Leutchen rausgeholt hat«, erwiderte er leise. »Da sind sie schon drei Wochen tot gewesen. Es war Juli und ein verdammt heißer Sommer.« Er schauderte bei der Erinnerung.
»Die sollte sich die Spusi mal ansehen.« Balke wies auf die zahllosen Reifenspuren im weichen Boden. »Möglich, dass die nicht alle von der Feuerwehr sind.«
Sven Balke stammte aus dem hohen Norden Deutschlands. Man hörte es, wenn er sprach, man sah es am kurz geschnittenen Blondhaar und an der hellen, sonnenbrandgefährdeten Haut. Er war einen halben Kopf kleiner als ich, etwa eins achtzig, und erregte mit seinem Charme, den blitzenden Augen und seinem gut trainierten Körper oft mehr Wohlwollen bei Frauen, als gut für ihn war. Inzwischen lebte er jedoch mit einer Kollegin zusammen, Evalina Krauss, die darauf achtete, dass er nicht auf dumme Gedanken und abends zeitig ins Bett kam. Seither erschien er meist ausgeschlafen und gut gelaunt zum Dienst.
»Wie lange hat es eigentlich geregnet in der Nacht?«, fragte ich.
»Angefangen hat es ungefähr um neun«, erwiderte der Brandsachverständige. »Ich wohne nur einen Kilometer von hier. Da bin ich grad mit dem Hund heimgekommen. Gegen Mitternacht, wie ich ins Bett bin, da hat’s wieder aufgehört.«
8
Als ich kurz vor Mittag mein Büro wieder betrat, fand ich es zu meiner Freude still und leer.
»Komische Arbeit hat unsere Frau Guballa«, rief Sönnchen mir nach. »Finden Sie nicht auch?«
»Für mich wäre das nichts«, erwiderte ich. »Immer nur vor dem Computer sitzen und rumtelefonieren.«
»Vielleicht besucht sie deshalb so gern Leute«, meinte meine Sekretärin nach kurzem Nachdenken. »Damit sie mal rauskommt? Glauben Sie denn, dass diese Judith Landers wirklich noch gefährlich ist? Nach so vielen Jahren?«
»Das spielt für die Kollegin wahrscheinlich gar keine Rolle. Sie sammelt Informationen über ihre Zielperson, weil es nun mal ihr Job ist, Informationen zu sammeln.«
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch. Sönnchen stand plötzlich in der Tür und sah mich an.
»Stellen Sie sich vor, ich hab diese Judith Landers sogar mal getroffen.«
»Wie das?«
Sie nahm sich einen Stuhl und setzte sich mir gegenüber. Heute trug sie eine neue, hübsch geblümte Bluse zu einem grauen, gerade geschnittenen Rock. »Heidelberg ist ein Dorf. Im letzten Jahr vor dem Abi bin ich ein paar Mal auf diesen wilden Partys an der Uni gewesen. Das war damals das Größte für uns: Die Studenten, die Uni, da ist die Post abgegangen. Da ist gekifft worden und … na ja, Sie wissen schon … Und damals hab ich sie gesehen. Irgendwer hat gesagt, da drüben, das ist die Judith.« Sönnchen zögerte und sah zum Fenster, als könnte sie dort in ihre Vergangenheit blicken. »Sie ist anders gewesen als die anderen. So still und ernst. Sie hat auch nichts getrunken.«
»Haben Sie mit ihr gesprochen?«
»Das nicht. Irgendwer hat damals schon gesagt, die Judith hätte Kontakte zur RAF. Ich hab das erst für Gerede gehalten. Später hat’s dann in der Zeitung gestanden. Sie hat so was … wie soll ich sagen … was Geheimnisvolles gehabt. Und ein bisschen was Hochmütiges auch. Männer hat sie nicht an sich rangelassen. Aber damals ist sie ja auch schon liiert gewesen, soweit ich weiß. Mit einem Oberarzt an der Uniklinik. Der ist später gestorben.«
Sie schwieg für Sekunden mit gesenktem Blick. Dann sah sie mir ins Gesicht.
»Dieser Mister Henderson soll ja ein ziemlicher Unsympath sein.«
»Wenn die Terroristen dieser Welt alle unsympathischen Menschen umbringen wollten, dann hätten sie viel zu tun. Und wir auch.«
Ich begann, meine Post durchzusehen. Sönnchen schloss die Tür von außen, öffnete sie jedoch gleich wieder.
»Der Herr von Lüdewitz«, sagte sie empört. »Stellen Sie sich vor, jetzt schickt er die arme Petra auch noch zum Einkaufen! Seine Sekretärin in Berlin würd auch hin und wieder Sachen für ihn besorgen, weil er ja immer sooo viel zu tun hat.«
»Was hat er denn eigentlich zu tun?«
»Das weiß kein Mensch so genau. Die meiste Zeit telefoniert er und staucht seine Leute zusammen. Außerdem macht er Witze über die Kleider von der Petra. Wenn das so weitergeht, dann tut sie ihm noch was in den Kaffee, sagt sie.«
Die Tür zum Vorzimmer schloss sich, und meine nächste Amtshandlung bestand darin, Theresa eine längere SMS zu schreiben. Sie hatte mir im Lauf des Tages bereits drei Nachrichten geschickt, aber ich hatte bisher keine Gelegenheit gefunden, sie zu beantworten. Sie freue sich rasend auf den Abend, schrieb sie. Heute war Freitag, neben Dienstag unser zweiter Jour fixe. Was sie weniger freute: Der Verlag hatte die neuesten Verkaufszahlen ihres Erstlings geschickt, »Kabale und Liebe am Heidelberger Hof«. Siebenhundertzweiunddreißig Stück waren bisher über die Ladentische der Region gegangen. Der Verleger fand, es sei ein Achtungserfolg, und das Weihnachtsgeschäft stehe ja noch bevor. Ich schrieb zurück, dass auch ich mich auf den Abend freute, was die Wahrheit war. Nach dem Trubel der letzten Tage sehnte ich mich nach meiner Göttin.
Erst seit wenigen Monaten wusste ich, dass ihr Mann und zugleich mein direkter Vorgesetzter homosexuell war und mir geradezu dankbar dafür, dass ich regelmäßig die sexuellen Bedürfnisse seiner Frau befriedigte. Seither war unsere Beziehung leichter geworden, fröhlicher, vertrauter. Früher hatte es immer ein Geheimnis gegeben zwischen uns, etwas Unausgesprochenes, das für Spannung und Prickeln in der Luft sorgte, diese jedoch manchmal auch vergiftete. Obwohl es jetzt eigentlich keinen Grund mehr gab für Heimlichtuerei, hatten wir aus lieb gewonnener Gewohnheit an unseren beiden Abenden festgehalten. Hin und wieder trafen wir uns jedoch auch außer der Reihe, was früher fast unmöglich gewesen war.
Ende der Leseprobe