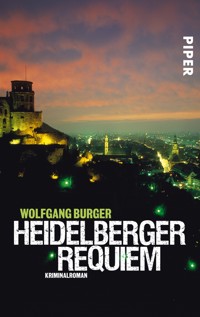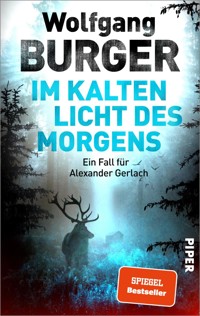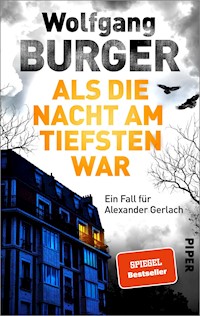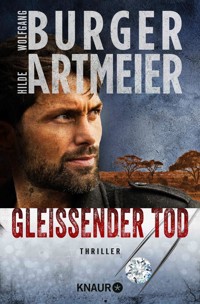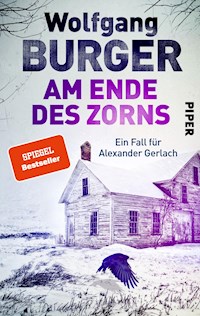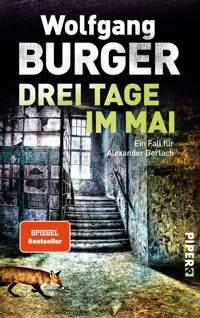9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Händeringend bittet Professor Henecka um Hilfe, da er – ein unbescholtener Bürger – mit Drohmails überschüttet wird. Bei seiner Recherche stößt Kripochef Gerlach jedoch bald auf einen alten Fall, in den Henecka verwickelt war. Die beste Freundin seiner Tochter ist nach einer Geburtstagsfeier nie zu Hause angekommen, obwohl die beiden Familien nicht weit voneinander entfernt wohnten. Im nahe gelegenen Wald fand die Polizei nur einen Schuh des Mädchens – von Lisa fehlt bis heute jede Spur. Als Gerlach dann auch noch feststellt, dass Heneckas Frau ebenfalls spurlos verschwand, ist er sich sicher, dass der Professor nicht ganz so unschuldig ist, wie er behauptet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Hilde
ISBN 978-3-492-97554-4
Oktober 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: plainpicture/Martin Benner und Ekaterina V. Borisova/shutterstock
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
1
Wenn ich etwas hasse auf dieser Welt, dann ist es Scheinwerferlicht. Grelles Licht, das auf mich gerichtet ist wie eine Waffe. Das mir den Schweiß aus den Poren treibt, mich quält und demütigt wie das Opfer eines Folterverhörs. Es verhindert, dass ich den Menschen hinter der blendenden Mauer ins Gesicht sehen kann. Den Menschen, die mich gleich anschreien, mir ihre drängenden, gemeinen Fragen zurufen werden. Fragen, die alle nur das eine Ziel haben: mich bloßzustellen, mich zu erniedrigen, mir Schmerzen zuzufügen, die ich nicht verdient habe. Fragen, die ungerecht sind und feige, weil sie gestellt werden von Leuten, die hinter diesem gemeinen Licht sitzen, in der wohligen Sicherheit der Masse. Sie sind viele, während ich allein bin. Sie sind anonym, während meinen Namen und mein Gesicht jeder in diesem großen und schon jetzt stickigen Raum kennt, der viel zu klein ist für den überwältigenden Andrang. Geil vor Ehrgeiz werden sie sich zu Wort melden und sich an meinem Elend weiden.
Aber noch kümmert sich niemand um mich. Noch werden Stühle gerückt, Witze gerissen, Kollegen lautstark über viele Reihen hinweg begrüßt. Links neben mir sitzt Kaltenbach, der sich mit eisiger Miene auf meine Vernichtung freut, rechts die Chefin der Staatsanwaltschaft, Frau Dr. Steinbeißer, von der ebenfalls keine Rettung zu erhoffen ist. Mein Mikrofon ist noch aus.
Drei Menschen sind gestorben, und ein weiterer ist gerade noch dem Tode entronnen – das sind Tatsachen. Und bei dreien dieser Ereignisse war ich irgendwie beteiligt oder zumindest in der Nähe des Tatorts. Aber dennoch trifft mich keine Schuld. Zugegeben, ich habe mich vielleicht nicht immer exakt an die Buchstaben des Gesetzes gehalten, vielleicht die eine oder andere Vorschrift ein wenig zu kreativ ausgelegt oder auch mal ganz ignoriert, aber im Grunde kann ich mir wirklich nichts vorwerfen. Leider bin ich vermutlich der Einzige in diesem lärmerfüllten, fensterlosen Raum, der das so sieht.
»Wieso haben Sie nicht wenigstens den letzten Mord verhindert?«, werden sie fragen. »Sie haben den Mörder doch kommen sehen, oder streiten Sie das etwa auch ab?« Und ich werde antworten: »Weil Mörder nun mal nicht mit einer blinkenden Leuchtschrift auf der Stirn daherkommen, die ihre Absicht ankündigt.«
Als ich die Waffe in seiner Hand sah, war es längst zu spät, um noch irgendetwas zu tun. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Außerdem dachte ich zu diesem Zeitpunkt ja, verflucht noch eins, es sei schon alles gut. Nein, natürlich nicht gut. Aber immerhin zu Ende.
Nach wie vor herrscht großes Stühlerücken dort unten, hinter dem Licht. Ich höre das Gekrächze und Gegacker der Geier, die sich auf ihr Festmahl freuen. Ein weiterer Scheinwerfer flammt auf. Theaterschauspieler müssen das jeden Abend aushalten, denke ich, als ich mich zurücklehne und zwinge, ruhig zu atmen. Aber die werden dafür bezahlt, es zu ertragen, und am Ende mit Applaus belohnt. Für mich wird es heute keinen Applaus geben, sondern nur Anschuldigungen, öffentliche Demontage und Erniedrigung. Und ich werde mich glücklich schätzen können, wenn ich die Heidelberger Polizeidirektion morgen noch betreten darf.
Kaltenbach hüstelt in sein Mikrofon. »Meine sehr verehrten Damen und Herren«, beginnt er, während die Leitende Oberstaatsanwältin weiter mit verkniffener Miene ihre Unterlagen sortiert oder zumindest so tut, als ob.
Jetzt leuchtet auch an meinem Mikrofon das rote Lichtlein auf. Nur sehr allmählich kehrt Ruhe ein. Hüsteln, Rascheln, Füßescharren, etwas Schweres poltert zu Boden, eine Frau schimpft und lacht in einem. Dann wird es still. Bedrohlich still.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren«, wiederholt Kaltenbach in kühlem, überlegenem Ton seine Begrüßung. »Ich darf Sie zu dieser zugegebenermaßen etwas kurzfristig anberaumten Pressekonferenz herzlich begrüßen, bei der wir Herrn Gerlach, der hier neben mir sitzt und einer der fähigsten Polizisten ist, die wir in Heidelberg haben …«
Habe ich richtig gehört, oder leide ich nun auch schon an Halluzinationen? Sollte meine Rolle hier etwa nicht nur die des Bauernopfers sein? Die des Trottels aus dem zweiten Glied, den man auf der Flucht zurücklässt, um die Hunde von sich selbst abzulenken?
»… Gelegenheit geben, manches richtigzustellen, das in den vergangenen Tagen die Öffentlichkeit aus Unkenntnis und teilweise leider auch auf Basis falscher Informationen beunruhigt hat.«
Das war zwar grammatikalisch nicht ganz richtig, aber es hört sich dennoch außerordentlich gut an. Der Leitende Polizeidirektor Kaltenbach sieht mich an, nickt mir aufmunternd zu, lächelt sogar ein winziges bisschen. »Lieber Herr Gerlach – Ihr Publikum.«
Jetzt ist es totenstill dort unten. Die Meute hält den Atem an.
Mein Räuspern tönt überlaut durch den Raum. Das rote Lichtlein am Mikrofon leuchtet unbeirrt. Ich habe das Wort.
»Wie Herr Kaltenbach eben schon sagte, hat es in den vergangenen Tagen einige Missverständnisse gegeben.« Meine Stimme funktioniert. Sie ist ein wenig rau, aber sie klingt sicher und vielleicht sogar selbstbewusst. »Die Art und Weise, wie diese Missverständnisse zustande gekommen sind, will ich nicht kommentieren. Aber erlauben Sie mir bitte, manches geradezurücken, was falsch oder verfälscht kommuniziert wurde. Ich will Ihnen die ganze Geschichte erzählen, und es wird ein wenig dauern, wofür ich Sie schon jetzt um Verzeihung bitte. Aber Sie sind ja hoffentlich hier, um die Wahrheit zu hören.« Plötzlich durchdringt mich ein Gefühl der Hoffnung, es könnte wider Erwarten gut gehen. Ich könnte am Ende dieser Veranstaltung doch nicht arbeitslos sein. »Es war nämlich so …«
2
Begonnen hatte alles – ja, wann eigentlich? Als ich am achtzehnten Mai, einem Montag, abends aus dem Intercity stieg und Zeuge des Überfalls auf den kleinen, dunkelhäutigen Mann wurde? Oder erst mit Professor Heneckas Anruf anderthalb Stunden später? Oder am nächsten Abend, als wir uns trafen und ich am Ende seinen tausendmal verfluchten braunen Umschlag einsteckte, dem ich den ganzen Stress und Ärger verdanke?
Nach jenen nächtlichen Ereignissen Anfang Mai in Kirchheim – noch heute muss ich schlucken, wenn ich daran denke – war ich krankgeschrieben. Ich war nicht körperlich krank. Körperlich ging es mir, abgesehen von der kleinen Schnittwunde am Hals und einer leichten Gehirnerschütterung, gut. Die lästigen Kopfschmerzen waren schon nach wenigen Tagen abgeklungen. Die Gehirnerschütterung war bei Weitem nicht so heftig gewesen wie beim letzten Mal, als ich beim Radfahren so helmlos wie folgenreich auf den Kopf gefallen war.
Es war meine Seele, die litt. Nachts konnte ich nicht richtig schlafen, schreckte im Halbstundentakt aus irgendwelchen Horrorträumen auf, tagsüber war ich zugleich müde und übernervös, neigte zu Wutausbrüchen wegen Nichtigkeiten, ging mir selbst und meinen Mitmenschen auf die Nerven.
Die Tage vertrieb ich mir mit Bewegung. Bewegung tat mir gut, hatte ich bald festgestellt. So machte ich lange Spaziergänge, oft ohne hinterher sagen zu können, wo ich gewesen war. Ich joggte, als gälte es mein Leben, um diese elende Angst auszuschwitzen, die mein Herz im eiskalten Griff hielt. Ich joggte gegen die Einsamkeit an, die kein Besuch, keine Zärtlichkeit, kein noch so einfühlsames Gespräch zu lindern vermochte. Ich rannte mit zunehmender Verbissenheit vor mir selbst davon, und schon nach wenigen Tagen stellte ich fest, dass mein Körper regelrecht aufblühte. Die Strecke, die ich laufen konnte, bis mir die Puste ausging, wurde länger und länger, und die Waage im Bad zeigte jeden Morgen erfreulichere Zahlen an. Das beste Mittel gegen überflüssige Pfunde, stellte ich fest, ist unglücklich sein.
Außerdem nutzte ich die geschenkte Freizeit, um Dinge zu tun, für die mir sonst die Zeit fehlte. Ich besuchte die Museen Heidelbergs, auch die Mannheimer Kunsthalle, fuhr schließlich sogar nach Frankfurt, um mir im Städel Museum eine Ausstellung über post- und neoimpressionistische Malerei anzusehen. Da mein alter Peugeot immer noch in der Werkstatt stand, nahm ich den Zug.
Die Ausstellung in Frankfurt war vor allem eines: sehr gut besucht. Ich schlenderte herum, blieb als vollkommener Kunstbanause einfach vor solchen Bildern stehen, die mich in irgendeiner Weise ansprachen, ohne mir Gedanken zu machen, was daran das Besondere war. Schon nach zehn Minuten kam mir der Verdacht, am falschen Ort zu sein in diesem kulturbeflissenen Gedränge und aufgeregten Getue.
Erst im vorletzten Raum, als ich mich schon darauf freute, das überfüllte Gebäude bald wieder verlassen zu dürfen, sprang mich ein Bild an, als hätte es seit hundertfünfundzwanzig Jahren nur auf mich gewartet: van Goghs Weizenfeld mit Krähen. Ein dunkler, gewittriger Himmel hing bleischwer über einem wogenden, überreifen Weizenfeld. Und vom Horizont her, der noch ein wenig heller war, es aber bald nicht mehr sein würde, schwebte im Tiefflug ein Schwarm Krähen auf den Betrachter zu, wie Todesvögel.
Mir blieb die Luft weg, keinen Schritt konnte ich näher an das Bild herantreten. Kein Zweifel, van Gogh hatte gewusst, was Angst war. Ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit, um mich von dem Anblick zu lösen. Wurde angerempelt, einmal auf Französisch beschimpft, weil ich im Weg stand. Aber all das interessierte mich in diesen Minuten nicht. Ich konnte es nicht erklären, ich konnte es nicht verstehen, aber es gab ganz offenbar eine geheime Verbindung zwischen diesem Gemälde und mir.
Den Rest der Ausstellung schenkte ich mir. Nach diesem Bild, nach diesem Erlebnis hätte es ohnehin nichts Interessantes mehr geben können.
Während der abendlichen Rückfahrt war der Intercity proppenvoll, den ich auf der Hinfahrt noch fast für mich allein gehabt hatte. Nahezu jeder Platz war besetzt mit schläfrigen oder geschwätzigen oder konzentriert lesenden Pendlern, die auf dem Weg zu ihren Familien waren oder zu einem Feierabendbier mit Freunden oder zu einem faulen Fernsehabend mit hochgelegten Füßen und Paprikachips. Bei jedem Halt leerte sich der Zug ein wenig – um sich gleich wieder zu füllen. Auch als ich in Heidelberg ausstieg, wogte eine drängende Menschenmenge um mich herum.
Plötzlich hörte ich Gejohle und Gebrüll. Ich vermutete eine Horde Angetrunkener, die von einem Fußballspiel zurückkehrten oder von einem Match der Mannheimer Adler in der SAP-Arena. Menschen vor mir blieben stehen, sahen sich irritiert nach der Quelle des Lärms um, wichen zurück, um eine Gruppe rücksichtslos rennender junger Kerle durchzulassen, vermutlich die Verursacher des Tumults. Wie eine Art Uniform trugen alle Hoodies, zerschlissene Jeans und Sneakers.
Erst als die vier oder fünf Burschen schon auf der Treppe zum Bahnhofsgebäude hinauf waren, nahm ich auch hinter mir Unruhe wahr, andere, leisere Stimmen, empört, erschrocken. Ich erblickte einen Mann am Boden, von dem ich anfangs dachte, es handle sich um ein Kind, so klein und mager war er.
Eine junge Frau mit hellgrünem Haar rüttelte vorsichtig an seiner Schulter, rief: »Hallo!« und: »Geht’s Ihnen gut?«
Dabei sah ein Blinder, dass es dem schmächtigen Mann, der in einem heruntergekommenen braunen Anzug und abgetretenen, ebenfalls braunen Schnürschuhen steckte, ganz und gar nicht gut ging. Mit wenigen Schritten war ich bei dem Bewusstlosen – das Geschiebe auf dem Bahnsteig hatte zum Glück schon ein wenig nachgelassen – und ging neben ihm in die Hocke.
»Rufen Sie einen Krankenwagen und die Polizei«, sagte ich in vielleicht etwas zu schroffem Ton zu der nervösen Grünhaarigen, die ihr Handy schon in der Hand hielt. In solchen Situationen sind Höflichkeit und freundliche Bitten fehl am Platz.
Immerhin, er atmete. Äußerliche Verletzungen waren nicht zu sehen. Auch kein Blut, keine seltsam verrenkten Gliedmaßen. Nach der Hautfarbe zu schließen, stammte er aus Asien. Aus einem dieser hoffnungslosen Länder, über die man wenig weiß.
»Malaie«, meinte ein älterer weißhaariger Herr mit beeindruckendem Bauch. »Oder Singapur. Bin ich schon öfter gewesen. So sehen die Leute da aus.«
»Kommen von da jetzt auch schon Flüchtlinge?«, wollte eine resolute Dame in feinem dunkelblauem Kostüm wissen. Sie war über vierzig, nicht unattraktiv und trug ein sandfarbenes Aktenköfferchen in der Rechten und Gold am Hals. »Ich würde sagen, Eritrea, Sudan, irgendwas in der Ecke.«
»Was ist hier eigentlich passiert?« Ich blickte in die Runde und achtete darauf, dass keine Augenzeugen sich aus dem Staub machten. »Hat jemand was gesehen?«
Mit eiligem Schritt näherten sich zwei Kollegen in den schwarzen Uniformen der Bundespolizei, einer schon mit dem Funkgerät am Ohr, und übernahmen den Fall. Ich blieb noch ein wenig stehen. Vielleicht, um zu helfen, vielleicht auch, weil Neugier sozusagen mein Beruf ist.
Niemand hatte etwas gesehen, stellte sich rasch heraus. Obwohl zig Menschen in unmittelbarer Nähe gewesen waren, konnte keiner sagen, was sich hier vor kaum mehr als einer Minute zugetragen hatte. Gedränge hatte es gegeben, jemand war grob geschubst worden, und auf einmal hatte der kleine Mann am Boden gelegen, und ein paar kräftig gebaute Kerle hatten sich grölend und lachend aus dem Staub gemacht.
»Glatzen, todsicher Nazis«, behauptete die Grünhaarige mit großen, zornblitzenden Augen. »Vorhin im Zug …« Sie deutete auf das Bündel Mensch am Boden. »Hat er da nicht einen Rucksack gehabt? Rot ist er gewesen, glaub ich, der Rucksack, dunkelrot mit Schwarz dran.«
Der jetzt verschwunden war. Unschwer zu erraten, was daraus geworden war. Die Kollegen wollten natürlich auch meinen Namen wissen. Ich überreichte ihnen eine dienstliche Visitenkarte. Einer drallen Frau jenseits der fünfzig fiel jetzt erst ein, die Hooligans hätten ihr Opfer schon im Zug drangsaliert. Aber niemand sonst konnte oder wollte dies bezeugen. Einen Ausweis oder andere Papiere konnten die Kollegen bei dem Opfer nicht finden. Die steckten vermutlich in dem verschwundenen Rucksack.
»Nichts als Ärger mit dem Pack«, sagte ein Mann, der direkt neben mir stand, leise zu seiner Frau.
»Meinen Sie den Verletzten oder die, die ihn ausgeraubt haben?«, fragte ich wütend. Anstelle einer Antwort erntete ich böse Blicke aus vier Augen.
Als der Notarzt kam, war der kleine Mann aus Afrika oder Malaysia oder Singapur schon wieder bei Bewusstsein, konnte ohne fremde Hilfe aufstehen, murmelte, immer noch benommen, krauses Zeug, das niemand verstand. Der Arzt erklärte nach kurzer Untersuchung, er werde den Patienten zur Beobachtung für eine Nacht in eine Klinik bringen lassen. Er werde aber bald wieder auf den Beinen sein.
Die Krankschreibung lautete »bis auf Weiteres«. Nach jenen Ereignissen, an die ich nicht denken wollte, was natürlich ganz falsch war, ich sah es ja ein, hatte mein Hausarzt mir eine Traumatherapie empfohlen. Diese hatte ich jedoch schon nach dem ersten Termin beendet, weil mir die Therapeutin den Nerv tötete mit ihren geduldigen Fragen zum immer gleichen Thema, ihrem weltumspannenden Verständnis für alles und jeden.
Seither ging es aufwärts mit mir. Meine selbst verordnete Bewegungstherapie wirkte tausendmal besser als das endlose Gequatsche in der puristisch eingerichteten Praxis. Von Tag zu Tag wurde ich ruhiger, das Pflaster am Hals trug ich fast nur noch aus Gewohnheit, Schmerztabletten brauchte ich längst nicht mehr, und auch meine Schlafphasen wurden länger und erholsamer. Immer seltener überfiel mich die Erinnerung an die scharfe Klinge an meiner Kehle, an das viele Blut, Claudias Blut, die erstickende Angst, das Gefühl der absoluten, der endgültigen Hilflosigkeit. An jenen kurzen Moment, als ich begriff, dass es aus war. Dass es keine Fortsetzung gab. Dass ich niemals wieder die Sonne sehen würde.
All das lag nun schon zwei Wochen zurück, und mit jedem neuen Tag rückte es ein wenig weiter in die Vergangenheit. Allmählich begann ich mich sogar schon wieder nach meiner Arbeit zu sehnen, nach meinem vertrauten Büro, dem Schreibtisch, auf dem sich bestimmt die unerledigten Akten türmten, nach Sönnchen, meiner treuen Sekretärin, die mich täglich anrief und sich mit bewundernswerter Sturheit weigerte, mir irgendetwas zu erzählen, das mit Verbrechen oder Polizeidienst zu tun hatte.
Es war derselbe Montagabend, an dem ich fast Augenzeuge des Überfalls am Bahnhof wurde, als um zwanzig vor acht mein Telefon zu trillern begann. Die angezeigte Handynummer kannten weder mein Telefon noch ich.
Ich war gerade dabei, mich anzukleiden, um die Wohnung zu verlassen, und meldete mich mit einem nicht gerade höflichen: »Ja?«
»Spreche ich mit Herrn Gerlach? Kriminaloberrat Gerlach?«
»Mit wem spreche ich denn?«
»Entschuldigen Sie, Henecka ist mein Name.« Der Mann räusperte sich, lachte verlegen. »Jan-Armin Henecka.«
Auch der Name war mir unbekannt. Der Anrufer hatte eine ruhige, fürs Ohr angenehme, für einen Mann vielleicht ein wenig zu hohe und weiche Stimme. Er klang kultiviert, weltgewandt, freundlich. Und im Moment ein wenig verunsichert.
»Und was verschafft mir die Ehre Ihres Anrufs?«
»Eine Sache, die ich ungern am Telefon besprechen möchte.«
Irgendetwas an seinem Ton gefiel mir nicht. Da schwang etwas mit, das über Unsicherheit und Verlegenheit hinausging. Stress, Verwirrung, vielleicht sogar Angst.
»Aha«, sagte ich nur.
»Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes für Sie, meine ich. Aber … könnten wir uns vielleicht treffen? Ich komme, wohin Sie wollen und wann Sie wollen.«
»Ich wüsste eigentlich nicht …«
»Es wird Ihr Schaden nicht sein, Herr Gerlach, bitte! Ich habe erfahren, dass Sie krankgeschrieben sind. Und da ist Ihnen doch bestimmt langweilig als der Tatmensch, als den man Sie mir beschrieben hat.«
»Ich bin zurzeit nicht im Dienst, das ist richtig. Aber langweilig ist mir ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich …«
Ich brach ab. Was ging es diesen komischen Vogel an, wie ich mich fühlte?
»Es ist nämlich so. Ich …« Noch einmal räusperte er sich. »Ich werde bedroht.«
»Dann wenden Sie sich an die Polizei. Dafür ist sie da.«
»Ja, natürlich.« Ich meinte, einen unterdrückten Seufzer zu hören. »Das habe ich natürlich als Erstes getan. Aber Ihre geschätzten Kollegen haben die Angelegenheit leider nicht gerade ernst genommen, um es vorsichtig zu formulieren. Ich muss wohl dankbar sein, dass man erst gelacht hat, als ich wieder weg war.«
»In welcher Form werden Sie denn bedroht?«, fragte ich nach einigen rat- und wortlosen Sekunden. »Körperlich? Mit Anrufen?«
»Mails«, erwiderte der Mann gequält, dessen Name mir schon wieder entfallen war. »Jemand bombardiert mich seit Wochen mit bösen Mails.«
»Löschen Sie sie. Blockieren Sie die Mailadresse über Ihren Spamfilter. Versuchen Sie herauszufinden, wer er ist. Beauftragen Sie einen Privatdetektiv, der Ihnen den Kerl vom Hals schafft. Oder handelt es sich um eine Frau?«
»Das weiß ich nicht. In den letzten Tagen hat auch öfter das Telefon geklingelt, aber es war nie jemand dran. Oder vielmehr, jemand hat geatmet, aber nichts gesagt. Oder doch. Einmal hat er geflüstert: ›Du Schwein‹.«
»Lassen Sie für ein paar Tage jemand anders das Telefon abnehmen.«
Wieder herrschte für kurze Zeit betretene Stille. Dann verlegte er sich aufs Jammern: »Herr Gerlach, ich bitte Sie! An einen Privatdetektiv habe ich auch schon gedacht. Aber Sie als Polizist, Sie haben doch ganz andere Möglichkeiten.«
»Zurzeit habe ich nicht mehr Möglichkeiten als Sie.«
»Aber doch. Sie haben Erfahrung. Sie haben Kontakte. Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, verzeihen Sie. Nennen Sie mir Ihren Preis. Ich bin kein Millionär, aber ich bin auch nicht arm. Wir werden uns mit Sicherheit einig werden.«
»Kein Interesse«, sagte ich kalt und leider nicht mit der Souveränität, die ich mir gewünscht hatte, und legte auf. Wenn die Kollegen den Fall nicht ernst nahmen, dann würden sie ihre Gründe haben. Jedes Polizeirevier kann im gemischten Chor strophenreiche Lieder singen von diesen Schauergeschichten: Mein Nachbar versucht mich umzubringen. Meine Ex hat schon zum dritten Mal meine Katze vergiftet. Meine Kollegin tut mir etwas in den Kaffee, das mich impotent macht. Mein Vermieter macht mit irgendwelchen Strahlen, dass ich ständig Hunger habe und immer dicker werde …
Mit großer Wahrscheinlichkeit war der Anrufer ein Neurotiker. Oder er hatte jemandem die Frau ausgespannt und erhielt nun die Quittung dafür.
Es gab noch einen zweiten Grund, weshalb ich das Gespräch so abrupt beendet hatte, und dieser Grund hieß Theresa. Wir hatten uns für diesen Abend verabredet, und inzwischen war es schon zehn vor acht. Ich würde mich verspäten wegen des blöden Herrn Henecka. Jetzt war mir der Name doch wieder eingefallen.
3
»Du siehst besser aus als letzte Woche«, behauptete meine Liebste nach dem ersten Kuss und schob mich an den Schultern ein wenig auf Abstand, um mich besser betrachten zu können. »Viel besser, wirklich.«
»Wie geht’s deinem Mann?«, fragte ich.
Theresas Gatte, der Leitende Polizeidirektor Dr. Egon Liebekind und mein direkter Vorgesetzter, war wieder einmal krank. Schon seit Wochen. Wie üblich war es die Lunge, die Probleme machte. Über die Jahre hatten die Ärzte eine mögliche Ursache nach der anderen ausgeschlossen, aber seine inzwischen manchmal lebensbedrohlichen Anfälle von Atemnot und Erstickungsangst zwangen ihn immer öfter zu Zwangspausen. Manchmal war er über Monate gesund und fidel, aber dann war aus heiterem Himmel und ohne jede Vorankündigung wieder einmal eine Blaulichtfahrt im Rettungswagen fällig.
»Auch besser«, sagte Theresa. »Morgen, spätestens übermorgen darf er nach Hause. Du musst dich wohl darauf einstellen, dass du über kurz oder lang einen neuen Chef bekommst. Egonchen will aufhören.«
»Das ist nicht dein Ernst! Ich werde … keine Ahnung … jedenfalls bin ich dagegen.«
»Ich werde es ihm sagen, wenn ich ihn morgen besuche.« Lächelnd nahm sie mich in ihre warmen, weichen Arme, drückte mich an ihre üppigen Brüste, und es tat mir unfassbar gut. Für einen kurzen Moment erlaubte ich mir, wieder Kind zu sein, mich beschützt zu fühlen von jemandem, der groß war und stark, der alles wusste und jedem Problem gewachsen war.
»Ich fürchte nur …«, sagte ich, als ihre Umarmung fester und die Küsse leidenschaftlich wurden. »Du weißt schon.«
»Das wird schon wieder«, meinte sie und strich mir übers Haar wie meine Mutter damals, als ich die Masern hatte. »Du darfst nicht immer daran denken. Entspann dich. Dann kommt es irgendwann von alleine wieder.«
Theresa sprach von meinen peinlichen Erektionsproblemen, die ich seit jener verfluchten Nacht hatte und die ich als Botschaft meines Körpers an den Kopf verstand, dass noch keineswegs alles wieder beim Alten war.
»Ich kümmere mich erst mal um den Sekt.« Theresa ließ mich so plötzlich los, dass ich fast das Gleichgewicht verlor. Da ich schon am Taumeln war, ließ ich mich auf die Matratze fallen, die uns in besseren Zeiten als Lotterbett gedient hatte, zog im Liegen das Jackett aus, warf es über die Lehne eines schwarz lackierten Stuhls im Wiener Kaffeehausstil, der mitten im Raum stand, und streckte Arme und Beine von mir. Nach kurzer Pause öffnete ich die zwei obersten Hemdknöpfe und lockerte den Gürtel, um keinen allzu verschlossenen Eindruck auf meine Göttin zu machen, die gerade in der Küche mit einem fröhlichen »Huch!« den Korken knallen ließ. Wer konnte wissen, ob nicht heute der Tag war, an dem es wieder klappte.
Gläser klirrten, die Kühlschranktür ploppte zu. Theresa kam durch die Tür geschwebt, setzte sich neben mich, reichte mir strahlend lächelnd mein Glas. Wir stießen an, und ich stellte fest, dass sich im Liegen schlecht aus einem vollen Glas trinken lässt. Theresa küsste lachend die Sekttropfen aus meinem Gesicht und von meinem Hals, und auch das fühlte sich sehr, sehr gut an.
»Lass dich fallen.« Sie legte sich neben mich und begann, die restlichen Knöpfe meines Hemds zu öffnen.
Ihre wohlschmeckende und vom Sekt ein wenig kühle Zunge fuhr in meinen Mund. Ihre freie Linke ging auf Forschungsreise.
»Du fühlst dich gut an«, gurrte sie. »Viel härter als sonst.«
»Du bist ja noch gar nicht unten.«
»Ich meinte die Bauchmuskulatur, mein Herz. Man merkt, dass du Sport treibst.«
Ich stellte mein Glas neben die Matratze, nahm Theresa das ihre ab und stellte es dazu. Dann zog ich sie an mich und begann, sie abzuküssen. Willig seufzend ergab sie sich meiner körperlichen Übermacht. Ich genoss es, wieder stark zu sein, meine Muskeln zu spüren, meine Kraft. Wieder ein Mann zu sein.
Nun ja, fast.
»Ist völlig okay«, verkündete Theresa tapfer, als wir später durch die kühle Frühlingsnacht schlenderten. »Wirklich kein Problem. Sex ist nicht alles.«
Der Regen der letzten Tage hatte endlich aufgehört, aber für Mitte Mai war es immer noch ungemütlich frisch, und in der Eile hatte ich den Mantel zu Hause gelassen. Ich schwieg, aber Theresa wusste natürlich, dass für mich nichts okay war.
In einem Tempo, als wäre einer von uns Invalide, gingen wir am Neckarufer entlang. Die Geräusche der Stadt hallten über den glitzernden und träge glucksenden Fluss zu uns herüber. Menschenlachen, Verkehrsrauschen, Motorraddonner, hin und wieder Fetzen von Musik. Ich versuchte, das Tempo zu erhöhen, aber Theresa sperrte sich. »Wir sind nicht auf der Flucht, mein Held«, meinte sie und schmiegte sich fester an mich. »Wir sind nur zum Vergnügen hier.«
Irgendwo sang eine einsame, etwas frustriert klingende Amsel ihr Schlaflied.
»Du musst mehr Geduld mit dir haben, Alexander«, sagte Theresa nach einer Weile ernst und mit Blick auf ihre Füße, die in eleganten, irgendwie grünlich schimmernden und für das holprige Gelände entschieden zu hohen Schuhen steckten. »Das Letzte, was du jetzt tun darfst, ist, dich unter Druck zu setzen.«
Dasselbe hatte die Therapeutin auch behauptet. Aber ich wollte keine Geduld mit mir haben. Ich wollte sein wie früher. Das Leben führen, das ich vor zwei Wochen noch geführt hatte.
Eine Weile bummelten wir so dahin, und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Obwohl längst Nacht war, konnte man den schmalen Pfad meist gut erkennen, da immer wieder von irgendwoher Licht kam. Fröhliches, buntes Licht. Friedliches Licht. Schönes Licht. Ich fühlte, wie ein weiteres Stückchen Leben in mich zurückkehrte. Eine neue Prise Optimismus. Ich fühlte, ich wusste, dass Theresa glücklich war, mich lebend und zumindest körperlich unversehrt neben sich zu haben. Und ich war froh, dass sie mir nicht mit Mitleid oder salbungsvollen Worten auf die Nerven ging.
Ich war ja nicht wirklich krank. Ich war praktisch schon wieder gesund. Körperlich war ich seit Jahren nicht so fit gewesen. Die Therapeutin hatte es immer wieder gesagt, wie zu einem verstockten Kind: Ich müsse akzeptieren, dass auch richtige Männer, starke Männer manchmal hilflos sind. Von Emotionen und Ängsten geplagt werden wie pubertierende Mädchen. Das müsse ich nicht nur ertragen, sondern zulassen, sogar willkommen heißen, denn nur so könne ich wieder gesund werden. Nur dann würde dieser kleine, für das Selbstbewusstsein echter Männer so überaus wichtige Körperteil irgendwann wieder aus seiner Schockstarre erwachen.
Wobei »Starre« natürlich das völlig falsche Wort war.
Zu Hause erwarteten mich meine Töchter. Sie hatten Gesprächsbedarf, und das verhieß meist nichts Gutes.
»Silke fliegt in den Sommerferien mit ihren Eltern nach Thailand«, eröffnete Sarah das Gefecht mit amtlicher Miene.
»Henning fliegt mit Doro nach Japan«, fügte Louise hinzu. »Für fünf Wochen. Sie machen eine Rundreise mit Kultur und so.«
Wie üblich hatten sie sich abgesprochen, agierten und argumentierten mit verteilten Rollen. Und natürlich würde ich am Ende wieder der Dumme sein und derjenige, der die Rechnung bezahlte.
»Was machen wir eigentlich in den Ferien?«, kam Sarah mit inquisitorischer Miene zum Punkt.
»Ähm«, sagte ich. »Eigentlich hab ich noch gar keine Pläne gemacht.«
»Auf keinen Fall hängen wir wieder die ganze Zeit daheim rum«, verkündete Louise. »Wie letztes Jahr.«
»Und vorletztes auch.«
»Wir wollen auch mal irgendwo hinfliegen«, erklärten sie im Chor. »Eine richtige Reise machen und so.«
»Jetzt mal langsam, Mädels.« Ich griff mir einen Stuhl und setzte mich zu ihnen an unseren runden Küchentisch aus über die Jahre goldbraun gewordenem Kiefernholz.
»Wenn du keine Lust hast, auch kein Problem. Wir wollen sowieso lieber allein weg. Nach Spanien vielleicht. Costa Brava soll voll geil sein.«
»Kommt nicht in die Tüte! Ihr seid zu jung, um allein zu verreisen. Das geht schon rein juristisch …«
»Falsch«, widersprach Sarah im Oberlehrerton. »Es gibt Jugendreisen mit Betreuung vor Ort und alles.«
Ich versuchte es auf die Mitleidstour: »Ihr wisst, dass unser Auto in der Werkstatt ist. Und es kostet viel mehr, als es anfangs geheißen hat. Jetzt ist auch noch irgendwas mit der Kupplung, habe ich heute erfahren, und dann der TÜV …«
»Andere Leute haben auch ein Auto und müssen auch zum TÜV und fliegen trotzdem in Urlaub.«
»Die Hausverwaltung hat letzte Woche geschrieben, das Dach muss neu gedeckt werden. Und die rückwärtigen Balkons sind auch marode. Und in den Rücklagen ist nicht genug Geld dafür. Im Moment habe ich noch gar keine Ahnung, was das alles kosten wird. In jedem Fall wird es teuer.«
»Dafür zahlen wir keine Miete. Andere Leute müssen Miete zahlen.«
»In zwei Jahren macht ihr Abitur, dann wollt ihr studieren …«
»Andere studieren auch, und ihre Eltern machen trotzdem Urlaub.«
Es war hoffnungslos. Also versuchte ich ein Friedensangebot: »Was habt ihr euch denn so vorgestellt?«
»Irgendwo, wo’s richtig toll warm ist. Karibik vielleicht.«
Die Jugendreise an die Costa Brava war offenbar nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Ein Scheingefecht.
»Florida soll auch voll cool sein.«
»Wieso nicht gleich Australien?«, konterte ich mit Blick zur Decke. »Oder was haltet ihr von Tasmanien?«
»Nichts. Weil da ist im Sommer Winter.«
Sie hatten an alles gedacht. Aber zum Glück kam mir eine Idee, wie ich möglicherweise zwei Fliegen mit einem Schlag erlegen könnte.
»Wie wär’s …« Lange hatten meine Töchter meinen Vaterworten nicht mehr so aufmerksam gelauscht wie in diesem Augenblick. »Was haltet ihr von Portugal? Wir besuchen Opa?«
»Oma kommt aber nicht mit!«
»Wird sie gar nicht wollen.«
»Und wir schlafen auch nicht bei Opa auf dem Sofa. Wir wohnen in einem richtigen Hotel!«
Bis jetzt lief es besser als befürchtet.
»Mit Pool und Animateuren und alles.«
»Ihr wollt ans Meer. Wozu dann ein Pool?«
»Macht man eben so. Man liegt am Pool und guckt aufs Meer.«
»Die meisten Hotels da unten haben Pools, denke ich. Und Animateure sowieso.«
»Und abends Disco.«
Noch etwas fiel mir ein: Mein dreiundsiebzigjähriger Vater gönnte sich seit einiger Zeit den Luxus einer zwanzig Jahre jüngeren Geliebten, welche der zweibeinige Grund dafür war, dass meine Mutter seit einigen Monaten in Heidelberg lebte. Und diese Geliebte, Elvira, arbeitete in leitender Funktion in einem großen Hotel an der Algarve. Vielleicht ergab sich daraus sogar die Möglichkeit eines kleinen Familienrabatts?
»Und?«, fragte Sarah mit misstrauischer Miene.
Blieb das Problem mit dem Flug. Ich … nun ja, ich fliege nicht gern. Nicht, dass ich Angst davor hätte. Ich fühle mich einfach unwohl in der Luft. Der Mensch ist dazu geschaffen, sich in Bodennähe aufzuhalten. Ich fühle mich nicht gut bei dem Gedanken, dass unter mir nichts ist als zehn Kilometer eiskalte Luft.
»Wir fliegen aber«, sagte Louise sofort. »Nix mit Zug oder so.«
Offenbar konnten meine Töchter seit Neuestem nicht nur ältere Herren schwindlig diskutieren, sondern auch Gedanken lesen.
»Klar fliegen wir. Was denkt ihr denn!«
»Also, ich will eigentlich nicht zu Opa«, war Sarah inzwischen klar geworden. »Das ist kein richtiger Urlaub.«
Ich hob die Augenbrauen, kam aber nicht dazu, Widerspruch einzulegen.
»Am Ende landen wir da unten in so einem Rentnerbunker und spielen den ganzen Tag Bingo.«
Da bemüht man sich, seine Kinder zu lebenstüchtigen, selbstbewussten, kritischen Menschen zu erziehen, und das sind dann also die Früchte.
»Ich bin immer noch für Trinidad«, sagte Louise mit leuchtenden Augen. »Die Fotos im Internet sind voll geil.«
Sarah dagegen neigte plötzlich mehr zur Dominikanischen Republik. »Da sind die Flüge auch billiger.«
»Wie lang fliegt man denn da so?«, fragte ich ahnungsvoll.
»Sechs Stunden?«, rätselte Sarah. »Acht? Mehr bestimmt nicht. Es gibt Direktflüge. So Charterbomber, du weißt schon.«
»Ist echt gar nicht so teuer!« Louise hatte sofort gespürt, dass mein Widerstand erlahmte. »Keine zweitausend Euro für uns drei.«
Zwei gegen einen ist einfach unfair. Vor allem, wenn dieser eine nicht ganz bei Kräften ist.
»Wir kümmern uns auch um alles.« Sarah klang, als wäre die Diskussion schon zu Ende und aus ihrer Sicht ein klarer Erfolg gewesen. »Du brauchst gar nichts machen.«
»Zu machen«, seufzte ich gequält.
Ich versuchte, meinen aufmerksamen Töchtern zu erklären, dass noch nichts beschlossen war. Dass ich aber darüber nachdenken würde. Und ich beschloss, meinen alten Vater, diesen Schwerenöter, der in den vergangenen Monaten stark in meiner Achtung gestiegen war, bei Gelegenheit anzurufen und nach Möglichkeiten und Rabatten zu fragen. Vielleicht gelang es mir am Ende ja doch, die Reiselust meiner Zwillinge wenigstens auf Europa einzugrenzen.
4
Der zweite Anruf des angeblichen Stalkingopfers kam am Dienstagvormittag um kurz nach elf.
»Haben Sie sich die Sache durch den Kopf gehen lassen?«, fragte Henecka mit aufgesetzter Leutseligkeit.
»Das habe ich gestern schon getan.«
»Sie bleiben bei Ihrer Absage?«
»Ich sehe keinen Grund …«
»Geld könnte kein Grund sein?«
Auch wenn mir ein teurer Urlaub und eine kostspielige Dachsanierung ins Haus stand, auch wenn die Reparatur meines betagten Autos mit jedem Tag teurer wurde – zu kaufen war ich nicht. Wobei meine Einstellung zu einem Urlaub im Süden sich über Nacht geändert hatte. Inzwischen erschien mir die Perspektive doch ganz verlockend: zu dritt essen gehen, endlich Zeit füreinander haben, hie und da ein Gläschen Wein ohne Töchter auf einer schattigen Terrasse mit Blick auf ein türkisgrünes Meer …
»Sagen Sie einfach, wie viel.« Die Nervensäge hatte mein Zögern falsch gedeutet. »Diese überaus lästige Angelegenheit liegt mir sehr am Herzen.«
»Mal andersherum«, erwiderte ich lahm. »Was hatten Sie sich denn so vorgestellt?«
»Zehntausend«, kam es wie aus der Pistole geschossen. »Fünftausend sofort, der Rest bei Erfolg.«
Das war nun allerdings ein Wort, aber …
»Und was genau heißt Erfolg?«
»Dass der Stalker nie wieder von sich hören lässt. Wir müssen uns unbedingt zusammensetzen, Herr Gerlach. Wäre heute am späten Nachmittag okay für Sie? Ich bin im Büro und habe noch einiges auf dem Schreibtisch …«
Wir trafen uns um siebzehn Uhr im Krokodil, einem Lokal nur wenige Schritte von meiner Wohnung entfernt. Jan-Armin Henecka war schon da, als ich kam, hatte sich an einen Ecktisch gesetzt, von wo er den Eingang im Auge hatte. Er hatte ein längliches, aristokratisch wirkendes Gesicht, selbstsicheres Auftreten und unruhige Augen und erhob sich sofort, als ich eintrat. Offenbar kannte er nicht nur meinen Namen und meine Telefonnummer, sondern wusste auch, wie ich aussah. Zudem wusste er, wo ich wohnte, denn er hatte das Lokal vorgeschlagen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!