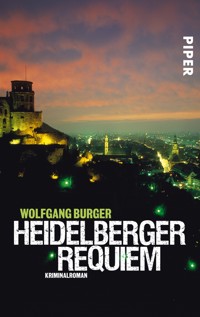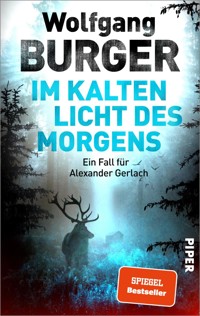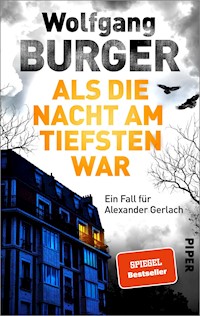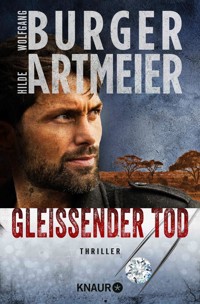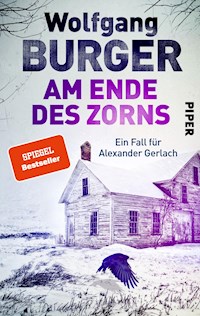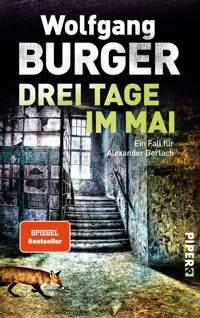6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marc-van-Heese-Thriller
- Sprache: Deutsch
Actionreich, brisant und mörderisch spannend: Im Polit-Thriller »Schmutziges Gift« wird eine verschwundene Polaris-Rakete zum 2. Fall für die unfreiwilligen Ermittler Mark van Heese und Linda Wanzl Das ungleiche und notorisch erfolglose Ermittlerpaar Marc van Heese und Linda Wanzl erhält endlich den lang ersehnten lukrativen Auftrag: Sie sollen in Wien heimlich einen bestimmten Mann fotografieren. Der Auftraggeber ist bereit, für diesen einfachen Job ein unfassbar hohes Honorar zu bezahlen. Unversehens werden Marc und Linda in einen aufwändig vertuschten politischen Skandal verwickelt, der mit einer vor vielen Jahren spurlos verschwundenen britischen Polaris-Atomrakete begann und seither viele Menschen das Leben gekostet hat. Sie werden zum Spielball skrupelloser Mächte, und als die Gefahr am größten ist, treffen sie auch noch alte Bekannte aus Nigeria wieder … Entdecken Sie die spannende Vorgeschichte zum Polit-Thriller »Schmutziges Gift« im kostenlosen Kurz-Thriller »Schmutzige Deals«. Rasante Action um eine verschwundene Polaris-Rakete, Waffenhandel und politische Verschwörung auf höchster Ebene – vom Bestseller-Autor der Alexander-Gerlach-Reihe, Wolfgang Burger, und seiner Ehefrau, der Krimi-Autorin Hilde Artmeier. Ihren ersten, ebenso actionreichen wie politisch brisanten Fall lösten Mark van Heese und Linda Wanzl im Polit-Thriller »Gleißender Tod«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfgang Burger / Hilde Artmeier
Schmutziges Gift
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Actionthriller, bei dem in jeder Hinsicht die Fetzen fliegen
Das ungleiche und notorisch erfolglose Ermittlerpaar Marc van Heese und Linda Wanzl erhält endlich den lang ersehnten lukrativen Auftrag: Sie sollen in Wien heimlich einen bestimmten Mann fotografieren. Der Auftraggeber ist bereit, für diesen einfachen Job ein unfassbar hohes Honorar zu bezahlen. Unversehens werden Marc und Linda in einen aufwändig vertuschten politischen Skandal verwickelt, der mit einer vor vielen Jahren spurlos verschwundenen britischen Polaris-Atomrakete begann und seither viele Menschen das Leben gekostet hat. Sie werden zum Spielball skrupelloser Mächte, und als die Gefahr am größten ist, treffen sie auch noch alte Bekannte aus Nigeria wieder …
Inhaltsübersicht
Widmung
Zwanzig Jahre früher
Freitag, 17. Mai
Marc van Heese, Freising in Oberbayern, nach Mitternacht
Linda Wanzl, Münster in Westfalen, zur selben Zeit
Marc van Heese, Deggendorf in Niederbayern, Vormittag
Zwei namenlose Männer vor der Steilküste westlich von Dover, Südengland, später Vormittag
Linda Wanzl, im Münsterland, kurz vor Mittag
Marc van Heese, Freising, später Nachmittag
Samstag, 18. Mai
Steven Huntington, Südengland, 9 Uhr morgens Greenwich-Zeit
Eileen Sanders, Südengland, zur selben Zeit
Steven Huntington, wenige Meilen vor Folkestone, später Vormittag
Zwei Unbekannte vor der Steilküste westlich von Dover, Mittag
Steven Huntington, Cliff House, kurz darauf
Eileen Sanders, Cliff House, zur selben Zeit
Steven Huntington, Cliff House, zur selben Zeit
Eileen Sanders, Cliff House, zur selben Zeit
Steven Huntington, Cliff House, Nachmittag
Eileen Sanders, London, früher Abend
Linda Wanzl, Münsterland, etwa zur selben Zeit
Eileen Sanders, London, später Abend
Marc van Heese, Freising, kurz vor Mitternacht
Sonntag, 19. Mai
Steven Huntington, Belfast, früher Morgen
Linda Wanzl, Münsterland, zur selben Zeit
Steven Huntington, Belfast, zur selben Zeit
Eileen Sanders, im Cliff House bei Folkestone, Vormittag
Steven Huntington, Belfast, zur selben Zeit
Linda Wanzl, Münsterland, zur selben Zeit
Steven Huntington, Belfast, zur selben Zeit
Zwei namenlose Beobachter vor der Steilküste westlich von Dover, zur selben Zeit
Eileen Sanders, Cliff House, zur selben Zeit
Steven Huntington, Belfast, zur selben Zeit
Eileen Sanders, Cliff House, zur selben Zeit
Steven Huntington, Belfast, zur selben Zeit
Linda Wanzl, Münsterland, zur selben Zeit
Eileen Sanders, Cliff House, zur selben Zeit
Steven Huntington, einige Meilen östlich von Belfast, zur selben Zeit
Eileen Sanders, irgendwo in Südengland, irgendwann später
Steven Huntington, einige Meilen östlich von Belfast, Nachmittag
Marc van Heese, Freising, spätnachts
Montag, 20. Mai
Steven Huntington, Liverpool Birkenhead, 6:30 Uhr Greenwich-Zeit
Linda Wanzl, Freising, zur selben Zeit
Marc van Heese, Freising, kurze Zeit später
Steven Huntington, irgendwo zwischen Liverpool und London, etwa eine Stunde später
Marc van Heese in Niederbayern, etwa zur selben Zeit
Eileen Sanders, irgendwo, irgendwann
Steven Huntington, London, später Vormittag
Linda Wanzl, Wien, gegen Mittag
Steven Huntington, London, zur selben Zeit
Linda Wanzl, Wien, Nachmittag
Steven Huntington, London, zur selben Zeit
Marc van Heese, Wien, zur selben Zeit
Steven Huntington, London, eine Stunde später
Marc van Heese, 16:40 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit
Steven Huntington, London, früher Abend
Linda Wanzl, Wien, zur selben Zeit
Steven Huntington, London, zur selben Zeit
Marc van Heese, Wien, zur selben Zeit
Eileen Sanders, irgendwo, irgendwann
Steven Huntington, London, zur selben Zeit
Linda Wanzl, etwa vierzig Kilometer östlich von Wien, zur selben Zeit
Marc van Heese, selber Ort, selbe Zeit
Linda Wanzl, selber Ort, selbe Zeit
Marc van Heese, noch auf dem Rastplatz, zur selben Zeit
Steven Huntington, London, zur selben Zeit
Linda Wanzl, bei Bratislava, 22:30 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit
Steven Huntington, Südengland, zur selben Zeit
Marc van Heese, Bratislava, zur selben Zeit
Steven Huntington, Dover, etwa zur selben Zeit
Dienstag, 21. Mai
Linda Wanzl, Bratislava, kurz nach Mitternacht
Steven Huntington, Belgien, lange nach Mitternacht
Eileen Sanders, irgendwo, tiefe Nacht
Linda Wanzl, Bratislava, kurz darauf
Marc van Heese, Bratislava, einige Stunden später
Steven Huntington, Deutschland, früher Morgen
Linda Wanzl, Bratislava, früher Vormittag
Steven Huntington, Prag, gegen Mittag
Marc van Heese, Bratislava, zur selben Zeit
Steven Huntington, Prag, Nachmittag
Marc van Heese, Bratislava, zur selben Zeit
Steven Huntington, irgendwo an der tschechisch-polnischen Grenze, Abend
Marc van Heese, Bratislava, zur selben Zeit
Eileen Sanders, Bratislava, tiefe Nacht
Linda Wanzl, irgendwo, tiefe Nacht
Steven Huntington, Bratislava, zur selben Zeit
Mittwoch, 22. Mai
Marc van Heese, irgendwo, irgendwann
Steven Huntington, Bratislava, einige Zeit nach Mitternacht
Linda Wanzl, irgendwo, irgendwann
Steven Huntington, Bratislava, tiefe Nacht
Marc van Heese, irgendwo, irgendwann
Steven Huntington, Bratislava, zur selben Zeit
Linda Wanzl, irgendwo, irgendwann
Marc van Heese, selber Ort, selbe Zeit
Steven Huntington, Bratislava, zur selben Zeit
Marc van Heese, irgendwo, irgendwann
Linda Wanzl, Bratislava, eine halbe Stunde später
Steven Huntington, Bratislava, zur selben Zeit
Josefina Osterbek, Münsterland, etwa zur selben Zeit
Steven Huntington, Bratislava, zur selben Zeit
Marc van Heese, selber Ort, selbe Zeit
Linda Wanzl, Bratislava, früher Morgen
Eileen Sanders, selber Ort, selbe Zeit
Linda Wanzl, selber Ort, selbe Zeit
Marc van Heese, selber Ort, selbe Zeit
Linda Wanzl, Flughafen Wien-Schwechat, Vormittag
Eileen Sanders, über den Alpen, zur selben Zeit
Marc van Heese, Venedig, später Nachmittag
Eileen Sanders, Venedig, früher Abend
Eileen Sanders, Bratislava, zwanzig Stunden früher
Linda Wanzl, Venedig, Abend
Marc van Heese, Venedig, bald darauf
Eileen Sanders, Venedig, eine Stunde später
Steven Huntington, Venedig, zur selben Zeit
Eileen Sanders, Venedig, spätabends
Linda Wanzl, Venedig, kurz darauf
Steven Huntington, Chioggia, 23:34 Uhr
Marc van Heese, Chioggia, kurz darauf
Linda Wanzl, in der Lagune südlich von Venedig, zur selben Zeit
Vier Tage später
Steven Huntington, Venedig, irgendwann
Montag, 27. Mai
Eileen Sanders, Venedig, Nachmittag
Steven Huntington, selber Ort, selbe Zeit
Eileen Sanders, selber Ort, selbe Zeit
Linda Wanzl, Venedig, später am Nachmittag
Zwei Wochen später
Marc van Heese, Münsterland, abends
Zwei Tage später
Für unsere Eltern
Zita und Josef, Berta und Ludwig
Zwanzig Jahre früher
Das sonore Brummen der beiden Hubschrauber mischte sich mit dem dumpfen Dröhnen des großen Diesels zu einem monotonen, einschläfernden Klangteppich.
»Und Sie meinen wirklich, Sir, es kann gar nichts passieren?«, fragte Sergeant Ken Harris, der Fahrer des letzten Lkw im Konvoi, seinen Beifahrer Captain John McCray. Dabei musste er fast schreien, um den Lärm zu übertönen.
Die Spitze des Konvois bestand aus zwei gepanzerten und voll besetzten Mannschaftswagen, ihnen folgten fünf der schweren olivgrün lackierten Sattelschlepper, in deren letztem Harris und McCray saßen. Den Schluss bildeten zwei weitere Mannschaftswagen voller Soldaten in Kampfanzügen und mit durchgeladenen halb automatischen Gewehren. Über ihnen schwebten in einer Höhe von hundert bis zweihundert Fuß zwei mit panzerbrechenden Raketen bewaffnete Sikorsky-Kampfhubschrauber, die zur Ausrüstung der Royal Navy gehörten.
Als McCray nicht antwortete, sah Harris auffordernd zu ihm hinüber. Es war das erste Mal, dass der junge Sergeant bei einem solchen Transport dabei war, und er war entsprechend aufgeregt. Der Captain seufzte und blickte auf die durchgeladene Pistole hinunter, die er mit festem Griff im Schoß hielt.
»Die Container sind aus so dickem Stahl, dass sie sogar durch eine panzerbrechende Granate nicht ernstlich beschädigt werden könnten«, sagte er endlich. »Sie überstehen einen freien Fall aus fünfzig Fuß Höhe und einen einstündigen Brand mit einer Temperatur von achthundert Grad Celsius. Sie können also völlig unbesorgt sein, Harris.«
»Ich mache mir keine Sorgen, Sir. Es interessiert mich einfach nur. Technik ist mein Steckenpferd.«
»Dann halten Sie ab jetzt den Mund und achten auf die Straße. Nicht, dass wir am Ende noch im Graben landen und uns zum Gespött des ganzen Stützpunkts machen.«
Der Captain hatte recht. Die Straße war wirklich verteufelt schmal und kurvig. Aus Sicherheitsgründen hatte man wie üblich eine abgelegene, wenig befahrene Route gewählt, die zudem für die Dauer ihrer Durchfahrt in beide Richtungen gesperrt war. Und wie jedes Mal war es wieder eine andere Strecke als die, welche der letzte Transport vor drei Monaten genommen hatte.
Der Konvoi machte kaum zehn Meilen in der Stunde. Die fünfachsigen Bedford-Sattelschlepper, die die kostbare Fracht ihrem Ziel entgegenschleppten, hatten Weisung, mindestens fünfzig Yards Abstand zu halten. Schon unzählige solche Transporte waren durchgeführt worden, seit das Vereinte Königreich über atomar bewaffnete U-Boote verfügte, und noch niemals war dabei irgendetwas Ernsthaftes vorgefallen. Dennoch klebten Harris’ Hände feucht am großen, heftig vibrierenden Lenkrad.
Das Sträßchen führte in einer weiten Linkskurve aus dem dunklen Fichtenwald hinaus, den sie in den vergangenen fünfzehn Minuten durchquert hatten. Die Hubschrauber gingen wieder ein wenig tiefer, das Brummen der Turbinen und das Schnattern der Rotoren wurden lauter. Hügelland tat sich vor ihnen auf, saftige schottische Wiesen mit Schafen darauf, die jetzt verblüfft die Köpfe wandten, um zu sehen, woher dieser plötzliche Radau rührte, der ihren ländlichen Frieden störte.
Alle zwei Jahre mussten die mit Atomsprengköpfen bestückten Polaris-Raketen der vier britischen Atom-U-Boote der Vanguard-Klasse zur Überholung ins Ausbesserungswerk bei Kirkintilloch gebracht werden, fast einem Vorort von Glasgow, und zwei Wochen später wieder zurück zur Flottenbasis Faslane-on-Clyde. Runderneuert, durchgecheckt, mit upgedateter Software versehen und manchmal sogar frisch lackiert.
»Und wenn, Sir – nur als Beispiel –, der Truck zu brennen beginnen würde?«
McCray verdrehte die Augen. »Für diesen Fall haben die Kameraden in den Begleitfahrzeugen sehr viele sehr große Feuerlöscher dabei. Außerdem, was soll denn da brennen, bitte schön? Und jetzt halten Sie endlich den Mund, Sergeant Harris. Das ist ein Befehl!«
»Aye, aye, Sir.«
Natürlich wusste Harris, was sich in den gepanzerten und feuersicheren Superspezialcontainern befand. Die Wände der Baracken in Faslane waren nicht dicker als die in anderen Militärstützpunkten, und ein feines Gehör sowie ein gut funktionierender Informationsfluss waren schon immer die beste Lebensversicherung der gemeinen Soldaten gewesen.
Die Straße führte jetzt in eine Senke hinab, nach einer gefährlich scharfen Kurve über eine kleine Brücke, unter der ein lebhafter Bach schäumte, zum nächsten Hügel hinauf. Harris schaltete zurück und trat das Gaspedal bis zum Bodenblech durch. Der Diesel brüllte auf, tat, was er konnte, aber dennoch wurde der Truck – wie die vier vor ihm – langsamer und langsamer. Oben kam ein Wegweiser in Sicht. Eine Abzweigung nach rechts zu irgendeinem abgelegenen Gehöft oder einem gottverlassenen Weiler.
Endlich hatten sie die Steigung geschafft, die Abzweigung kam näher, Harris schaltete krachend hoch, ging jedoch gleichzeitig vom Gas, sodass der Abstand zum Truck vor ihnen größer wurde.
Links, etwa achtzig Yards vom Straßenrand entfernt, stand eine grau verwitterte, windschiefe Scheune mit löchrigem Strohdach. Weit und breit kein Mensch, kein Haus, kein Leben, abgesehen von den immer noch dämlich glotzenden und unentwegt kauenden Schafen.
»Und wenn – nur so als Beispiel –«, begann Harris erneut, »eine der Sikorskys abstürzt und … Ups, was war denn das?«
Von der Scheune her war etwas in die Luft gezischt, das eine weiße Rauchsäule hinterlassen hatte. Dieses Etwas hatte den vorderen Hubschrauber getroffen, und bevor sie überhaupt einen Knall gehört hatten, verwandelte die schwere, waffenstrotzende Maschine sich in einen Funken sprühenden Feuerball, der um sich selbst kreiselnd wie ein Meteor vom Himmel stürzte.
Harris trat hart auf die Bremse und sah aus dem Augenwinkel eine zweite Rauchsäule, die nicht in den Himmel wuchs, sondern in seine Richtung schoss, allerdings nicht waagerecht, sondern im Winkel von etwa dreißig Grad nach oben. Er hörte das Krachen, meinte sogar die Druckwelle der Explosion zu spüren, dann verstummten die Triebwerke der Sikorsky über ihnen abrupt.
Die dritte Rakete traf den Truck vor ihnen. Dessen Fahrer hatte noch die Tür aufgerissen, wollte wohl fliehen, aber bevor sein Fuß den bröckeligen Asphalt der miserabel instand gehaltenen Straße berührte, existierten er und der Offizier auf dem Beifahrersitz nicht mehr. Die Raketen zischten jetzt in rascher Folge aus der Scheune, trafen den zweiten, den dritten, den ersten Transporter. Die zuerst getroffene Sikorsky donnerte mitten in eine Gruppe Schafe, die zweite irgendwo in der Nähe in den Wald, der in der nächsten Sekunde lichterloh in Flammen stand. Nur ein Truck war bisher verschont geblieben, der, in welchem Harris und McCray saßen. Dieser Umstand war jedoch weder großem Glück noch einem unwahrscheinlichen Zufall zu verdanken.
Harris nahm McCray, der mit offenem Mund auf das lodernde Inferno starrte, die Glock 17 aus der erschlafften Hand und schoss ihm in kurzer Folge zwei Kugeln in den Kopf. Dann rammte er den ersten Gang ins Getriebe, setzte sogar den Blinker, als er in das Seitensträßchen einbog, schaltete hoch, trat das Gaspedal durch, und bald darauf war der Truck im dichten Nadelwald verschwunden.
Freitag, 17. Mai
Marc van Heese, Freising in Oberbayern, nach Mitternacht
Leicht angetrunken und schwer angepisst fahre ich nach Hause. Mitternacht ist vorüber, und der Abend war wieder einmal ein Schuss in den Ofen. Die Krönung eines weiteren beschissenen Tages in meinem zurzeit absolut nicht rundlaufenden Leben.
Stundenlang habe ich in Ingo’s Bar gehockt, einen Whiskey nach dem anderen in mich hineingeschüttet, zwei von den guten Zigarren geraucht, und sonst war nichts, absolut nichts. Nur der blonde Rauschgoldengel, der mit einer Freundin da war, hat hin und wieder zu mir herübergesehen. Da die Freundin jedoch offenkundig unter akutem Liebeskummer litt, ist außer Blickkontakten nichts gelaufen.
Dabei hätte sie mir schon gefallen, die Blonde. Groß und kräftig, ein vielversprechender Busen unter einem eng sitzenden sommerhimmelblauen Pulli, nicht übertrieben geschminkt, keine übertrieben langen Nägel, an den Beinen eine Jeans, die sich ohne Spezialwerkzeug vermutlich weder an- noch ausziehen lässt, an den Füßen frech rote High Heels, die mich dummerweise an Linda erinnerten, die ein ganz ähnliches Paar besitzt, es allerdings nur zu sehr besonderen Anlässen trägt. Vor allem hatte die Blonde diesen Blick, der Abenteuerlust verriet. Aber da war ja nun leider die unentwegt heulende und schniefende Freundin, die man unmöglich allein lassen konnte in ihrem Elend.
Um Viertel vor zwölf sind die beiden abgezogen, ein letzter Blick, ein Lächeln, das Hoffnung weckte. Kurz darauf bezahlte auch ich meine Rechnung und schwang mich in meinen Porsche. Zu dem Haus am Hang über Freising, wo ich derzeit wohne, brauche ich keine fünf Minuten.
Ich biege in die Einfahrt, beschließe, den Wagen heute im Freien stehen zu lassen, weil die Fernsteuerung des Garagentors seit Wochen nicht mehr funktioniert und ich auf einmal sterbensmüde bin. Als ich aussteige, ahne ich eine Bewegung hinter mir, und bevor ich reagieren kann, hat jemand meine Arme nach hinten gerissen und hält sie mit eisernem Griff auf meinem Rücken fest. Ich bin kein Schwächling, war in letzter Zeit sogar hin und wieder im Fitnessstudio, aber gegen diese Schraubzwingen habe ich keine Chance.
Ein großer, breiter und beunruhigend muskulöser Kerl tritt vor mich. Seine Visage habe ich heute schon einmal gesehen – hinter dem Steuer des Mustang mit Hamburger Kennzeichen, der längere Zeit gegenüber von meinem Büro parkte.
Ich sehe es in seinen Augen: Was jetzt kommt, wird wehtun.
»Schöne Grüße von Kai«, sagt der Typ. Er muss um die zwei Meter groß sein und ist fast so breit wie mein Kleiderschrank. Dazu runder Kopf, kleine, kalte Augen, spiegelnde Glatze, Lederjacke, norddeutscher Charme.
»Sag Kai, ich will ja bezahlen«, behaupte ich eilig. »Hab das Geld schon zweimal überwiesen, aber irgendwas ist mit seiner IBAN …«
»Elftausend schuldest du ihm noch. Kai mag es nicht, wenn er auf sein Geld warten muss.«
»Deshalb müsst ihr doch nicht gleich grob werden.«
Mein Gegenüber erklärt mir amüsiert und mit Hamburger Akzent, ich hätte keine Ahnung, wie es ist, wenn er und sein Kumpel grob werden.
»Okay, Jungchen, jetzt hör mal gut zu. Elftausendfünfhundert hier und jetzt, oder wir nehmen den Porsche gleich mit. Wir fahren dich auch gerne zum nächsten Geldautomaten, falls du nicht genug Kleingeld im Haus hast.«
»Wieso elfeinhalb? Eben hieß es noch elf!«
»Alles wird teurer, Jungchen. Spesen, Fahrtkosten, unsere kostbare Arbeitszeit …«
»Zeig mir einen Automaten auf dieser Welt, der an einem Tag über zehntausend Euro ausspuckt.«
Sein Blick sagt: dein Problem. Sein eher angedeuteter Hieb in meine Magengrube sagt: Bilde dir bloß nicht ein, du könntest Spielchen mit uns spielen.
Es tut noch viel mehr weh, als ich befürchtet habe.
»Leute, ich habe das Geld im Moment nicht«, würge ich heraus. »Im Prinzip habe ich es schon, natürlich, nur nicht hier und nicht jetzt. Kommt heute Abend wieder, okay? Bis heute Abend habe ich es aufgetrieben, ich schwöre.«
»Heute Abend kriegen wir zwölf. Zinsen, du verstehst.«
»Und wie wäre es morgen?«
»Zwölfeinhalb.«
Übermorgen ist Sonntag. Mir ist ein wenig schwindlig.
»Dann sagen wir in Gottes Namen zwölfeinhalb am Montag, okay? Ich bin nicht sicher, ob die Bank es schafft, bis heute Abend genug von meinen Aktien zu verkaufen …«
Der Glatzkopf rollt die Augen, holt aus, schlägt aber nicht zu.
»Na gut, weil wir so nette Menschen sind: dreizehntausend am Montagabend, aber dann ist Ultimo. Und damit du uns bis dahin nicht vergisst, Jungchen …«
Dieses Mal haut der Spinner seine Eisenfaust so hart an meine Schläfe, dass in meinem Kopf ein Funkenregen explodiert, der jedem Silvesterfeuerwerk Ehre gemacht hätte. Der hinter mir lässt plötzlich los, und bevor ich wieder zur Besinnung komme, sind sie weg. Mir dröhnt der Kopf von diesem Hammerschlag, und auf dem linken Auge scheine ich blind zu sein. Irgendwo in der Nähe wird ein hubraumstarker Achtzylinder angelassen – der Mustang.
Vorsichtshalber setze ich mich erst mal auf die Stufen, die zur Haustür hinaufführen. Meine Hände zittern, meine Knie sind Gummi, mir ist speiübel. Wie zur Hölle soll ich bis Montag zwölftausend Euro auftreiben? Falsch: dreizehntausend.
Wenn ich nur wüsste, wo Eileen steckt, verflucht. Für die wäre das ein Pappenstiel, Klimpergeld aus der Portokasse.
Linda brauche ich nicht zu fragen. Selbst wenn sie jeden Morgen in Geld baden würde, sie würde mir keinen Cent davon abgeben. Wahrscheinlich würde sie sich im Gegenteil mächtig amüsieren, wenn sie wüsste, in welchem Schlamassel ich gerade stecke.
Mit Kai, dem Vorbesitzer des Porsches, habe ich mich auf Teilzahlung geeinigt. Fünfundfünfzigtausend sofort, bar auf die Hand, zehntausend ein Vierteljahr später plus zehn Prozent Zinsen. Die Frist ist längst abgelaufen, und ich bin nach wie vor pleite. Wie sollte ich ahnen, dass es mir so schwerfallen würde, in drei Monaten einen so läppischen Betrag aufzutreiben?
Ich habe es nicht vergessen, natürlich nicht, aber ein klein wenig darauf gebaut, Kai und seine Schlägerkumpels würden mich nicht finden, hier im katholischen Süden. Offenbar habe ich diese Hamburger Zuhälter gründlich unterschätzt.
Wenn das Gespräch morgen Vormittag in Deggendorf gut läuft und ich einen fetten Auftrag an Land ziehe, dann wird mir die Firma bestimmt problemlos einen ordentlichen Vorschuss genehmigen, und alles …
Morgen?
Nein, heute.
Mitternacht ist ja schon vorüber.
Linda Wanzl, Münster in Westfalen, zur selben Zeit
Der Wonnemonat Mai macht seinem Namen dieses Jahr keine Ehre. Brr, ist das kalt. Ein Blick aufs Handy sagt mir, dass es halb ein Uhr morgens ist.
Ich unterdrücke ein Gähnen, lehne mich im Fahrersitz meines guten alten Alfa Romeo zurück und ärgere mich, weil ich nicht an eine warme Decke gedacht habe. Dass es nachts kalt werden könnte, hätte ich wahrhaftig wissen können. Die dünne Jeansjacke ist für solche Temperaturen nicht geeignet, und jetzt sitze ich schon seit drei Stunden hier und friere, und nichts tut sich.
Eigentlich ist mein Auftrag denkbar einfach. Tim Krause, ein erst vor Kurzem nach Münster gezogener HNO-Arzt, ist davon überzeugt, dass seine Ehefrau ihn betrügt. Ich soll sie beschatten und beweiskräftige Fotos liefern.
Angeblich ist Susanna Krause heute mit einer Golffreundin in einer Kneipe im Stadtzentrum verabredet. In Wirklichkeit hat sie ihren Audi in einer ruhigen Seitenstraße hier am Rand der Stadt abgestellt und ist durch das dunkelgrüne Stahltor in der übermannshohen Mauer auf der anderen Straßenseite geschlüpft, vor dem ich mir seither den Hintern platt sitze. Einmal ist ein Mann mit Hund vorbeigegangen, um eine späte Runde durch das friedliche Bonzenviertel zu drehen. Nach und nach sind die Lichter in den Nachbarhäusern erloschen, durchweg noblen Bauwerken aus der Gründerzeit. Sonst ist nichts geschehen. Rein gar nichts.
Von der ehemaligen Fabrikantenvilla, in der die untreue Ehefrau und ihr Lover sich jetzt vermutlich vergnügen, sind nur der Fachwerkgiebel und ein schmuckes Türmchen zu sehen. Die Mauer, die das Grundstück umgibt, ist unmöglich ohne Hilfsmittel zu übersteigen. Wie, grüble ich, während ich friere, mich ärgere und noch mehr friere, komme ich nur an die gewünschten Beweisfotos?
Eigentlich haben Marc und ich unsere Agentur für private Ermittlungen gemeinsam gegründet. Im vergangenen Herbst war das. Seit Mister Großmaul sich jedoch aus dem Staub gemacht hat, ist die verbliebene Geschäftsführerin Belinda Marie Wanzl, also ich, für alles zuständig, was bei »Private Eye« – Marc nannte unser Baby im Spaß noch hin und wieder AFAM, Agentur für alles Mögliche, was meine erste Idee zum Firmennamen gewesen war – so anfällt. Leider fällt jedoch sehr wenig an. Der Laden ist von Anfang an nicht gut gelaufen, und über die Monate ist es eher schlechter als besser geworden. Trotzdem hätte ich den Auftrag ablehnen sollen. Es macht mir wirklich keinen Spaß, untreuen Ehefrauen hinterherzuspionieren, noch dazu bei dieser Kälte. Aber ich brauche nun mal das Geld.
Ein A. Herrmann wohnt in der Villa, über den im Internet rein gar nichts zu finden ist. Kein Eintrag bei Facebook, bei Xing oder sonst wo. Wahrscheinlich hat Susanna ihn auf Tinder kennengelernt, wo die beiden Turteltäubchen sich unter einem Decknamen angemeldet haben. Superstecher_XXL und Traumfrau_1. Im Gegensatz zu meinem Auftraggeber, einem schmierigen, selbstgefälligen Ekelpaket um die sechzig, ist die blond gelockte Gattin in meinem Alter, also gerade mal dreißig. Irgendwie kann ich verstehen, dass sie fremdgeht.
Wieder ein Blick aufs Handy. Zehn vor eins. Susanna Krause hat offenbar keine Lust, zu ihrem gehörnten Gatten zurückzukehren.
So geht das nicht mehr weiter. Ich stecke das Handy ein, steige aus und überquere die nachtstille Straße. Im Nachbarhaus linker Hand wohnt ein Hubert Breekemann, laut seinem Facebook-Profil ein rüstiger Bauingenieur im Ruhestand. In seinem Haus, das hinter einem etwa zwei Meter hohen Zaun liegt, war es die ganze Zeit über stockdunkel. Der Hausherr scheint ausgeflogen zu sein. Die eisernen Streben sind oben zwar ziemlich spitz, aber von dichtem Efeu umrankt, das eine gute Kletterhilfe abgeben sollte.
Zielstrebig umrunde ich das Anwesen – es ist ein Eckgrundstück –, mache am Ende des Zauns halt. Auch hier wächst Grünzeug, es macht einen erfreulich stabilen Eindruck. Weit und breit keine Laterne, deren Lichtschein mich verraten würde. Versuchshalber stecke ich die rechte Schuhspitze zwischen das Blättergewirr, belaste den Fuß. Es hält.
Im Nu bin ich oben, schwinge mich über die Eisenstäbe, klettere auf der anderen Seite so flugs hinunter, wie ich hinaufgekommen bin, und halte einen Moment inne. Bis auf das gedämpfte Rauschen von der fernen A 1 ist nichts zu hören. Es riecht nach Flieder, Jasmin und Frühlingsfrische.
Geduckt schleiche ich am Haus vorbei, das als Einziges hier nicht ins gutbürgerliche Ambiente passt – ein mit Bullaugen versehener Atombunker, in dem sich nach wie vor nichts regt. Die viele Kohle, die Breekemann haben muss, schützt offenbar nicht vor Geschmacksverirrung.
Ein Knacken, ein plötzlicher Lichtstrahl blendet mich.
Ich springe in die Sträucher neben mir, warte mit angehaltenem Atem.
Nur ein Bewegungsmelder, natürlich. Ich trage schwarze Kleidung, mein auffallend rotes Haar habe ich unter einer Mütze versteckt. Sollte allerdings gerade jemand aus einem Fenster geguckt haben …
Vorsichtig luge ich zwischen den Blättern hindurch, die Szenerie liegt in kaltem Schein vor mir. Der gepflasterte Weg vor dem Bunker sieht aus wie mit einem Lineal gezogen, die verlassenen Sitzmöbel auf der Terrasse wie Würfel aus Stahl. Schräger Typ, dieser Breekemann.
Alles bleibt ruhig.
Ich entspanne mich, bleibe aber vorerst weiterhin in Deckung. Auch in den Nachbarhäusern, die von hier kaum zu sehen sind, tut sich nichts.
Irgendwann verlöscht das Licht. Dennoch warte ich geschlagene fünf Minuten, bis ich weiterhusche, jetzt im Schatten der Büsche. Meine Augen haben sich längst wieder an die Dunkelheit gewöhnt. Über mir funkeln Sterne und eine schmale Mondsichel.
Hinter dem riesigen Pool schließt sich ein Rasenstück an, einige Meter ganz ohne Sichtschutz, dahinter erahne ich eine Baumgruppe mit weit ausladenden Ästen. Ein besonders dicker scheint über die Mauer in A. Herrmanns Grundstück hinüberzuragen.
Ich sprinte los, dieses Mal flammt zum Glück kein Scheinwerfer auf.
Eine Eiche, stelle ich fest, als ich mich am untersten Ast hochziehe. Die Blätter rascheln im Nachtwind. Dicht am Stamm klettere ich höher, steige auf den Ast, der sich über die Mauer neigt, krieche weiter.
Ein hell erleuchtetes zweiflügeliges Fenster im ersten Stock sehe ich etwa zehn Meter vor mir. Innen ein zerwühltes Bett, auf dem sich zwei nackte Körper umschlingen, so fest ineinander verkeilt, als wollten sie nie wieder voneinander lassen.
Bingo.
Ich hangle mich am Ast entlang, steige auf die Mauer, die direkt unter mir verläuft, gehe in die Knie, zücke das Handy und aktiviere die Kamera. Nun höre ich die beiden sogar stöhnen. Die Frau in seufzend-wohligen Tönen, den Mann in kehligem …
Noch während ich den richtigen Bildausschnitt suche, zischt etwas an meinem Oberarm vorbei, so knapp und scharf, dass ich fast das Gleichgewicht verliere. Ich höre den Schuss hinter mir knallen, laut und gefährlich nah, ziehe den Kopf ein, drücke mich so flach wie möglich auf die Mauer, hoffe inständig, dass der Schütze mich in der Dunkelheit nicht genau sehen kann.
Da fällt der nächste Schuss. Ein scharfer Schmerz zuckt durch meine linke Pobacke. Ich spüre, dass ich den Halt verliere. Erst im Moment des Fallens wird mir bewusst, dass die zweite Stimme, die ich gehört habe, nicht die eines Mannes war.
Marc van Heese, Deggendorf in Niederbayern, Vormittag
Noch fünfhundert Meter bis zur Ausfahrt Deggendorf. Ich setze den Blinker, gehe vom Gas, der Sechszylinder-Boxermotor in meinem Rücken hört auf zu grölen. Natürlich hat die Firma mir einen Wagen zur Verfügung gestellt, als Außendienstler steht mir das zu. Aber die Karre – ein koreanisches Fabrikat selbstverständlich, weil mein Arbeitgeber dort produziert – ist so jämmerlich, dass ich mich damit bei Kunden nicht blicken lassen kann. Da macht ein Porsche 911 Carrera schon mehr Eindruck.
Xaver Geißlhammer heißt der Inhaber einer mittelständischen Tiefbaufirma, dem ich heute hoffentlich einen ordentlichen Umsatz abschwatzen werde. Es hat mich eine Menge Anrufe und Überredungskünste gekostet, überhaupt einen Termin zu bekommen. Bayerische Bauunternehmer kaufen ungern Dinge von Menschen, die sie nicht kennen. Aber gestern klang er dann plötzlich geradezu euphorisch. Er hat an einer Ausschreibung zur Verbreiterung eines Teilstücks der A 3 teilgenommen und rechnet ziemlich fest mit dem Zuschlag. Sollte der Deal klappen, dann braucht er Maschinen, Planierraupen, Bagger, Straßenwalzen. Ein Geschäft, das leicht in die Millionen gehen könnte. Vielleicht mein Durchbruch. Hoffentlich. Nein, ganz bestimmt.
Der schwarze Mustang mit den beiden grinsenden Schlägern darin, der mir seit einer halben Stunde im Genick hängt, fährt geradeaus weiter. Ich soll wissen, dass sie mich im Auge haben. Dass sie nicht lockerlassen.
Wenn es gut läuft, wenn es auch nur halbwegs gut läuft, dann verdiene ich heute zwanzig-, dreißig-, vielleicht sogar fünfzigtausend, und die Firma gibt mir den Vorschuss, den ich brauche, um am Montag meine Schulden zu bezahlen. Mein linkes Auge ist blau und zugeschwollen, weshalb ich trotz des trüben Himmels meine Sonnenbrille aufsetze. Mit nur einem Auge Auto zu fahren, ist gar nicht so einfach.
Netterweise liegt das Firmengelände nur wenige Hundert Meter von der Autobahn entfernt. Ich finde einen Parkplatz, an dem »Besucher« steht, und stelle den Motor ab. Ich atme fünfmal tief durch, zwinge ein Verkäuferlächeln in mein Gesicht, straffe beim Aussteigen den Rücken, ziehe die Schultern zurück, sage dreimal »Hier kommt Marc van Heese, der größte Baumaschinenverkäufer aller Zeiten« vor mich hin und reiße die knarrende Tür auf, an der leicht schief ein Plastikschild mit der Aufschrift »Büro« pappt.
Die Brünette in den Dreißigern, die am ersten Schreibtisch links sitzt, mustert mich mit mäßigem Wohlgefallen und einer gehörigen Portion Misstrauen. Ich schalte mein Verkäufergrinsen hoch bis an die Schmerzgrenze.
Heute ist mein Tag, ich fühle es in jeder Faser meines Körpers, heute wird es klappen.
Heute muss es einfach klappen.
»Ich möchte zu Herrn Geißlhammer, schöne Frau. Ich bin angemeldet.«
»Is ned do«, lautet die knappe Antwort der keineswegs besonders schönen Frau, die offenbar zugleich Empfangsdame und Mädchen für alles ist. Eigentlich hatte ich mir die Firma ein bisschen größer vorgestellt.
»Ich habe einen Termin. Um zehn. Jetzt ist es …«, Blick auf die Rolex, »zwei Minuten vor.«
Ein zu früh kommender Vertreter wird in Bayern noch weniger geschätzt als ein zu spät kommender, habe ich in den vergangenen Wochen herausgefunden.
»Is ned do«, wiederholt sie stoisch, inspiziert ihre in einem zu schreienden Pink lackierten Fingernägel und murmelt etwas von einer Baustelle in Plattling.
»Und wann kommt er zurück?«
»Woasined« heißt auf Deutsch: »Das weiß ich leider nicht«, so viel Bayerisch habe ich schon gelernt. »Setzan’S eana halt derwail do hi.«
Gehorsam nehme ich auf einem der beiden Klappstühle Platz, die an einem runden, blitzsauberen Tischchen in der Büßerecke gleich hinter der zugigen Eingangstür stehen.
In dem engen, mit Regalen, Registerschränken und Plunder vollgestopften und nach frischem Nagellack duftenden Büro stehen noch drei weitere Schreibtische, alle voller Chaos und verwaist. An den Wänden hängen großformatige Fotos von irgendwelchen todlangweiligen Baustellen. Die Brünette wendet sich wieder ihrer Tipperei zu, plappert leise den Text vor sich hin, den sie von einem handschriftlichen Entwurf ins Reine schreibt. Hin und wieder nippt sie an ihrem Kaffeebecher. Mir auch einen anzubieten, kommt ihr nicht in den Sinn.
Ich schlucke meinen ersten Frust hinunter. Lächeln, lächeln, immer lächeln. Optimistisch sein. Ich bin der Größte, Marc van Heese, der tollste Baggerverkäufer dieser Galaxis. In Lagos war ich der King. Einmal habe ich an einem einzigen Nachmittag mit Liebherr-Radladern einen Umsatz von fast neun Millionen Dollar gemacht. An einem einzigen gottverdammten Nachmittag!
In den sechs Wochen, die ich nun schon Bayern unsicher mache, habe ich noch nicht mal hunderttausend geschafft. Ich hasse den Job. Ich hasse die Bettelei am Telefon. Ich hasse diese selbstgefälligen, manchmal fetten, manchmal sehnig durchtrainierten, aber immer oberschlauen Mittelständler, mit denen ich mich Tag für Tag herumquälen muss. In Lagos waren meine Kunden Giganten. Firmen wie de Beers, die Hundertausende von Mitarbeitern beschäftigten, Milliardenumsätze machten und wegen ein paar Hunderttausend Dollar mehr oder weniger nicht herumzickten.
Um nicht nur blöde dazusitzen, packe ich schon mal meine schönen bunten Prospekte aus, blättere sie durch, lege sie akkurat auf einen Stapel und sehe verstohlen auf die Uhr. Zehn Minuten sitze ich schon hier, und Herr Geißlhammer ist immer noch in Plattling, wo immer das sein mag.
»Der Porsche do draußen«, fragt die Frau unvermittelt und plötzlich fast freundlich. »Is des Ihrer?«
Ich nicke.
»Wie schnell geht na der?«
»Hab ich noch nicht ausprobiert.«
»Zwoahundertfuchzig aber scho?«
»Denke schon, ja.«
»Dreihundert macht er aber ned?«
»Ich glaube nicht, nein.«
»Is des a Diesel oder a Benziner?«
Viertel nach zehn.
Ich hätte so gerne einen Kaffee, ich lechze nach einem Kaffee. Ob ich es wagen kann, um einen zu bitten, ohne mir gleich das Geschäft zu vermasseln? Vielleicht stehen die Bayern darauf, dass ich mich unterwürfig gebe, anspruchslos, bescheiden. Vielleicht ist Herr Geißlhammer gar nicht in Plattling, sondern beobachtet mich per Überwachungskamera in irgendeinem Nachbarzimmer, um zu entscheiden, ob ich es wert bin, dass man mit mir spricht. Andererseits würde sich in diesem Fall die Brünette wahrscheinlich nicht die Nägel im Büro lackieren.
»I glaab, des dauert no a bissl«, sagt sie jetzt fast mitleidig. »Meng’S vielleicht an Kaffee derweil?«
Halleluja!
Kaum steht der Becher vor mir, rauscht ein schwerer BMW auf den Hof, und ein jungdynamischer Endvierziger springt heraus.
»Do kimmda ja«, sagt die Brünette zufrieden und lächelt mich verschwörerisch an. Fehlt nur noch, dass sie dabei zwinkert. Vielleicht spekuliert sie auf eine kleine Spritztour im Porsche nach einem erfolgreichen Geschäftsabschluss?
Die Tür scheppert auf, Herr Geißlhammer tritt krachend ein, sieht mich, stutzt, sieht seine Tippse an, dann wieder mich.
»Van Heese«, sage ich eilig und springe auf. Meine ausgestreckte Rechte ergreift er erst mit Verzögerung. »Wir haben telefoniert.«
»Ah«, stößt er hervor, »Sie san des. I hab denkt, Sie san Koreaner?«
»Die Maschinen, die ich anzubieten habe, kommen aus Korea. Aber keine Sorge, hervorragende Qualität, unschlagbare Preise, ewig lange Garantie, Service überall in Deutschland …«
»Ghört eana der Porsche do draußn?«, will er wissen.
Offenbar macht mein Auto wirklich Eindruck auf ihn. Es läuft!
»Ja, ich …«
»An Neunelfer Carrera S?«
»Stimmt genau.« Ein Männerlächeln vom Porsche-Fahrer zum BMW-Fan.
»Dann kennan’S glei wieder gehn.«
»Äh … Ich versteh nicht?«
Mir zu Ehren spricht er plötzlich Hochdeutsch: »Wissen’S, wenn ein Vertreter so ein Auto fahrt, dann verdient er zu viel. Und wenn er außerdem no so a Angeberuhr hat wie Sie, dann verdient er glei zwoamol zu viel. Und wenn der Vertreter zu viel verdient, dann sind seine Produkte zu teuer, verstehn’S mich?«
Nun ja, so etwas Ähnliches wie Hochdeutsch.
»Und das heißt …?«
»Des hoast, du packst jetzt dei Zeug zamm und schleichst di. Den Kaffee kannst mitnehma. Den Becher schenk i dir.«
Als ich wieder im Porsche sitze, stecke ich mir erst mal eine Zigarre an. Eine von den kurzen. Die langen sind für erfolgreiche Verkaufsgespräche. Von denen habe ich noch reichlich im Etui. Die kurzen dagegen sind fast alle. Ich muss demnächst für Nachschub sorgen.
Zwei namenlose Männer vor der Steilküste westlich von Dover, Südengland, später Vormittag
»Fuck!«
Der weißblonde Riese schreckte aus seinem Dämmerschlaf hoch, wollte näher an den Bildschirm treten, neben seinen Kollegen, der ihn mit seinem Fluch geweckt hatte, stieß dabei mit dem Schädel gegen eine der Stahlstreben an der Decke des niedrigen Raums und fluchte ebenfalls lauthals.
»What’s wrong?«, fragte er dann.
»Look!« Der andere, der im Gegensatz zu ihm klein und dünn war, deutete aufgeregt auf den linken der beiden großen Monitore. »Sie tun es schon wieder! Das ist doch nicht normal! Das sind Tiere, sage ich dir. Tiere sind das!«
Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt der Große sich den Kopf. »Und deshalb machst du so ein Theater? Mann, tut das weh!«
»Die Frau muss eine Nymphomanin sein«, spekulierte der Kleine mit konzentriertem Blick auf das Bild, das sich ihnen bot. »Und der Typ nimmt irgendwas, das ist mal sicher. So oft kann kein Mensch, ohne irgendwas einzuwerfen.«
Seufzend und die schmerzende Stelle an der Stirn betastend sank der große Blonde wieder auf die grob gezimmerte Holzbank an der stählernen Wand, ohne jedoch den Blick vom Flachbildschirm zu wenden, auf dem gestochen scharf in HD und Farbe eine dieses Mal nicht ganz so wilde Rammelszene zu sehen war. Heute war dort drüben offenbar Slow Sex angesagt. Das Paar, das sie mithilfe ihres Hightech-Equipments von einem unentwegt schlingernden und schaukelnden Fischerkahn aus seit Tagen observierten, ging seinem Hobby auf der Terrasse eines großzügigen Anwesens am Rand der Klippen westlich von Dover nach. Sex an frischer Luft schien einen besonderen Reiz für die beiden zu haben. Wobei man natürlich nicht wissen konnte, wie oft sie es miteinander trieben, wenn sie drinnen waren.
Wie bei solchen Jobs üblich, hatten die beiden Männer keinen Schimmer, wer die Leute auf der Terrasse waren, die jetzt zügig ihrem Höhepunkt entgegenstrebten, und weshalb sie sie im Auge behalten mussten. Vermutlich wurden auch die Telefone und Handys abgehört, aber das machten andere. Die beiden auf der Terrasse sprachen Englisch, so viel wussten sie immerhin, weil sie anfangs über eine Wanze hatten mithören können, worüber die Zielpersonen sich unterhielten, wie sie beim Vögeln stöhnten, jauchzten und schrien. Die Frau sprach mit amerikanischem Akzent, der Mann dagegen stammte eindeutig aus London.
Die Amerikanerin war eine sensationell gut gebaute Schwarzhaarige um die dreißig und lustigerweise untenherum blond. Er war älter, vermutlich schon jenseits der vierzig, leicht angegraut, körperlich aber offenkundig noch bestens in Schuss. Er nannte sie »My Love« oder »Eileen«, sie ihn »Steven«.
»Wir könnten später aus dem ganzen Material ein Video produzieren und es auf Youporn stellen«, knurrte der Riese mit säuerlicher Miene.
»Die zahlen doch nichts«, gab der andere zu bedenken. »Außerdem haben wir keinen Ton, seit diese Scheißwanze den Geist aufgegeben hat. Und was, bitte schön, ist schon ein Porno ohne Gestöhne?«
Zu gerne hätten sie gewusst, weshalb sie seit Tagen auf diesem versifften, nach Diesel und Fisch stinkenden Kahn sitzen mussten, um einem offenbar frisch verliebten Pärchen bei seinen gymnastischen Übungen zuzusehen. Immerhin war der Kleine inzwischen nicht mehr seekrank und musste nicht alle Viertelstunde die steile Treppe zum Deck hinaufhetzen, um sich über die Reling zu übergeben. Der stickige Raum, in dem die Männer saßen, war fensterlos, die Luft trotz ewig offen stehender Luke kaum zu atmen, und allmählich litten sie unter einem ausgeprägten Lagerkoller, der sie humorlos und nervös machte. Die extrem hochauflösende Kamera mit Nachtsichtfunktion und sensationell lichtstarkem Zeiss-Objektiv war auf dem Dach des Ruderhauses montiert, und irgendeine superschlaue Realtime-Software sorgte dafür, dass das Bild absolut ruhig blieb, während dieser elende Kutter ohne Unterlass schaukelte und rollte und über die Wellen tanzte.
Über die Kotzerei des Kleineren hatte der alte, fast zahnlose Skipper, der den Kahn steuerte, sich jedes Mal königlich amüsiert. Er machte keinen Hehl daraus, dass er seine beiden Fahrgäste verachtete, diese verweichlichten Landratten. Zudem hasste er vermutlich auch den Job, dieses blödsinnige Im-Kreis-Herumschippern, mal eine halbe Meile nach hier, mal eine halbe Meile nach dort. Andererseits verdiente er zurzeit todsicher an einem Tag mehr als sonst in einem Monat mit der Fischerei, die von Jahr zu Jahr weniger einbrachte.
»Wie lange noch?«, fragte der Riese mit geschlossenen Augen. Heute Abend würde er Kopfschmerzen haben und morgen eine Beule.
»Vier Stunden.« Der Kleine seufzte abgrundtief. »Du glaubst nicht, wie ich mich auf den ersten Pint im Eight Bells freue.«
»Und auf den zweiten und den dritten und den vierten …«, murmelte der Riese.
Auf die Minute genau um achtzehn Uhr würde der Alte seinen Kutter in eine Bucht steuern, wo er vom Haus über den Klippen aus nicht zu sehen war. Dort würde ein Motorboot mit der zweiten Mannschaft warten. Die am Tag geleerten Treibstoffkanister wurden beim Schichtwechsel gegen volle ausgetauscht, Getränke und tiefgekühlte Fertiggerichte wurden geladen, die Latrine entleert, der Wassertank aufgefüllt. Auch der Alte würde von Bord gehen und das Steuer einem seiner Söhne überlassen. Es schien jeden Abend ein anderer rotgesichtiger Kerl zu sein, der die Nachtschicht auf der Brücke übernahm.
Linda Wanzl, im Münsterland, kurz vor Mittag
»Kannst du die nächste Reitstunde übernehmen?« Jo klingt müde, als sie mir Kaffee eingießt. »Tut mir leid wegen deinen Blessuren, aber ich muss mich dringend um die Pflegepferde und das Turnier am Sonntag kümmern, und Björn hat heute ja frei.«
»Solange ich nicht selbst im Sattel sitzen muss«, sage ich mit denkbar schlechter Laune.
Ich lehne mich ans Büfett neben der Eckbank, denn heute bleibe ich lieber stehen. Der dicke Verband an meinem Popo ist fast noch lästiger als der Streifschuss an sich. Wenn Susanna Krause und Anna Herrmann, ihre lesbische Freundin, mich nach meinem Sturz von der Fast-drei-Meter-Mauer – glücklicherweise auf die richtige Seite und in einen nicht allzu stacheligen Busch – nicht ins Haus gelassen und sofort die Polizei alarmiert hätten, hätte der schießwütige Nachbar mich am Ende vielleicht noch schlimmer zugerichtet. So wurde der alte Breekemann umgehend wieder in die Geschlossene verfrachtet, in der er, wie ich erfuhr, Dauergast ist, und ich selbst ins Krankenhaus.
Nach einer schlaflosen Restnacht durfte ich mich am frühen Vormittag dann auch noch mit einer schadenfrohen Polizistin und meinem hochverehrten Auftraggeber herumstressen. Polizeiobermeisterin Hasenbühl scheint grundsätzlich keine hohe Meinung von Privatdetektivinnen zu haben, und Krause wollte partout nicht einsehen, warum er mir einen Schmerzensgeldzuschlag bezahlen sollte, geschweige denn das vereinbarte Honorar. Die gewünschten Fotos hatte ich ihm nicht geliefert, das war ich seiner Susanna und ihrer Freundin schuldig. Seither kann ich bestimmte HNO-Ärzte noch weniger leiden als die Bullen.
»Eigentlich müsste ich die Buchrezension fertig machen, bin schon über der Deadline.« Der Krimi, den ich besprechen muss beziehungsweise darf, war so stinklangweilig, dass ich trotz Querlesen lange vor Schluss aufgegeben habe und die Rezension nun ewig vor mir herschiebe. »Und dem Rakebusch muss ich endlich eine Mahnung schicken, der hat immer noch nichts überwiesen. Aber wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich gleich auf den Platz.«
»Danke, Lindalein.« Jo füllt ihre eigene Tasse auf und setzt sich schwerfällig auf ihren angestammten Holzstuhl am Küchentisch. »Bei Rakebusch ist übrigens nichts zu holen. Zwei Schülerinnen aus der Neun-Uhr-Gruppe haben sich über ihn unterhalten. Gestern hat er für seine Klitsche Insolvenz angemeldet.«
»Im Ernst?«, frage ich entgeistert. Allein der Flug nach Kreta hat mich vierhundert Euro gekostet, Hotel und Mietwagen nicht eingerechnet. »Warum hat er mir den Auftrag denn erteilt, wenn er weiß, dass er die Rechnung nicht bezahlen kann?«
»So sind sie eben, die Kapitalisten, alles Blutsauger«, sagt mein Tantchen in ihrer schnoddrigen Münsterländer Art und trinkt einen großen Schluck. »Dass sein leitender Ingenieur nicht in Heraklion im Krankenhaus liegt, sondern sich am Strand die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, war für mich so klar wie Kloßbrühe. Ich kapiere nicht, warum du dir für diese Spioniererei nicht zu schade bist.«
»Erstens, weil ich Geld brauche, und zweitens weißt du so gut wie ich, dass ich mir meine Klienten nicht aussuchen kann.«
Meine Tante Josefina Osterbek, wie Jo mit vollständigem Namen heißt, betreibt einen Reiterhof, uralt und mitten im Grünen, auf dem ich aufgewachsen bin. Wir befinden uns in ihrer gemütlichen Wohnküche mit Blick auf den Birnbaum, wo wir uns wie fast jeden Vormittag auf einen schnellen Kaffee treffen, und wieder einmal muss ich mir eingestehen, dass ich mir bei meiner Rückkehr ins Münsterland alles anders vorgestellt hatte.
Im vergangenen Herbst hielt ich die Gründung unseres Detektivbüros noch für eine vielversprechende Idee. Marcs völlig überzogenen Vorstellungen – er träumte von sechsstelligen Jahresumsätzen – stand ich zwar von Anfang an skeptisch gegenüber, doch so gut wie in Köln, wo ich mich mit Gelegenheitsjobs und schlecht bezahlten Schreibaufträgen für Käseblättchen und ständig unter Geldnot leidende Online-Redaktionen durchgeschlagen hatte, würde ich allemal leben können. Hatte ich gedacht.
Bei meinem Umzug auf Jos Hof und Marcs Einzug – er hatte ja nichts zum Umziehen – hatte ich ihr versprochen, bei Bedarf nicht nur als Reitlehrerin einzuspringen, sondern sie auch bei den laufenden Kosten zu unterstützen. Futter und Pflege, Tierarzt, Instandhaltung der Koppeln, Reitplätze und Ställe – ein Betrieb wie der meiner Tante läuft nicht von alleine, und ich weiß ja, wie knapp sie immer kalkulieren muss. Seit Marc mich hat sitzen lassen, reicht mein Beitrag nicht mal für Kost und Logis. Selbst die Miete für das »Private Eye«-Büro, das ursprünglich Jos Sonntagszimmer war, bleibe ich ihr seit Monaten schuldig. Deshalb schreibe ich seit Neuestem wieder Texte. Falls ich mal einen Auftrag ergattere, was selten genug vorkommt.
»Und alles nur wegen Marc«, zische ich, und beim bloßen Gedanken an ihn sehe ich schon wieder rot. »Um die Kundenakquise wollte er sich kümmern, um den Technikkram, auf dem Hof wollte er mithelfen und, und, und.« Ich versuche, meinen Ärger hinunterzuwürgen. Mein Ton wird davon aber nur noch giftiger: »Seinetwegen hast du deiner zweiten 450-Euro-Kraft gekündigt, und mit welchem Resultat? Jetzt müssen du, Björn und ich alles alleine machen. Dieser verfluchte …«
»Wenn du nicht ständig an Marc herumgenörgelt hättest«, Jo packt ihren Kaffeelöffel und fuchtelt damit wild herum, »wenn du hin und wieder auch mal nett zu ihm gewesen wärst, dann säße er jetzt hier bei uns und würde seinen Teil der Arbeit erledigen. Also beklage dich nicht, Belinda Marie, genauso wolltest du es doch haben.«
Wenn meine Tante, die mich großgezogen hat, mich mit meinem kompletten Namen anspricht, ist äußerste Vorsicht geboten. Ich werfe ihr mindestens genauso kämpferische Blicke zu wie sie mir, halte jedoch vorsichtshalber den Mund. Jedes Mal, wenn das Gespräch auf Marc kommt, endet es in Streit.
Mitte Februar hat er eines Abends seinen Krempel gepackt, nach dem ich weiß nicht wievielten Krach, und ist in seinem Angeber-Porsche davongedüst. Nicht einmal verabschiedet hat er sich, der Feigling. Mein Tantchen war todunglücklich, als ihr klar wurde, dass Marc nicht nur nach Altenberge zur Sparkasse gefahren war. Der einzige Schwiegersohn in spe, den sie je leiden konnte. Was sage ich – dem sie jeden Wunsch von den Augen ablas. Ich hingegen komme ohne ihn besser zurecht, aber hallo!
»Du bist noch jung, Lindalein, da sieht man vieles anders.« Jo schiebt ihre Brille, die ihr in der Aufregung auf die Nasenspitze gerutscht ist, wieder zurück und klingt auf einmal versöhnlich. »Aber weißt du, in einer Zweierbeziehung muss man sich nun mal zusammenraufen. Die rosaroten Zeiten dauern nirgendwo ewig.«
»Mit wem, bitte schön, hast du dich denn zusammengerauft?« Demonstrativ sehe ich mich in der Küche um. Die einzigen Männer, die es hier gibt, hängen an der Wand, fein säuberlich gerahmt und alle tot. Lenin, Marx, Fidel Castro, Che Guevara, Dutschke und wie sie alle hießen. »Wenn ich mich recht erinnere, hast du jedem deiner Verflossenen schon beim ersten Schritt über die Hausschwelle erklärt, dass hier nach deinen Regeln gespielt wird.«
Betreten zupft sie an dem kunstvoll geflochtenen Zopf herum, der über ihre Schulter hängt, betrachtet erst ihre Finger, als würde sie auf etwas warten, und sieht mir dann mit sorgenvoller Miene ins Gesicht.
»Und genau das möchte ich dir ersparen, Lindalein, das Alleinsein. Auch du wirst irgendwann alt werden, und dann wirst du es bereuen, dass du Marc hast gehen lassen. Er hat so viele gute Seiten, und ich habe doch gesehen, wie gern ihr zwei euch hattet, auch wenn ihr nicht immer einer Meinung wart.«
Wütend schütte ich den Kaffee, der längst kalt geworden ist, in mich hinein. »Hundertzwanzigtausend hat er von der Versicherung bekommen, als Schadensersatz für seinen kaputten Benz – und nach Weihnachten hat er das, was von unserem Geld noch übrig war, ausgerechnet wieder in ein Auto investiert, und noch dazu in so eins!«
»Ja, das war wirklich keine Glanzleistung. Trotzdem war es nicht euer Geld, sondern seines, und Männer sind nun mal so.« Jo seufzt. »Deshalb müssen wir Frauen klüger sein.«
Sie steht auf, holt eine Flasche von ihrem selbst gebrannten Korn aus dem Uralt-Kühlschrank und zwei Schnapsgläser aus dem knarrenden Küchenbord, füllt sie bis zum Rand, reicht mir ein Glas und kippt ihren Schnaps in einem Zug hinunter.
»Genug geklönt.« Mit einem lauten Rums stellt sie ihr Gläschen auf den Tisch, zieht ihren ausgefransten Pulli zurecht und stapft zur Tür. »Du schreibst deinen Text fertig, ich sattle die Pferde, und dann sehen wir uns auf dem Platz, okay?«
Marc van Heese, Freising, später Nachmittag
Wie es aussieht, werde ich den Porsche verkaufen müssen. Von meinem Fixum kann ich gerade mal die Miete für das Haus bezahlen, und das Geschäft läuft so mies, dass man es eigentlich gar nicht als Geschäft bezeichnen kann.
In Lagos, bei der Euro Mining, das waren noch Zeiten! Vor zwei Jahren, als noch alles normal war, als noch niemand ahnte, welche Katastrophen bald über uns hereinbrechen würden, als ich mit Eileen noch richtig verheiratet war und nicht nur auf dem Papier. Ich darf gar nicht daran denken, was ich damals verdient habe, sonst wird mir noch elender zumute als ohnehin schon. Damals war Marc van Heese der Starverkäufer.
Und heute?
Den letzten Umsatz habe ich vor drei Wochen gemacht. Zwei kleine Rüttler an diesen ständig grantelnden Straßenbauer in Kempten. Der seither schon dreimal reklamiert hat wegen irgendwelcher lachhafter Kleinigkeiten, um auch nach der Lieferung den Preis noch mal zu drücken. Habe ich eben »granteln« gesagt? Jetzt fange ich auch schon an, wie ein Bayer zu denken.
Ich könnte kotzen.
Wenn ich nur wüsste, wo Eileen steckt. Wohin sie sich verkrochen hat, nachdem sie die vielen Millionen abgegriffen hat, die eigentlich ich mir unter den Nagel reißen wollte. Sie würde mir die paar Tausend Euro problemlos leihen, wenn nicht sogar schenken. Seit dem Zusammenbruch der EuMin ist alles, aber auch wirklich alles schiefgegangen. Nun sitze ich hier in meinem Käseladen im tiefsten Oberbayern, rauche schon wieder viel zu viel und kann mich nicht einmal überwinden, ein paar neue Adressen von potenziellen Kunden zu recherchieren, die ich noch nicht mit Anrufen beglückt habe.
Obwohl es gerade erst halb fünf ist, beschließe ich, Feierabend zu machen. Jetzt noch Telefonakquise zu versuchen, hat ohnehin keinen Sinn. In meiner momentanen Stimmung vergraule ich die Kunden nur oder fange womöglich noch Streit an mit einem dieser eingebildeten Ignoranten. Ich fahre das Notebook herunter, packe es ein, verlasse das Lädchen, in dem vor wenigen Monaten wirklich noch Käse verkauft wurde, und verschließe die Tür, auch wenn es drinnen rein gar nichts zu stehlen gibt. Außer meinen Bürostuhl vielleicht und das Festnetztelefon.
Kontrollblick auf die Schaufenster links und rechts. Könnte ich mal wieder putzen lassen. Und die schönen Pappaufsteller mit Fotos von Baggern, Planierraupen, Betonmischern und Straßenwalzen sollten dringend abgestaubt werden. Den Käse rieche ich immer noch jeden Morgen, wenn ich meine glorreiche Generalvertretung des weltberühmten koreanischen Maschinenbauers Kyocuzza betrete, der in Deutschland und insbesondere in Bayern einfach keinen Fuß auf die Erde kriegt. »Das wird schon«, heißt es aus Hamburg immer, wo die Europazentrale meines neuen Arbeitgebers sitzt, »Anlaufschwierigkeiten«. Aber es dauert höchstens noch einige Wochen, dann werden sie mir die miesen Zahlen unter die Nase halten und mir einen Tritt in den Hintern geben.
Da steht er, direkt vor der Tür, mein silberfarbener Porsche, in der Spätnachmittagssonne blitzend und funkelnd, gerade mal vierzigtausend Kilometer auf dem Tacho. Bevor ich einsteige, streiche ich einmal zärtlich über das gewölbte Blech des Dachs. Wie er riecht! Wie man darin sitzt! Als wäre das Wägelchen eine Maßanfertigung speziell für mich.
Der Motor springt bei der ersten Kurbelwellenumdrehung an. Nur zum Spaß, und um die Inhaberin des Dritte-Welt-Ladens auf der anderen Straßenseite zu ärgern, trete ich kurz aufs Gas. Wie immer steht sie in der Tür und beobachtet mich mit ausdrucksloser Miene. Wie immer ist sie alternativ bunt gekleidet. Wie immer hat sie ihre albernen Zöpfe um den Kopf gewickelt, was aber gar nicht so bescheuert aussieht, wie es klingt. Ich hasse sie, und sie hasst mich, aber nach anfänglichen Kabbeleien leben wir in einem verhältnismäßig stabilen Waffenstillstand.
Eines weiß ich: Meine bunte Nachbarin hat heute mit ihrem Fair-Trade-Laden mehr Umsatz gemacht als ich, und sie weiß es vermutlich auch. Sie findet, ich passe nicht hierher. Und dummerweise hat sie vollkommen recht.
Was waren das für Zeiten in Lagos. Als ich noch der King war. Als ich noch mehr Geld hatte als die hiesigen Bauern Heu in der Scheune. Wenn ich nur wüsste, wo es geblieben ist, das viele schöne Geld. Nun ja, im letzten Rest davon sitze ich gerade und lege den ersten Gang ein. Zu Ehren der Tante mit den semmelblonden Zöpfen fahre ich ein wenig flotter an als nötig.
Semmelblond? Schon wieder …
Zwanzig vor fünf. Was soll ich anfangen mit dem frühen Abend? Die Auswahl ist in einem Städtchen wie Freising überschaubar, über dem dazu ein Bischof wacht: Fernsehen, Kino, Biergarten oder Ingo’s Bar. Bei Ingo trifft man immerhin manchmal Frauen, die nicht nach Kuhstall oder Weihrauch riechen. Allerdings selten vor zehn. Außerdem habe ich Hunger. Also erst mal Biergarten. Obwohl wir erst Mitte Mai haben, ist es schon sommerlich warm.
Ich bin kaum losgefahren, als ich schon wieder bremse und nach einer Parklücke Ausschau halte. Ich finde keine, denn beim Weißbräu Huber ist heute offenbar mächtig was los. Ich fahre zweimal um den Block und stelle den Wagen am Ende dort wieder ab, wo ich vor zehn Minuten eingestiegen bin: vor meinem Käseladen am Unteren Graben. Ich sollte wenigstens mal das alte Schild über der Tür entfernen lassen.
Beim Aussteigen sehe ich den Mustang wieder. Die beiden Schläger in schwarzen Muscle-Shirts fahren im Schritttempo an mir vorbei und grinsen mich an. Auf dem Beifahrersitz hockt der, dem ich das blaue Auge verdanke. Er lässt mich seine wirklich beeindruckende Faust sehen, an der jetzt auch noch ein Schlagring funkelt. Die zwei scheinen sich bestens zu amüsieren. Zeit, mir endlich eine Strategie für die Lösung meines aktuell größten Problems einfallen zu lassen.
Beim Weißbräu Huber habe ich mir einen Schweizer Wurstsalat geleistet und zwei Halbe Helles dazu. Um halb acht bin ich nach Hause gefahren, habe geduscht und mich für den Abend fein gemacht. Meine schicken neuen Jeans von Armani habe ich angezogen und dazu das kornblumenblaue Hemd, das Linda mir zu Weihnachten geschenkt hat.
Wie lange das schon her ist.
Anschließend habe ich meine privaten Mails gecheckt (außer Spam nichts im Posteingang), im Fernsehen Nachrichten geguckt (langweilig) und die Post durchgesehen (Rechnungen, eine Mahnung, der Dauerauftrag für die Stromrechnung funktioniert immer noch nicht).
Dann ist es endlich Zeit.
Ich fahre wieder in die Stadt hinunter und finde dieses Mal direkt vor meinem Ziel einen Parkplatz. Als ich mit Was-kostet-die-Welt-Miene im frisch rasierten Gesicht und einer Zigarre im Mund (ausnahmsweise eine von den langen, denn jetzt ist sowieso schon alles egal) Ingo’s Bar betrete, ist es immer noch erst halb zehn, und ich bin der erste Gast.
»Hocken alle in den Biergärten bei dem Wetter«, knurrt der Inhaber zur Begrüßung und schenkt mir ein müdes Halbgrinsen. »Das Übliche?«
Das Übliche ist ein zwölf Jahre alter Connemara mit viel Eis. Ich setze mich an die Ecke der futuristisch beleuchteten Bar, an der ich immer sitze. Frauen setzen sich lieber neben einen, wenn ein gewisser Sicherheitsabstand bleibt.
Nach dem zweiten Whiskey trudeln allmählich weitere Gäste ein. Überwiegend Paare, die sich selbst genug sind. Frauen zu zweit oder zu dritt, die andere Dinge im Kopf haben, als männliche Bekanntschaft zu suchen. Der Rauschgoldengel scheint heute keinen Ausgang zu haben.
Als das dritte Glas fast leer ist, taucht eine kleine, schmale Frau auf. Französischer Typ, dunkler Kurzhaarschnitt, adrettes Kleidchen. Sie sieht mich, wendet den Blick sofort ab, setzt sich in die hinterste Ecke und beginnt, sich konzentriert und ausgiebig mit ihrem iPhone zu beschäftigen.
Ich hänge auf meinem Barhocker, betrinke mich zügig, denke abwechselnd an Linda und Eileen und daran, dass ich am Montag ein wirklich ernstes Problem haben werde. Als ich zum hundertsten Mal auf die Uhr sehe, kommt mir der Gedanke, dass ich die Rolex verkaufen könnte. Die müsste locker noch zehntausend bringen. Und wozu braucht der Mensch eine Rolex, wenn er doch sowieso aufs Handy schaut, um herauszufinden, wie spät es ist?
Samstag, 18. Mai
Steven Huntington, Südengland, 9 Uhr morgens Greenwich-Zeit
Angenehm frische, feuchte Luft füllt Steven Huntingtons Lungen. Kühlt seine Stirn. Eine Wohltat nach dem stickigen Dunst von tausend Menschen im wie immer ausverkauften Royal Opera House. Freitagabend, Mitte November, der Londoner Regen ist mit matschigen Schneeflocken durchmischt. Was will man anderes erwarten in dieser Stadt, diesem verrückten, rund um die Uhr pulsierenden, liebenden und hassenden, feiernden und trauernden Moloch? In dieser Millionenstadt, die Menschen fast aller Nationalitäten, Hautfarben und Glaubensrichtungen beherbergt? Auch jetzt – so viele Menschen um sie herum. Die meisten heiter und gelöst, zufrieden, manche nachdenklich oder beschwingt diskutierend über das Stück. Anna Netrebko, die ihre überirdische Stimme der Turandot lieh, das Bühnenbild von Stewart Laing.
Steven Huntington fühlt sich rundum wohl, trotz Regen, trotz Schnee. Zugleich berauscht und ermüdet von dieser göttlichen Musik, die ihm noch in den Ohren klingt. Turandot, die Königin des Hasses, die Netrebko, die live sehen und hören zu dürfen man nicht in vielen Städten dieser Welt die Möglichkeit hat.
Und – das Wichtigste – neben ihm Rose. Sie trägt hohe Schuhe, er hat seinen rechten Arm um ihre Schultern gelegt, zieht sie ein wenig fester an sich. Sie schenkt ihm ihr Lächeln, das so viel Wärme hat, so viel Liebe. Er küsst sie. Leicht nur. Sie erwidert den Kuss. Und in diesem flüchtigen, ein wenig verwackelten Kuss im Gehen, in der Kälte, im Londoner Novemberregen, ist etwas, das ihn völlig automatisch seine Schritte beschleunigen lässt.
Es wird ihr letzter Kuss sein.
Seine letzten Sekunden zusammen mit der Frau, um deren Hand er heute, an diesem festlichen, an diesem großen Abend anhalten wollte. Falls die Situation sich ergeben würde, natürlich.
Die Situation wird sich nicht ergeben.
Als Steven Huntington den Blick wieder nach vorn richtet, auf die vielen Rücken, die meisten in dicken dunklen Mänteln, viele unter vom Wind gebeutelten Regenschirmen eilig unterwegs zur nur wenige Schritte entfernten U-Bahn-Station Covent Garden, fühlt er, wie Rose in seinem Arm zusammenzuckt. Er hört den stark gedämpften Knall, mehr ein Plopp als ein Knall, stellt jedoch zunächst keinen Zusammenhang her zwischen dem Geräusch und dem Zucken der Frau, die er selten so sehr geliebt hat wie gerade jetzt. Er fühlt, wie sie das Gleichgewicht verliert, wie ihre Beine nachgeben, versucht automatisch, sie festzuhalten, was nicht einfach ist, denn ein erwachsener Mensch, dessen Muskeln auf einmal alle Kraft verlieren, wird unfassbar schwer, selbst wenn er so schlank und leicht ist wie Rose. Huntington beginnt nun selbst das Gleichgewicht zu verlieren, es gelingt ihm nicht, seine Geliebte auf den Beinen zu halten. Der Regen strömt über sein Gesicht, weil er wieder einmal den Schirm zu Hause gelassen hat, woran er ausgerechnet jetzt denkt, ausgerechnet in diesem Moment. Schließlich muss er Rose fallen lassen, versucht wenigstens, ihren Sturz irgendwie zu dämpfen.
Begreift immer noch nichts.
Hinter ihm ein Schrei.
Der Schrei einer Frau.
»Blood!«
Was für ein Unsinn – wieso denn Blut?
Vermutlich ist Rose nur übel geworden, der Kreislauf, nach dem langen Aufenthalt im Warmen die plötzliche Kälte, die hohen Absätze und …
Aber dann sieht auch er den dunklen Fleck auf ihrer Brust, schaut instinktiv auf, in das Gesicht eines Schwarzen, nur zwei, drei Schritte von ihm entfernt, der ihn ernst anblickt, ausdruckslos, keinesfalls mit Hass.
Der eine Pistole in der Hand hält.
Eine Pistole mit aufgeschraubtem Schalldämpfer.
Aber Steven Huntington begreift immer noch nicht.
Der Schwarze, dessen rundes Gesicht seltsam verschwommen bleiben wird in seiner Erinnerung, hebt die Waffe ein wenig an.
Dann wird es Nacht und vollkommen still.
»Steven!«, hörte Huntington eine Frau rufen.
Eine Frau, die nicht Rose war. Die nicht Rose sein konnte, denn Rose war ja tot. Seit vielen Jahren schon und …
Jemand rüttelte an seiner Schulter. Unsanft. Energisch. Fast ein wenig grob.
»Dein Handy, Steven!«, sagte Eileen mit besorgtem Blick, als er die Augen öffnete.
Eileen Sanders, Südengland, zur selben Zeit
»Steven!«, rief Eileen Sanders noch einmal und schüttelte dieses Mal kräftiger die rechte Schulter ihres Lebensgefährten.
Endlich kam er zu sich. Sein Blick und der wie von einem erstickten Schrei halb offen stehende Mund sagten ihr, dass er wieder einmal seinen Albtraum gehabt hatte.
»Are you okay?« Beunruhigt beugte sie sich zu ihm hinunter – er lag auf einer Lounge-Liege aus schwarzem Rattangeflecht und mit sandfarbenem Polster – und streichelte seine Wange. »Your mobile is ringing.«
Aber noch war er zu sehr in dieser anderen Welt gefangen, um auf ihre Berührung zu reagieren oder ihre Worte zu verstehen. In der Welt des Schreckens, die er vor ihr verschloss, zu der sie keinen Zutritt hatte, gleichgültig, wie oft er darin versank, wie oft er daraus hochschreckte. Wie gut sie ihn kannte, diesen Blick voller Panik und Verwirrung.
»Das Handy«, wiederholte sie, während es im Haus unverdrossen vor sich hin trällerte.
Nun sprang er auf, taumelte hinein.
Sekunden später kam er zurück, jetzt mit sichereren Schritten und wieder klarem Blick, der Steven, den sie kannte. Stark, beherrscht und manchmal ein wenig fremd.
»Zu spät«, sagte er gleichmütig, setzte sich zu ihr an den Tisch, schenkte sich eine dritte Tasse Kaffee ein und sah sie entspannt lächelnd an. Doch tief im Hintergrund war da immer noch die Angst in seiner schon wieder so männlichen Miene, in seinen eisblauen Augen mit den winzigen Sprenkeln rund um die Pupillen.
»Wer war es?«, fragte sie.
»Keine Ahnung«, erwiderte er leichthin. »Eine unbekannte Nummer. Wahrscheinlich verwählt.«
Sie spürte, sie war sicher, dass er sie belog. Er wusste genau, wer der Anrufer gewesen war, wollte aber nicht darüber sprechen. Oder sah sie plötzlich überall Gespenster, Schatten auch dort, wo es keine gab, weil dieser eine große Schatten ihn immer wieder heimsuchte? Was verbarg er nur vor ihr?
Eileen gab sich einen Ruck, richtete sich auf und stellte endlich die eine Frage, die sie längst hätte stellen sollen: »Was bedrückt dich so, Steven? Warum sprichst du nicht mit mir darüber?«
Doch er machte nur eine abwehrende Handbewegung, lächelte unverbindlich und sah hinüber zu den in der dunstigen Morgensonne schneeweiß glänzenden Kreidefelsen, an denen die Wellen sich schäumend brachen. Ein frischer, salziger Wind wehte landeinwärts. Steven trank einen Schluck und ließ seinen Blick hinaus aufs Meer schweifen, das heute so blau war wie selten und irgendwo weit draußen, an einer kaum erkennbaren Linie, mit dem Himmel verschmolz. Seinen Albtraum, der ihn eben noch so verstört hatte, schien er vergessen zu haben.