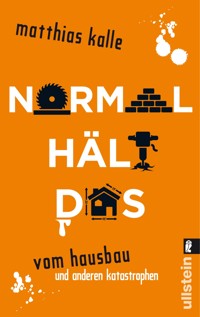12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
***Weißt du noch, als ...?*** Wie sah dein erster Kassettenrecorder aus? Wer war deine große Liebe, als "Dirty Dancing" im Kino lief? Wo warst du, als die Mauer fiel? – meistens reichen ein paar Stichworte und schon sind sie da: die Erinnerungen, die unser Leben prägen. Die erste Liebe, "November Rain" von Guns N´ Roses, Tschernobyl, Miami Vice, Massive Attack, die erste Zigarette, der Tod von Lady Di – sofort entstehen Bilder im Kopf, die wir nie vergessen werden, sie sind der Stoff, der uns verbindet und uns in Geschichten schwelgen lässt. Es sind die prägenden Erinnerungen an eine Zeit, in der wir unsere Freunde vom Festnetz aus anriefen und stolz auf unseren Walkman waren, in der "Wetten, dass …?" noch eine große Show war und in der wir dachten, von Hermann Hesse könne man fürs Leben lernen. Matthias Kalle, Jahrgang 1975, und heute stellvertretender Chefredakteur des ZEITmagazins, nimmt uns in seinem fulminanten Buch "Als wir für immer jung waren" noch einmal mit "Zurück in die Zukunft": vom ersten Kuss (der eigentlich immer der zweite war) bis Kurt Cobain, von der Raucherecke bis zur Love Parade, von Tamagotschi bis Harald Schmidt beschwört er die prägenden Erinnerungen unseres Lebens herauf – 90 davon sind in diesem Buch. "Ich glaube, dass sich aus unseren Erinnerungen unsere Biografie zusammensetzt. Aus den Erinnerungen an all das, was war, was vergangen ist, was nicht wiederkommt, was wir nicht loswerden, was uns begleitet und geprägt hat, was wir vermissen und was wir bedauern, worüber wir lachen und uns ärgern und schämen – an all das, was wir waren. Und dadurch auch an all das, was wir heute sind."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Matthias Kalle
Als wir für immer jung waren
Die prägenden Erinnerungen unserer Jugend
Über dieses Buch
»Weißt du noch, als …?«
Wie sah dein erster Kassettenrecorder aus?
Wer war deine große Liebe, als »Dirty Dancing« im Kino lief?
Wo warst du, als die Mauer fiel?
Meistens reichen ein paar Stichworte und schon sind sie da: die Erinnerungen, die unser Leben prägen. Die erste Liebe, »November Rain« von Guns N´ Roses, Tschernobyl, Miami Vice, Massive Attack, die erste Zigarette, der Tod von Lady Di – sofort entstehen Bilder im Kopf, die wir nie vergessen werden, sie sind der Stoff, der uns verbindet und uns in Geschichten schwelgen lässt. Es sind die prägenden Erinnerungen an eine Zeit, in der wir unsere Freunde vom Festnetz aus anriefen und stolz auf unseren Walkman waren, in der »Wetten, dass …?« noch eine große Show war und in der wir dachten, von Hermann Hesse könne man fürs Leben lernen. Matthias Kalle, Jahrgang 1975, und heute stellvertretender Chefredakteur des ZEITmagazins, nimmt uns in seinem Buch noch einmal mit »Zurück in die Zukunft«: vom ersten Kuss (der eigentlich immer der zweite war) bis Kurt Cobain, von der Raucherecke bis zur Love Parade, von Tamagotschi bis Harald Schmidt beschwört er die prägenden Erinnerungen unseres Lebens herauf.
»Ich glaube, dass sich aus unseren Erinnerungen unsere Biografie zusammensetzt. Aus den Erinnerungen an all das, was war, was vergangen ist, was nicht wiederkommt, was wir nicht loswerden, was uns begleitet und geprägt hat, was wir vermissen und was wir bedauern, worüber wir lachen und uns ärgern und schämen – an all das, was wir waren. Und dadurch auch an all das, was wir heute sind.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung und -abbildung: Schiller Design, Frankfurt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490264-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Was bleibt
Die Raucherecke
Tschernobyl
Kurt Cobain
Die Europa-Kassetten
Willst du mit mir gehen?
Miami Vice
Caravan of Love
Nightswimming
Aids
E.T.
Der Walkman
Beverly Hills, 90210
Der Friseursalon
Nike
La Boum
Die Swatch-Uhr
Erste Liebe
Die erste Zigarette
Morrissey
Ein Colt für alle Fälle
Der erste Kuss
Die Ärzte
Der Spielplatz
Tennis
Das Mix-Tape
Dirty Dancing
Die erste Nacht
Das Poster von Béatrice Dalle
Pulp Fiction
Freundschaft
Rap
Das erste Handy
Don’t Cry – November Rain – Estranged
Popliteratur
Familiengeschichte
Britpop
Die Filme von John Hughes
Die Tankstelle
Girlie
Die Videothek
Der Nordsee-Urlaub
Boybands
Supermodels
Werbung
Das Zeitschriftenregal
Massive Attack
Calvin Klein
Körperschmuck
Wetten, dass…?
Die Disco
Sitcoms
Die Kirmes
Der Geschichtsunterricht
IKEA
Die Bücher von F. Scott Fitzgerald
Harald Schmidt
Der Sportverein
New York
Die Love Parade
Der 9. November 1989
»Homo Faber«
Radio-Tage
Der erste Absturz
Die MTV-Jahre
Rot-Grün war die Hoffnung
Hermann Hesse
Otto
McDonald’s
Camus
Michael Schanze
Winona Ryder
Absolute Giganten
Live Aid
Kate Moss
Französische Revolution
Tamagotchi
Die Weihnachtsserie
Rocky
Der Game Boy
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Der Club der toten Dichter
Der Tod von Lady Diana
Der C64
Es
Star Wars
Die letzten Tage des Sommers
Für meine Mutter
»It’s not like years ago
The fear of getting caught
The recklessness and water
They cannot see me naked
These things, they go away
Replaced by every day«
R.E.M., »Nightswimming«, 1992
»… Nein, es ist unmöglich; es ist unmöglich, die Lebendigkeit irgendeines Abschnitts aus unserem Dasein wiederherzustellen, – das, was die Wahrheit, den Sinn und das innerste Wesen eines Erlebnisses ausmacht. Es ist unmöglich. Wir leben wie wir träumen – allein …«
Joseph Conrad, »Herz der Finsternis«, 1899
Was bleibt
Irgendwann landeten wir immer bei Alf.
Wenn ich Freunden oder Kollegen von der Arbeit an diesem Buch erzählte, davon, dass ich prägende Erinnerungen sammeln würde, weil ich glaube, dass wir alle viel mehr gemeinsam haben, als uns vielleicht lieb ist, weil wir diese Erinnerungen teilen, bewusst und unbewusst, dann fragte jeder früher oder später: »Du meinst so was wie Alf?«
Ja. So was wie Alf. In diesen Momenten wusste ich, dass sie ahnten, worum es in diesem Buch geht, obwohl sie noch keine Zeile davon gelesen hatten (und ich noch keine Zeile geschrieben hatte). Sie dachten an Alf, und ihre Augen bekamen einen leichten Glanz, sie lächelten, und das, woran sie dachten, schien sie für einen Augenblick zu irritieren. So als ob sie sich darüber wunderten, dass sie sich bei all den Momenten ihrer Jugend ausgerechnet an Alf erinnerten. Vielleicht war die Erkenntnis auch ein kleiner Schock: Alf ist Teil meiner Biographie, und er wird es immer bleiben.
Unsere Biographie setzt sich aus unseren Erinnerungen zusammen. Aus den Erinnerungen an all das, was war, was vergangen ist, was nicht wiederkommt, was wir nicht loswerden, was uns begleitet und geprägt hat, was wir vermissen und was wir bedauern, worüber wir lachen und uns ärgern und schämen – an all das, was wir waren. Und dadurch auch an all das, was wir heute sind.
Die prägenden Erinnerungen unseres Lebens – 87 davon sind in diesem Buch. Vom ersten Absturz bis Tschernobyl, von der Raucherecke bis zum rot-grünen Wahlsieg, vom Nike-Turnschuh bis Harald Schmidt. Die Erinnerungen sind so etwas wie Mosaiksteinchen, aus denen sich jeder sein eigenes Bild, sein eigenes Erinnerungsset zusammensetzen kann. Ein bisschen soll das Lesen dieses Buches so sein wie der Besuch einer Ausstellung, in einem Museum der Erinnerungen, in dem man sich die Exponate anschaut und beim Betrachten plötzlich an etwas denkt, das mit einem selbst, mit dem eigenen Leben zu tun hat. Es kann sein, dass man bestimmte Exponate vermisst. Aber dieses Vermissen, diese Lücken sind am Ende das, was jeder von uns mit seinen eigenen Erinnerungen füllen muss. Erinnerungen, die man teilt und aus denen prägende Momente unserer Autobiographie geworden sind.
Jeder erinnert sich an den Menschen, in den er verliebt war, als »Dirty Dancing« im Kino lief. Jeder erinnert sich an das, was das Lied »November Rain« von Guns N’ Roses in einem angerichtet hat, als es 1992 erschien – und was davon geblieben ist. Hat man die Liebe seines Lebens geküsst? War es der Grund tiefer Traurigkeit? Jeder erinnert sich daran, wie er zum ersten Mal »E.T.« gesehen hat; daran, dass Sophie Marceau einmal das Mädchen war, in das jeder Junge verliebt war; daran, dass man jemand anderes war, nachdem man seine erste Zigarette geraucht hat; daran, dass man dachte, der Musiksender MTV könne einem die Welt erklären; daran, als man glaubte, man müsse unbedingt nach New York ziehen …
All das, und noch so viel mehr, hat uns geprägt, prägt uns immer noch, denn unsere Erinnerungen sind unser Referenzrahmen, wir beziehen uns auf sie, ob wir wollen oder nicht. Erinnerungen erklären uns nicht nur, was uns geprägt hat und wo wir herkommen – sie zeigen uns vor allem, wer wir sind. Und diese Prägungen, die Erinnerungen, sind kollektiv, sie beziehen sich auf gemeinsam Erlebtes – auch wenn wir bei unserem ersten Liebeskummer alleine waren. Wir waren dabei nämlich alle allein.
In diesem Buch gibt es auch die Erinnerung an den ersten Kuss (Seite 77). Aber ist diese Erinnerung meine? Ist es die meines besten Freundes – jedenfalls so, wie er sie mir einmal erzählt hat? Oder ist die Erinnerung zusammengesetzt aus Kussszenen aus Filmen und meiner Vorstellung, wie ein erster Kuss verdammt nochmal zu sein hat? Was, wenn der erste Kuss mit zwölf beim Flaschendrehen stattfand und man ausgerechnet den hässlichsten Jungen oder das hässlichste Mädchen der Klasse küssen musste? Behält man diese Erinnerung für sich? Verdrängt man sie? Macht man den zweiten Kuss, der um so vieles schöner und besser war, zum ersten? Oder klaut man sich die Erinnerung an seinen ersten Kuss einfach aus einem Buch, einem Lied oder einem Film? Vermischt man sie mit anderen Erinnerungen – vielleicht mit Erinnerungen an den vierten und sechsten Kuss? Oder erfindet man einfach die Erinnerung, an die man sich gerne erinnern will?
Die Erinnerungen in diesem Buch sind nicht meine Erinnerungen. Es sind unsere. Und jeder von uns gibt den einzelnen Erinnerungen eine andere Bedeutung, einen anderen Akzent – wichtig aber sind sie in gewisser Weise für jeden von uns, denn es sind Erinnerungen an Momente, die uns geprägt haben und die mitgeschrieben haben an unserer Autobiographie. Wir sind nämlich nicht so verschieden, wie wir glauben. Wir sind nicht so besonders, so einzigartig, so speziell. Und das ist in dem Fall großartig, denn darin liegt ein riesiges, soziales Potential. All die geteilten, aber eben nicht deckungsgleichen Erinnerungen sind die Grundlagen für Gespräche, für kollektives Erinnern als gemeinschaftliche Erfahrung und vielleicht auch für eine berechtigte Form von Nostalgie. Für viele »Weißt-du-noch-Momente«.
Wir sind die Summe der Erfahrungen, aus denen unser Gedächtnis das macht, von dem wir glauben, dass es unsere Erinnerungen sind. Aber viele davon sind erfunden, erlogen, geklaut, geliehen, verzerrt. Vielleicht sogar die Erinnerungen, die immer wiederkommen, wie aus dem Nichts, überfallartig. Erinnerungen, gegen die wir uns nicht wehren können.
In diesem Buch geht es auch um die Erinnerungen an Musik. Natürlich werden sich viele an andere Lieder, Platten und Bands erinnern als an die, die in diesem Buch vorkommen. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Es geht vor allem darum, an welches Gefühl man sich erinnert, wenn man sich an bestimmte Lieder, Platten und Bands erinnert. Man kann das selbst ausprobieren, es funktioniert wie eine Zeitreise in ein früheres Ich: Wenn man sich heute die Musik anhört, die einem vor fünfzehn, zwanzig, dreißig Jahren die Welt bedeutet hat – was fühlt man dann? An was erinnert man sich? Sind die Gefühle die gleichen wie damals, wenn man sich erinnert?
Die Lieder, die mir damals die Welt bedeutet haben, dauerten meist drei Minuten, und zu Beginn haben sie einem das Herz gebrochen, und zum Schluss war es wieder neu zusammengesetzt. Die Lieder, die mich damals begleitet und meine Gefühle geprägt haben, kamen von The Smiths, von den Pixies, von den Stone Roses, aber vor allem von Prefab Sprout. Ich entdeckte die Band, als ich fünfzehn war, im Jahr 1990. Damals erschien »Jordan: The Comeback«, und alle Lieder auf dieser Platte waren makellos, perfekter Pop. Im Plattenladen schaute ich nach weiteren Platten von Prefab Sprout und fand eine, die hieß »Steve McQueen«, sie war aus dem Jahr 1985. Ich kaufte sie, fuhr nach Hause, legte mich auf den Fußboden und hörte mir »Steve McQueen« an. Nie zuvor hatte ich so eine schöne Musik gehört – und doch erinnerte ich mich beim ersten Hören an jedes einzelne Lied. Ich lag auf dem Boden meines Zimmers und erinnerte mich daran, wie ich die Musik schon einmal gehört hatte, ich war sieben oder acht Jahre alt, an einem Sonntagmorgen im Herbst. Ich war bereits aufgestanden, während alle anderen noch schliefen. Ich trug einen Frotteeschlafanzug, stand vor der Balkontür und sah hinaus. Die Wiesen und Felder, auf die ich blickte, lagen im Nebel, man sah keine Menschen, keine Autos, die ganze Welt war noch nicht wach, und ich war der Einzige, der diese Welt, diese neblige, große, wundervolle Welt sehen konnte. Diese Erkenntnis machte mich traurig, aber ich konnte nichts tun gegen diese Traurigkeit, ich blieb vor der Balkontür stehen und schaute hinaus.
Daran erinnerte ich mich, als ich »Steve McQueen« zum ersten Mal hörte. Und wenn ich »Steve McQueen« heute höre, dann erinnere ich mich daran, wie ich auf dem Fußboden meines Zimmers lag und mich daran erinnerte, wie ich vor der Balkontür stand. Und jemand singt: »Shaded feelings / I don’t believe you«.
Das Album »Steve McQueen« war wahrscheinlich schon eine Erinnerung, als es erschien. Die Melodien waren bereits im Gedächtnis, noch bevor man sie gehört hatte. Jedes Lied auf der Platte ist eine Erinnerung an eine Sehnsucht, die man niemals hatte.
Und das sind dann vielleicht die besten Erinnerungen. Einige davon stehen in diesem Buch. Die anderen sind in Ihrem Kopf. Vielleicht gleich neben Alf.
Matthias Kalle, Frühjahr 2017
Die Raucherecke
Manchmal findet man ausgerechnet da, wo andere nicht einmal suchen würden, nach den passenden Fragen zu den Antworten, die man schon hatte. Unsere Suche begann in der Raucherecke, eine nur scheinbar unwirtliche Gegend, nicht groß, nicht hübsch, nicht einladend. Und doch war die Raucherecke lange Sehnsuchtsort, zunächst unerreichbar – ein Ort, zu dem man aus naheliegenden Gründen keinen Zugang fand: Man war einfach nicht alt genug. Doch irgendwann war diese zehnte Klasse zu Ende, und dann, nach den Sommerferien, da wusste man, dass alles Vorherige nur ein Warmlaufen, eine Vorbereitung war. Nach den Sommerferien war es so weit: Die Lehrer mussten einen siezen, man konnte seine Fächer wählen und sogar die unnützen, unbrauchbaren für immer abwählen, denn was hatte Chemie für einen Sinn? Aber vor allem durfte man ab der elften Klasse rauchen. Öffentlich. Nicht heimlich hinter den Fahrradständern oder im Gebüsch neben dem Sportplatz. Man wurde automatisch Mitglied in einem Club, weil man einen Ort betreten durfte, der bis dahin tabu war: Die Raucherecke. Und wenn ein Ort ein Versprechen sein kann, dann war die Raucherecke das größte Versprechen von allen. Hier war man unter sich, hier hatten die Jüngeren nichts verloren, und die Lehrer interessierten sich schon aus Gesundheitsgründen nicht besonders für das, was in der Raucherecke passierte.
Und was da alles passierte! Im Grunde genommen ja nichts. Man stand da. Und rauchte. Manche rauchten zwar nicht, aber sie standen trotzdem in der Raucherecke, weil hier, nur hier, in den Pausen und in den Freistunden, das Leben besprochen und verhandelt wurde. In der ersten Pause am Montag fand die Abschlussbesprechung des Wochenendes statt – am Donnerstag begannen bereits die Planungen für das nächste. Dazwischen gab es genug Zeit und genug Ruhe, um einige Dinge zu klären und über andere Dinge zu spekulieren. Wer wird nicht verstanden haben, dass nicht Faust, sondern Mephisto die eigentlich tragische Figur bei Goethe ist? Wie heißt das Mädchen vom Ratsgymnasium, die eine Affäre mit ihrem Erdkundelehrer haben soll? Warum haben eigentlich immer Erdkundelehrer Affären mit ihren Schülerinnen? Woher bekommt man eigentlich diese Streifen-Shirts, die Kurt Cobain immer trägt? Hat Basti Samstagabend wirklich eine ganze Flasche Sauren Apfel alleine getrunken? Wer hat die Mathehausaufgaben? Wird das Leben zu uns später gut oder schlecht sein? Werden wir die nächste Doppelstunde überleben? Warum sind die anstrengendsten Mädchen ausgerechnet die, mit denen man zusammen sein möchte?
Das Rauchen spielte in der Raucherecke keine entscheidende Rolle. Manche rauchten, manche nicht – so einfach war das. Anderes war komplizierter: Da die Raucherecke der gesellschaftliche Mittelpunkt der Oberstufe war, entschied sich hier zum Beispiel, wer Schülersprecher werden würde. Konnten die Besucher der Raucherecke mit einem Kandidaten leben, stiegen seine Chancen. Seit jeher gilt der Grundsatz: Hatte man die Raucherecke, hatte man auch den Rest der Schule. In der Raucherecke wurde Politik gemacht, Karrieren erschaffen und Existenzen vernichtet. Und hier war auch der Platz für Sätze mit Fragezeichen, für Spekulationen, für Träume und für Hoffnungen. Was immer auch gedacht wurde: In der Raucherecke wurde es zuerst gedacht.
Tschernobyl
Eigentlich kann kein Mensch mehr wissen, was er am 26. April 1986 gemacht hat. Was war das überhaupt für ein Tag? Der 26. April 1986 war ein Samstag. Und es war der letzte Spieltag der Bundesligasaison 1985/1986, jene Saison, in der Bayern München 33 Spieltage lang nicht ein einziges Mal Tabellenführer war. Aber weil an diesem 26. April 1986 um kurz nach 17 Uhr Werder Bremen sein Spiel verlor, wurde Bayern München doch noch Deutscher Meister. Die Bilder davon liefen dann in der Sportschau, in den Nachrichten, und am Abend kam seltsamerweise nicht »Wetten, dass…?« im Fernsehen.
Im Radio spielten sie in diesen Tagen sehr oft die Nummer eins der deutschen Charts, das Lied »Geil« von Bruce und Bongo, aber der aufregendste Popstar war natürlich Madonna. Doch auch sie konnte nichts daran ändern, dass es etwas langweilig war, im April 1986, wahrscheinlich auch an jenem Samstag, dem 26. April, an den sich kein Mensch mehr erinnern kann.
Am Montagabend, es war der 28. April, schickte die Deutsche Presseagentur eine Eilmeldung in die Redaktionen. In einem Atomkraftwerk in Tschernobyl, irgendwo in der Sowjetunion, habe es einen Unfall gegeben, ein Reaktor sei beschädigt worden, man habe Maßnahmen zur Beseitigung der Havarie ergriffen. Aber erst einen Tag später, Dienstag, 29. April, war da plötzlich dieses Wort: Katastrophe. Es gab zunächst nur dieses Wort. Die Tagesschausprecherin sagte, es sei in Tschernobyl offenbar zu dem »gefürchteten Gau gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall«. Das war alles, keine Fotos, nichts. Am 30. April zeigte die Tagesschau ein Foto des Unglücksorts, das zuvor im sowjetischen Fernsehen gezeigt worden war – stark retuschiert, man sah im Grunde nur ein Atomkraftwerk. In den folgenden Tagen wurden Satelliten über Tschernobyl gelenkt, die Bilder, die sie schickten, waren schlecht, ungenau, Experten versuchten sie zu deuten, aber immer noch wusste niemand, was eigentlich passiert war. Aber alle wussten, dass es sich um eine Katastrophe handelte.
Katastrophe. Dieses Wort war plötzlich in der Welt, und zwar nicht als Theorie oder als eine gruselige Was-wäre-wenn-Geschichte. Sondern als Wirklichkeit. Denn es war tatsächlich eine Katastrophe, und für alle, die nach dem Krieg geboren wurden, war es die erste Katastrophe in ihrem Leben. Aber sie war nicht groß und grausam – sie war klein und ungreifbar. Im Fernsehen sah man vor allem alte, dicke Männer mit riesigen Brillen, die umständlich erklärten, dass keinerlei Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Tatsächlich hatte man sich eine Katastrophe etwas anders vorgestellt. Sie war seltsam langweilig – aber in dieser Langeweile lag ihre besondere Bedrohung. Wenn wir in jenen Tagen vor die Tür traten, dann sah die Welt noch genauso aus wie vor dem 26. April 1986. Es gab keinen großen Knall, niemand sah einen Atompilz am Horizont, Sirenen heulten nicht, die Menschen gingen zur Arbeit. Wenn es eine Hysterie gab, dann war sie leise und lief in geordneten Bahnen ab. Die erste Katastrophe unseres Leben wurde zum Teil des Sachkundeunterrichts: mit Zahlen und Fakten und Vorschriften wurde die Katastrophe verwaltet. Vor allem aber wurde sie begriffen und runtergerechnet auf das eigene Handeln – dass wir heute unseren Müll trennen, ist eine direkte Folge des Super-GAUs von Tschernobyl. Denn das, was am 26. April passierte, war nicht nur eine Katastrophe, sondern auch ein Höhepunkt in der Diskussion um den Umwelt- und Naturschutz. Tschernobyl passierte in einer Zeit, in der man über sauren Regen sprach und über das Waldsterben und in der die Grünen plötzlich im Bundestag saßen. Und wir? Wir bestellten bei Greenpeace diesen Aufkleber mit der Weissagung der Cree: »Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.« Dass dieser Satz so niemals von einem Indianerhäuptling gesagt wurde, erfuhren wir erst später, aber da hatte er seine Wirkung bereits getan. Dass wir heute Bionade trinken und uns vegan ernähren, ist in gewisser Weise auch eine Folge von Tschernobyl.
Tschernobyl war eine Katastrophe ohne Bilder, ohne Erklärungen. Etwas Schlimmes war passiert – und im Fernsehen sprachen sie über Pilze, über Trüffel, über Gemüse, darüber, was man noch essen kann, was man in fünf oder in zehn Jahren noch nicht wieder essen darf. Experten erklärten Windbewegungen, Kühe sollten zunächst nicht mehr auf die Weide, Spielplätze durften nicht mehr betreten werden, Schwimmbäder wurden geschlossen, und es gab »zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Bevölkerung«, wie es Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble in einer Pressekonferenz erklärte. Und Wolf Maahn sang »Ohohhoo Tschernobyl / das letzte Signal vor dem Overkill / he, he, stoppt die AKWs«.
Man konnte die Katastrophe nicht sehen, nicht greifen – man konnte sie auch nicht jagen oder bekämpfen. Die Katastrophe war ein Geist, ein Nebel. Sie war Regen, und vor allem war sie ein Gefühl, das uns durch die achtziger Jahre begleitete. Die Katastrophe war eine diffuse Angst vor dem Untergang, und für den Untergang würde das Atom sorgen. Entweder als Atomkrieg oder als kaputtes Atomkraftwerk, denn Tschernobyl machte ja klar, dass kein Mensch mehr auf einen roten Knopf drücken musste, um die Katastrophe einzuleiten. Der Feind war vielmehr Dummheit und Unvermögen, und das war nicht in den Griff zu kriegen. Die Katastrophe bekam mit Tschernobyl nur einen anderen Namen. Und irgendwann verschwand die Angst – vielleicht, weil sie nie wirklich da war, weil sie zu abstrakt war.
Der erste Super-GAU der Geschichte, der größte anzunehmende Unfall. Und wir spielten Fußball im Regen.
Kurt Cobain
Als mich Björn am 8. April 1994 morgens mit seinem klapprigen Renault 4 zur Schule abholte, hörten wir in den Nachrichten, dass Kurt Cobain tot sei. Er habe sich erschossen, mit einer Schrotflinte, es hieß, er habe den Lauf an seinen Kopf gehalten und dann abgedrückt. Cobain, so sagte es der Nachrichtensprecher, war der Sänger der weltweit erfolgreichen Rockband Nirvana.
Björn fuhr seinen Wagen an den Seitenstreifen und hielt an. Er fummelte in der Brusttasche seines Holzfällerhemdes nach einer Zigarette, zündete sie an und nahm einen ersten tiefen Zug. Dann sagte er »Scheiße«. Ich starrte aufs Radio, so als ob ich erwarten würde, dass da noch etwas kommt, eine Korrektur vielleicht, ein Hinweis, dass man sich geirrt habe, Cobain sei gar nicht tot, er habe danebengeschossen. Es kam aber nur das Wetter, dann die Verkehrsmeldungen, und danach spielten sie »Smells Like Teen Spirit«. Björn schmiss die Zigarette aus dem Autofenster und fuhr weiter.
Er parkte den Wagen auf dem Lehrerparkplatz, obwohl das für Schüler verboten war, aber wir hatten nur noch wenige Tage bis zum Abitur, deshalb war es egal, denn was sollte passieren? Wir gingen schweigend über den Vorplatz der Schule, durch das Tor, durch die Aula auf die andere Seite des Gebäudes, öffneten die Tür zum Schulhof und bogen nach rechts in die Raucherecke. Einer fragte, ob wir es schon gehört hätten, und wir nickten. Dann rauchten wir, niemand sagte ein Wort.
Im Geschichtsunterricht erzählte uns der Lehrer, wie das vor 14 Jahren gewesen war, als John Lennon erschossen wurde, wie damals die Welt plötzlich stillstand. Weil man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass jemand auch nur auf die Idee kommen würde, John Lennon zu erschießen. Der Lehrer redete dann noch sehr viel über John Lennon und über seine Verdienste für die Musik, für den Frieden, für die Gleichberechtigung, für eine bessere Gesellschaft. Was er nicht sagte, aber meinte: Das war ein großer Verlust – im Vergleich zu Kurt Cobain.
Hatte unser Lehrer womöglich recht? Als Cobain sich erschoss, war der Mann gerade mal zweieinhalb Jahre in unserem Leben. Im Herbst 1991 gab es plötzlich dieses Lied, das Lied, sein Lied, unser Lied. »Smells Like Teen Spirit« kam wie eine Faust aus dem Nichts und traf uns mit voller Wucht. Erst in den Magen, dann an den Kopf, dann ins Herz. Das Lied war Schmerz und Wut und Freude, und wenn wir es hörten, dann konnten wir unser Glück nicht fassen, dass es da jetzt ein Lied gab, das scheinbar nur für uns geschrieben wurde. Ein Lied, das uns verstand, das uns verband – und das wir überall hören konnten. »Smells Like Teen Spirit« lief im Radio, auf MTV, bei uns zu Hause und in der Disco, in die wir damals gingen. Und wenn der DJ das Lied spielte, dann war es immer ein bisschen so, als würde es alle Ketten sprengen, denn mit den ersten Takten stürmten selbst die auf die Tanzfläche, die sonst lieber an der Bar saßen und Bier tranken. Das Lied befreite die Traurigen und die Schüchternen – sie wurden für vier Minuten zu Jugendlichen, die die ganze Welt verfluchten. Es waren vier Minuten, in denen alles möglich war: Man konnte tanzen und schreien und springen und man konnte jemanden festhalten und küssen und man konnte mit geschlossenen Augen auf der Tanzfläche stehen und hoffen, dass dieser Moment ewig dauern würde.
Wir kauften das Album »Nevermind«, und natürlich war das toll, großartig, »Come As You Are« war ein sehr gutes Lied, »In Bloom« und »Lithium« auch, aber nichts auf der Platte kam auch nur annährend an »Smells Like Teen Spirit« heran. Darüber waren wir ein bisschen enttäuscht, aber das sagten wir nicht, das behielten wir für uns. Und wir hörten in dieser Zeit auch das Album »Ten« von Pearl Jam, wir mochten die Hits »Alive« und »Jeremy«, und wir fanden »Plush« von den Stone Temple Pilots ganz gut, aber all das konnte nicht das Versprechen einlösen, das uns Kurt Cobain mit »Smells Like Teen Spirit« gab.
Es war aber nicht nur dieses Lied, es war so viel mehr. Wir kauften uns weiße Chucks und eine Levis 501, und wir bearbeiteten die Schuhe und die Hose, bis sie aussahen, als würden wir seit einer Ewigkeit nichts anderes tragen. Deshalb konnten wir uns selbst die Lüge erzählen, dass Kurt Cobain der erste Popstar war, der aussah wie wir. Denn er war natürlich nicht nur ein Popstar, er war der ältere, smartere Bruder, den wir nie hatten. Der stellvertretend für uns bereits alles erlitten und alles erlebt hatte. Und der für uns daran zerbrochen war, so dass wir nicht mehr daran zerbrechen mussten.
Dann erschien 1993 das Nirvana-Album »In Utero«, das uns komplett verstörte. Es gab Gerüchte darüber, dass es Kurt Cobain nicht gutginge, Drogen, Courtney Love, solche Sachen. Bei einem MTV-Unplugged-Konzert im Herbst 1993 sah er dann nicht mehr aus wie ein Rockstar, sondern wie ein Weichei, verzweifelt, traurig. In diesem Moment war er uns vielleicht zu nah gekommen, als das wir noch zu ihm aufsehen konnten.
Das Letzte, was man mitbekam, waren dann Meldungen über Konzertabsagen und Krankenhausaufenthalte und schließlich die Nachricht über seinen Selbstmord. In den Tagen danach gab es widersprüchliche Meldungen, Wahrheiten, Spekulationen über das, was da eigentlich passiert sei. Cobain soll voll gewesen sein mit Heroin, außerdem habe er einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er aus einem Lied von Neil Young zitiert: »Es ist besser auszubrennen, als zu verblassen.«
Aber stimmte das überhaupt? Uns hatte Cobain doch eine andere Erkenntnis geschenkt, eine, an die er sich vielleicht selber nicht erinnern konnte, obwohl sie doch bis heute Sinn macht: Mit gelöschtem Licht ist es weniger gefährlich.
Die Europa-Kassetten
Ich liege auf dem Teppich und höre Karius & Baktus und bekomme so eine Panik, dass ich auf die Pausetaste drücke und mir schnell die Zähne putzen gehe, freiwillig, fünf Minuten lang.
Ich versuche alle Abenteuer von Flash Gordon hintereinander zu hören, denn Gordon ist nicht nur stark, sondern auch witzig, und zu keinem Zeitpunkt bricht er unter der Last, das gesamte Universum vor dem Imperator Ming zu retten, zusammen.
Ich bin mit den »5 Freunden« irgendwo in England und wundere mich ein bisschen darüber, dass die Stimme des Erzählers die gleiche Stimme ist wie die von Flash Gordon.
Ich verstehe nicht so ganz, warum Tarzan und Klößchen in einem Internat leben, außerdem mag ich das Lied, das zu Beginn der TKKG-Abenteuer gespielt wird, nicht besonders, weil die Kinder darin eher schreien als singen. Den Spitznamen »Pfote« für Gaby finde ich ein bisschen albern.
Ich finde die »Drei ???« doof, ich kann mit denen nicht so wahnsinnig viel anfangen, dafür mag ich die Stimme des Erzählers bei »Hui Buh«.
Ich brauche unbedingt so ein Walkie-Talkie-Gerät, wie es die Helden bei den »Funk-Füchsen« benutzen.
Die Nachmittage mit meinem Kassettenrekorder, er ist rot, daneben ein kleiner Koffer, den ich mir extra gewünscht habe, voll mit den Kassetten der Firma »Europa«. Die Bilder in meinem Kopf, die Ahnungen davon, wie es weitergehen könnte, wenn eine Folge zu Ende ist. Der Regen, der an die Fensterscheibe schlägt, die Tasse mit dem Kakao auf dem Boden. Die Hoffnung, dass das Leben eventuell auch für mich Abenteuer bereithält und dass Dinge wie Mut und Freundschaft wirklich existieren.
Die Europa-Jahre, die irgendwann einfach zu Ende gehen. Weil der Kassettenrekorder eine andere Aufgabe bekam, weil es andere Kassetten gab, Kassetten mit Musik, die andere Geschichten erzählten, Geschichten, die wichtiger wurden als die, die von Mut und Abenteuer und Freundschaft erzählten. Obwohl – eigentlich blieben die Geschichten die gleichen, sie hörten sich nur anders an.
Willst du mit mir gehen?
Über die tiefere Bedeutung dieser Frage machten wir uns keine Gedanken. Es gab ja schlichtweg keine andere Möglichkeit, um herauszufinden, ob man für die nächsten zwei, drei Wochen der Freund oder die Freundin von jemandem war. Wie sollte man das auch anders feststellen?
Als wir jünger waren, brachte uns ein Kinderspiel einen Dreischritt bei: verliebt – verlobt – verheiratet. Das waren die akzeptierten Beziehungsformen (das etwas »kompliziert« sein könnte – das eigentlich alles immer kompliziert ist, das wussten wir damals ja noch nicht). Heiraten konnten nur Erwachsene, sich verloben auch, denn das machte man ja kurz bevor man heiratete. Aber wenn man verliebt war – was machte man dann? Und abgesehen davon gab es ja auch noch verknallt – das war nicht so heftig wie verliebt. Verknallt war man öfter.
Es gab irgendwann in unserer Klasse die sogenannten Top-Ten-Listen. Darauf notierte man – von Platz 10 bis Platz 1 – die, für die man schwärmte (Schwarm war auch so ein Wort, das nur im Leben von Zwölfjährigen existierte). Man schrieb diese Listen auf kleine Zettel, die während des Unterrichts unter den Tischen die Runde machten. Der gängige Trick bei diesen Listen bestand darin, dass es keinen Platz 1 gab – ein sicheres Indiz dafür, dass man zwar verknallt war (in Platz 2 und ein bisschen auch in Platz 3), aber nicht verliebt. Mit jemandem gehen konnte man selbstverständlich auch, wenn man nur verknallt war, aber man musste sich beeilen, Top-Ten-Listen änderten sich ständig.
Es konnte also passieren, dass man die Frage »Willst du mit mir gehen?« zu spät stellte. Zu spät konnte bedeuten: zwei Tage zu spät. Zwei Tage, in denen man von Platz 2 auf Platz 5 gerutscht war, weil man einen schlechten Tag beim Völkerball erwischt hatte. Das war dann ärgerlich, aber nicht zu ändern. Noch ärgerlicher aber war es, wenn man selbst gefragt wurde, und man diese Frage nur mit einem »Bist du bescheuert?« beantworten konnte.
Es kam auch vor, dass man nicht selber gefragt, sondern jemanden geschickt hat, der die Frage stellen sollte. Das dauerte dann zwar immer ein bisschen länger, dafür machte man sich aber nicht zum Trottel. Auf diese Weise ging ich mit 13 Jahren mit zwei Mädchen, mit denen ich in der Zeit unserer Beziehung überhaupt nicht geredet habe. Zwei Tage später kam dann auch meistens die beste Freundin und machte Schluss.
Und irgendwann gab es diese Frage nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in unserem Leben.
Miami Vice
Meine Mutter war ein bisschen verliebt in Lieutenant Castillo, den Chef von Sonny Crockett und Ricardo Tubbs. Castillo wirkte immer so, als würde er die Last und die Schmerzen des Lebens gerade noch so ertragen können. Er sprach nicht viel, traf immer die richtigen Entscheidungen, war streng und schien bereits viel Schlimmes hinter sich zu haben. Castillo trug immer Schwarz, und in seinem Büro wurde es nie hell.
Damals habe ich nicht verstanden, was meine Mutter an ihm fand – er war das absolute Gegenteil von allem anderen in dieser Serie, die uns 1986 das erste Mal eine Ahnung davon gab, was dieses Wort »cool« eigentlich bedeuten könnte. Cool fanden wir natürlich Sonny Crockett, der mit einem Alligator auf einem Schiff lebte und so rumlief, wie man aus Sicht eines Zwölfjährigen als Erwachsener gerne rumlaufen würde: Die Sakkos wirkten lässig, er trug immer T-Shirts mit einer Knopfleiste (die man zunächst nirgendwo kaufen konnte, dann aber überall) und Schuhe, die wir nie zuvor gesehen hatten (auch diese Espadrilles schmissen sie einem irgendwann hinterher). Crockett fuhr irre Autos und hatte einen aufregenden Job.
Aber der entscheidende Unterschied zwischen »Miami Vice« und den Serien, die wir vor »Miami Vice« geschaut haben, war ein anderer (früher interessierte uns weder der Stil einer Serie noch die Tatsache, dass der Held eine Ray-Ban-Sonnenbrille trug): Die Dinge, die die Helden erlebten, änderten sie. Sie trugen Narben, Wunden davon – sie waren für uns sichtbar, denn wir hatten zuvor noch keine Serien gesehen, in denen es so viel Zeitlupen gab (kannten wir nur von Fußballübertragungen) und in denen die Kamera den Menschen so nahe kam (kannten wir überhaupt nicht). Und deshalb bleibt immer diese eine Szene, wenn ich mich an »Miami Vice« erinnere: Sonny Crockett steht am Strand, alles ist in Zeitlupe, sein Gesicht voller Schmerz, ein Synthesizer spielt eine traurige Melodie, etwas ist schiefgegangen, zerbrochen, vorbei. Und das Leben eines Polizisten ist die Einsamkeit, da kann alles drum herum noch so toll aussehen.