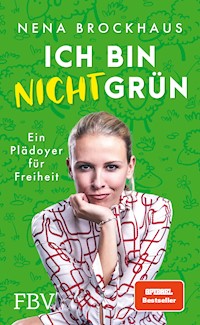17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gräfe und Unzer Edition
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Tugenden wie Leistungswille, Opferbereitschaft und Disziplin scheinen auf dem Rückzug. Die Personifizierung dieser Werte hat es hart erwischt: den alten weißen Mann. Während dieser um seinen Platz in der Gesellschaft kämpft, steht zeitgleich der Wohlstand des Landes und der Zusammenhalt auf der Kippe. Zufall? Oder die Folgeerscheinung einer Gesellschaft, die sich in Identitätsdebatten stürzt und den Blick für das Wesentliche verloren hat? Ob im Biergarten mit dem ehemaligen Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber, in Ascona mit Top-Manager Wolfgang Reitzle oder bei Weltstar Mario Adorf zu Hause – die Journalistinnen Franca Lehfeldt und Nena Brockhaus machen sich auf die Suche nach den Antworten der alten weisen Männer auf die drängenden Fragen der Gegenwart. Und sie hören aufmerksam zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
Gräfe und Unzer Edition ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Franziska Daub
Lektorat: Silke Panten
Bildredaktion: Simone Hoffmann
Covergestaltung: ki36 Editorial Design, München, Daniela Hofner
eBook-Herstellung: Pia Schwarzmann
ISBN 978-3-8338-8957-8
1. Auflage 2023
Bildnachweis
Coverabbildung: GU/Luca Geselle
Fotos: GU/James Zabel; Getty Images; iStockphoto; Anne Gabriel-Jürgens/13PHOTO; picture alliance/dpa
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-8957 03_2023_01
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
EIN ALTER WEISSER MANN ZU SEIN, ist in der Gesellschaft längst kein Gütesiegel mehr. Während ihm zu oft das Wort entzogen wird, sind sich die Journalistinnen Franca Lehfeldt und Nena Brockhaus einig, dass ein Umdenken stattfinden muss. Denn es sind auch diese Männer, die unser Land aufgebaut und am Laufen gehalten haben. Ihre Werte und Erfahrungen bieten einen Kompass in herausfordernden Zeiten.
Ob im Biergarten mit Ausnahmepolitiker Edmund Stoiber, in Ascona mit Topmanager Wolfgang Reitzle oder bei Weltstar Mario Adorf zu Hause – die zwei jungen Frauen machen sich auf die Suche nach dem Erfolgsrezept für ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander. Und sie hören aufmerksam zu.
In zehn Gesprächen portraitieren sie Männer einer Generation, die anders ist, als der Mainstream glauben macht. Die Autorinnen haben es geschafft, dass sich die alten weisen Männer öffnen und eine Seite zeigen, die sonst verborgen bleibt. Das macht dieses Buch zu einem echten Charakterstück.
Alte weise Männer ist eine Liebeserklärung – an Erfahrung, Leistung und Meinungsfreiheit.
Für Thomas Schink, der mit seinen jugendlichen 61 Jahren leider zu jung für dieses Buch ist, doch in zehn Jahren der weiseste von allen sein wird.
Nichts auf der Welt erfüllt mich mit mehr Stolz, als deine Tochter zu sein.
Du wirst so sehr geliebt.
Deine Nena
Für Papi von Karla!
Einleitung
Wenn eine Freundschaft entsteht, schwingt stets Magie mit. Bedarf doch der Wandel von Fremden zu Freunden verschiedenster Zutaten: Vertrauen, Loyalität, Gemeinsamkeiten. In unserem Fall verbindet uns die Liebe zu »alten weißen Männern«. Auch wenn wir sie lieber als alte weise Männer bezeichnen. Es ist uns Beruf, Berufung und Vergnügen zugleich, uns vom »feministischen Feindbild« die Welt erklären zu lassen. Doch damit nicht genug, unsere Sympathie für alte weise Männer ist zugleich biografisch begründet. Die Medienbranche als Haifischbecken zu bezeichnen, ist weder übertrieben noch anklagend. Es ist Fakt. Wer in diesem Becken Schwimmen lernen möchte, braucht neben Engagement auch Förderer und Verbündete, sonst geht er unter.
Im Angesicht des Zeitgeistes müsste »frau« meinen, dass die progressive Medienwelt mit gutem Beispiel vorangeht und Frauen sich gegenseitig Räuberleitern bauen, um den nächsten Karriereschritt zu erreichen. Männer leben diese Kultur seit jeher. Noch zu viele Frauen der Gegenwart sind jedoch unentschlossen. Gemeinsam auf Veranstaltungen posieren, in den sozialen Netzwerken Herzchen hinterlassen und mit dem Slogan »Empowerment« Geld verdienen? Immer gerne. Wenn es jedoch hart auf hart kommt und eine andere Frau zur potenziellen Wettbewerberin wird, stellt sich die Realität nicht selten anders dar. Schnell verwandelt sich die vermeintliche weibliche Loyalität in eine Melange aus Vergleich, Neid und Intrige. Natürlich gibt es die großartigen Chefinnen und Kolleginnen, die fordern und fördern. Sie sind jedoch unserer Erfahrung nach leider die Minderheit.
Anders verhält es sich mit den alten weisen Männern, denen wir begegnet sind. Vom feministischen Zeitgeist abgestraft und in die Ecke gestellt, wirken sie zuweilen scheu, wenn eine Frau nach Rat oder konstruktiver Kritik fragt. Bis der alte weise Mann Vertrauen fasst und eine Verbündete im Geiste identifiziert, kann es einige Zeit dauern. Doch wenn eine Frau seine Freundschaft gewinnt, ist ihr seine Unterstützung gewiss. Auf unterschiedliche Weise und innerhalb verschiedener Karrierestufen haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein alter weiser Mann als Mentor ehrlicher und konstruktiver ist als manche Frauen, die sich als Freundinnen, Schwestern oder Team bezeichnen. Alte weise Männer haben in unseren Karrieren bis dato entscheidende Rollen gespielt; ohne sie wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir sind kein Einzelfall. Als Architekten weiblicher Karrieren haben sie vielen Frauen Brücken gebaut, wo sonst nur eine Sackgasse oder gar ein Abgrund gewesen wäre.
Gleichzeitig faszinieren uns die alten weisen Männer, weil sie aus einer Welt stammen, in der wir beide nur allzu gerne leben würden. Einer Welt ohne Genderstern, ohne Twitter-Shitstorm und ohne belehrenden Zeigefinger. Die Männer, die wir für dieses Buch interviewen durften, waren in einer Zeit erfolgreich, in der Leistung zählte, kein Woke-Washing herrschte und die Rolling Stones noch »She Was Hot« ohne gesellschaftliche Debatte singen konnten. Wir sprechen von einer Zeit, bevor der hypermoralisierende Zeitgeist über das Land rollte. Die Modernisierungen der vergangenen Jahrzehnte haben manchen Muff vertrieben, aber auch einen Preis gefordert. Denn Tugenden wie Leistungswille, Opferbereitschaft, Pflichterfüllung und Disziplin scheinen auf dem Rückzug. Die Personifizierung dieser Werte hat es hart erwischt: den alten weißen Mann. Er wurde in den letzten Jahren zunehmend zum gesellschaftlichen Auslaufmodell stilisiert. Die Rede ist hier von übereifrigen Feministinnen, die in der Gesellschaft hysterisch Stempel verteilen – ohne zu hinterfragen, ohne sich Zeit zu nehmen, ohne zuzuhören. Generell halten wir den in Deutschland vorherrschenden Geschlechterkampf für überhitzt, und es fehlt uns in den Reihen unserer Generation an Demut: Demut vor Erfahrung. Demut vor dem Alter. Demut vor Lebensleistung. Denn es sind die alten weisen Männer, die unser Land am Laufen gehalten haben. Während ebendiese Männer um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen, stehen zeitgleich der Wohlstand des Landes und sein Zusammenhalt auf der Kippe.
Wir fragen uns: Ist das Zufall? Oder ist es die Folgeerscheinung einer Gesellschaft, die von einer Viertagewoche träumt, sich in Identitätsdebatten stürzt, Diversität wichtiger als Leistung nimmt, traditionelle Lebensentwürfe mitunter verachtet und den Blick für das Wesentliche verloren hat? Während den alten weißen Männern gesellschaftlich zu oft das Wort entzogen wird, sind wir uns sicher, dass ein Umdenken stattfinden muss. Gerade jetzt müssen wir uns von ihnen die Welt erklären lassen. Denn die alten Männer sind weise. Ihre Werte und ihre Erfahrungen bieten einen Kompass in unübersichtlichen Zeiten. Sie wissen, was geht und was nicht. Und zumeist zeigen sie mehr Horizont, Toleranz und Humor als ihre »Gegner*innen«.
Mit diesem Buch treten wir an diese Männer heran und hören ihnen zu. Tauchen Sie mit uns ein in die Lebensweisheiten der alten weisen Männer. Hören Sie auf ihre Botschaften, bleiben Sie dran, wenn Irrtümer, Sackgassen und Niederlagen bekannt werden und Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart erfolgen.
Ihre
Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt
Der alte weiße Mann – eine Begriffserklärung
Wer ist eigentlich dieser alte weiße Mann? Wer hat ihn erfunden? Und wie konnte aus einer Beschreibung eine Beschimpfung werden? Wir fragen nach bei FOCUS-Kolumnist Jan Fleischhauer, dem die Autorin Sophie Passmann attestierte, ein alter weißer Mann zu sein. Wie geht es ihm mit dieser gesellschaftlichen Schublade? »Hier widerspreche ich direkt: Die Gesellschaft steckt mich überhaupt nicht in diese Schublade«, erklärt Fleischhauer im Zoom-Call. »Wenn jemand versucht, mich in diese Schublade zu stecken, sind das Leute, die sich davon im Meinungskampf einen Vorteil erhoffen, indem sie mir so ein Label verpassen. Nach dem Motto: Sei mal ganz still, jetzt kommen wir.« Er fährt fort: »Die Frage ist ja, inwieweit ›alter weißer Mann‹ überhaupt an das Geschlecht gebunden ist. So, wie ich Frau Passmann verstanden habe, bekommt das Label, wer besonders verstockt ist oder sich auf dem Erreichten ausruht. Es können also auch Frauen alte weiße Männer sein.«
In ihrem Buch Alte weiße Männer interviewte die Feministin Passmann Männer wie den 45-jährigen Entertainer Micky Beisenherz oder den damals 29-jährigen SPD-Politiker Kevin Kühnert. Biologisch waren ihre Interviewpartner in der großen Mehrheit höchstens mittelalte Männer. Die Konversationen drehten sich darum, über alte weiße Männer zu sprechen, aber nicht darum, mit ihnen zu reden. Letzten Endes wird deutlich, dass für Passmann eben jeder Mensch ein alter weißer Mann sein kann.
Das Konzept »alter weißer Mann« wäre schließlich kein paradoxes Wunderwerk der Identitätspolitik, wenn sie nicht auch das andere Geschlecht miteinschließen würde.
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezeichnete Passmann den US-amerikanischen Spitzenpolitiker Bernie Sanders mit seinen 77 Jahren beispielsweise nicht als alten weißen Mann, den 50-jährigen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hingegen schon. Der soll bereits als Schüler ein solcher gewesen sein.1 Wir fragen uns: Wer denkt bei dem Begriff alter weißer Mann an einen Schüler? Oder an eine Frau? Und was ist falsch daran, auf Erreichtes stolz zu sein?
Die Realität ist, dass Feministinnen den alten weißen Mann vehement für ihren Geschlechterkampf missbrauchen. Spätestens seit dem Aufkommen der MeToo-Bewegung ist die gesellschaftliche Lage eindeutig: Der alte weiße Mann ist schuld. Den alten weißen Mann zu beleidigen, klickt eben auch besser, als sachlich für Frauenpensionen zu werben, oder wie Der Standard schrieb: »Bei Frauenpensionen und Arbeitsmarktpolitik für Frauen kracht es nicht, diese Themen interessieren auch heute niemanden. Wenn feministische Themen vor allem dann interessieren, wenn sie undifferenziert und polemisch verpackt werden, bedeutet das Alarmstufe Rot: Feminismus darf nicht zum Clickbait verkommen.«2
Nicht nur Feministinnen wie Passmann, auch Nachrichtenmagazine wie der Spiegel haben eingestimmt in den Abgesang auf den alten weißen Mann. Im Juli 2021 zierte das Spiegel-Cover die Zeichnung der Büste eines alten Mannes, die vom Sockel gestürzt wird. Die Aufschrift: »Aufstand gegen den alten weißen Mann«.3
Generell ist das Thema angesagt in Deutschlands Redaktionen. Da fragt sich auch schon mal ein Redakteur selbstkritisch, ob er nicht vielleicht selbst ein alter weißer Mann sei, und erklärt zunächst einmal die soziale Stellung des Feindbildes: »Doch nicht nur ihre Fassade, auch ihre Reputation bröckelt. Wer heute in diesem Land ein Mann um die fünfzig ist, der sieht sich zu hoher Wahrscheinlichkeit mit einem schier unausweichlichen Schicksal konfrontiert. Er ist im Begriff, zu jener Klischeefigur zu werden, die für die progressiven Teile der Bevölkerung das Feindbild Nummer eins darstellt, und zwar zum alten weißen Mann.«4 Für den Redakteur im Ressort Leben scheint dieser Vorgang verständlich: »Vielleicht ist es ausgleichende Gerechtigkeit.«
Wir halten fest: Wer progressiv sein will, also mit der Zeit geht, muss gegen den alten weißen Mann sein.
Wenig erstaunlich, dass sich der Journalist Thomas Tuma bei all der Aufregung über den alten weißen Mann bereits im März 2019 ironisch im Handelsblatt gefragt hat: »Was tun mit all den alten weißen Männern? Das Wahlrecht aberkennen? In Umerziehungslager sperren? Über eine Klippe stoßen?«5
Doch wann begann eigentlich diese Überdrehung?
Der Ursprung des Begriffs »alter weißer Mann« ist schwer zu finden. In der Schweizer Mediendatenbank taucht der Begriff bereits in den 1990er-Jahren auf. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt: »Der Amerika-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Facts schrieb damals, die Feministin Betty Friedan habe die Republikaner als einen ›Haufen dreckiger, alter weißer Männer‹ bezeichnet, weil diese ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Clinton vorantrieben.«6
Sie soll allerdings nicht die erste Person gewesen sein. Wie die NZZ beschreibt, sagte ein schwarzer Konzertbesucher in Georgia 1990 einem Reporter über das Verbot von anstößigen Rap-Texten: »Ich habe es satt, dass alte weiße Männer den Schwarzen vorschreiben, was sie tun dürfen.«7
Warum dient »alter weißer Mann« bloß als Beschimpfung, obwohl es doch vielmehr eine Beschreibung ist? Fleischhauer erklärt: »Die Wahrheit ist doch, dass man umso mehr mit seinem Alter hadert, je älter man ist. Wir Männer reden da nicht so gern drüber, aber nichts fürchtet ein Mann mehr, als irgendwie als alt und abgehängt zu gelten. Deshalb funktioniert das auch als politisches Schreckgespenst so gut. Sie müssen das einem Mann nur entgegenschleudern und er wird alles tun, um Ihnen zu zeigen, dass sie falschliegen.«
Ob jede gesellschaftliche Debatte ein Feindbild braucht? Da ist sich Jan Fleischhauer unsicher: »Wenn man eine politische Mission hat, ist es sicher hilfreich, ein Feindbild zu haben. Das bringt einen morgens in Wallung. Gegen irgendetwas muss man anrennen, sonst kann man ja gleich liegen bleiben. Brauchen wir als Gesellschaft Feindbilder? Da bin ich wiederum im Zweifel.«
Auch wir sind davon überzeugt, dass es für gesellschaftliche Veränderungen keine Feindbilder braucht. Schon gar nicht gelebte Altersdiskriminierung.
Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte haben viele Autoren das »politische Schreckgespenst« alter weißer Mann definiert. Für dieses Buch gilt unsere eigene Definition, anhand derer wir unsere Interviewpartner ausgewählt haben: Ein alter weiser Mann ist über 70Jahre alt, beruflich erfolgreich und in seinem Fachgebiet eine Koryphäe. Er darf Umbrüche und Niederlagen in seinem Leben erfahren haben. Am Ende geht es bei unserer Auswahl der alten weisen Männer nur um eines: Lebensleistung.
1 Unter folgendem Link > finden Sie die Quellen, die der Arbeit an diesem E-Book zugrunde lagen.
Die Lage der Nation
Finanz-, Corona-, Energie-, diese drei Begriffe bilden nur einen Ausschnitt der gegenwärtigen Paarungsoptionen des Terminus Krise. Obgleich der Umbau der deutschen Energieversorgung eine der komplexesten Aufgaben der Nachkriegszeit ist, wird der Begriff Krise inzwischen inflationär und vorschnell verwendet. Medien und Experten bemühen regelmäßig das Zeitalter der Krisen, um die Gegenwart zu definieren. Dabei kreieren sie geradezu apokalyptische Sackgassen-Szenarien. Der Tenor: Nichts wird wieder so glorreich und unbeschwert, wie es einmal war.
Auch das Individuum sieht sich verstärkt Krisen gegenübergestellt. Ob Ehe-, Midlife- oder Jobkrise, der Homo sapiens des 21. Jahrhunderts beschäftigt sich gerne und ausführlich mit sich und seinen mikrokosmischen Problemen – oder um es auf Therapeuten-Deutsch zu sagen: mit seinen Herausforderungen. Beinhaltet Homo sapiens per definitionem doch die Attribute »verstehend« und »weise«, hat sich ein Teil der Spezies dieser Tage auf die Suche nach sich selbst begeben. An sich muss das kein Widerspruch sein; wenn jedoch die Selbstfindung die eigene Leistung bremst oder gänzlich lähmt, wenn Selbstfindung über dem Beitrag für das Gemeinwohl steht oder dieses gar hemmt, dann entsteht eine gesellschaftliche und ökonomische Schieflage. Geht es uns aller objektiv spürbaren Brüche noch so gut?
Das Ende des Zweiten Weltkriegs markiert den historischen Beginn des schrittweisen Wiederaufbaus Deutschlands. Die Nation war moralisch und materiell bankrott, abhängig von der Gunst der Alliierten. Die Trümmer in den Großstädten symbolisierten die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stunde null. Doch die selbst verschuldete Tortur wandelte sich in den Folgejahren zum Heilmittel und gebar durch Fleiß, Disziplin und Einfallsreichtum ein Wirtschaftswunder mit kaum für möglich gehaltenem Wachstum. Waren die Adenauer-Jahre noch gesellschaftspolitisch restaurativ, folgten nach der Befriedigung materieller Bedürfnisse dann auch notwenige Schritte zur Aufarbeitung der Vergangenheit, der Emanzipation und der Liberalisierung der Gesellschaft.
Der von der Nachkriegsgeneration erwirtschaftete materielle und politisch-kulturelle Wohlstand wurde zunehmend an die folgenden Generationen vererbt. Während die erste Übergabe noch die Fortsetzung einer Kultur der Anstrengung umfasste, stellt sich die Situation bei der dritten und bald vierten Übergabe anders dar. Der gesellschaftlich erreichte und für selbstverständlich genommene Wohlstand hat der jüngeren Generation vielfach ein Anspruchs- und »Good Life«-Denken ermöglicht, das die Werte und Tugenden der Gründergeneration verdrängt. Dabei geht es wohlgemerkt nicht um eine »Null Bock«-Haltung, die wie in den 1980er-Jahren den Ausstieg aus der als Hamsterrad empfundenen Wettbewerbsgesellschaft versucht und dabei Wohlstandsverzicht in Kauf nimmt. Wir diagnostizieren stattdessen, dass manche immer mehr von anderen erwarten – und immer weniger von sich selbst.
Dabei sieht man geradezu eine Spaltung: Der eine Teil der jüngeren Generation kämpft um sozialen Aufstieg oder darum, den Lebensstandard der eigenen Eltern zu halten. Oft treffen wir hier Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in nicht akademischen Berufen arbeiten oder auf dem Land leben. Sie haben wenig Verständnis für identitätspolitische Debatten des anderen Teils der eigenen Altersgruppe, der die Annehmlichkeiten öffentlicher Angebote in den Großstädten nutzt, in akademischen Milieus flaniert oder vom bedingungslosen Grundeinkommen träumt. Polemisch gesagt: Die einen zahlen Steuern, schaffen Wohlstand und montieren die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die anderen prägen die Debatten auf Twitter.
Während in den letzten Jahren aus den Vollen geschöpft worden ist, ist das Handwerkszeug für die eigenverantwortliche Bewältigung von Wandel und Krise aus dem Blick geraten. An seinen Platz ist die Pflege individueller Befindlichkeiten getreten, die auf die gesellschaftliche Ebene multipliziert dafür sorgen könnten, dass Deutschland erneut der »kranke Mann Europas« wird.
Anspruchshaltung 1: Der Staat regelt das schon!
Nicht erst seit der Finanzkrise 2008 hat der Staat eine immer größere Rolle in der Krisenbewältigung eingenommen. Spätestens in der Corona-Pandemie lernte die Gesellschaft: Der Staat springt ein, der Staat regelt das schon – auch die individuellen Bedürfnisse. Eigenverantwortung? Fehlanzeige.
Was dabei stetig vergessen wird: Die Politik soll nur den Rahmen setzen und die Menschen selbstbestimmt handeln lassen. Doch die Einsicht, dass der Einzelne selbst besser die Verantwortung für sein Handeln übernimmt, scheint der Politik spätestens mit dem Chaos um die Corona-Regeln abhandengekommen zu sein. Dieser Befund gilt für viele Bereiche, in denen sich unser Leben aktuell wandelt: Arbeit, Energie, Wohnen, Mobilität.
Der Staat sieht das anders. Er spannt das Sicherheitsnetz bei großen Krisen, ruft Sondervermögen aus und spannt Rettungsschirme auf. Fakt ist: Der Staat rettet die Bürger nicht mit seinem Vermögen, sondern mit unseren Steuergeldern und Krediten, für die am Ende die Bevölkerung haftet. Wie der Weihnachtsmann, lächelnd und mit Rauschebart, verteilt der Staat das Geld der Bürger, anstatt Steuern zu senken und damit Menschen zu motivieren, mehr zu investieren oder für das eigene Fortkommen zu arbeiten. Genau diese Motivation zur Mehrarbeit und Leistungsbereitschaft brauchen wir, um in einer veränderten Weltlage die Errungenschaften eines Sozialstaats und einer wohlhabenden Gesellschaft zu erhalten. Unsere Wirtschaft sucht engagierte Menschen für einfache und für qualifizierte Jobs.
Anspruchshaltung 2: Bachelor- und Master-Studium für alle!
Was auch immer in den vergangenen zwanzig Jahren in Elternhäusern, der Berufsberatung, in Schulen, in Hochschulen oder von Medien und Politik vermittelt worden ist, das Abitur und Studium für alle ist einer der größten Irrtümer der Gegenwart. Statt individuelle Talente zu fördern, Schwächen klar zu benennen und ein bundesweit einheitliches Auswahlprinzip zu implementieren, gilt seit einiger Zeit die unausgesprochene Übereinkunft, dass jeder alles können und dürfen sollte. Ausbildungsberufe, etwa im Handwerk, leiden unter dieser Gleichmachung. Die Folgen sind Personal- und Auszubildendenmangel. Die Branchen haben an Attraktivität eingebüßt, während die Hörsäle in Deutschland voll sind. Im Ergebnis steht Deutschland vielfach still: Ob auf Autobahnen, in Wohngebieten oder auf der Schiene, es fehlen die qualifizierten Kräfte, während Akademiker auch mit zweifelhafter Berufsorientierung auf den Arbeitsmarkt kommen.
Gleichzeitig verändert sich das Vermittelte in den Elternhäusern und an den öffentlichen Bildungseinrichtungen. Eine starke Leistungsorientierung, sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht, und die Freude am gründlichen Untersuchen und Durchdenken von Problemen tritt in den Hintergrund. Das Prinzip von Fordern und Fördern wird von Pädagogen zunehmend als hartes und unzeitgemäßes Prinzip bewertet. Insbesondere das elitäre Bürgertum, oft vertreten im akademischen Teil des Öffentlichen Dienstes mit Jobgarantie, gutem Einkommen und ohne Druck vom Weltmarkt, trägt diese Entwicklung mit. Der Samthandschuh ist inzwischen die vorherrschende und geliebte Umgangsform des vom Zeitgeist erfassten Teils der deutschen Gesellschaft – sowohl in Bildungsstätten als auch im Großraumbüro, in dem man per Du ist und täglich einen neuen Platz an der Schreibtischinsel wählen kann. Das Motto »Wir sind alle gleich« ist längst auf dem Vormarsch und zugleich ein fataler Irrtum.
Anspruchshaltung 3: Das Einfordern und die Priorisierung der »Life-Work-Balance«
Durch den steigenden Wohlstand streben immer mehr Menschen nach der richtigen Work-Life-Balance. Ein Begriff, den frühere Generationen weder definieren noch verwenden konnten. Die Viertagewoche und individuell planbare Homeoffice-Tage werden laut eingefordert, viele Unternehmen geben dem amerikanischen Arbeitstrend nach. Es ist allemal ein lobenswerter Anspruch, ein Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben anzustreben. Jedoch hinkt dieses Modell in der Realität oft aufgrund der Diskrepanz zwischen individueller Wahrnehmung und der nüchternen Realität des eigenen Leistungsbeitrags. Dass sich die Leistungsbereitschaft der deutschen Arbeitnehmer auf dem absteigenden Ast befindet, stellt beispielsweise Carlo Lazzarini, Chef des Progess-Werk Oberkirch gegenüber der WirtschaftsWoche fest: »Die deutschen Löhne sind gestiegen, die Arbeitszeit sinkt. Das ist fernab vom Leistungsprinzip.«8
Einst stand der soziale Aufstieg im Fokus. So wurde nicht nur dem verstorbenen Ausnahmebanker Alfred Herrhausen, geboren im Jahr 1930, sowohl körperliche als auch geistige Leistungsorientierung vermittelt, »sie war wohl ein generelles Merkmal der sich herausbildenden modernen Massengesellschaft, die individuellem, auf mess- und vergleichbare Resultate zielendem Leistungsstreben unabhängig von der sozialen Schicht hohe Wertschätzung zukommen ließ«.9 Wie Herrhausen die von seinem Vater weitergegebene Lebensweisheit zitierte: »Wie ich dich einschätze, bist du mindestens durchschnittlich intelligent, und wenn du jeden Tag eine Stunde mehr arbeitest als die anderen, dann muss es klappen.«10 Der Extrameter, die Überstunde oder das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gelten als eigentlich kaum zumutbare Härte. Eine auf staatliche Umverteilung geeichte Gesellschaft reagiert mit Empörung, Unverständnis und Schelte gegenüber jenen, die mehr Arbeit und Leistungssteigerung einfordern. Gleichzeitig wird das altmodische und in die Jahre gekommene Leistungsprinzip verdrängt und ersetzt von moralischen und überheblichen Zeitgeistdebatten: gendergerechte Sprache, Quoten, Work-Life-Balance – ein Land in der Selbstbeschäftigungsfalle, während die internationale Konkurrenz sich längst anschickt, Deutschland in allen Kategorien zu überholen. Auch die Freude an der beruflichen Tätigkeit ist in Deutschland erschreckend niedrig. In Deutschland würden laut der WirtschaftsWoche 56 Prozent aufhören zu arbeiten, wenn sie es finanziell nicht mehr nötig hätten.11 Dass Arbeit über die Sicherung des Lebensunterhalts hinaus auch soziale Teilhabe bedeutet und Sinn geben kann, wäre demnach einer Mehrheit egal.
Um die Krisen unserer Zeit zu bewältigen, benötigen wir zwingend die Rückkehr zu alten Werten und Tugenden.
Das Wissen ist da, und die Wertevermittlung ist noch möglich. Die Generation der 1940er- und 1950er-Jahre ist anders groß geworden, meist einfacher, und hat andere Werte kennengelernt. Um die Krisen unserer Zeit zu bewältigen, sollten wir den Menschen jener Generation zuhören: den alten weisen Männern, denen wir unseren Wohlstand größtenteils zu verdanken haben.
DER EUROPÄER
Mario Adorf
»Welcher Mensch will schon ungebildet sein?«
Das Interview führte
NENA BROCKHAUS
Wir Frauen lernen von klein auf: Laufe einem Mann nicht hinterher. Um keinen Preis. Niemals. Ich gestehe hiermit: Ich tat es. Monatelang buhlte ich um ein Treffen mit ihm. Besorgte mir über Umwege gar seine private Handynummer. Ich wusste: Für Alte weise Männer brauche ich ihn oder keinen.
Die Rede ist von Mario Adorf. Seit über sechs Jahrzehnten gehört er zu den renommiertesten Schauspielern Deutschlands. Er ist einer der raren Superstars, die wir in diesem Land haben. Seine Filmografie: überbordend wie facettenreich. Vom Krimiklassiker Nachts, wenn der Teufel kam über Die Blechtrommel bis hin zu unvergesslichen Fernsehauftritten in Helmut Dietls Kir Royal und Dieter Wedels Mehrteiler Der große Bellheim.
Sie merken schon: Die Karriere von Mario Adorf zu beschreiben, ist nur mit einem Feuerwerk an Superlativen möglich. Als er die Goldene Kamera für sein Lebenswerk erhielt, nannten ihn die First Ladys des deutschen Films Iris Berben und Hannelore Elsner »unseren großen Mario, unseren allergrößten Mario« und endeten ihre Laudatio mit »Play it again, Super-Mario«.
Heute ist Mario der Große 92 Jahre alt. An einem verregneten, herbstlich anmutenden Tag empfängt er mich nachmittags in seiner Wohnung in München Schwabing. Es ist nicht sein einziger Wohnsitz. Adorf lebt zusätzlich in Südfrankreich und Paris. In einen blauen Janker gekleidet öffnet er die Tür, nimmt mir meinen braunen Mantel ab, hängt diesen in die Garderobe und unterhält sich währenddessen mit seiner Ehefrau auf schnellem Französisch. Seit 54 Jahren ist er mit der Französin Monique Faye zusammen. Seit 1985 sind die beiden verheiratet. Wir nehmen an einem schwarzen Holztisch Platz, das Esszimmer ist farbenfroh und gemütlich gestaltet. Seine Frau Monique bringt Plätzchen und Kaffee. Beherzt greift Adorf zu, er sei heute noch nicht zum Essen gekommen, erklärt er mir.
Herr Adorf, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kritik?
Meine ersten Kritiken hatte ich am Theater, da waren einige gut und einige nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Meine Mutter hat das damals alles gesammelt, ich habe es mir selten angeschaut.
Sind Kritiken für Sie bedeutungslos?
Nein, ich gehöre nicht zu jenen, die behaupten: Ich lese nie Kritiken. Wenn eine Kritik vernünftig ist, nehme ich sie ernst. Ich habe nie gegen eine Kritik prozessiert oder jemanden angeschrien. Nur einmal habe ich einem bekannten Journalisten, der mich wirklich unfair behandelt hat, einen Brief geschrieben – ich habe ihn nicht abgeschickt. Generell sind mir Kritiken und Preise nicht so wichtig. Ich kannte einen Schauspieler, der hat seine Karriere lange gezielt auf den Gewinn eines Oscars ausgerichtet. Er hat ihn nicht bekommen. Ein junger Autor wollte die Aufführung seines Theaterstücks durchsetzen, weil er meinte, dass er dann dafür einen Preis bekäme. Ich habe ihm gesagt: »Tu das nicht. Der Preis ist das Sahnehäubchen, aber er darf nicht das Ziel sein.«
Gab es einen Preis, der Ihnen etwas bedeutet hat?
Zum Zeitpunkt der Verleihung hatten sicher die meisten Preise eine schmeichelhafte Bedeutung für mich, aber in besonderer Wertschätzung bleiben einige wenige, weil sie in der Form kleine bronzene Kunstwerke sind wie der Ernst-Lubitsch-Preis, in der letzten Zeit die Siegesgöttin Nike und der Europäische Kulturpreis für Schauspielkunst, der mir am vergangenen 26. September in meiner Geburtsstadt Zürich verliehen wurde.
Wo stehen Ihre Preise heute?
Ich weiß gar nicht, wo meine Preise sind. Fünf oder sechs sind noch da. Aber der Rest? Die kamen zu Ausstellungen, etwa in die Akademie der Künste in Berlin, nach Düsseldorf, Hannover, und in meiner Heimatstadt Mayen stehen einige Preise. Ich habe sie geehrt angenommen, aber auch nicht für so wichtig gehalten, nicht einmal ein Oscar hätte mir viel bedeutet. Mein erster nennenswerter Film Nachts, wenn der Teufel kam … hatte 1958 eine Oscarnominierung für den besten ausländischen Film. Von dieser Nominierung habe ich drei Monate nach der Verleihung erst erfahren. Heute wird schon jede Nominierung monatelang vorher frenetisch gefeiert. Bei der Blechtrommel war ich damals nicht einmal eingeladen, das Ticket habe ich selbst bezahlt, saß in der 26. Reihe und niemand hat mich erkannt. Ich bin auch nicht, wie später manche, jubelnd auf die Bühne gehüpft. Ich bin brav sitzen geblieben, während ein paar hundert Zuschauer genau während der Sparte bester ausländischer Film den Saal verließen, um eine Zigarette zu rauchen.
Der Film Die Blechtrommel aus dem Jahr 1979 gewann als erster deutscher Film den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Neben weiteren anderen Preisen erhielt er zudem die Goldene Palme in Cannes. Adorf spielte in dem Film die Rolle des Alfred Matzerath.
Worauf haben Sie Ihre Karriere ausgerichtet?
Schlicht darauf, gute Arbeit zu machen. Die Schauspielerei ist ein Handwerk, keine außerordentliche Begabung, die vom Himmel kommt. Die meisten Menschen wären dafür nicht unbegabt. Das Handwerk kann man erlernen. Ich kam bereits vom Handwerk. Ich habe für mein Studium sehr hart arbeiten müssen: auf dem Bau und im Steinbruch. Für mich war die Schauspielerei eine Arbeit wie jede andere.
Sie sind vermutlich der einzige Mensch, der die Schauspielerei mit der Arbeit auf dem Bau vergleicht.
Was tut man auf dem Bau? Man baut auf. Das tut man in meinem Beruf auch. Man baut eine Rolle auf. Es gibt noch mehr Parallelen: Wie auf dem Bau ist die Schauspielerei keine einsame Beschäftigung. Sie ist Gemeinschaftsarbeit. Ich habe die Sonderstellung des Einzelnen nie geschätzt. Ich konnte nie nachvollziehen, wenn ein Schauspieler schon nachmittags um 15 Uhr allein in seiner Garderobe sitzt, um sich in seine Rolle zu versenken. Manchmal habe ich am Theater drei Rollen an einem Tag gespielt. Ich habe eher Schauspieler bewundert, die kurz vor dem Auftritt noch einen Witz erzählt haben. Schauspielerei ist ein Handwerk, das es zu beherrschen gilt.
Heutzutage kommen viele Schauspieler direkt zum Film.
Das war früher unüblich. Schauspieler kamen damals meist vom Theater. Heute kommen sie schon als Superstar zu ihrer ersten Fernsehrolle. Für mich war die Arbeit beim Theater wichtig. Dort lernte ich, in kleinen Rollen aufzufallen und weiterzukommen. Es war für mich immer wichtig, eine Rolle gut zu spielen. Natürlich ist es Glück, gute Rollen zu bekommen, aber auch daran kann man arbeiten. Man kann das Glück packen. Die Göttin Fortuna ist zwar blind, aber nicht unsichtbar. Man kann sie packen.
Besteht Glück darin, auch Nein zu sagen?
Ich habe unzählige Rollen für Filme abgesagt, bei denen ich gemerkt habe, dass ich da nicht hinpasse. Ich war aber nie auf der Suche nach Rollen, die mir ähneln. Sie müssen mich packen. Ich kannte einen sehr populären Schauspieler, der seine Rollen so lange veränderte, bis sie mit seinem privaten Ich fast identisch waren. Ich wollte beim Spielen immer jemand anderes sein. Ich wollte Neues erfahren über die darzustellenden Menschen, wie sie ticken, denken und fühlen. Ich bin ein Gegner der Routine.
Der Schauspieler Peter Sattmann wurde vom Spiegel gefragt, ob er auf Charakterschauspieler wie Sie, die im Feuilleton besprochen werden, neidisch sei. Seine Antwort lautete: Ja. Seine Erklärung: Bei ihm habe es mit der Reputationsschauspielerei nie funktioniert, weil er immer Geld brauchte und es sich nicht leisten konnte, einen Dreh abzusagen.12 Konnten Sie es sich finanziell immer leisten, Rollen abzusagen?
Ich kannte Peter Sattmann mal sehr gut, wir waren eine Zeitlang befreundet, bis sich unsere schauspielerischen Wege trennten. Bei mir gab es nach dem ersten großen Erfolg viele Angebote, da musste ich Nein sagen und habe angefangen, auf Qualität zu schauen. Man kann von zehn Rollen neun absagen, aber der Kamin musste auch bei mir rauchen. Es gibt das Gegenteil zu Sattmann: Ich kannte einen wunderbaren Schauspieler, der zu viel abgelehnt hat. Der hat der finanziellen Versuchung immer widerstanden. Manche Rollen hat er außerdem wegen seiner zu deutlich betonten politischen Einstellung nicht bekommen und so sind ihm große Chancen verwehrt geblieben.
Darf man als Schauspieler politisch sein?
Dürfen sicher, aber sollte man? Man kann es sogar. Nehmen Sie Ronald Reagan oder Arnold Schwarzenegger. Aber der Politiker vertritt doch eine bestimmte Partei, er tut alles für die Grundsätze und Ideen seiner Partei, er ist naturgemäß in Opposition zu allen Andersgesinnten. Der Schauspieler aber kann nicht sagen: Ich spiele ausschließlich für die Linken oder Rechten, er spielt für alle, für das sehr verschiedene gesamte Publikum. Und das ist für mich gut so.
Würden Sie sich als politischen Menschen beschreiben?
Ich habe mich immer für die Politik interessiert, habe aus meiner Einstellung nie ein Geheimnis gemacht und auch meine Meinung öffentlich vertreten. Ich habe mich allerdings auch zurückgehalten. Ich hatte privat oder beruflich nie viel übrig für Vereine, und Parteien sind schließlich auch so etwas wie ein Verein. In meiner Jugend war ich in einem Boxclub und bei einem Fußballverein. Das war’s. Ansonsten habe ich mich nie einer Gruppe, einem Clan angeschlossen. Und oft zu meinem beruflichen Schaden. Den Drang, die Welt zu verändern, verspüre ich nicht, auf der Straße werben oder protestieren, das mögen andere tun.
Ich wählte die Theaterbühne, das Lesepult. Dort und mit einigen Filmen konnte ich das Gute tun, die Menschen unterhalten, aber auch zum Nachdenken bringen.
Sie haben Italien wegen des damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi verlassen, heißt es.
Ja, das ist wahr, weil ich ihn verachtet habe. Weil ich ihn ungut fand und immer noch finde. Ich habe vierzig Jahre lang teilweise unter schlimmen politischen Verhältnissen in Italien gelebt, aber das war mir dann zu viel. Es gab Momente, in denen ich mich in einem Film befand, von dem ich nicht wusste, dass Berlusconi heimlich der Produzent war. Das hat mich geärgert. Es gab sogar Versuche der Umarmung von Berlusconi. Er hat sich positiv über mich geäußert, versucht, mich zu vereinnahmen, aber das habe ich nicht zugelassen.
Ihre Jahre in Italien waren die schönsten ihres Lebens, haben Sie einmal gesagt.
Ja, das waren die wichtigsten und prägendsten, aber auch leichtlebigsten Jahre meines Lebens. Das sogenannte Dolce Vita. Die Freizügigkeit, die damals herrschte, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Wir hatten eine Lebensqualität, die sich im Genießen des Lebens ausdrückte. Von morgens bis abends – bis 1973 dann die erste Energiekriese kam. Was konnte in dieser perfekten Zeit eine solche Krise ausmachen? Es folgte ein unwiederbringlicher Verlust an Lebensqualität. Bis zum Sommer1973 konnte man zum Beispiel zur Arbeit gehen, sich anschließend duschen und um 20.30 Uhr ins Kino gehen, um ab 22.30 Uhr im Restaurant zu essen. Im Juli1973 hörte das auf. Da mussten die Restaurants um 24 Uhr schließen, sie blieben plötzlich nicht mehr bis 2 Uhr offen. Das hieß: Man konnte nicht mehr nach dem Kino ins Restaurant gehen. Oder nach einem frühen Abendessen ins Kino gehen, auch das gab’s nicht mehr: Die 22.30-Uhr-Vorstellung wurde gestrichen. Vor der Krise konnte man beides. Ich habe gemerkt: Hier ist mir ein Teil meiner Lebensqualität genommen worden. Dieser Teil ist nie wieder zurückgekehrt. Es war nie wieder so wie vorher. Die Restaurants haben nie wieder bis 2Uhr aufgemacht, die haben gemerkt: Es geht auch so.
Sie sagten einmal, dass Sie als Halbitaliener ein ganzer Italiener werden wollten.
Ja, das war damals mein Wunsch, als ich in den 60er-Jahren nach Italien gegangen bin. Mit der Zeit merkte ich dann, wie deutsch ich doch eigentlich war. Meine Liebe zu Italien war die der deutschen Romantiker. Meine Sehnsucht nach Italien war eine deutsche Sehnsucht.
Mario Adorf wurde 1930 als uneheliches Kind einer deutschen Röntgenassistentin und eines verheirateten italienischen Chirurgen aus Kalabrien in Zürich geboren. Mit drei Jahren kam er in seiner Heimatstadt Mayen in der Eifel in ein katholisches Kinderheim, wo er später auch Messdiener wurde. Der Grund: Seine Mutter arbeitete als Näherin. Zu den Auftraggebern durfte sie ihren Jungen, als er drei Jahre alt wurde, nicht mehr mitnehmen. Nur sonntags konnte sie ihn sehen. Die Mutter hatte gegenüber dem Heim, in dem Adorf aufwuchs, eine Dachkammer bezogen. Als das Waisenhaus bei Kriegsbeginn zu einem Lazarett umfunktioniert wurde, war Adorf neun Jahre alt und zog in das Zimmer seiner Mutter.
Was sind Sie heute: Deutscher, Italiener, Europäer?
Europäer. Ich habe mich immer als Europäer gesehen. Mit meiner Geschichte liegt das auch nahe: In der Schweiz geboren, in Deutschland aufgewachsen, Halbitaliener, mit einer französischen Frau verheiratet. Manche Schauspieler sagen, ich sei ein Weltenbummler. Hardy Krüger hat das einst mit Recht von sich gesagt. Das bin ich nicht, aber Europa empfand ich schon immer als meinen Kontinent. Wenn ich im Flugzeug flog, bemerkte ich, wie viele Landflächen da unten gelb-braun sind. Man fliegt stundenlang über nicht erschlossene Länder – und dann kommt man nach Europa. Dieser grüne Felderteppich, die Wälder, die kleinen Dörfer, die architektonische Vielfalt. Europa. Hierher komme ich gerne zurück. Ich bin nicht nur Deutscher, ich bin Europäer.
Was bedeutet für Sie Heimat?
Es ist so eine Sache mit der Heimat. In meinem Herzen bin ich Eifler. Meine Heimat ist das Städtchen Mayen in der Eifel. Die ehemals steinige, heute so grüne Eifel. Von der Sprache her gibt es Leute, die bei mir den Dialekt heute noch heraushören.
Sie sprechen vier Sprachen fließend: Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch.
Abgesehen von meiner Muttersprache Deutsch musste ich mir alle Sprachen selbst beibringen. Zum Teil ist mir das akzentfrei gelungen. In Italien habe ich schon meinen dritten Film selbst synchronisiert, aber es kam auf den Dialekt an, wie im Deutschen. Ich kann berlinern, werde von vielen für einen Berliner gehalten, habe aber nie Bayerisch gewagt. So gibt es auch in den italienischen Dialekten jene, die mir liegen, und andere, die es nicht tun. Als ich den Mussolini spielte, hätte ich mich gerne selbst synchronisiert, aber daran bin ich gescheitert. Alle dafür vorgeschlagenen italienischen Schauspieler haben den Regisseur beschworen: »Lass den Mario das machen, der kann das perfekt«, aber der Regisseur kam aus der Gegend von Mussolinis Geburtsort und sagte nur knapp: »Tut mir leid, ich höre es.« Die Italiener haben viel feinere Ohren als die Deutschen. Sie sind viel empfindlicher. Die Sprache ist in Italien mit viel Nationalstolz verbunden. Der ist in Deutschland weniger vorhanden, vielleicht zu Recht.
Die Beherrschung unterschiedlicher Sprachen ermöglicht Ihnen als Schauspieler die völlige Unabhängigkeit.
Ja, mich haben die von den Nazis in die Emigration getriebenen und zurückgekehrten Theaterleute damals stark beeinflusst. Nach vier Semestern Studium in Mainz bin ich nach Zürich gegangen, in meine Geburtsstadt. Dort habe ich am Schauspielhaus in der Komparserie mitgewirkt und all die wunderbaren Menschen kennengelernt, Schauspieler wie Ernst Ginsberg und Kurt Horwitz, oder Regisseure wie Fritz Kortner und Leopold Lindtberg, die alle gelitten haben unter der Sprachlosigkeit, die sie während der Emigration erleben mussten. Kortner sagte: »Wir hatten unsere Muttersprache verloren.« Das hat mich nachhaltig geprägt. Ich wollte nicht, dass es mir, wenn sich die politische Lage noch einmal dramatisch ändern sollte, genauso ergehen würde. Ich lernte: Um zu überleben, muss ich mehrere Sprachen sprechen.
Sie haben es ohne schwere politische Lage umgesetzt und sind in unterschiedlichsten Ländern wie Frankreich, Italien, England, Österreich und der Schweiz berühmt geworden. Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt?