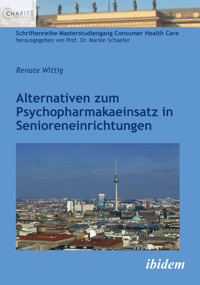
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care
- Sprache: Deutsch
Der Einsatz von Psychopharmaka in Senioreneinrichtungen in Deutschland steht seit Jahren in der Kritik – oftmals würden sie nur zur Ruhigstellung, nicht aber aus medizinischen Gründen verordnet. Renate Wittig hat für ihre hier vorgelegte Studie anhand von Daten der AOK-Versicherten die Verordnung von Psychopharmaka in den Jahren 2010 bis einschließlich 2014 mit Blick auf alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten analysiert. Ein besonderes Interesse galt dabei der Frage, in welcher Pflegestufe sich diese Patienten während des Einnahmezeitraums befanden und ob es sich um Bewohner einer Pflegeeinrichtung handelte. Entgegen den Erwartungen erfolgten die meisten Psychopharmaka-Verordnungen für Patienten der Pflegestufe 0. Gerade für diese wäre ein Ausweichen auf andere Therapiemöglichkeiten und -optionen und Interventionen durchaus möglich, hilfreich und sinnvoll. In der Altersklasse von 70 bis 75 Jahre sind für die männlichen und in der Altersklasse von 75 bis 80 Jahre für die weiblichen Versicherten die höchsten Verordnungszahlen gefunden worden. Gesondert betrachtet wurden die Psycholeptika-Verordnungen der AOK-Versicherten im Zeitraum von 2010 bis 2015. Im Fokus standen dabei insbesondere Benzodiazepin- und Antidepressiva-Verordnungen. Obwohl durch Studien belegt ist, dass deren Einnahme über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten das Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken, um rund fünfzig Prozent steigert, werden Benzodiazepine besonders in der Altersklasse der 70- bis 80-Jährigen noch immer in hohem Ausmaße verordnet. Über die Analyse hinaus gibt Wittig einen Abriss über den Einfluss von Psychopharmaka auf kognitive Fähigkeiten und belegt unter Bezugnahme auf bereits vorhandene Studien, dass verschiedene alternative Wege möglich sind, den Alltag von an Demenz oder Depression erkrankten Senioren durch nichtmedikamentöse Interventionen wesentlich zu erleichtern. Dabei geht es vor allem darum, die Lebensqualität zu steigern und die Alltagskompetenz zu erhöhen. Wittig stellt geeignete Trainingsprogramme für Senioren zur Steigerung der physischen und kognitiven Leistungsfähigkeit vor und bewertet sie. Das Buch richtet sich insbesondere an die Leitungen von Senioreneinrichtungen, an Pflegedienstleitungen und heimversorgende Apotheken, aber auch an Ärzte, die Pflegeheime betreuen, sowie an Betroffene und Interessierte im Bereich der Pflege. Sowohl die Bewohner dieser Einrichtungen als auch das Pflegepersonal würden unmittelbar von einer Berücksichtigung und Umsetzung der hier präsentierten Ergebnisse profitieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1. Abkürzungsverzeichnis
2. Zusammenfassung
3. Einleitung
4. Ziel und Aufgabenstellung
5. Material und Methode
6. Darstellung der Ergebnisse empirischer Daten
7. Einfluss von Psychopharmaka auf kognitive Fähigkeiten und Leistungen
8. Ansätze zur Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Menschen
9. Vergleich von kognitiver Verhaltenstherapie zu medikamentöser Therapie bei Depressionen
10. Bewertung von Nahrungsergänzungsmitteln in höherem Lebensalter
11. Bewertung von alternativen Ansätzen zur Verbesserung der psychischen Situation im Alter
12. Der Effekt von Musik auf die Lebensqualität und Depressionen bei Pflegeheimbewohnern mit Demenz
13. Diskussion der Ergebnisse
14. Schlussfolgerungen
15. Literaturangaben
Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care
Impressum
ibidem-Verlag
1. Abkürzungsverzeichnis
ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
ADL: Activities of Daily Life
APOE 4: Apolipoprotein E 4
ARCD: Age related cognitive decline
ATC: Anatomisch-therapeutisch-chemische Klassifikation
BfR: Bundesinstitut für Risikobewertung
BMI: Body-Mass-Index
BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
CANTAB: Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery
CD: Compact Disc
DDD: Defined Daily Dose
DGSM: Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin
DHA: Docosahexaensäure
DIMDI: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation
EKG: Elektrokardiogramm
FAB: Frontal Assessment Battery at Bedside
FDA: Food and Drug Administration
GBA: Gemeinsamer Bundesausschuss
GDS: Geriatric Depression Scale
GKV: Gesetzliche Krankenversicherung
HTA: Health Technology Assessment
IADL: Instrumental Activities of Daily Life
IQWIG: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
KVB: Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
MMSE: Mini-Mental-State-Examination
NNT: Number needed to treat
PAL: Paired Associates Learning
PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale
QT-c: QT Intervall im Elektrokardiogramm
Sim A: Selbständig im Alter
Sim A-P: Selbständig im Alter-Programm
US: United States
USA: United States of America
WHO: World Health Organization
WIdO: Wissenschaftliches Institut der AOK
2. Zusammenfassung
Der Einsatz von Psychopharmaka in Pflegeheimen steht seit Jahren in der Kritik. Deshalb soll mit dieser Arbeit überprüft werden, ob es altersspezifische und geschlechtsspezifische Besonderheiten gibt. Dazu standen Daten der AOK-Versicherten über einen Zeitraum von fünf bis sechs Jahren zur Verfügung. Daraus wird ersichtlich, dass insgesamt mehr weibliche als männliche Patienten Psychopharmaka verordnet bekommen haben. Die Altersspanne der häufigsten Verordnungen lag bei 70 bis 80 Jahren. Eine Betrachtung nach den Pflegestufen und nach der Heimzugehörigkeit ergab, dass auf Patienten der Pflegestufe 0 der Hauptanteil von Psychopharmaka-Verordnungen in den Jahren von 2010 bis einschließlich 2014 in allen Pflegestufen entfiel. Immerhin war bei der Verordnung von Psycholeptika von 2010-2015 ein Abwärtstrend zu erkennen. Benzodiazepine als Vertreter der Psycholeptika und Antidepressiva als Vertreter der Psychoanaleptika sind am häufigsten weiblichen Patienten in der Altersklasse von 75-80 und männlichen von 70-75 Jahren verordnet worden.
In der weiteren Arbeit geht es einerseits darum, herauszufinden, ob durch Rehabilitations- und Trainingsprogramme die Selbständigkeit im Alter erhalten und gefördert werden kann. Inwieweit sowohl der physische als auch der ko-gnitive Leistungsabbau beeinflussbar sind und welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um diesen entgegenzuwirken, soll aufgezeigt werden. Dazu wurde im Einzelnen ein Aktivierungsprogramm für Senioren in stationären Pflegeeinrichtungen hinsichtlich der Mobilisierung von körperlichen und ko-gnitiven Fähigkeiten verbunden mit den Auswirkungen auf den Alltag untersucht. Ein kombiniertes Training brachte erstaunliche Erfolge hinsichtlich der Reduktion der Anzahl der Sturzpatienten (um >50%). Die Sturzhäufigkeiten konnten um 70% reduziert werden. Des Weiteren zeigten sich Verbesserungen in den Parametern der Aktivität, kognitiven Wachheit und des positiven psychischen Wohlbefindens. Ein weiteres Aktivierungsprogramm richtete sich an Senioren, die noch selbständig in ihrem Haushalt leben konnten. Es zeigten sich durch diese Studie Erfolge in den Bereichen: gesunde Ernährung, körperliche Aktivität und soziale Vorsorge. Im Ergebnis konnte sowohl die geistige als auch die körperliche und soziale Kompetenz der Studienteilnehmer gesteigert werden. Interaktive Ansätze wirkten sich positiv auf die Motivation und Flexibilität aus. Durch andere Studien konnte belegt werden, dass körperliche Aktivität und Fitness schon in früherem Lebensalter positiven Einfluss auf den Erhalt der kognitiven Leistungsfähigkeit nimmt. Inwieweit Arzneimittel (insbesondere die Benzodiazepin-haltigen) Einfluss auf kognitive Fähigkeiten haben können, wurde anhand von Studien dargestellt. Im Ergebnis zeigte sich, dass Benzodiazepine die kognitive Leistungsfähigkeit herabsetzen können. Daher werden sie als Schlafmittel von Fachgesellschaften, laut nationalen und internationalen Leitlinien nur für eine maximale Anwendungsdauer von vier Wochen empfohlen. Andererseits wurde hinterfragt, welchen Einfluss bestimmte Nahrungsergänzungsmittel auf den Erhalt von kognitiven Fähigkeiten ausüben können. Es hat sich gezeigt, dass ein geringer Gehalt an Vitamin D im Blut mit einem erhöhten Risiko für den Abbau von kognitiven Fähigkeiten assoziiert war. Bei einer erhöhten Vitamin-D-Zufuhr verringerte sich das Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Aus weiteren Studien ging hervor, dass besonders chronisch kranke und pflegebedürftige ältere Menschen zu den Risikogruppen gehören, die einen Vitamin-D-Mangel ausbilden. Der Einsatz von DHA als präventive Option zur Erhaltung von kognitiven Fähigkeiten erwies sich bei möglichst frühzeitiger Gabe an gesunden Studienteilnehmern in der Tendenz als wirkungsvoll.
Zusätzlich sollte untersucht und diskutiert werden, welche nichtmedikamentösen Maßnahmen und Therapien zur Verfügung stehen, um positiven Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität im Alter mit Demenz oder Depressionen nehmen zu können. Ein besonderes Betreuungskonzept einer Senioreneinrichtung, die speziell auf die Bedürfnisse an Demenz erkrankter Senioren ausgerichtet ist, konnte während der Aufenthaltsdauer ihrer Bewohner eine Reduktion des Verbrauches an Psychopharmaka bewirken. Humor in Pflegeeinrichtungen mit Hilfe von Clown-Interventionen hinterließ ebenfalls positive Effekte bezogen auf das emotionale Wohlbefinden der Bewohner und des Pflegepersonals. Eine kognitive Verhaltenstherapie in der Studie erbrachte ebenso gute Ergebnisse bei der Behandlung von Depressionen ohne Angststörungen wie eine Antidepressiva-Behandlung mit SSRI. Als Alternative zu Antidepressiva (insbesondere SSRI) erwies sich die Aminosäure 5-Hydroxytryptophan zur Senkung der depressiven Symptomatik als ebenso wirkungsvoll. Darüber hinaus traten unter der 5-Hydroxytryptophantherapie weniger unerwünschte Arzneimittelwirkungen auf. Diese waren auch an einem geringeren Anteil an Patienten als unter der SSRI-Gabe beobachtet worden. Auch Musikinterventionen nahmen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Senioren in stationären Pflegeeinrichtungen bei Demenz und Depression. Als besonderes Beispiel kann hier der Einsatz von Live-Musik genannt werden. Bei den aktiven Interventionen stellten sich die Erfolge durch ein erhöhtes Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, ein gesteigertes Selbstvertrauen und einen sinkenden Depressionswert dar. Durch die Ergotherapie als weitere nichtmedikamentöse Maßnahme erfolgte eine effektive kognitive Stimulation bei leichter und mittelschwerer Form der Demenz. Bei schwerer Form der Demenz war eine Wirkung unter Einbeziehung von strukturierten und patientenorientierten Verfahren nachweisbar.
3. Einleitung
Der Begriff Kognition, der lateinischen Ursprungs ist und sich von cognoscere ableitet, das so viel bedeutet wie erkennen, erfahren, kennenlernen, beinhaltet eine Informationsverarbeitung von Menschen und anderen Systemen. Der Mensch verfügt über kognitive Fähigkeiten wie die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerung, das Lernen und Problemlösen, aber auch die Kreativität, die Fähigkeit zu planen, die Orientierung, die Imagination, die Argumentation, die Introspektion, den eigenen Willen und nicht zuletzt den Glauben. Sogar Emotionen werden nicht unwesentlich von kognitiven Anteilen bestimmt und können selbst kognitive Fähigkeiten beeinflussen. Die Psychologie beschreibt die Kognition als mentale Prozesse und Strukturen eines Individuums. Dazu zählen die eigenen Gedanken, Wünsche, Absichten, Meinungen und Einstellungen zu bestimmten Sachverhalten. Aber auch Informationsverarbeitungsprozesse bezogen auf einen Lernvorgang und die Wissensverarbeitung lassen sich diesem Begriff zuordnen. Selbst bei gesunden Individuen ist die kognitive Leistungsfähigkeit begrenzt. Fähigkeiten wie das Wahrnehmen durch die Sinnesorgane, das Denken, Lernen, die Fähigkeit sich zu erinnern, die Konzentration und Motivation sowie die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und Reaktion, die sich in entsprechenden Handlungen ausdrückt, können durch bestimmte äußere Einflussfaktoren, aber auch durch individuelle Befindlichkeiten, wie z.B. Müdigkeit und Lustlosigkeit, limitiert sein (119).
Mit steigendem Alter reduziert sich die Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Gehirns, so dass die Impulsweiterleitung verlangsamt sein kann. Davon betroffen ist hauptsächlich das Kurzzeitgedächtnis. Ebenso verringert sich mit zunehmendem Alter die Fähigkeit, zuvor gelerntes Wissen abzurufen. Der Gedächtnisforscher Korte erklärt, dass dieses nicht an der Speichergröße des Gehirns liegt, die nahezu unbegrenzt ist, sondern an der verminderten Fähigkeit, eine bestimmte Information aus der Vielzahl der Erinnerungen wiederzufinden und aufzurufen (64). Vergleicht man das menschliche Gehirn mit einem Computer, so kann es mit zunehmendem Alter zwar seine Rechengeschwindigkeit verlieren, dafür aber eine ständige Programmänderung vornehmen und damit die eigene Leistungskapazität interessanterweise teilweise sogar wieder erhöhen. Amerikanische Wissenschaftler unter der Leitung der Psychologin Sherry L. Willis untersuchen seit über fünfzig Jahren in der Seattle Longitudinal Study über das kognitive Altern über 6.000 Teilnehmer (97). Im Abstand von jeweils sieben Jahren wurde die geistige Fitness der Teilnehmenden überprüft. Die Wissenschaftler kamen in dieser Studie zu einem beeindruckenden Ergebnis: Die Teilnehmer der älteren Jahrgänge erhielten in nur zwei von insgesamt sechs Testkategorien schlechtere Ergebnisse. Diese beiden Testkategorien waren die Rechenfähigkeit und die Reaktionsschnelligkeit. In den anderen Testbereichen war mit dem Alter sogar eine Zunahme der kognitiven Fähigkeiten zu verzeichnen. Die besten Testergebnisse erhielten die Teilnehmer in der Altersklasse zwischen 55 und 60 Jahren. Das zeigt, dass das menschliche Gehirn in der Mitte des Lebens neue Fähigkeiten zu entwickeln scheint. Informationen können leichter verknüpft und wichtige von unwichtigen schneller unterschieden (und aussortiert) werden. Dieses Phänomen belegte der Psychologe Arthur F. Kramer sowie Ashley Nunes von der Universität Illinois durch eine Studie, die mit Hilfe von Fluglotsen durchgeführt worden ist (78). Während die Reaktionsgeschwindigkeit der jüngeren Lotsen in Routinesituationen deutlich höher war, reagierten die älteren Lotsen in unvorhergesehenen Situationen schneller. Unter dem Einfluss von vieldeutigen Informationen schnitten die älteren Lotsen ebenso besser ab. Diese schnellere Reaktionsfähigkeit, in komplexen Si-tuationen angemessen zu reagieren, begründen die Wissenschaftler mit der langjährigen Fachkenntnis der älteren Fluglotsen.
Bei Erkrankungen wie Depressionen, Demenz, Alzheimer oder Parkinson sowie nach einem Schlaganfall können die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sein. Die Demenz und Depression zählen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen, die bei älteren Menschen auftreten (9, 25, 108). Dabei können Depressionen die Entstehung einer Demenz begünstigen (8). Eine besondere Form der Depression stellt die sogenannte Altersdepression dar, die sich auch durch lavierte Symptome wie Schlaf- und Appetitlosigkeit und Schmerzen äußern kann und dadurch für den Arzt nicht leicht zu diagnostizieren ist. Durch veränderte Lebensumstände im Alter, wie den Verlust eines nahestehenden Menschen und somit einer wichtigen Bezugsperson, Vereinsamung, mangelnde Bewegungsfreiheit durch körperliche Einschränkungen oder Wohnungswechsel (z.B. in eine kleinere Wohnung) und damit in ein neues soziales Umfeld kann ebenfalls eine Altersdepression ausgelöst werden (99). Die Demenz stellt des Weiteren eine Ursache für Behinderung im Alter dar. Während der kognitive Abbau meist eng mit dem körperlichen verbunden ist, schwinden komplexere motorische Fähigkeiten vor den grundlegenden. Durch die reduzierte körperliche Aktivität kann sich der Rückgang funktioneller und motorischer Fähigkeiten noch verstärken (100). Im Pflegealltag der stationären Langzeitpflege besteht neben dem Problem des Individualitätsverlustes des Einzelnen das Problem des Verlustes der Mobilität und Selbständigkeit bedingt durch den Verlust der Aktivitäten im Alltag in der häuslichen Umgebung. Deshalb ist es hier besonders wichtig, Selbständigkeitspotentiale zu erkennen, zu fördern und aufrechtzuerhalten. Bewegung und Beschäftigung sind essentiell für Senioren in Pflegeheimen zu einer gezielten Förderung der Alltagskompetenz, von Gleichgewichtsfähigkeiten und zur Sturzprophylaxe. Der Einsatz von Kraft- und Funktionstraining spielen dabei eine wichtige Rolle. Bedingt durch den demografischen Wandel ist ein Anstieg der Anzahl der Pflegeheimbewohner und Pflegeheimbewohnerinnen zu erwarten (71, 85, 100), so dass hier dringend Veränderungen in den derzeitigen Pflegekonzepten geboten sind.
4. Ziel und Aufgabenstellung
Im Hinblick auf die Verordnung von Psychopharmaka soll anhand von Verordnungsdaten von AOK-Versicherten in den Jahren 2010 bis einschließlich 2014 überprüft werden, in welchen Altersklassen diese besonders häufig verordnet werden. Ob dabei geschlechtsspezifische Besonderheiten in der Verordnungsweise vorliegen, soll ebenfalls untersucht werden. Im Einzelnen wird danach analysiert, in welcher Pflegestufe die meisten Patienten Psychopharmaka verordnet bekamen. Ferner wird bestimmt, ob mehr AOK-Versicherte, die sich in einer Pflegeeinrichtung befinden, Psychopharmaka verordnet bekamen als die nicht stationär lebenden Versicherten. Bei den Verordnungen der Benzodiazepin-Derivate (als Untergruppe der Psycholeptika) insgesamt werden ebenfalls alters- und geschlechtsspezifische Merkmale betrachtet. Des Weiteren werden die Psychoanaleptika-Verordnungen der vergangenen sechs Jahre allgemein und im Speziellen die Antidepressiva (mit der Untergruppe der Nichtselektiven Monoamin- Wiederaufnahmehemmer) auf alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten hin untersucht.





























