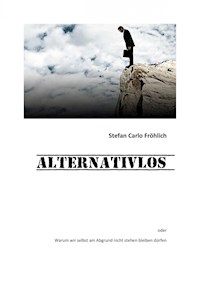
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Geht's Ihnen so wie mir? Wundern Sie sich auch, warum wir Otto=Normal-(Strom) Verbraucher die Erneuerbare Energie (EEG) Umlage zahlen, die strom-fressenden Industrieunternehmen aber nicht? Oder warum das für den Kunden vorgesehene Sonderkündigungsrecht in Bausparverträgen plötzlich für den Vertragspartner gilt? Oder warum die Steuerzahler jetzt verantwortlich für den Atommüll sind, obwohl jahrzehntelang die Energiekonzerne Milliarden Euro pro Quartal an Gewinnen eingefahren haben? Zugegeben, mittlerweile kenne ich die Antworten, aber ich vermute, dass dies noch längst nicht bei allen von Ihnen der Fall ist. Ich glaube, Aufstände in Hong Kong, Baumhäuser in Hambach und selbst das neue AfD-wählende Wutbürgertum sind auf diese Sachverhalte zurückzuführen, selbst wenn das dem Demonstrierenden in dem Augenblick vielleicht gar nicht bewusst ist. Wir sollten uns aber mit dem heutigen Zustand von Geldsystem, Politik und Industrieinteresse auseinandersetzen, denn der Rahmen wird täglich neu definiert, und das, was uns gestern noch absurd erschien, ist morgen bereits Grundgesetz und unsere Gedanken dann vielleicht verfassungswidrig. Wenn Sie also den Eindruck haben, dass viele Dinge momentan keinen Sinn ergeben, dann ist das Lesen meines kleinen Buches für Sie ALTERNATIVLOS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel Seite
ALTERNATIVLOS
oder
warum wir selbst am Abgrund nicht stehen bleiben dürfen
von
S C Fröhlich
Vorgeplänkel
Eigentlich fallen mir gleich drei Vorworte ein, die ich diesem Text vorausschicken möchte, deshalb habe ich ein wenig Angst, dass die Vorworte länger werden als der Text selbst. Diese Angst nimmt mir ein stückweit die Tatsache, dass ich sehr gerne abschweife, der Text wird also mindestens doppelt so lang werden wie geplant und deshalb mindestens dreifach so unterhaltsam, denn wenn ich abschweife, dann wird’s richtig kurzweilig und interessant. Versprochen.
Vorwort Nummer eins wäre eine Vorstellung des Autors: Ich bin, glaube ich, ganz „normal“ aufgewachsen. Vater kaufmännischer Angestellter, Mutter Sekretärin. Sie legte eine Karrierepause ein, als ich geboren wurde und jobbte später halbtags als Schuhverkäuferin. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt bereits Geschäftsführer. Mittelständisches Unternehmen. Die Erziehung war also eher konservativ-rechts. Wenn man etwas mehr als der Durchschnitt verdient, findet man Beitragsbemessungsgrenzen eine tolle Erfindung, die spürbaren Zinsen tun einem nicht allzu weh, das Häuschen ist nach zwanzig bis dreißig Jahren abbezahlt, Regierung Schmidt ist nicht übel, Regierung Kohl aber eher nach unserem Geschmack, denn 54% Spitzensteuersatz kratzt uns (leider) nicht. Das Leben kann anstrengend sein, aber nur, wenn man wirklich etwas erreichen will, ansonsten reicht die deutsche Gewissenhaftigkeit vollkommen aus. Deshalb kommt Papa im Großen und Ganzen immer pünktlich um Viertel nach Fünf Uhr nach Hause. Ein gutes Land, ein gutes System. Sohnemann, das bin ich, strebte daher auch eher nach Geld als nach Pulitzer-Preisen, lernte auch kein Instrument, obwohl lyrische und musikalische Veranlagungen zweifellos nachweisbar sind. In den Achtzigern begann die Globalisierung sehr rasch Tempo aufzunehmen, also musste man, um Karriere zu machen, Auslandserfahrungen nachweisen. Mit England, Frankreich, drei Jahren Nordamerika und fünf Jahren Asien habe ich es vielleicht etwas übertrieben, aber heute stelle ich nachrechnend fest, dass, wenn ich mit 67 dann endlich in Rente gehen darf, werde ich trotz allem dreimal so lange in Deutschland gearbeitet haben wie in den anderen Ländern zusammen.
Auslandserfahrung ist absolut unbezahlbar, Paris hat mich gelehrt, dass ein Wohn- oder Arbeitszimmer auch im Café gegenüber gelegen sein kann, wenn die eigene Wohnung kaum größer ist als das Bett, in dem man schläft, aber dennoch fast das gesamte Gehalt an Miete kostet. England hat mir das gute alte Hierarchiedenken vermittelt und mir gezeigt, dass in Europa immer noch die Zweiklassengesellschaft existiert, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit kommend auf meinem Nachhauseweg drei Stunden in einer Autoschlange bei Ascot warten musste, bis auch der letzte steinreiche oder adelige Besucher den Parkplatz des Pferderennens verlassen hatte. Es waren teilweise Lücken von fünfzehn Minuten zwischen den Rolls Royces und Bentleys, aber ein Normalsterblicher darf natürlich nicht dazwischen. Es würde dann schließlich das Auge des hinterdrein fahrenden High Society Members mit einem verrosteten Mitsubishi beleidigt. Das verhindert der Bobby mit strengem Blick und seinem Gummiknüppel. In Asien habe ich mein Wertesystem komplett revidiert und bin sehr glücklich darüber, und in USA habe ich gelernt, wie man’s auf keinen Fall machen sollte.
Egal was.
Das zweite Vorwort möchte ich an Nicolas Hofer richten, der mir hoffentlich nicht übel nimmt, dass ich mich eiskalt an der Struktur eines seiner Vorträge entlang hangele und ihn auch teilweise tolldreist zitiere. Das müssen im Übrigen auch Egon Kreutzer und Ulrike Herrmann wegstecken können. Diese drei liefern nämlich das Gerüst und den theoretischen Hintergrund für meine Abhandlung. Alle Zahlen, Daten, Fakten sind hingegen von mir recherchiert und doppelt bis dreifach verifiziert. Für Beispiele und aktuellen Bezug sind hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verantwortlich, mit Ihren hervorragenden Dokumentationen, die üblicherweise gegen drei Uhr morgens ausgestrahlt werden, die aber, dank der Mediatheken, dem interessierten Bürger zu jeder Tageszeit zur Verfügung stehen.
Das dritte und ursprünglich vorgesehene Vorwort sollte ungefähr so klingen:
„Die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auf“, den Spruch habe ich mein halbes Leben lang für eine Scheißhausparole gehalten, für Propaganda der Linken, für den Neid der Besitzlosen. Und wenn ein Vorurteil einmal in der Welt ist, setzt man sich selten mit der Materie auseinander, denn Wissen ist der Tod eines jeden Vorurteils und man hat ja so ungerne Unrecht. Das Gehirn hat Masse, deshalb handelt es sich vermutlich um Trägheit der Masse. Ich erinnere mich aber noch genau, wann und wo ich meinen Irrtum einsah. Mehr oder weniger durch Zufall landete ich bei YouTube auf einem Vortrag von Nikolas Hofer, eher weniger zufällig als mehr, denn für VWL habe ich mich schon immer interessiert und während des Studiums, als eigentlich gar keine Zeit dafür war, da ich es berufsbegleitend absolvierte, habe ich VWL-Bücher verschlungen wie andere Leute Stephen King Romane. Es war spät am Abend und eigentlich war ich müde und wollte ins Bett, aber nach den ersten Sätzen des Vortrags war ich interessiert, nach ein paar weiteren Minuten dann überrascht, denn mein Jahrzehnte altes Vorurteil wurde plötzlich in Frage gestellt. Als das Video nach etwas mehr als einer Stunde endete, war ich angefixt.
Die folgenden Wochen und Monate nutzte ich jede freie Minute, um mir tonnenweise Dokumentationen und Fachartikel einzuverleiben. So ist das mit der Masse des Gehirns, ist Masse erstmal in Bewegung, ist es schwer, sie wieder zu stoppen. Das autodidaktische Aufarbeiten des Themas Wirtschaft hatte bei mir eine krasse Nebenwirkung, plötzlich begannen viele Dinge Sinn zu machen, über die ich mich vorher nur gewundert hatte. Der Ausdruck „alternativlos“ würde zwar erst viel später von Frau Merkel zum geflügelten Wort gemacht werden, aber unterschwellig war genau dieses Sentiment schon da, weil ich schlagartig verstand, warum gewisse Entscheidungen genau so und nicht anders getroffen werden mussten. Gleichzeitig machte sich ein beklemmendes Gefühl breit, weil mir die Ausweglosigkeit in der Entwicklung, die unsere Märkte nehmen, langsam auch bewusst wurde. Meine erste Reaktion war, Bekannte und Arbeitskollegen zu nötigen, sich Dokumentationen wie „Let’s make money“ oder „Der Geist des Geldes“ anzuschauen, um mich anschließend mit ihnen darüber unterhalten zu können. Ich wollte andere Meinungen, Einschätzungen und Ideen zu dem Thema hören.
Dann begann ich, mir alternative Szenarien auszumalen, Lösungsansätze zu suchen, und ich bin ziemlich stolz darauf, an dieser Stelle sagen zu können, dass ich Negativzinsen auf Bankguthaben als quasi „alternativlos“ schon 2010 ankündigte, zwei Jahre bevor sie tatsächlich eingeführt wurden. Die Tatsache, dass diese Entwicklung so kurz bevorstand, und ich dennoch von jedem, mit dem ich es diskutierte, für völlig verrückt erklärt wurde, zeigt, wie wenig der Otto-Normalverbraucher das System versteht, in dem er lebt. Und das bringt uns zu dem Grund, warum ich jetzt hier sitze und diese Abhandlung schreibe. Je mehr Leute die Regeln unseres Geld- und Wirtschaftssystems verstehen, umso mehr Ideen und Vorschläge wird es geben, was man besser machen kann. Und diese Vorschläge werden dringend benötigt, denn wir bewegen uns aus Gründen, die ich hier ausführlich beleuchten werde, unaufhaltsam auf einen Abgrund zu. Und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Exponentiell zunehmende Geschwindigkeit. Und das fatale ist, wenn wir dann auf den Abgrund zurasen, werden wir nicht stehenbleiben, nein, wir werden weitergehen. Denn auch das ist alternativlos.
Letzten Endes habe ich mich aber für ein komplett anderes Vorwort entschieden und möchte Sie fragen, ob Sie James Burke kennen? Nicht den Boxer oder den Mafioso, sondern den Wissenschaftsreporter von der BBC. In den 19 Dreißigern in Nordirland geboren, präsentierte er uns in den 70er und 80er Jahren Sendereihen wie „The day the universe changed“ und „Connections“. Ich weiß gar nicht, ob diese Programme jemals übersetzt und in Deutschland ausgestrahlt wurden (ich hab‘s nachgeschaut, wurden sie nicht). Falls nicht, ist uns Einiges entgangen (Tja). Bei Burke’s Dokumentationen über die großen Erfindungen, Entdeckungen und Entwicklungen der Welt ging es nicht darum, uns einfach die Historie zu erzählen, wenn auch mit dem typischen, trockenen British Humor.
Die Brillanz seiner Programme bestand darin, die „Connections“, die Verbindungen in Alledem aufzuzeigen. Dabei sprang er nicht selten in 25 Minuten von der Entdeckung Amerikas über Chinesischen Tee zur Erfindung der Atomkraft. Er konzentrierte sich immer auf die Ereignisse, die unmittelbar miteinander in Verbindung standen, auch wenn sie Jahrhunderte voneinander entfernt waren, Beispiel: Webstühle -> Lochkarten -> Computer, und erklärte, warum das Eine untrennbar vom Anderen abhing, oder warum es die natürliche oder vielleicht sogar zwangsläufige Folge war. Nichts Anderes habe ich hier vor, nur nicht entlang technischer Erfindungen und Entdeckungen, sondern inmitten der Finanz- und Wirtschaftsprozesse.
Vielleicht werde ich Ihnen gar nicht so sehr viel Neues erzählen, aber mit Sicherheit sind Ihnen nicht alle Verbindungen bekannt, die so Vieles erklären können, was uns täglich „Spanisch“ vorkommt, und die gleichzeitig aber für viele Politiker und für die Banken so sonnenklar sind, dass sich deren gesamtes Handeln alternativlos danach richtet.
Ein Modell hat ausgedient
Wie oft sich ausgerechnet Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsexperten überhaupt nicht mit Geld auszukennen scheinen, ist schon bemerkenswert. Warum das aber tatsächlich der Fall ist, kann man recht leicht nachvollziehen. Es liegt nämlich daran, dass sie unser Wirtschaftssystem mit Modellen erklären, in denen zumeist gar kein Geld vorkommt.
In der wirtschaftlichen Theorie gehen wir nämlich alle auf den Markt oder an die Börse, bringen unsere sämtlichen Waren, Güter und Dienstleistungen mit und tauschen diese miteinander. Dazu haben wir uns auf ein Tauschmittel geeinigt, und das sind rein zufällig diese bunten Zettelchen von der EZB, hätte aber auch etwas ganz Anderes sein können. In diesen wirtschaftlichen Theorien dient das Geld nur als Wertaufbewahrungsmittel oder als Tauschmittel. An diese Begriffe erinnert sich sicherlich noch jeder, der zu irgendeinem Zeitpunkt einmal Wirtschaftslehre studiert hat. Kern des Wirtschaftens ist ja schließlich auch nicht das Geld als solches, sondern der Profit. Es geht ja darum, Gewinne zu erwirtschaften. Jetzt kann man aber ohne das Geld zu verstehen, den Profit erst recht nicht erklären. Dennoch glaubt aber jeder zu wissen, woher dieser Gewinn, dieser Profit, kommt. Wenn nun, und das werden wir in wenigen Absätzen schon bewiesen haben, selbst die Experten das Geld nicht verstanden haben, wie können wir dann alle glauben, wir wüssten, wo Profit herkommt?
Wir hören seit 2008 fast ununterbrochen den Ausdruck „Finanzkrise“, immer wieder auch gerne „Wirtschaftskrise“. „Krise“ aus dem Griechischen, bedeutet laut Duden eine „schwierige Zeit oder Situation, die einen Höhe- und einen Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt“. Die Tatsache, dass diese „schwierige Zeit“ nun schon seit 10 Jahren anhält, spricht also eigentlich bereits dagegen, dass es eine Krise ist. Denn um welche Entwicklung soll es sich hier handeln, und vor allem, wo ist denn der Wendepunkt? Wieso ändert sich die Situation nicht? Dass es sich um einen Wendepunkt gehandelt hat, kann man immer erst im Nachhinein beurteilen. Im Umkehrschluss heißt das, wir können noch gar nicht wissen, ob wir uns eigentlich in einer Krise befinden. Na, das ist doch sehr beruhigend, oder? Der Duden sagt dann aber weiter, „nimmt die Entwicklung einen dauerhaft negativen Verlauf, so spricht man nicht mehr von einer Krise, sondern von einer „Katastrophe“ (wörtlich aus dem Griechischen übersetzt bedeutet das Wort „Niedergang“), und das klingt dann schon deutlich weniger beruhigend. Was ist denn nun wirklich los in unserem marktwirtschaftlichen System?
Bitte ein BIP oder ich kriege die Krise
Eine Krise machen wir, oder machen die Medien, Politiker und Wirtschaftssubjekte netterweise stellvertretend für uns, zumeist am BIP fest. Wächst das BIP, geht es uns gut, stagniert es oder sinkt es, dann sind wir in einer Krise. Aber was schrumpft denn da eigentlich bei negativem BIP? Was genau ist das BIP und warum soll es uns schlecht gehen, wenn diese Zahl schrumpft? Und was hat das Wachstum des BIP mit Wohlstand und Krisen zu tun?
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der sogenannte Produktionswert einer Wirtschaft abzüglich der Vorleistungen, um genau zu sein, werden offiziell noch Gütersteuern addiert und Subventionen abgezogen, das können wir aber an dieser Stelle erst einmal ignorieren. Wenn man Leistungen ans Ausland abzieht und Leistungen von Deutschen im Ausland addiert, ist man übrigens beim Bruttosozialprodukt, einem Begriff, der den Älteren noch bekannt vorkommen müsste. Er ist aber seit Geier Sturzflug nicht mehr in regelmäßigem Gebrauch, vermutlich weil er mit der Bedeutung des Wortes „sozial“ noch viel weniger zu tun hat als mit dem Wohlstandsbegriff.
Als Unternehmer muss ich, um beispielsweise einen Tisch zu bauen, generell in Vorleistung gehen. Ich brauche eine Idee, also die Vision von einer Platte mit vier Beinen drunter. Und in der Regel auch Geld, um Holz zu kaufen und mindestens einen Arbeiter zu bezahlen, der mir das Ding sägt und zusammenschraubt. Diese Vorleistung muss ich dann von der Bewertung des Tisches abziehen, nichts Anderes ist das BIP. Wenn mich die Vorleistungen 100 Euro gekostet haben, und ich den Tisch mit 200 bewerte, dann entspricht mein persönliches BSP, mein Bruttoschreinereiprodukt, genau 100 Euro. Das BIP ist nur eine Zahl, ein Buchwert, es kann realisierte Gewinne enthalten, wenn ich den Tisch tatsächlich für 200 verkaufen konnte, muss es aber nicht. Und als Zahl abstrahiert es auch völlig vom Inhalt, von dem, was eigentlich hergestellt wurde. Der Buchwert kann natürlich auch Hoffnungen beinhalten, die nennt man Zuschreibungen, zum Beispiel in der Bewertung von Immobilien.





























