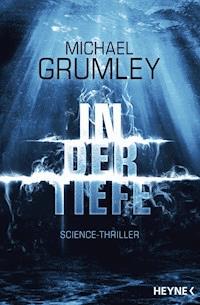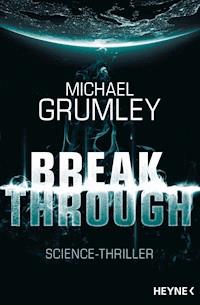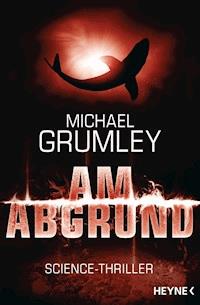
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Breakthrough-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Auf einer einsamen Insel mitten im Arktischen Ozean wird eine geheimnisvolle Kammer entdeckt, in der sich Millionen von eigenartigen Samenkapseln befinden. Bei näherer Untersuchung stellt sich heraus, dass diese Kapseln außerirdischen Ursprungs sind. Wer hat diese Kammern gebaut? Und zu welchem Zweck? Sonderermittler John Clay und Meeresbiologin Alison Shaw nehmen die Sache genauer unter die Lupe und stoßen dabei auf ein uraltes Geheimnis. Ein Geheimnis, das alles, was wir bisher über die Evolution zu wissen glaubten, infrage stellt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Ähnliche
Das Buch
Im Jahr 1984 wurde auf einer einsamen Insel im Arktischen Mittelmeer ein Atombunker errichtet. Im Falle einer nuklearen Katastrophe sollte hier das genetische Erbe der Menschheit aufbewahrt werden. Nun, Jahrzehnte später, wird ein zweiter Bunker entdeckt. Wer hat ihn erbaut? Und zu welchem Zweck? Es ist jedoch nicht der Bunker selbst, der das Team um Sonderermittler John Clay und Meeresbiologin Alison Shaw vor ein Rätsel stellt, sondern die Abermillionen von Samenkapseln, die sich darin befinden. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Kapseln außerirdischen Ursprungs sind. Welche Spezies würde Lichtjahre durchs Universum reisen, um ihren genetischen Code auf der Erde zu deponieren? John Clay und Alison Shaw versuchen, das Geheimnis um die mysteriösen Kapseln zu lüften, und stoßen dabei auf eine uralte Wahrheit. Eine Wahrheit, die alles, was die Menschheit bisher über die Evolution zu wissen glaubte, infrage stellt …
Die Breakthrough-Reihe:
Erster Roman: Breakthrough
Zweiter Roman: In der Tiefe
Dritter Roman: Am Abgrund
Der Autor
Michael Grumley arbeitet in der Informationstechnologie, doch seine große Leidenschaft gehörte schon immer der Literatur. Seit Jahren träumte er davon, selbst einmal einen Roman zu schreiben, der eine einzigartige Geschichte erzählt. Mit seiner Breakthrough-Serie hat er sich diesen Traum erfüllt. Der Autor lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Kalifornien.
Mehr über Michael Grumley und seine Romane erfahren Sie auf:
MICHAEL GRUMLEY
AM
ABGRUND
SCIENCE-THRILLER
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Wally Anker
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der amerikanischen OriginalausgabeCATALYST
Deutsche Erstausgabe 10/2018
Redaktion: Elisabeth Bösl
Copyright © 2015 by Michael Grumley
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung eines Motivs von solarseven/Shutterstock
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-21340-4V002
www.diezukunft.de
Prolog
Steve Caesare zuckte vor Schmerzen zusammen, als er seinen Ärmel hochkrempelte und die Hand auf den Griff seiner Waffe legte. Der Flur, in dem er sich befand, war von weißen Marmorwänden umgeben und mit einem dicken beigefarbenen Teppich ausgelegt, sodass er sich der Tür mehr oder weniger lautlos nähern konnte.
Caesare blickte zu einem der von der Decke hängenden Kronleuchter auf und suchte seine Umgebung nach Kameras ab. Wenn es sie gab, dann waren sie sehr gut versteckt. Seine Hoteluniform war ihm viel zu klein, und es schien, als ob seine breiten Schultern den Stoff jeden Augenblick zum Platzen bringen könnten. Jeder, der auch nur einen flüchtigen Blick auf den Monitor warf, würde sofort merken, dass hier etwas nicht stimmte.
Das Tivioli Mofarrej war eines der elegantesten Hotels in São Paulo und bei Weitem das teuerste. Es wurde nur von der betuchtesten Kundschaft genutzt und strahlte, wie es da über dem Stadtbild von Brasiliens reichster Stadt ragte, ein Gefühl von Macht und Prestige aus.
Er hatte zwei ganze Wochen gebraucht. Zwei Wochen, um den Mann zu finden, vor dessen Tür er jetzt in diesem Korridor stand. Miguel Blanco ließ es sich mit dem, was er von Mateus Alves, seinem ehemaligen Arbeitgeber und einem der reichsten Männer Südamerikas, gestohlen hatte, offensichtlich gut gehen. Nachdem er seinen ehemaligen Boss umgelegt hatte, war es ihm gelungen, beinahe einhundert Millionen brasilianische Reals von diversen Konten und Fonds abzuheben. Es handelte sich zwar nur um einen Bruchteil des Vermögens des alten Mannes, aber es war völlig ausreichend – auf jeden Fall genug, um nun der Elite anzugehören, die Blanco den Großteil seines Lebens beschützt hatte.
Einfach war das sicher nicht gewesen. Zugang zu Alves’ Konten zu erhalten war das eine. Außerdem hatte Blanco dabei Hilfe gehabt. Viel schwieriger dürfte es gewesen sein, die Spuren zu verwischen. Dazu hatte Blanco Hilfe von mehreren guten Compadres gebraucht, die nicht nur äußerst diskret sein mussten, sondern auch von der Auflösung von Alves’ unvorstellbarem Reichtum nicht schlecht profitierten.
Caesare war jedoch nicht auf das Geld aus. Er war aus einem anderen Grund hier. Der Mörder war genauso korrupt wie der Alte selbst, und Caesare hatte keinerlei Sympathie für die beiden. Nein, er befand sich aus nur einem einzigen Grund hier: Vergeltung.
Er stand jetzt vor dieser Tür, weil Blanco ihn auf dem Berg hatte umbringen wollen. Doch Caesare lebte. Nach einer zweiwöchigen Suche war es jetzt an der Zeit, ihm einen kleinen Überraschungsbesuch abzustatten.
Caesare näherte sich der Tür, sah aber weder eine Wache noch einen Aufpasser, was ihn stutzig werden ließ. Gäste, die in der Präsidentensuite nächtigten, verfügten normalerweise über einen Sicherheitsdienst. Aber wo befand sich Blancos? Der Mann war einmal Offizier beim brasilianischen Geheimdienst gewesen. Entweder war er viel zu selbstsicher, oder komplett paranoid. Wenn er paranoid war, wo warteten seine Sicherheitsleute?
Blanco war auf jeden Fall hinter dieser Tür. Zumindest war das der Stand der Dinge vor einer halben Stunde gewesen. Caesare hatte das Telefonsignal lokalisiert. Es war wenige Meter von dem Punkt, an dem er jetzt stand, gekommen, ehe es abrupt verschwunden war. Drei Meter von der Tür entfernt zog Caesare leise seine Glock .40 aus dem versteckten Halfter und legte den Zeigefinger auf den Abzug. Er neigte den Kopf zur Seite und checkte den Flur hinter sich ein letztes Mal aus dem Augenwinkel.
Als er zur Tür kam, näherte er sich seitlich und hielt die Waffe an der rechten Hüfte. Dann hob er sie mit einer sanften Bewegung und lehnte sich vor, um zu lauschen. Er hörte keinen Ton, keine Stimmen, keinen Fernseher. Nichts.
Als Blanco Rio de Janeiro verlassen hatte, hatte sich nur eine Person in seiner Begleitung befunden: Alves’ langjährige Assistentin Carolina Sosa. Sie war diejenige, die ihm Zugang zu den vielen Konten und den relevanten Informationen ihres Chefs verschafft hatte. Sie war der Schlüssel zu Alves’ Reichtümern.
Caesare zog eine kleine Karte mit Magnetstreifen hervor. Sie war zwar gebraucht, aber ungemein nützlich und stammte aus einem Hotel, für das er einige Stunden durch São Paulo hatte hetzen müssen, um es zu finden. Es war der Arbeitsplatz eines Kontakts, der Generalschlüssel für beinahe jedes Hotel in der Stadt programmieren konnte.
Caesare hielt die Karte in der linken Hand und drehte die rechte, um einen Blick auf seine Uhr zu werfen.
Jetzt wäre nicht schlecht, Will.
Endlich klingelte das Telefon in der Suite. Caesare nahm seine Chance wahr und zog die Karte durch das Türschloss, während er gleichzeitig die Hand auf die Klinke legte und sie hinunterdrückte. Das laute Klicken wurde vom Klingeln des Telefons übertönt, und Caesare lehnte sich gegen die Tür und öffnete sie einen Spaltbreit – gerade genug, dass sie sich nicht wieder von selbst schloss. Im gleichen Augenblick setzte er seinen linken Fuß nach vorne, um sie offen zu halten.
Das Telefon klingelte erneut, und es hallte durch die gesamte Suite. Nach dem dritten Klingeln verstummte es wieder, und es herrschte absolute Stille. Caesare warf einen weiteren Blick über die Schulter, ehe er sein Ohr an die offene Tür legte. Keine Schritte. Keine Bewegung. Nichts.
Er lehnte sich gegen die Tür und drückte sie auf, bis ihm ein kühler Luftzug ins Gesicht wehte. Geräuschlos öffnete er sie weiter, bis er einen Blick ins Innere der Präsidentensuite werfen konnte. Hinter dem Eingangsbereich bemerkte er einen dunklen, polierten Tisch, umringt von perfekt arrangierten Stühlen.
Er trat ein, die Waffe noch immer schussbereit an der Hüfte. Als er sich umdrehte, um die Tür sanft wieder ins Schloss fallen zu lassen, schoss der Schmerz in seinen Rippen durch seinen Körper – das Resultat der beinahe tödlichen Verletzung, die Blanco ihm zugefügt hatte.
Die Tür fiel leise klickend ins Schloss, und Caesare schlich über den makellosen Marmorboden des Eingangsbereichs. Dann trat er in den kurzen Flur und schielte vorsichtig um die Ecke.
Er erstarrte.
Das hatte er nicht erwartet. Der Raum schien in tadellosem Zustand außer zwei Stühlen, die in seiner Mitte standen. Auf jedem Stuhl saß eine reglose Gestalt, festgebunden und voller Blut. Beide hatten einen Knebel im Mund, und ihre Köpfe waren nach vorne gesunken.
Die erste Gestalt war eine Frau. Ihr dunkles Haar hing ihr ins Gesicht, sodass Caesare sie zuerst nicht wiedererkannte. Es war Carolina Sosa. Der Mann war Miguel Blanco. Sein lebloser Körper wurde lediglich von den Fesseln auf dem Stuhl gehalten.
Keiner bewegte sich.
Caesare verschwand augenblicklich wieder hinter der Ecke, bis nur noch seine Waffe und die Hälfte seines Gesichts zu sehen waren. Es schien noch alles sehr frisch zu sein, und es war durchaus möglich, dass sich der Mörder noch in der Suite befand. Caesare wartete eine Minute, ehe er sich langsam von der Wand löste, um einen besseren Blick in den Raum werfen zu können. Er schlich vorwärts, trat auf den dicken Teppich, erreichte die nächste Tür, hielt sich aber so weit wie möglich von der Ecke fern, um den besten Blickwinkel zu behalten.
Es dauerte einige Minuten, ehe er sich derart durch die gesamte Präsidentensuite gearbeitet hatte. Überzeugt davon, dass er alleine war, begab er sich wieder ins Wohnzimmer und starrte auf die zwei regungslosen Gestalten.
Er ging auf sie zu und musterte Carolinas mit dunklen Haarsträhnen bedecktes Gesicht. Darunter sah er, dass ihre Haut mit Blutergüssen übersät war.
Er ging an ihr vorbei und stellte sich vor Blanco. Sein Gesicht war ebenfalls komplett grün und blau geschlagen, und sein Knebel drohte aus dem Mund zu fallen.
Caesare starrte ihn eine Weile an, ehe er endlich den Kopf schüttelte. Ein Leben voller Betrug und Hinterlist endete normalerweise recht abrupt und mitunter auch gewaltsam. Das eng gezogene Gummiband um Blancos Arm verriet Caesare, dass Blanco sämtliche Geheimnisse verraten hatte. Sie hatten ihn unter Drogen gesetzt, um die Informationen dann wortwörtlich aus ihm herauszuprügeln.
Schade nur, dass Caesare zu spät gekommen war. Zumindest hätte Blanco ihre Begegnung überlebt. Er blickte sich ein letztes Mal um, ehe er seine Waffe zurück in den Halfter gleiten ließ.
Caesare drehte sich zur Tür um und wollte schon gehen, als er plötzlich etwas im Augenwinkel bemerkte. Er hatte seine Waffe schon wieder gezogen, ehe sein Gehirn überhaupt verarbeitet hatte, was geschehen war.
Blanco hatte sich bewegt.
Es war kaum merklich gewesen, aber er hatte sich definitiv bewegt. Blancos Augen blieben weiterhin geschlossen, aber Caesare war sich sicher, dass es sich hier nicht um das letzte Zucken eines Toten gehandelt hatte. Er wartete mit beiden Händen an der Waffe. Dann geschah es erneut.
Caesare legte eine Hand unter das Kinn des Brasilianers und hob sanft dessen Kopf an, ehe er den Rest des Knebels aus seinem Mund zog. Die angeschwollenen Augenlider zuckten, ehe sie sich einen Spaltbreit öffneten. Dunkle unkoordinierte Augen erspähten Tageslicht.
»Blanco«, flüsterte Caesare.
Es dauerte eine Weile, ehe dieser seine Augen auf Caesare richtete. Aber kaum hatte er es geschafft, erkannte er ihn sofort wieder und riss sie weit auf.
Caesare wollte Blanco schon anlächeln und ihm das Wort »surpresa« ins Ohr flüstern, konnte sich aber noch zurückhalten. Stattdessen richtete er sich wieder auf und ging zum Telefon. Er hatte den Hörer schon abgenommen, als Blanco etwas hinter ihm hervorprustete.
»Não!« Einen Augenblick später murmelte er erneut etwas, diesmal aber auf Englisch. »Nicht anrufen.«
»Ich hole Hilfe.«
Blanco senkte die Augen und musterte seinen Arm, auf dem neben dem Einstich ein Tropfen Blut klebte. »Für … mich … gibt … es … keine Hilfe mehr«, sagte er schwach.
Caesare kniete sich vor ihm hin. »Wer war das?«
»Otero«, flüsterte er.
Caesare beugte sich über Blancos Ohr. »Was wollte er?«
»Bitte.« Blancos Stimme wurde schwächer. »Bitte … Retten Sie sie.«
Caesare blickte sich in der Suite um. »Retten? Wen denn?«
Blanco konnte kaum noch die Lippen bewegen. »Meine Familie.«
1
Admiral Langford blickte auf, als John Clay die Tür zu seinem Büro öffnete. Hinter ihm stand Will Borger. Der Admiral winkte sie schnell zu sich, drückte einen Knopf auf seinem Telefon und legte den Hörer in seiner Hand auf die Gabel.
»Okay, Clay und Borger sind hier. Fahren Sie fort, Steve.«
»Bom dia, Gentlemen«, ertönte Caesares Stimme über den Lautsprecher. »Wir haben hier unten wirklich tolles Wetter. Brandheiß und schwül.«
Clay lächelte. »Klingt entzückend.«
»Ja, nur leider ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.«
»Hast du Blanco gefunden?«
»Oh, ja, das habe ich. Aber er war bedauerlicherweise nicht in der besten Verfassung. Genau genommen ist er tot.«
Clay und Borger schenkten Langford einen überraschten Blick.
»Tot?«, wiederholte Borger verwirrt. »Aber wir haben doch den Telefonanruf geortet, ehe er sein Handy ausschaltete. Das ist gerade mal eine Stunde her.«
»Tja, wie das Leben halt so spielt, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass er das Handy selbst ausgeschaltet hat. Ich habe ihn grün und blau geprügelt in seiner Suite gefunden. Carolina Sosa hatte bereits das Zeitliche gesegnet, und Blanco blieben nur noch wenige Minuten auf dieser Welt. Ich konnte nichts mehr für ihn tun.«
»War er bei Bewusstsein?«
»Kaum. Ich konnte ein wenig aus ihm herauskitzeln. Aber wirklich nur ein wenig.«
Clay bemerkte ein Echo am anderen Ende. »Wo bist du?«
Caesare warf rasch einen Blick die metallenen Stufen empor und hinab, während er sich mühevoll aus der gestohlenen Uniform pellte. »Ich bin im Treppenhaus des Hotels.«
Langford starrte auf das Telefon. »Wissen Sie, wer es getan hat?«
»Ein gewisser Otero. Hat einer von euch schon mal von ihm gehört?«
Die drei Männer schüttelten die Köpfe. »Nein.«
Caesare nickte. »Ich gehe davon aus, dass er etwas mit Alves am Hut hatte.«
»Wieso das?«
»Weil er etwas Bestimmtes wollte«, gab Caesare zurück.
»Was soll das denn heißen?«
»Das Geld schien ihm völlig gleichgültig. Er wollte Antworten.«
»Antworten worauf?«
»Soweit ich einschätzen kann, Antworten bezüglich Alves. Wer auch immer dieser Otero ist, er sucht nach etwas. Geld ist einfach zurückzuverfolgen, aber Blanco und seine Freundin machten den Eindruck, als ob sie Opfer eines veritablen Verhörs waren, inklusive Wahrheitsserum. Als krönenden Abschluss gab es dann einen tödlichen Cocktail direkt ins Blut gespritzt. Aber wie auch immer, ich wette, dass dieser Otero nicht mit meinem Besuch gerechnet hat. Erst recht nicht vor dem Tod Blancos.«
Langfords Stirn war gerunzelt, als er sich näher über das Mikrofon beugte. »Welche Informationen haben Sie aus Blanco herauskitzeln können?«
»So gut wie keine«, entgegnete Caesare. »Er war schon recht mitgenommen. Aber sein letztes verständliches Wort lautete: mamaco.«
»Mamaco?«
Caesare hatte sich endlich gänzlich der Uniform entledigt. »Das ist Portugiesisch und heißt Affe, Admiral. Otero weiß offensichtlich von Alves’ Reservat in Brasilien, und er weiß auch von dem Affen.«
Langford bemerkte, wie Clay und Borger einen Blick austauschten. Bei dem Affen handelte es sich um einen kleinen Kapuzineraffen, den ein Team von »Forschern« entdeckt hatte, das im Auftrag des alten Mannes gearbeitet hatte, ehe er umgebracht worden war. Eigentlich waren es Wilderer. Alle außer einem. Er war ein echter Forscher gewesen und mehr oder weniger durch Zufall über einen sehr besonderen Kapuzineraffen gestolpert. Dieser Affe war so ganz anders als all die Tiere, die sich zuvor in ihren Netzen verheddert hatten.
Dieser war nämlich hochintelligent, und während die normale Lebenserwartung eines Kapuzineraffen bei ungefähr fünfundzwanzig Jahren lag, stellte sich heraus, dass dieser um ein Vielfaches älter war. So viel älter, dass der Multimilliardär Mateus Alves alles daransetzte, zwei Ziele zu erreichen: Er wollte herausfinden, woher der Affe stammte, und niemand sollte herausfinden, was er vorhatte.
Langford konnte förmlich die Rädchen in Clays Hirn rattern hören. »Clay?«
Dieser schenkte dem Admiral einen kurzen Blick, ehe er sich an das Mikrofon richtete. »Wie hat Otero von dem Affen erfahren, beziehungsweise woher weiß er überhaupt, dass Alves nach ihm suchte?«
»Und warum verließ jemand wie Alves freiwillig sein milliardenschweres Imperium und verschwand komplett aus dem Licht der Öffentlichkeit?«, ergänzte Caesare.
»Otero muss von irgendwoher Wind davon bekommen haben«, mutmaßte Clay. »Aber wie?«
»Blanco hat sich sehr gut umgehört, mit vielen Leuten gesprochen«, überlegte Caesare. »Vielleicht wollte er Profit aus Alves’ Entdeckung schlagen. Es ist durchaus möglich, dass er jemanden gefunden hat, der verrückt genug war auf seinen Vorschlag einzugehen.«
Clay nickte gedankenverloren. Das war natürlich eine Möglichkeit. Außer das mit der Verrücktheit. Sie wussten alle, dass Alves alles andere als verrückt gewesen war. Die Heimat des Affen auszumachen war eine Sache. Was Alves aber wirklich wollte, war die DNS, denn die DNS eines Primaten und die eines Menschen unterscheiden sich um nur ein Prozent. Sollte ein Primat also viermal so alt werden, wie es eigentlich möglich war, dann konnte das unter Umständen auch auf Menschen übertragen werden.
Alves war alt gewesen, Mitte achtzig, und sein einziges Ziel hatte darin bestanden, sein eigenes Leben zu verlängern. Er hatte geglaubt, endlich die Superdroge gefunden zu haben, die ihm das ermöglichen konnte.
Clay nahm den Faden auf. »Aber man würde Blanco doch nicht einfach so mir nichts dir nichts umbringen … Nicht wegen des Wortes ›Affe‹. Ich bin mir sicher, dass sie mehr Informationen aus ihm herausgeprügelt haben. Vielleicht sogar viel mehr. Vielleicht sogar so viel, dass es sich lohnte, Blanco auf der Stelle zu ermorden. Nur so würde er schweigsam bleiben.«
Langford rieb sich das Kinn. »Dann müssen wir davon ausgehen, dass dieser Otero alles weiß.« Er holte tief Luft und beugte sich vor. »Ich möchte, dass wir das Szenario kurz durchspielen, denn es kommt mir so vor, als ob wir jetzt ein noch größeres Problem haben. Ich habe soeben einen Bericht unseres Bergungsteams vor der Küste Guayanas erhalten. Sie haben genügend Reste der Torpedohülle und Rückstände des darin enthaltenen Sprengstoffes ausfindig gemacht, um ihn positiv identifizieren zu können.« Langford hielt kurz inne und blickte zu Clay und Borger auf. »Die Bowditch wurde nicht von den Russen versenkt, wie wir anfangs angenommen hatten. Es waren die Chinesen.«
Clay und Borger hatten schon ihre Überraschung bei der Nachricht nicht verbergen können, dass Blanco tot war. Jetzt aber schienen sie absolut sprachlos.
Die Versenkung eines der modernsten Forschungsschiffe der amerikanischen Marine zwei Wochen zuvor schien bisher ein komplett separates Ereignis gewesen zu sein.
War es aber offensichtlich nicht. Es hatte direkt etwas mit dem Tod des Multimilliardärs Alves zu tun, was aber niemand hätte ahnen können. Die U.S.S. Bowditch hatte ein chinesisches Kriegsschiff beobachtet, das Monate zuvor so unauffällig wie nur möglich an der nördlichen Küste Südamerikas in Guayana angedockt hatte.
Und was die Chinesen dort vorgehabt hatten, war eine wahre Offenbarung gewesen. Die Crew des Schiffes war im Schutz der Dunkelheit regelmäßig in den Dschungel ausgerückt, denn die Chinesen hatten eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht – und zwar auf demselben Berg, von dem Mateus Alves vermutet hatte, er sei die Heimat des rätselhaften Kapuzineraffen.
Caesares Stimme ertönte als Erstes über den Lautsprecher. »Admiral, habe ich Sie richtig verstanden? Die Chinesen sollen die Bowditch versenkt haben?«
»Genau das habe ich gesagt.«
»Aber das einzige U-Boot in der Gegend war doch russisch.«
»Das Einzige, von dem wir wussten.«
»Einen Augenblick, bitte.« Clay warf Langford einen Blick zu. »Das kann nur bedeuten, dass das chinesische U-Boot die ganze Zeit vor Ort war.«
»So sieht es aus.«
»Und es wartete damit, die Bowditch anzugreifen, bis das Kriegsschiff samt Ladung ausgelaufen war.«
Langford nickte. Clay wusste so gut wie kein anderer, was danach geschehen war. Schließlich war er zum Zeitpunkt des Angriffs an Bord gewesen.
»Das ist es!«, entfuhr es ihm. »Deswegen hat das Kriegsschiff nie angegriffen … Es konnte nicht. Und genau deswegen war auch das U-Boot vor Ort. Als Schutz. Um dafür zu sorgen, dass das Kriegsschiff unversehrt auslief.«
»Sie mussten das Innere des Kriegsschiffes komplett ausschlachten, um genug Platz für die Ladung zu machen.«
Clay nickte, als sich das Puzzle vor seinem inneren Auge wie von selbst zusammenfügte. »Die haben monatelang Kisten aus dem Dschungel geschleppt. Es waren so viele, dass sie nie im Leben in ein Kriegsschiff gepasst hätten. Es ist einfach viel zu voll mit Waffen und Munition. Es sei denn, sie schlachteten es aus. Nur wenn sie sämtliche Gerätschaften ausbauten, hatten sie genügend Platz für ihre Fracht. Aber das bedeutete auch, dass sie wehrlos waren. Das U-Boot hat auf das Schiff gewartet, um notfalls den Weg freizumachen.«
Langford beobachtete, wie sich Clays Gesichtsausdruck veränderte. Clay besaß das Gedächtnis eines Elefanten. Wenn man ihm genügend Zeit ließ, konnte er so gut wie jeden Fall lösen.
»Nun, das war clever«, bemerkte Caesare.
Langford runzelte die Stirn. »Die Russen wären schon schlimm genug gewesen, aber die Chinesen stellen ein ganz neues Problem dar.«
Clay ging derselbe Gedanke durch den Kopf. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland hatten nach dem Fiasko in der Ukraine einen neuen Tiefpunkt erreicht. Und das diplomatische Verhältnis zwischen Washington und China hatte auch schon bessere Tage gesehen, insbesondere, da die Chinesen öffentlich die Russen unterstützten. Bis zu dem Zeitpunkt war China, dank des jahrzehntelangen Handelsverkehrs, stets ein geopolitischer Partner der U.S. gewesen, wenn auch ein widerwilliger. Aber in den letzten Jahren hatte China einen eigenen Weg eingeschlagen und sich immer weiter von der Position der Vereinigten Staaten abgewandt, bis es quasi die Gegenstellung einnahm. Sollte publik werden, dass die Volksrepublik ein Forschungsschiff der Vereinigten Staaten angegriffen und versenkt hatte, würde die ganze Sache eskalieren und außer Kontrolle geraten.
»Und was geschieht jetzt?«, wollte Clay wissen.
Langford schüttelte den Kopf. »Nichts Gutes. Was auch immer die Chinesen auf dem Berg gefunden haben, sie waren bereit, einen Krieg dafür anzuzetteln. Aber täuschen Sie sich nicht, wir hätten genauso gehandelt.«
Langford rieb sich die Augen. Das Außenministerium hatte bereits begonnen, die Russen für die Versenkung der Bowditch zu beschuldigen. Jetzt müsste es seine Aussagen wieder zurückziehen und sich stattdessen auf China konzentrieren, durfte aber auf keinen Fall bestehende Handelsbeziehungen kompromittieren. Sollten diese abbrechen, würde es schlimm enden, und niemand würde als Sieger hervorgehen. Der einzige Ausweg, der der Regierung blieb, war das Thema klein zu halten und es später zu einem strategisch cleveren Gegenangriff zu benutzen. Langford wusste, dass die amerikanischen Politiker nicht ruhen würden, bis sie ihre Rache hatten, ganz gleich welche langfristigen Auswirkungen sie nach sich ziehen würde. Die unschöne Wahrheit lautete, dass Politiker Kriege anzettelten, sich aber auf Langfords Männer beriefen, um sie zu führen und in ihnen zu fallen.
Langford blinzelte und starrte das Telefon an. Es herrschte Stille im Raum. Er setzte sich in seinem Stuhl auf und ergriff das Wort: »Für den Augenblick möchte ich, dass Sie drei alles über Otero herausfinden. Alves hatte Beziehungen, und ich bin mir sicher, dass das Gleiche für seine Lakaien gilt. Vor allen Dingen müssen wir verhindern, dass die brasilianische Regierung Wind davon kriegt und sich einmischt.«
»Ja, Sir«, kam die Antwort der drei beinahe gleichzeitig zurück.
Langford beendete den Anruf, indem er einfach auflegte. Dann blickte er Clay und Borger nach, die seine Bürotür öffneten und in den Flur traten.
Und somit hatte das Spiel wieder einmal begonnen.
Der Admiral stöhnte kurz auf. Bald schon musste er seinen Leuten erklären, wie es dem chinesischen Kriegsschiff ergangen war, nachdem es mit seiner wertvollen Fracht erfolgreich aus Georgetown ausgelaufen war. Und das ergab überhaupt keinen Sinn.
2
Clay folgte Will Borger in dessen finsteres Büro, auch wenn das Wort ›Büro‹ angesichts des Raums, den Will zur Verfügung hatte, ein wenig zu hoch gegriffen war. Er befand sich in einem Keller des Pentagons und würde ungemein von Fenstern und etwas Sonnenlicht profitieren. Und von jemandem, der ab und zu aufräumte. Computer und sonstige technische Gerätschaften, von denen die wenigsten Menschen wussten, wozu sie gut sein mochten, stapelten sich bis zur Decke. Einige Teile schienen das gleiche Alter wie Borger zu haben, der bald seinen fünfzigsten Geburtstag feiern würde.
Will trat an seinen Schreibtisch, auf dem drei Monitore nebeneinander standen. Clay schloss die Tür hinter ihnen.
Mit einem lauten Knarzen nahm Borger auf seinem Stuhl Platz und zog einen weiteren für Clay herbei. »Bitte setzen Sie sich.«
»Nein danke, ich stehe gerne.«
Borger nickte und wandte sich wieder seinen Monitoren zu. »Ich muss Ihnen etwas zeigen. Etwas, von dem niemand sonst weiß.«
Clay schaute zu, wie Borger ein neues Fenster auf einem der Monitore öffnete und zu tippen begann. Einen Augenblick später erschien eine Landkarte auf dem mittleren Monitor. Borger hob eine Hand und deutete kurz auf eine große Festplatte, die unter dem Monitor lag.
»Das hier ist die Festplatte, die ich auf der Bowditch benutzt habe. Man kann von Glück sagen, dass ich sie in meinen Rucksack gepackt habe, ehe wir das Schiff verlassen mussten.«
Clay warf Borger einen Blick zu. »Ist es etwa die mit dem Videomaterial?«
»Richtig.« Er zeigte mit der Linken auf die Landkarte und nahm die Maus in die rechte Hand. Die Karte zeigte einen Ausschnitt Südamerikas, genauer gesagt Guayanas. Borger klickte einige Male, um nach Georgetown zu zoomen. »Als wir zurückkamen, wollte ich herausfinden, was wirklich mit der Bowditch passiert war. Also habe ich sämtliche Daten von den ARGUS-Satelliten vor und nach dem Angriff heruntergeladen.«
Clay beugte sich über Borgers Schulter und wartete, bis die Karte vollständig geladen hatte. Einen Augenblick später konnten beide die U.S.S. Bowditch klar und deutlich im Wasser vor Georgetown liegen sehen.
»Da ist sie ja«, flüsterte er.
Es handelte sich um ein Standbild, aber das weiße Kielwasser hinter dem Schiff verriet, dass es unter Volldampf auf Georgetowns kleinen Hafen zufuhr. Und zwar direkt auf das chinesische Kriegsschiff zu, das ihn verlassen wollte.
Borger zoomte ein wenig heraus. Die beiden Schiffe wurden kleiner, aber plötzlich sah Clay etwas, kaum sichtbar im Kielwasser einige Hundert Meter hinter der Bowditch.
Ein Torpedo.
Borger drückte auf eine Taste, und das Standbild begann sich zu bewegen. Er neigte sich zur Seite, um Clay freien Blick vom Geschehen zu gewähren. Wenige Augenblicke später sah er, wie sich der Bug der Bowditch bewegte. Clay wusste, dass Captain Krogstad in jenem Moment den Befehl gegeben hatte, das Unmögliche zu tun. Er hatte das Schiff umdrehen wollen.
»Um Gottes willen«, murmelte Clay.
»Es ist nicht leicht, sich das anzusehen.«
»Wohl wahr.«
Die nächsten Minuten verbrachten sie schweigend vor dem Bildschirm und sahen zu, wie sich das Schiff quälend langsam drehte. Das Manöver war nur wenige Augenblicke vor dem Torpedoeinschlag vollbracht.
Die Bowditch war ein Forschungsschiff, sodass es sich auf keinerlei erwähnenswerte Waffensysteme berufen konnte – und erst recht auf nichts, was einen Torpedoangriff zu vereiteln vermochte. Die einzig offensive Alternative bot der Oceanhawk Helikopter, der auf dem Hauptdeck stand. Sie schauten zu, wie sich die Rotoren zu drehen begannen, ein verzweifelter Versuch, vor dem Einschlag abzuheben. Aber er war zu spät dran. Der Anblick der Explosion der Backbordseite verschlug ihnen selbst auf dem Video den Atem. Der Großteil des Vordecks verschwand von einem Augenblick zum anderen. Der Oceanhawk, noch immer auf einem Teilstück stehend, fand ein jähes Ende. Clay und Borger mussten geschockt mit anschauen, wie er aufgrund der Explosion auf die Seite rollte, seine sich immer schneller drehenden Rotoren auf das Deck schlugen und in tausend Stücke zerbarsten. Dann fiel er komplett um und verschwand in einem riesigen orangen Feuerball.
Der Rest des Videos zeigte die Ereignisse genau so, wie sie die beiden Männer in Erinnerung hatten. Sie sahen jeden, sich selbst darunter, auf dem Achterdeck stehen, wie Captain Krogstad es ihnen befohlen hatte. Wenn er schon nicht von dem Torpedo davonlaufen konnte, lautete seine Mission, so viele Leben wie nur möglich zu retten. Die Rettungsboote ließen sich am besten vom Achterschiff ablassen, während der Rest des Schiffes geopfert wurde, um den Großteil der Explosion zu absorbieren.
Als die Bowditch unter Wasser verschwand, pausierte Borger das Video. »Das ist erst das zweite Mal, dass ich mir das angeschaut habe.«
Clay nickte, die Augen noch immer auf den Bildschirm gerichtet. »Das kann ich nachvollziehen.«
Borger holte tief Luft und wandte sich an Clay. »Aber es gibt noch etwas, das Sie sehen sollten.«
Clay hob die Augenbrauen und wartete.
Borger legte die Hände auf seinen hervorstehenden Bauch. »Ich habe mir auch den Rest des Videos angeschaut und bin mir nicht sicher, ob Sie es wissen, aber die Explosion war gewaltig und groß genug, um die meisten kommerziellen Flugzeuge in der Gegend sofort zum Landen zu zwingen – und zwar in einem Umkreis von mehreren Hundert Kilometern, also in einem Umkreis, der groß genug ist, um bis nach Venezuela zu reichen.«
»Nein, das habe ich nicht gewusst.«
»Nun, jetzt tun Sie es. Jeder Flug. Landen. Das war’s.« Ein Lächeln breitete sich auf Borgers Miene aus. John Clay kannte diesen Gesichtsausdruck nur zu gut.
»Sie haben etwas gefunden.«
»Alle Flugzeuge befanden sich auf dem Boden und waren mit einem Startverbot belegt«, wiederholte er. »Alle kommerziellen Flieger.«
Clay hob eine Augenbraue. »Aber …«
»Aber Militärmaschinen nicht.«
»Und das soll heißen …?«
»Das soll heißen«, gab Borger zurück, »dass Militärmaschinen nicht zum Landen gezwungen wurden. Oder soll ich sagen … die einzige Militärmaschine in der Gegend.« Er tippte erneut auf der Tastatur herum, und eine zweite Landkarte mit Georgetown in der Mitte erschien auf dem Monitor. Borger zeigte erst auf die eine Karte, dann auf die andere. »Das hier ist der internationale Flughafen in Guayana. Bitte merken Sie sich den Zeitstempel auf beiden Karten.
»Die Aufnahmen sind zeitgleich.«
»Genau. Zwei verschiedene Orte, gleicher Zeitpunkt. Auf der ersten Karte sehen Sie den Atlantik, kurz nachdem die Bowditch versenkt wurde. Die zweite ist vom Flughafen in Georgetown.«
Borger zoomte auf den Flughafen und ließ die Videos schneller laufen, sodass die Sekunden nur so vorbeirauschten, aber die Karten blieben weiterhin synchron. Nach einer knappen Minute hielt er den Zeitraffer an. »Da ist es. Genau da.«
Clay betrachtete das Bild. Er sah ein Flugzeug, das Richtung Startbahn rollte.
»Was ist das?«
Borger zoomte weiter hinein und wartete einen Augenblick, bis sämtliche Pixel geladen hatten. Die Propellerturbinen unter dem Flügel waren gut zu erkennen. Borger zoomte noch weiter hinein.
»Das ist eine Y-12«, murmelte Clay ungläubig.
Borger nickte. »Richtig erkannt. Stammt aus China, ein Mehrzweckflugzeug, das über zwanzig Passagiere befördern kann.«
»War es die ganze Zeit dort?«
»Nein. Es ist drei Tage vor dem Angriff gelandet. Mitten in der Nacht.«
Clay runzelte die Stirn. Natürlich mitten in der Nacht. Überhaupt schienen die Chinesen in Guayana grundsätzlich nur nachtaktiv gewesen zu sein.
Borger drückte wieder auf Play, und sie sahen, wie das Flugzeug kurz auf der Startbahn anhielt, um dann an Geschwindigkeit zu gewinnen und abzuheben. Noch im Steigflug drehte es nach Westen ab.
Clay richtete sich hinter Borger auf und verschränkte die Arme.
»Haben Sie vielleicht eine Idee, wohin es geflogen ist?«, fragte Borger.
Es gab nur ein Land westlich von Georgetown, das mit der Reichweite des Flugzeugs erreicht werden konnte. Und auch dieses Land pflegte nicht die besten Beziehungen mit den USA. »Venezuela.«
»Schon wieder richtig.« Borger gab einen weiteren Befehl ein und zentrierte die Karte erneut auf einen Flughafen. »Aber nicht irgendwo in Venezuela. Nein, die Maschine flog direkt zum El Libertador Luftwaffenstützpunkt in Maracay. Der Flug dauerte genau drei Stunden und siebenunddreißig Minuten. Kurz nach der Landung stieg eine einzige Person aus und wechselte in ein anderes, bereits wartendes Flugzeug.« Er suchte und fand die betreffende Maschine, die viel größer war.
Clay erkannte sie, ohne dass Borger weiter hineinzoomen musste. Sowohl das Design als auch die Größe machten es unverkennbar. Es war eine Xian Y-20, eines der größten Flugzeuge der chinesischen Luftstreitkräfte.
»Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um ein Transportflugzeug handelt?«, fragte Borger.
»Ganz sicher«, nickte Clay. »Es befindet sich noch in der Entwicklung. Das da ist ein Prototyp, der erst vor ein paar Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.«
»Ein Prototyp?«
»Genau.«
Clay dachte weiter nach. Der El Libertador Luftwaffenstützpunkt in Venezuela war berühmt wegen des versuchten Staatsstreichs von 1992. Damals hatte General Visconti ihn eingenommen und von dort aus Luftangriffe auf die Hauptstadt starten lassen. Aber dieser Ruf störte Clay gar nicht. Vielmehr war es die Tatsache, dass die zwei chinesischen Flugzeuge nicht an einem normalen Flughafen gelandet waren, sondern sich einen Luftwaffenstützpunkt ausgesucht hatten. Die Schlussfolgerung musste lauten, dass die venezolanische Regierung vom Vorhaben der Chinesen gewusst hatte. Und die Tatsache, dass die Xian Y-20 vor Ort war, ließ vermuten, dass die venezolanische Regierung wesentlich mehr wusste, als sie je bereit sein würde zuzugeben.
»Ist die Maschine nach China zurückgeflogen?«, erkundigte sich Clay.
»Ja, das ist sie, mit einem kurzen Zwischenstopp auf Hawaii, um nachzutanken. Ziel war Peking.« Borger warf Clay einen Blick zu. »Aber warum sollten die Chinesen einen Prototyp den ganzen Weg nach Südamerika schicken? Schließlich ist das mit einem gewissen Risiko behaftet.«
»Die Y-20 verfügt über die größte Reichweite aller chinesischen Transportflugzeuge. Und wenn sie ein bewaffnetes Flugzeug geschickt hätten, dann wäre der Aufschrei viel größer gewesen. Außerdem benötigten sie eine einigermaßen sichere Maschine, die beinahe nonstop zurückfliegen kann.«
»Für nur eine Person? Das muss aber ein verdammt teurer Trip gewesen sein.«
»Was bedeutet, dass diese Person sehr wichtig gewesen sein muss.« Clay sah Borger, der noch immer vor ihm auf seinem Stuhl saß, direkt in die Augen. »Oder die Person hatte etwas sehr Wertvolles bei sich.«
»Oder beides.«
Clay nickte. »Oder beides.«
Gemeinsam starrten sie auf das Standbild, auf dem eine winzige Gestalt zu sehen war, die gerade über den Asphalt auf das größere Flugzeug zulief.
Plötzlich klingelte Clays Handy und störte ihre Konzentration. Er schaute auf das Display, hob ab und stellte das Telefon auf laut. »Steve, wo treibst du dich denn rum?«
»An der frischen Luft. Aber wenn du es genauer wissen willst, in der Nähe von Santos. Und du?«
»Wir sind in Borgers Büro.«
»Gut. Ich hoffe, du hilfst ihm aufzuräumen.«
Clay grinste, während Borger so tat, als wäre er gekränkt.
»Seid ihr alleine?«
»Ja.«
Caesare stand im Schatten eines großen Baums und ließ den Blick über den Ozean schweifen. Der Strand befand sich keine zwei Häuserblocks entfernt, aber er bevorzugte es hier, wo er einen besseren Überblick hatte. Schließlich wollte er nicht, dass ihm irgendjemand zu viel Aufmerksamkeit schenkte.
Als Langford das Telefongespräch kurzerhand beendet hatte, hatte Caesare es bereits bis in den ersten Stock des Hotels geschafft. Drei Minuten später war er aus dem Gebäude ins Freie getreten. Es würde nicht lange dauern, ehe man die Leichen von Blanco und Sosa fand, und Caesare hatte keine große Lust dabei zu sein.
»Was habe ich denn verpasst?«
Clay warf erneut einen Blick auf die Monitore auf Borgers Schreibtisch. »Es sieht ganz so aus, als ob Will etwas gefunden hat.«
»Du klingst nicht gerade entzückt.«
»Das nächste Mal gebe ich mir mehr Mühe.«
»Bestimmt wirst du das. Soll ich mich für schlechte Nachrichten wappnen?«
»Vielleicht. Es scheint, als ob jemand kurz nach dem Torpedoangriff eine Starterlaubnis in Georgetown erhalten hat. Er ist mit einem chinesischen Propellerflugzeug nach Venezuela ausgebüchst, um von da aus weiter nach Peking zu fliegen.«
»Willst du mich auf den Arm nehmen?«
»Nein, leider nicht.« Clay beugte sich vor und starrte konzentriert auf den Bildschirm vor sich. »Nur eine Person. Mit so etwas wie einem Aktenkoffer in der Hand.«
Caesare stöhnte. »Das verheißt nichts Gutes.«
»Wer ist jetzt hier nicht entzückt?«
»Ich sage, wir schieben die Schuld auf Borger.«
Will Borger riss überrascht die Augen auf, kniff sie dann aber wieder zusammen.
»Und wir wollten sie gerade dir zuschieben.«
Trotz des lockeren Umgangstons wussten sie alle um den Ernst der Lage. Falls Borger recht hatte, war irgendetwas von dem Kriegsschiff entwendet worden, ehe es ausgelaufen war, denn was auch immer nach Peking, dem politischen Nabel Chinas, gebracht worden war, musste von extremer Wichtigkeit sein. Clay hatte bereits eine Vermutung, was sich in dem Aktenkoffer befand.
»Haben Sie irgendeine Ahnung, mit wem wir es hier zu tun haben, Will?«
»Noch nicht, aber ich mache mich dran.«
Caesare nickte gedankenverloren. Er stand noch immer unter dem Baum und begutachtete eine attraktive Frau auf der anderen Straßenseite. »Nun, es tut mir leid, aber ich habe auch nichts Besseres in petto. Aber da ist noch etwas, das ich bei der Unterredung mit Langford nicht erwähnt habe.«
Ohne den Kopf zu bewegen, tauschte Clay einen raschen Blick mit Borger aus. »Erzähl.«
»Blanco hat noch ein wenig gesungen, ehe er in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Und zwar über Otero. Der Typ weiß vom Affen. Aber es macht ganz den Anschein, als ob das nicht alles war. Blanco hat mir auch verraten, worüber Otero ihn ausgefragt hat. Das Wort, das er dabei immer wieder wiederholte, lautete Acarai, also Berg auf Portugiesisch.«
Clay stöhnte. »Die Kacke ist also am Dampfen, was?«
»Genau. Wie viel er weiß, kann ich nicht genau einschätzen. Aber auf jeden Fall beschränkt es sich nicht nur auf den Affen.«
»Wenn das wahr ist«, mischte Borger sich ein, »dann wird dieser Otero sich ein eigenes Bild von dem Berg machen wollen.«
»Genau. Und wenn er dort lange genug rumstochert, könnte er über Sachen stolpern, von denen er besser nichts wissen sollte.«
Ohne etwas zu sagen, nahm Clay auf dem Stuhl neben Borger Platz. »Das heißt, dass wir vor ihm da sein müssen.« Er hielt inne und überlegte kurz. »Und wir brauchen Hilfe.«
»Zwei Doofe, ein Gedanke.«
»Hättest du vielleicht Lust, auf deinem Rückweg einen kleinen Abstecher zu machen?«
Caesare, noch immer unter dem Rio-Palisanderbaum stehend, flog ein Lächeln über die Lippen. »Soll das ein Scherz sein? Ich liebe Puerto Rico.«
Borger hob eine Augenbraue und sagte laut genug, dass Caesare ihn hörte: »Sie verstehen schon, dass wir DeeAnn mit an Bordhaben sollten?«
»Klar. Ein Kinderspiel.«
Clay glaubte nicht, dass es so einfach werden würde, wie Caesare sich das vorstellte. »Nun gut. Borger und ich werden weiter recherchieren. Wann kannst du los?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher«, entgegnete Caesare und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Mit dem Handy gegen das Ohr gedrückt, drehte er sich zu den schimmernden Hochhäusern São Paulos in der Ferne um. »Ich muss vorher noch etwas erledigen, nämlich herausfinden, wo sich Miguel Blancos Familie befindet.«
Borger starrte Clay fragend an. »Sie wollen wissen, wo Blancos Familie wohnt?«
»Nein«, antwortete er trocken. »Ich muss wissen, wo sie sich in diesem Augenblick befindet.«
3
Die strahlende Sonne über Puerto Rico ließ das Wasser im Salzwasserbecken silbern schimmern, als ob sich ein seidener Vorhang durch die Wogen zog.
Auf der anderen Seite des dicken Glases stand Alison Shaw und betrachtete die beiden Delfine, Dirk und Sally, die sich im Wasser tummelten. Eine Gruppe Kinder hatte sich vor ihnen aufgereiht, und die beiden schwammen bis zum Glas und stupsten es mit ihren Nasen genau an den Stellen an, gegen die die Kinder mit ihren Händen drückten. Sie kreischten vor Aufregung, als Dirk sich spontan zur Seite drehte und das Glas mit seiner Flosse berührte.
Alison war glücklich. Richtig glücklich. Sie senkte den Blick und rieb vorsichtig am Verband um ihr Handgelenk. Der grauenhafte Trip in die Karibik gehörte der Vergangenheit an. Es war ein Wunder, dass sie jetzt gesund und munter hier stand und mit nichts weiter als ein paar Blessuren davongekommen war. Chris Ramirez und Lee Kenwood hatten am meisten abbekommen, aber selbst sie waren wieder hier, und ihre Wunden verheilten besser und schneller, als ursprünglich angenommen.
Dirk und Sally hatten sie begleitet. Natürlich durften sie jederzeit wieder zurück ins offene Meer, wann immer sie wollten. Sie konnten selbst entscheiden, wann sie kamen und gingen. Dirk war besonders erpicht darauf, immer wieder zurück ins Labor in Puerto Rico zu schwimmen, was Alison überraschte. Sie hatte die Vermutung, dass es mit seinen üppigen Futterrationen zu tun hatte. Auch war sie davon überzeugt, dass er die Zeit im Becken wie einen Urlaub verstand, denn hier musste er sich keine Gedanken darüber machen, woher die nächste Mahlzeit kommen könnte.
Das Beste von allem aber war, dass Alison sich verliebt hatte. Endlich hatte sie den Mann ihrer Träume gefunden. John Clay war der umwerfendste Mann, den sie je getroffen hatte – was allerdings nicht besonders viel hieß, denn ihre Exfreunde hatten sichergestellt, dass sich ihr Standard knapp über dem Unerträglichen eingependelt hatte.
Aber John war ein Phänomen. Er war gut aussehend, stark, intelligent und jemand, mit dem man reden konnte. Er schien der Traummann einer jeden Frau zu sein.
»Wir sollten sie bald füttern«, ertönte Chris’ Stimme hinter ihr. »Und wenn wir schon beim Thema Essen sind, was steht für uns auf dem Plan?«
Alison drehte sich zu ihm um und musterte den Becher, den er in den Händen hielt. »Ist es nicht etwas spät für Kaffee?«
Chris lächelte. Die meisten Schwellungen in seiner linken Gesichtshälfte waren abgeklungen. »Es ist nie zu spät für einen Kaffee.« Seine Vorliebe für den Muntermacher hatte sich zu einem Running Gag zwischen den beiden entwickelt. Er stammte aus den Anfangstagen ihrer Zusammenarbeit, in der sie teilweise ganze Nächte durchgeackert hatten. Chris war, genau wie sie auch, ein Meeresbiologe, und die beiden hatten von Anfang zusammengearbeitet.
Chris trank den Becher aus und stellte ihn dann auf seinem übervollen Schreibtisch ab. »Ich schaue mal, ob unsere IT-Experten Hunger haben. Bist du dabei?«
»Nein, macht ihr ruhig.«
Alison schaute ihm hinterher, als er das Labor durchquerte und die breite Treppe zum oberen Stockwerk emporstieg. Als er um die Ecke verschwand, wandte sie sich wieder dem Becken zu. Die Kinder winkten wie wild, riefen »Auf Wiedersehen« und wurden von ihren Lehrern vorsichtig vom Glas gepellt. Die nächste Klasse sollte die Delfine am Nachmittag besuchen.
Alison holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Es gab da nur eine Sache, die ihr Gefühl von vollkommener Glückseligkeit dämpfte. Und sie tat ihr Bestes, sie so lange wie möglich zu ignorieren.
Sie blickte auf die Stirnwand des Labors, an der Unmengen von Servern des mittlerweile berühmten ISIS-Rechensystems standen. Sie nahmen die gesamte Wand in Anspruch. ISIS stand für Inter-Spezies-Interpretations-System, und es war die erste Version des Systems gewesen, das damals ihren unglaublichen Durchbruch in der Forschungseinrichtung in Miami ermöglicht hatte. Seitdem sie nach Puerto Rico und somit näher an Dirk und Sallys natürliche Heimat gezogen waren, hatten sie ISIS radikal verbessern können. Und genau diese Verbesserungen ermöglichten den nächsten Quantensprung, den sie sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen zu erhoffen gewagt hatten. ISIS war nun in der Lage, die Sprache von Delfinen und Primaten zu übersetzen. Es war ein schier unglaublicher Fortschritt, denn das System hatte ihn mit einer solchen Bravour vollzogen, dass selbst die Computerexperten Lee und Juan es kaum fassen konnten. Und als i-Tüpfelchen hatte ISIS obendrein auch noch Sprachfetzen auf eine Art und Weise übersetzt, von der sie gar nicht gedacht hatten, dass es möglich sei, denn ISIS war für so etwas gar nicht programmiert.
Alison starrte auf die Wand voller Server, die vor sich hin summten und Tausende grüne LEDs in unregelmäßigen Abständen aufblitzen ließen. Das System ging systematisch durch alle gesammelten Daten und suchte nach weiteren möglichen Zusammenhängen zwischen bereits etablierten Sprachmustern.
Alison wandte sich ab, als sie ein bekanntes Gesicht bemerkte, das aus dem langen Flur trat, der ihr Labor mit der Biosphäre verband. DeeAnn Draper lächelte und blickte sich neugierig im leeren Labor um.
»Ist wohl Mittag.«
Alison grinste. »Wie hast du das nur wieder herausgefunden?«
»Ich liebe berechenbare Männer.« DeeAnn lächelte und beäugte die letzten Kinder, die sich von den Delfinen im anderen Ende des Beckens verabschiedeten.
Alison setzte eine besorgte Miene auf, runzelte die Stirn und fragte leise: »Bist du dir noch immer sicher?«
»Ja«, meinte DeeAnn nickend. »Ich habe mich heute früh noch einmal mit Penny unterhalten. Sie bereiten in der Stiftung schon alles vor.«
Alison seufzte. Sie verstand, warum DeeAnn sie verlassen wollte. Der letzte Monat war niederschmetternd gewesen, um es gelinde auszudrücken, sowohl emotional wie auch körperlich. DeeAnn hatte sich auf eine Reise gemacht, auf der sie eigentlich einen Freund hatte finden sollen – letztendlich aber hätte sie beinahe mit dem eigenen Leben dafür gezahlt. Wenn Steve Caesare sie nicht eigenhändig gerettet hätte, stünde sie jetzt nicht vor Alison.
Eine unmittelbare Begegnung mit dem Tod zog normalerweise eine Veränderung der Person nach sich. Alison konnte das nachvollziehen, und DeeAnn bildete keine Ausnahme. Sie war am Leben, aber die Lust auf Abenteuer war ihr vergangen. Alles, was sie jetzt noch wollte, war ein einfaches Leben führen und sich um jemanden kümmern. Und diesen jemand hielt sie tatsächlich für eine Person – eine Tatsache, der sie dank ISIS absolut sicher war.
»Also …«
DeeAnn beantwortete Alisons Frage, ehe diese sie überhaupt auszusprechen vermochte: »Wir reisen nächsten Freitag ab.«
Alison schürzte die Lippen und nickte. Sie streckte die Arme aus und umarmte DeeAnn. Während der letzten Monate hatte die Frau sich zu ihrer Mentorin gemausert. Sie war eine unglaubliche Person in so vielerlei Hinsicht. Sie hatte die Welt um sich herum mindestens genauso beeinflusst wie Alison und ihr Team. Nur wusste es der Rest der Welt noch nicht.
»Wann willst du den anderen Bescheid geben?«
DeeAnn räusperte sich. »Heute oder morgen.« Sie setzte erneut ein Lächeln auf und warf einen Blick über Alisons Schulter. Dirk und Sally schwammen durch das Becken auf sie zu. Elegant schwebten sie zur Glaswand und beobachteten die beiden Frauen.
Hallo D Ann.
Sie blinzelte eine Träne fort und richtete ihr Lächeln an die beiden Tiere. »Hallo, Sally. Hallo, Dirk.«
Dirk starrte sie fragend an. D Ann traurig.
»Ein wenig.« Mittlerweile hatte sie sich an ISIS’ Aussprache ihres Namens gewöhnt. Lee meinte, dass das System Schwierigkeiten hatte, ein doppeltes »e« nach einem »d« zu verarbeiten. Er verstand es auch nicht, aber die Aussprache glich eher einem gestotterten »D-an«. Natürlich war es nichts Weltbewegendes, aber es erinnerte sie stets daran, dass sie letztendlich doch mit einer Maschine sprach.
Warum traurig?
DeeAnn warf Alison einen Blick zu. »Das ist eine lange Geschichte.«
Plötzlich ertönte ein lautes Surren aus den Lautsprechern auf dem Schreibtisch. Auf dem Monitor erschien eine rote Fehlermeldung: »Nicht übersetzbar – Geschichte.«
»Ist schon gut«, meinte Alison und wechselte das Thema. »Habt ihr schon Hunger?«
Dirk wurde sichtlich aufgeregter, als Alisons Frage in Form einer Reihe von Klicks und Pfiffen übersetzt wurde. Ja, Essen, jetzt.
Alison wandte sich an Sally, die ein wenig näher vor der Glaswand schwebte als Dirk. »Und du Sally? Hast du auch schon Hunger?«
Die Frauen lauschten, wie Alisons Frage von den Unterwasserlautsprechern wiedergegeben wurde, aber Sally blieb ihnen eine Antwort schuldig. Stattdessen starrte sie die beiden mit dem immerwährenden Lächeln eines Delfins an.
»Sally?«
Wieder spuckte der Unterwasserlautsprecher etwas aus, und nach einer langen Pause gab Sally endlich eine Antwort.
Du fährst weg.
Alison und DeeAnn rissen völlig überrumpelt die Augen auf.
»Ja … Ja, das stimmt, Sally«, gab DeeAnn zurück. »Aber wie hast du das gewusst?«
Warum du weg.
DeeAnn runzelte die Stirn. Wie sollte sie mit einem Delfin über menschliche Emotionen reden? Es lag an vielen Dingen. Depression. Trauer. Angst davor, das Reinste zu verlieren, das ihr je untergekommen war. Außerdem wusste sie jetzt, wie sich die Liebe einer Mutter anfühlte, auch wenn sie nur einem Gorilla galt.
»Das ist … kompliziert.«
ISIS surrte protestierend. Diesmal konnte es das Wort »kompliziert« nicht übersetzen.
DeeAnn versuchte es erneut. »Es ist schwer, dir das zu sagen.«
Diesmal schaffte ISIS es, aber Sally antwortete nicht. DeeAnn war sich nicht sicher, ob Sally mit der Antwort zufrieden war oder nicht. Delfine waren keine Menschen, aber selbst in der beschränkten Zeit, die sie mit Dirk und Sally verbracht hatte, wusste sie, wie menschlich und natürlich ihre Kommunikation sich doch angefühlt hatte. Sie fragte sich, ob das, was wir als menschliche Kommunikation und somit für einzigartig halten, auch anderen Kommunikationsarten zugrunde lag. Wir konnten sie nur nicht mehr deuten.
Wie du, Alison?
»Mir geht es gut«, lächelte sie Sally an. »Und wie geht es dir?«
Wie schlimm ist es?
Alison warf einen Blick auf ihren Verband. »Es geht mir schon besser. Danke.« Seit ihrer Rückkehr zeigten sowohl Sally als auch Dirk großes Interesse an all den Verletzungen, ganz gleich ob es sich um Alison, Chris oder Lee handelte. Vielleicht traf »großes Interesse« es nicht ganz. Vielmehr schienen sie fürsorglich. Alison war sehr gerührt davon und fragte sich insgeheim, ob sie sich vielleicht verantwortlich fühlten. Schließlich waren sie ja der Grund gewesen, warum sie überhaupt dort gewesen waren, aber nie im Leben würde Alison ihnen das vorwerfen. Und trotzdem spürte sie eindeutig, dass sie nicht nur Sympathie seitens der Delfine empfing, sondern auch Empathie. Ihrerseits fragte sie die Delfine wiederholt, ob ihnen bei der Explosion nichts passiert war. Obwohl sie die Frage stets verneinten, war Alison sich nicht so sicher, ob es der Wahrheit entsprach.
Wo Mann?
Alison schenkte Sally ein verschlagenes Grinsen. Sie erkundigte sich nach John. Nach ihrer Rückkehr hatten sie einige Tage zusammen verbracht, und John hatte sich des Öfteren mit den Delfinen unterhalten. Als Technikexperte konnte er sich kaum einkriegen, was sie mit ISIS erschaffen hatten. Insbesondere war er von den Westen beeindruckt, die Lee und Juan gebaut hatten.
Clay hatte Alison vorgewarnt, dass es noch eine Weile dauern würde, ehe Alison und ihr Team überhaupt begreifen würden, was sie geleistet hatten. Er wollte sie vorbereiten und gab ihr zu verstehen, dass die Welle der Neugier, die ihnen in Miami nach dem ersten Durchbruch widerfahren war, von der, die diesem Quantensprung folgen sollte, in den Schatten gestellt werden würde.
Alison strich sich ihre dunklen Strähnen hinters Ohr und beantwortete Sallys Frage mit einem kindlichen Kichern: »John musste weg. Er ist nach Hause.«
Sally stieß die Alison wohlbekannte Reihe von Geräuschen aus, die ISIS gleich am Anfang als Gelächter identifiziert hatte. Er kommt zurück.
Das hoffte Alison doch sehr. Und vielleicht würde er eines Tages sogar zurückkommen und nicht wieder wegwollen.
Im oberen Stockwerk saßen Chris, Lee Kenwood und Juan Diaz zusammen im Computerlabor. Es besaß eine angenehme Größe, war überraschend ordentlich und verfügte über eine Reihe metallener Schreibtische, die an einer Wand aufgereiht standen. Über ihnen hingen aufgeräumte Regale voller Bücher, diverser Computerteile und Berge magnetischer Backup-Kassetten. In der Mitte des Raums stand ein größerer Tisch, der von einer hellen Deckenlampe beleuchtet wurde. Darauf lag eine neue Weste, die anhand diverser Kabelstränge mit einem Computer verbunden war.
In der Mitte der Weste befand sich ein großer Lautsprecher. Wenige Zentimeter darüber waren ein kleines Mikrofon und eine Digitalkamera eingebaut. Die Weste ersetzte diejenige, die bei DeeAnns Einsatz in Südamerika kaputtgegangen war. Die Daten hatten sie zum Glück retten können, aber die kleine Hauptplatine und der Prozessor waren hinüber.
Chris beobachtete Lee und Juan. Er wartete weiterhin geduldig auf eine Antwort bezüglich des Mittagessens. Die beiden ITler aber schienen sich weniger auf ihr leibliches Wohl zu konzentrieren, als vielmehr auf den Bildschirm, der auf Lees Schreibtisch stand.
»Darf ich davon ausgehen, dass ihr noch immer nach dem Bug sucht?«
»Das ist kein Bug«, murmelte Lee und fummelte mit der Maus herum.
»Tut mir leid, ich meinte die Anomalie.«
»Das ist es auch nicht.«
»Das Mysterium?«
Juan drehte sich zu ihm um und rollte die Augen, während Lee, noch immer am Bildschirm klebend, den Kopf schüttelte.
»Ach, kommt schon! Das war doch nur ein Witz.« Chris beugte sich zum Schreibtisch hinab, las ein Buch auf und blätterte es rasch durch. Es pries sich als die Bibel aller Computer-Algorithmen an, was Chris sofort glaubte. Der Inhalt schien absolut unverständlich. »Was ist denn genau los? Wo ist der Haken?«
Lee machte eine Pause und drehte sich zu ihm um. »Es ist nicht so, dass da irgendwo ein Haken ist. Vielmehr stimmt etwas nicht ganz.«
»Hat es auch etwas mit den Logs zu tun?«
»Davon gehe ich aus.«
Die Log-Dateien, auf die Chris anspielte, wiesen nämlich ein schwerwiegendes Problem auf. Vor ihrer verhängnisvollen Reise in die Karibik hatte Lee entdeckt, dass die ISIS-Übersetzungen und die dazugehörigen Videodaten zunehmend zeitversetzt verarbeitet wurden. Die Log-Dateien zeigten die Frequenz dieser Fehler auf, die sich rapide häuften, sodass Lee glaubte, die Tausende von Zeilen neuen Computercodes für die Forschung an Primaten hätten das System kompromittiert.
Nach einer Reihe schlafloser Nächte allerdings entdeckten sie, dass ISIS auf eine Menge subtiler, nicht akustischer Muster ansprach. In anderen Worten: das System lernte nichtverbale Kommunikation.
Lee und Juan konnten aber nicht ausmachen, wie es das bewerkstelligte und warum die Westen beinahe zu gut funktionierten.
Chris hörte Lee aufmerksam zu, als er erklärte, wonach sie suchten. »Willst du mir also damit sagen, dass ISIS wesentlich besser arbeitet, als ihr es euch erhofft habt?«
»Mehr oder weniger.« Lee stand auf, ging zum großen Tisch und hob die Weste in die Luft. »Sobald ISIS merkt, dass Dirk oder Sally sprechen, digitalisiert es das Signal und gleicht es mit einer Datenbank von bereits identifizierten Vokabeln ab. Hat es eine Übereinstimmung gefunden, werden die übersetzten Worte durch den Lautsprecher ausgegeben.«
»Und dasselbe, nur in umgekehrter Reihenfolge, passiert, wenn wir mit den Delfinen sprechen, richtig?«
»Genau. Es funktioniert wie geplant mit Delfinen, denn ihre Sprache ist mehr oder weniger ausschließlich verbal. Bei Primaten ist das jedoch nicht der Fall. DeeAnn hat uns darauf hingewiesen, dass Primaten sich größtenteils anhand von nichtverbaler Kommunikation wie Gesten und Gesichtsausdrücken verständigen.«
»Ja, ich weiß.«
»So weit, so gut. Aber von da an hört es auf, Sinn zu ergeben«, meinte Lee und blickte schulterzuckend zu Juan. »ISIS bemerkt, verarbeitet und benutzt diese nichtverbalen Hinweise – so viel wissen wir. Wir haben aber keine Ahnung, wie es das schafft. Noch viel interessanter aber ist die Tatsache, dass ISIS diese nichtverbale Kommunikation erkennt, aber keine Möglichkeit hat, sie zu vermitteln.«
»Zumindest keine Möglichkeit, von der wir wissen«, verbesserte Juan seinen Kollegen.
Chris kniff die Augen zusammen. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinterherkomme.«
Lee dachte kurz nach. »Nehmen wir mal an, dass ISIS eine nichtverbale Kommunikationsform von Dulce erkennt. Sie zuckt mit den Schultern. Die Geste wird erkannt und mit den Audiodaten verglichen. Wie zum Teufel soll es da zu einer Übereinstimmung kommen? Wie soll ISIS Dulces Schulterzucken übersetzen?«
Endlich fiel bei Chris der Groschen. »Ich verstehe. Auch wenn ISIS eine Geste wahrnehmen kann, fehlt dem System die Möglichkeit, diese Geste durch den Lautsprecher der Weste wiederzugeben.«
»Bingo!«
»Wow. Das ist irre.«
»ISIS sollte gar nicht in der Lage sein, Gesten wahrzunehmen, hat es aber irgendwie geschafft. Und wir haben keine Ahnung, wie.«
Chris ließ sich das Gesagte durch den Kopf gehen. Natürlich hatte auch er keine rasche Antwort parat, aber er hegte eine Vermutung. Er hatte sich während ihrer Zusammenarbeit des Öfteren mit Alison darüber unterhalten und war sich sicher, dass es auch die anderen beschäftigte. Nach Jahren der Erfahrung mit verschiedensten Tierarten kamen sie letztendlich zum selben Schluss: Kommunikation beinhaltete etwas Tieferes, Grundlegenderes als nur das, was sie beobachten konnten. Insbesondere bei weniger entwickelten Gehirnen. Aber das war eigentlich nichts Neues, sondern eine Tatsache, die über die Jahre schon viele Gemüter beschäftigt hatte. Woher besaßen Lebewesen ein solch umfangreiches instinktives Wissen, wenn es ihnen nicht von den Eltern beigebracht wurde?
Kommunikation vermittelte Wissen, aber Chris und Alison sowie andere Forscher, selbst Tierärzte, waren sich einig, dass ihnen einige Vorgänge auf einer tieferen Ebene entgingen – auf einer Ebene, die Menschen derzeit weder verstehen noch messen konnten.
ISIS aber schien genau das zu tun.
4
Tiago Otero hob den Kopf, als er ein leises Klopfen an der Tür vernahm. Einen Augenblick später wurde sie sanft geöffnet, und einer seiner Assistenten lugte mit entschuldigender Miene durch den Spalt und unterbrach die Besprechung.
Otero setzte eine gequälte Miene auf und entschuldigte sich bei seinem Gegenüber, das am anderen Ende des kleinen Tisches saß. Der Mann hatte dunkle Augen und einen weißen Schopf, was ihn älter als Otero aussehen ließ. Er trug den grün-braunen Kampfanzug der brasilianischen Armee und beobachtete Otero wortlos, als dieser sich von seinem mit Leder bezogenen Stuhl erhob und seinem Assistenten in den Flur folgte.
Sie hielten an und warteten, bis die Tür sich hinter ihnen schloss. Als sie das Klicken hörten, veränderte sich Oteros Blick und wurde eiskalt.
»Was ist?«
»Es tut mir sehr leid, Sie zu unterbrechen«, flüsterte der junge Mann, »aber Sie haben strikte Anordnungen gegeben, dass man Sie im Fall eines Problems augenblicklich benachrichtigen soll.«
Otero forderte ihn mit einem erwartungsvollen Blick zum Weiterreden auf.
»Lieutenant Russo hat den Kontakt zu seinen Männern verloren.«
Otero verzog kaum eine Miene, sondern starrte seinen Assistenten aufmerksam an und schürzte die Lippen, sodass dieser nervös wurde. Oteros Unberechenbarkeit war kein Geheimnis, und seine Wutausbrüche legendär. Sein Assistent hatte diesen Blick schon des Öfteren gesehen, aber stets gehofft, dass er nie ihm gelten würde. Jetzt betete er förmlich, dass sein Boss es nicht auf ihn abgesehen hatte.
Otero hatte keine Freunde, lediglich Feinde und Bekanntschaften, die ihn fürchteten. So gefiel es ihm. Seine Anwesenheit reichte schon aus, um die Leute nervös und verängstigt zu machen. Furcht war ein bemerkenswerter Motivator. Sie raubte den Starken ihr Selbstvertrauen und ließ die Ergebenen gehorchen. Otero schnaubte verächtlich, wenn er mitbekam, dass manche Menschen Geld und Macht verwechselten. Richtige Macht entstand einzig und allein aus Furcht. Macht durch Geld war etwas für Warmduscher, Macht durch Furcht jedoch für Gebieter.
»Und warum hat er es mir nicht selbst gesagt?«
»E-Er versucht immer noch, den Kontakt wiederherzustellen, Sir.«
Otero starrte ihn nachdenklich an. Die Männer, die sein Assistent gemeint hatte, waren von Russo nach Florianópolis geschickt worden, um einen einfachen Job zu erledigen – und sie waren Experten auf diesem Gebiet.
Miguel Blanco hatte ihm in São Paulo sämtliche Informationen geliefert, die er benötigte – und mehr. Aber Blanco der Schwätzer hatte seine Geschichte schon zu vielen anderen erzählt. Er musste beseitigt werden.
Und was noch viel wichtiger war: Blanco hatte einen von Oteros Partnern auf dem Gewissen. Alves war ein Rivale gewesen – ein Mann ohne jegliche Skrupel –, aber dennoch gehörte er zu ihnen. Er hatte Rang und Namen gehabt, war Teil der Führungsetage des Landes gewesen. Ein Oligarch wie Otero selbst, der die Regierung Brasiliens sowie den Werdegang des gesamten Kontinents hatte beeinflussen können. Ein Mann mit einem größeren Vermögen, als die meisten es sich vorstellen konnten. Und mit so viel Einfluss ist man nicht ganz schutzlos.
Otero hatte ihn damals gewarnt, dass Blanco, dem Sicherheitschef, nicht zu trauen war. Aber Alves hatte abgewunken und stattdessen seiner jungen Assistentin, die mit ihm ins Bett stieg, viel zu viel anvertraut. Ein Fehler, der sich mit zunehmendem Alter massiv häufte. Diese alten Säcke mussten einfach immer wieder versuchen, sich die letzten Reste ihrer Männlichkeit zu bewahren. Viel schlimmer war, dass sie so gleich mehrere Angriffspunkte boten. Auf einmal war Alves verletzlich gewesen, und das war eine Chance, die Blanco sich nicht entgehen lassen konnte.
Alves war ein Narr gewesen, aber trotzdem hatte Blanco mit der Ermordung seines Bosses sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Jetzt musste nur noch seine Familie dran glauben, damit man ein Exempel statuiert hatte. Nicht das erste und sicherlich auch nicht das letzte. Alves war clever, Otero gnadenlos.
Und dann gab es noch Alves’ Geheimnis. Er war kurz davor gewesen, die größte Entdeckung der Menschheit zu machen. Eigentlich war er schon zu nahe dran gewesen, denn letztendlich hatte seine Ungeduld sein Urteilsvermögen beeinträchtigt. Nein, nicht seine Ungeduld. Es war die Verzweiflung, mit der er sich daran klammerte. Und als er herausfand, dass sie alles versprach, was er sich erhofft hatte, war es eben diese verzweifelte Hoffnung, die ihn sein Leben gekostet hatte. Das war ein Fehler, der Otero nicht unterlaufen würde.
Florianópolis war eine der begehrtesten Städte in ganz Brasilien. Gut sechshundert Kilometer südlich von São Paulo gelegen, ist sie die Hauptstadt des Bundesstaats Santa Catarina und bietet einen der höchsten Lebensstandards in ganz Brasilien. Ihre Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Brasilianern europäischer Abstammung, und das angenehme subtropische Klima macht die Stadt zu einem idealen Wohnort – wenn man über das nötige Kleingeld verfügte. Wenn nicht, musste man es sich eben aneignen.
Steve Caesare untersuchte die beiden gefesselten Typen, die mit dem Gesicht nach unten zu seinen Füßen lagen. Einer röchelte noch, der andere war bereits tot. Das war aber nicht Caesares Schuld gewesen. Der Idiot hatte einfach nicht aufhören wollen. Er hatte weiter und weiter gemacht, bis Caesare keine Wahl mehr gehabt hatte.
Er trat einen Schritt zurück und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. Falls seine Seite schon vorher wehgetan hatte, so waren die Schmerzen jetzt, nachdem er die beiden durch das Wohnzimmer hatte zerren müssen, kaum noch auszuhalten.