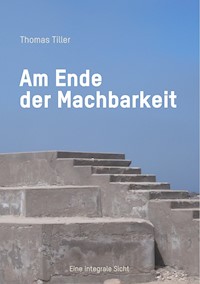
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Situation ist nicht so, wie wir sie uns vorstellen? Dann müssen wir nur das Richtige tun und die Situation aktiv verändern, um eine Verbesserung herbeizuführen. So in etwa lässt sich Machbarkeit kurz und knapp beschreiben. Das Prinzip Machbarkeit wird in praktisch allen Bereichen unseres Lebens unhinterfragt angewendet: im Alltag und im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ebenso wie im Management oder in der Politik. In vielen Situationen funktioniert das sehr gut. Doch Machbarkeit hat ihre Grenzen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Obwohl wir seit über 40 Jahren wissen, dass wir als Menschheit mehr Ressourcen verbrauchen als die Erde regenerieren kann, und trotz aller weltweiten Bemühungen, hat sich nichts verändert. Das hat unterschiedlichste Gründe. Unbewusste Grundannahmen, wie die Welt funktioniert, die Reduktion der Wirklichkeit auf ein handhabbares Maß und die ausschließliche Suche nach Lösungen im Außen sind nur drei davon. Thomas Tiller macht sich in diesem Buch auf die Suche nach den Mechanismen, die der Machbarkeit zugrunde liegen, ohne die Machbarkeit zu diskreditieren und ohne die Wirklichkeit in ihrer Komplexität zu reduzieren. Er bietet dabei aus der eigenen Praxis, unter anderem als Gruppenmoderator und integraler Berater, verschiedene Möglichkeiten an, die Welt um und in sich zu erleben. "Am Ende der Machbarkeit" ist eine Einladung, sich selbst zu erkunden und dort nach den Grenzen der Machbarkeit zu suchen. Eine Art Reisebericht durch eine Welt, die vielen von uns nur teilweise bekannt ist - eine Reise durchs Ich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.am-ende-der-machbarkeit.de
Inhalt
Einleitung
Die Krux mit der Machbarkeit
Wieso ein Buch über die Grenzen der Machbarkeit?
Was genau ist also „Am Ende der Machbarkeit“?
An wen richtet sich „Am Ende der Machbarkeit“?
Teil 1: Was ist Machbarkeit? Oder: Die Grenzen von innen erforscht
Innen versus Außen: Über eine Grenze, die keine ist
Hardware versus Software: Über eine hilfreiche, aber fatale Vereinfachung der Welt seit Descartes und über die Hoffnung, den Heiligen Gral doch noch zu finden
Einer versus Viele: Über mich, dich und mein Erleben von uns
Verantwortlich gemacht werden versus Verantwortung übernehmen: Über den Glauben, es hätte nichts mit mir zu tun
Kausalität versus Beziehung: Über die immer häufiger enttäuschte Hoffnung, die Welt sei verstehbar
Ich versus Meines: Über das Ego, den Unterschied zwischen ,Ich‘ und ,Meines‘ und den Verlust der Alleinherrschaft
Wir versus Ich: Über ,Systeme‘, deren ,Träger‘ und die Beziehung zwischen ihnen. Oder: Ein zum Scheitern verurteilter Versuch, über Zusammenhänge zu sprechen
Machbarkeit als Wir versus Machbarkeit im Ich: Über die Macht der Machbarkeit
Machen versus Tun: Über Verbesserung, Veränderung und die Tatsache, dass es keinen Unterschied macht
Teil 2: Was ist Machbarkeit? Oder: Die Grenzen von außen erforscht
Sein versus Tun: Über eine unausweichliche Dualität und den ‚Ort‘ dazwischen
Horizontale versus Vertikale: Über die Schnittstelle zwischen unserem endlichen Leben und dem unendlichen Nichts
Nichts versus Alles: Über zwei Wege zum gleichen Ende
Gewalt versus Verbundenheit: Über zwei gegensätzliche Arten, in der Welt zu sein
Versus und Und: Über die Grenze als Ort
Wer bin ich? Über originär Neues und das Grundbedürfnis nach Selbstverwirklichung
Teil 3: Am Ende der Machbarkeit Oder: Der Unterschied zwischen Veränderung und Transformation
Zeit
Transformation im Innen
Transformation im Außen
Trotzdem handeln
Teil 4: Machen sein lassen Oder: Die Veränderung sein, nicht machen
Ja sagen
Im Kontakt sein
Der letzte Moment
Radikal sein
Machen anerkennen
Verantwortlich sein
Dramen sein lassen
Sein lassen
Epilog: Der Weg durchs Ich
Anhang: Implikationen für die Beratung
Auftrag und Haltung
Der Weg durchs Ich in der Arbeit mit dem ,Wir‘
Anmerkungen
Literatur
Einleitung
Dieses Buch ist eine Ode an die Hilflosigkeit. Ein Plädoyer für die Arbeit und Anstrengung, die darin liegt, anzuerkennen, dass wir vieles von dem, was um uns herum und in uns wirklich los ist, nicht annähernd verstehen. Es ist eine Aufforderung, dem Ruf der Sehnsucht zu folgen, die uns in Richtung des unbekannten Abgrunds zieht, der wir sind: die Sehnsucht, die wir am meisten fürchten. Und es ist eine Einladung, die Kontrolle abzugeben und freudvoll zu scheitern, ohne die Verantwortung dafür abzugeben.
Auf meiner Suche nach Machbarkeit und ihren Grenzen bin ich an viele Grenzen gestoßen. Natürlich in erster Linie an meine eigenen. Wem ich zum Beispiel immer wieder begegnet bin, ist mein stärkster Vertreter und Befürworter der Machbarkeit, nämlich mein Ego, das unbemerkt vor allem eines leistet: mich durch viele Grundannahmen über die Welt am Leben zu erhalten. Und ich bin an viele Grenzen im Außen gestoßen. Das Ansprechen von Machbarkeit als unausgesprochene Vorannahme für fast alles Handeln ist eine solche Grenze. ‚Was soll ich denn tun, wenn ich den Glauben aufgebe, dass mein Tun das gewollte Ergebnis zur Folge hat? Und warum sollte ich dann überhaupt noch etwas tun?‘ Ein Beispiel für typische Fragen, denen ich auf meiner Suche begegnet bin. Und diese Fragen sind absolut berechtigt.
Aber auch der Hinweis, dass eine Situation, die wir verändern wollen, eventuell komplexer ist als wir sie wahrnehmen, stößt selten auf offene Ohren. ‚Wenn ich warte, bis ich die Situation in ihrer Gänze begriffen habe, ist es zu spät – ich muss so schnell wie möglich handeln‘, ist eine häufige Reaktion. Eine Reaktion, in der sich der allzu menschliche Impuls wiederfindet, unangenehmen Situationen zu entkommen und schnell Lösungen zu finden.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich plädiere nicht dafür, solchen – oft lebensrettenden – Impulsen zu widerstehen. Wenn Sie Ihrer Traumfrau oder Ihrem Traummann begegnen: Handeln Sie bitte schnell! Fangen Sie nicht an, die Situation in ihrer Ganzheit erfassen zu wollen, sonst könnte Ihr potenzieller Partner weitergegangen sein und das war’s dann. Wäre doch schade. Was ich allerdings sage ist, dass es vor allem in komplexen und hartnäckigen Situationen, die uns nicht passen, Alternativen gibt. Alternativen, diesen Situationen zu begegnen. Alternativen, die das ,um zu‘ nicht als die einzige Grundlage für unser Handeln haben.
Ohne Machbarkeit kein Überleben. Aber wenn ich der Welt nur und ausschließlich mit der Idee der Machbarkeit begegne, kann auch das fatale Folgen haben. Unter anderem die, dass mein Tun am Ende eine Verschlechterung meiner Situation bringen könnte, und ich mir dann eingestehen muss, dass ich dafür mitverantwortlich bin.
Einige Beispiele? Die uns allen bekannten Altkleidersammlungen für so genannte Dritte-Welt-Länder. Sie haben langfristig nur dazu geführt, dass Kleidung in den ärmsten Teilen dieser Welt in brauchbarer Qualität praktisch kostenlos zur Verfügung steht und die Menschen, die bisher vor Ort für die Herstellung von Bekleidung zuständig waren, nicht nur ihre Rolle in der Gemeinschaft verloren haben, sondern ihre Kompetenzen gleich mit. Oder hybrides Saatgut, das zwar dazu geführt hat, dass theoretisch eine weltweite Vollversorgung mit Lebensmitteln möglich wäre, das aber auch zur Folge hatte, dass Landwirte ihr über Generationen erarbeitetes Wissen aufgegeben haben und in eine komplette Abhängigkeit von der Saatgut-Industrie geraten sind. Zwei sehr ‚platte‘ Beispiele, zugegeben, aber eben zwei Beispiele, die zeigen, wie der Glaube an Machbarkeit eine Situation langfristig eher verschlechtert hat.
Die Krux mit der Machbarkeit
Ein weiteres Beispiel: Seit über vierzig Jahren widmet eine unglaubliche Vielzahl an Menschen ihr Leben der Frage, wie wir unseren Planeten und damit die Menschheit auf Dauer vor dem Untergang retten können. Spätestens seit 1972, nämlich seit der Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlicht hat, wissen wir, dass wir als Menschheit nicht überleben werden, wenn wir so weiterleben wie bisher. Seit damals gibt es unzählige Ansätze, dieser Situation zu entkommen. Doch auch nach fast 45 Jahren hat sich am Ressourcenverbrauch nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Wer den „Living Planet Report 2016“ vom WWF oder ähnliche Veröffentlichungen liest, wird feststellen: Wir verbrauchen weiterhin mehr Ressourcen als uns unser Wirt, die Erde, zur Verfügung stellt. Wir leben weiterhin auf Pump. Das heißt, es hat keine wesentliche Veränderung der Gesamtsituation stattgefunden. Und das trotz aller Energie, die so viele Menschen darauf verwendet haben. Die Rettung unseres Planeten widersetzt sich nachhaltig jeder Form von Machbarkeit.
Beim Versuch, sich Machbarkeit und ihren Grenzen zu nähern, wird klar: Machbarkeit verdankt ihre Macht unter anderem zwei Aspekten. Der eine ist die Tatsache, dass sie unbewusst wirkt. In dem Moment nämlich, in dem ich bemerke, wann ich aus der Idee heraus handle, dass mein Tun eine vorhersehbare und gewünschte Änderung zur Folge hat, habe ich Machbarkeit in ihrer universellen Gültigkeit entthront und es werden Alternativen sichtbar.
Der zweite Aspekt ist die Tatsache, dass Machbarkeit ein sehr komplexes Gebilde ist. Das scheint schwer nachvollziehbar, denn eine einfache Beschreibung von Machbarkeit ist: Ich möchte eine Situation ändern, ich handle und danach ist die Situation so, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. Was soll daran komplex sein? Nur ist es eben nicht so einfach. In der Regel bin nicht nur ich an einer Situation beteiligt, die ich gezielt verändern will, sondern noch viele andere Menschen, die alle wieder an Machen glauben und die alle eine eigene Vorstellung vom Ergebnis haben. Alleine das würde die oben genannte Idee von Machbarkeit ad Absurdum führen. Aber dabei bleibt es nicht. Da ist die Frage: Was ist dieses ,etwas‘, das ich als Situation bezeichne und das ich verändern will? Die Frage, wie ich erkenne, ob die Situation danach besser ist. Die Frage, inwieweit ich mich selbst verändert habe, während ich versucht habe, die Situation zu verändern. Die Frage, wann ich aufhöre zu machen und wann ich mir eventuell eingestehe, dass mein Machen nicht zum erwünschten Ergebnis führt. Die Frage, was außer mir und meinen Mitmenschen sonst noch an der ,Gestaltung‘ einer Situation beteiligt ist. Und viele weitere Fragen.
Wieso ein Buch über die Grenzen der Machbarkeit?
Ohne die Grundannahme der Machbarkeit wären wir nicht, wo wir als Menschheit heute sind. Wir könnten nicht mit Menschen auf der anderen Seite des Planeten reden, uns keine Übertragungen von Ereignissen auf der ganzen Welt in Echtzeit ansehen und wir hätten nicht den Lebensstandard und die Lebenserwartung, die viele von uns nach Jahrhunderten der Forschung heute haben.
Begonnen hat der Siegeszug der Machbarkeit in der Zeit der Aufklärung mit der Idee des wissenschaftlichen Herangehens an die Welt. Messbarkeit, Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit sind die Grundlagen dieses Herangehens. Und sie gelten bis heute. Aber das kam und kommt um einen Preis. Der Preis ist die Absolutheit dieser Grundannahme. Egal, um was es geht: Alles ist machbar.
Nun hat diese Grundannahme ein paar perfide Eigenschaften. Eine davon ist, dass sie schwer zu entdecken ist. Selbst Bücher, die sich mit dem Thema Präsenz und Prozessorientierung beschäftigen, die also der Zielorientierung und der Machbarkeit den Kampf ansagen, tun dies mit einem offenen oder heimlichen Versprechen: der Wirksamkeit. Und das ist eine Form von Machbarkeit.
Es gibt einen einfachen Test, um zu überprüfen, ob hinter einem Ansatz, der die Machbarkeit scheinbar nicht als Grundannahme hat, nicht doch die Machbarkeit lauert. Überprüfen Sie einfach, weswegen ein Vertreter oder eine Vertreterin eines solchen Ansatzes diesen anbietet oder weswegen Sie diesen Weg gehen wollen. Wenn darauf eine Antwort kommt, die ein ,um zu‘ enthält, versteckt sich dahinter meist einfach nur eine tieferliegende und unbewusste Hoffnung auf Machbarkeit. Das ,um zu‘ verrät die Machbarkeit.
Nur, um einem Eindruck zu begegnen, der jetzt und sicher noch öfter in diesem Buch entstehen könnte: Ich habe nichts gegen Machbarkeit. Ganz im Gegenteil. Ich bin täglich dankbar, dass Vorhersagbarkeit und Steuerbarkeit in vielen Fällen und auf vielen Ebenen funktionieren. Ich könnte zum Beispiel dieses Buch nicht schreiben, hätten nicht viele Menschen vor mir auf der Basis der Machbarkeit Computer entwickelt, Bücher geschrieben und ihr Leben in den Dienst dieser Idee gestellt.
Aber Machbarkeit scheint eine der unbewusstesten und am wenigsten hinterfragten Grundannahmen unserer Zeit geworden zu sein, bis an den Punkt, an dem wir nur noch diese Grundannahme haben. Und weil es keine lebbare und bewusste Alternative gibt, erkennen wir Machbarkeit nicht mal mehr als das, was sie eigentlich ist: eine Grundannahme. Sie ist zur unbemerkten Allgemeingültigkeit geworden. Eine Art moderner, globaler ‚Glaube‘. Und selbst die vielen Gegnerinnen und Gegner dieser Religion machen ganz subtil nur wieder das Gleiche, indem sie die Machbarkeit verdammen, ,um zu‘ – um dem (Teufels-)Kreis des permanenten Wachstums zu entkommen; um Freiheit und Gleichheit für alle zu etablieren; um dem Machbarkeitswahn zu entkommen … Und jedes ,um zu‘ steht für genau eine Sache: Machbarkeit.
Machbarkeit hat ihre Grenzen. Diese Tatsache auszublenden, können wir uns nicht mehr leisten. Nicht nur, weil wir dabei sind, die Existenz der Menschheit zu gefährden, indem wir die Erde soweit ausbeuten, dass wir am Ende nichts mehr haben, wovon wir leben könnten. Das – mit all seinen Aspekten, wie zum Beispiel einer großen Ungleichverteilung von überlebenswichtigen Ressourcen – ist sicher der sichtbarste und dramatischste Grund. Ein viel wichtigerer Grund ist aber der, dass viele von uns so weit sind, dass das Ausblenden nicht mehr funktioniert. Irgendwie wissen wir, dass es so nicht weitergehen kann, und irgendwie wissen wir auch, dass mehr des Gleichen keine Veränderung bringen wird.
Was genau ist also „Am Ende der Machbarkeit“?
Es ist eine Einladung, die eigene Art, in der Welt zu sein, zu hinterfragen. Nicht infrage zu stellen. Wozu auch? Sie hat uns bis jetzt unser Überleben gesichert. „Am Ende der Machbarkeit“ ist eine Reisebeschreibung auf einem Weg durch bekanntes Terrain, bis an dessen Grenzen und darüber hinaus. Eine Einladung, dieses vielleicht unbekannte Terrain und dessen Grenzen neugierig zu erkunden und sich überraschen zu lassen, ohne das Bekannte und Funktionierende zum Teufel zu jagen.
Nichts, was Sie an Ideen in diesem Buch finden, ist neu. Für alle, die mit dem Integralen Modell von Ken Wilber und Co. vertraut sind, wird es viel Bekanntes geben. Das Gleiche gilt für Komplexitätstheorie und Kybernetik, Systemtheorie, alle Ansätze in der Psychologie und Therapie, die auf der Annahme von Teilen basieren, We-Spaces, Phänomenologie und viele weitere Bereiche. Aber: Sie müssen von all dem noch nichts gehört haben, um dieses Buch zu lesen.
Es geht mir in diesem Buch nicht um Wissen. Wissen ist wichtig, um eine gemeinsame Grundlage zu haben, und hilfreich zur Orientierung. Aber das ganze Wissen wird Ihnen wenig Neues bringen, wenn Sie sich nicht selbst auf den Weg begeben, Machbarkeit und deren Grenzen zu erforschen und zu erleben.
Dieses Buch ist eine Landkarte, die viele Informationen aus unterschiedlichen Gebieten zusammenträgt. Aber wie jede Karte ist auch dieses Buch nur ein stark vereinfachtes Abbild dessen, was es darstellt. Bereisen müssen Sie dieses Land selbst. Und die Reise geht vor allem an einen Ort: Ihr Inneres. Es ist eine Reise durchs Ich, auf die Sie sich begeben, wenn Sie die Machbarkeit und deren Grenzen erkunden.
Und es gilt, was für mich in der Beratung von Menschen auch gilt: Glauben Sie nichts und niemandem, der oder das von sich behauptet, die Wahrheit zu kennen oder Wahrheit zu sein. Auch nicht mir und diesem Buch. Ideen und Wissen? Auf jeden Fall hilfreich. Aber es gibt nur einen Menschen, der all das am Ende ins (Er-)Leben bringen kann – und das sind Sie. Und zwar auf die einzigartige Weise, mit der Sie in der Welt sind und diese Welt erleben.
Das erfordert Mut. Denn es verlangt von Ihnen, dass Sie viele Einzelaspekte, die von anderen bis ins Detail erforscht und erarbeitet worden sind, auf einer sehr ,groben‘ Ebene beleuchten und dann vor allem eines tun: herausfinden, wie Sie diese Aspekte auf Ihre ganz eigene Art erleben, und das, ohne die Sicherheit des ,allgemeingültigen‘ Wissens. Machbarkeit ist zuallererst eine Idee, eine Art, in der Welt zu sein. Machbarkeit zu erforschen heißt, Ihr eigenes Erleben und Ihre eigenen Überzeugungen zu erforschen. Mir geht es darum, Sie zu begeistern, die unterschiedlichen Schichten und Aspekte der Welt, die Sie erleben, in ihrem Zusammenwirken und in ihrer Komplexität als Ganzes zu erfahren; die Referenz für Ihr Handeln dort zu suchen, wo sie am Ende ist: nicht im Wissen, nicht in der Moral, nicht in Gott, überhaupt nirgends im Außen – sondern in Ihnen.
Daher hier einige Hinweise dazu, wie ich in diesem Buch mit Ihnen spreche. Machbarkeit ist – wie gesagt – ein komplexes Gebilde. Um sich dem anzunähern, werden wir verschiedene Aspekte einzeln beleuchten müssen, um sie greifbar zu machen. Würde ich jeden dieser Aspekte exakt beschreiben, würde das mehrere Bücherregale füllen. Diese Arbeit haben sich zum Glück viele Menschen vor uns gemacht und wir dürfen getrost darauf zurückgreifen, ohne den gesamten Weg selbst finden zu müssen. Das bedeutet, dass ich an vielen Stellen grob fahrlässig und unverschämt vereinfachen werde. Es ist, als würden wir uns in einen Hubschrauber setzen und das Land von oben betrachten, um einen Überblick bzw. ein Gesamtbild zu bekommen. Ich werde bei allen Aspekten darauf verweisen, welche Autorinnen oder Autoren sich dem Thema gewidmet haben. Viel von dem, was wir uns anschauen, ist aber intuitiv und ohne vertiefte Kenntnis der einzelnen Gebiete sehr gut zu erfassen.
Außerdem werde ich Sie im Buch sehr direkt ansprechen. Nicht, weil ich das so toll finde, sondern, weil ich nicht über etwas Abgehobenes rede, sondern mit Ihnen spreche; mit Ihnen über mein und Ihr Erleben der Welt. Dazu stelle ich eine mögliche Art, die Welt zu erleben, zur Verfügung. Als Anstoß. Als Reibungsfläche. Aber es geht um Ihr eigenes inneres Erleben dessen, was ich hier anspreche. Wenn Sie nur nach Wissen suchen, lesen Sie die Literaturliste am Ende des Buches und suchen Sie sich die Veröffentlichungen heraus, die Sie am meisten ansprechen oder interessieren. Lesen Sie dieses Buch nicht auf der Suche nach neuem Fachwissen, sondern auf der Suche danach, wie Sie damit umgehen.
Machbarkeit ist außerdem ein sehr dynamisches, lebendiges Gebilde. Das heißt, die Beschreibung der Einzelaspekte dient vor allem dazu, diese dann im Anschluss in einen Zusammenhang zu setzen und sie in deren Zusammenspiel zu sehen. Dabei werde ich bisweilen einen eher ‚flapsigen‘ Ton anschlagen und sehr plakative Beispiele nutzen. Das erlaubt es mir, komplexe Themen in einer ‚Unschärfe‘ zu betrachten, die nötig ist, um das Gesamtbild im Auge zu behalten. Nichts davon ist leichtfertig oder gar bewertend gemeint. Es ist nur eine Möglichkeit, sich einem so komplexen Thema in einem annähernd lesbaren Buch anzunähern, ohne vorher verschiedene Studien in sehr unterschiedlichen Fachgebieten absolvieren zu müssen.
Aus dem gleichen Grund werde ich über viele Aspekte sehr radikal und sehr faktisch sprechen. Erinnern Sie sich dabei bitte immer daran, dass es der Verständlichkeit dient und nicht mein Versuch ist, irgendeine allgemeingültige Wahrheit zu proklamieren. Wenn bei Ihnen Widerstand aufkommt gegen die Art, wie ich Dinge präsentiere, dann lassen Sie ihn bitte unbedingt zu! Erforschen Sie ihn. Und wenn Sie einzelne Aspekte anders erleben? Erforschen Sie, wie Sie diese erleben. Genau darum geht es in diesem Buch auch.
Noch ein kurzer Hinweis zu den Fußnoten: Die meisten Fußnoten sind entweder ergänzende Bemerkungen und Gedanken oder Erklärungen, weil ich im Text einen entsprechenden Sachverhalt sehr grob vereinfacht habe. Auch das dient der Verständlichkeit. Sie können den kompletten Text jedoch problemlos lesen, ohne die Fußnoten zu beachten.
An wen richtet sich „Am Ende der Machbarkeit“?
Ursprünglich war „Am Ende der Machbarkeit“ als Annäherung an eine Haltung in der Beratung gedacht. Also für Menschen, die sich in den Dienst anderer Menschen stellen, um diese auf die eine oder andere Art auf ihrem Weg zu unterstützen oder zu begleiten.1 In gewisser Weise ist Beratung ja genau das Versprechen von Machbarkeit. Und zwar in Situationen, in denen Machbarkeit aus der eigenen Kompetenz oder den eigenen Möglichkeiten der Kunden oder Klienten heraus nicht mehr funktioniert. Die Frage bei Beratung ist in fast allen Fällen eine Variante von: Was kann ich bzw. können wir machen, um meine bzw. unsere Situation in diese oder jene Richtung zu verändern oder zu verbessern? Dabei spielt die Haltung des Beraters bzw. der Beraterin kaum eine Rolle. Eigentlich nur die, ob eine Beraterin oder ein Berater dort anknüpfen kann, wo die Kundinnen und Kunden oder die Klientinnen und Klienten stehen. Es ist jedoch gerade der gezielte Veränderungswunsch der Kundinnen und Kunden bzw. der Klientinnen und Klienten, der jedem Auftrag zugrunde liegt. Und würden diese nicht davon ausgehen, dass durch das Hinzuziehen einer Beraterin oder eines Beraters auf irgendeine Art eine Verbesserung einträte, dann würden die meisten höchst wahrscheinlich auf Beratung verzichten. Beratung basiert also auf dem Versprechen der Möglichkeit, eine Situation gezielt durch Handeln zu verändern; also auf Machbarkeit. Und ein weiteres Mal: In vielen Bereichen funktioniert diese Grundannahme gut. Spannend wird es da, wo sie ihre Grenzen hat.
Das Ansinnen, ein Buch nur für Beraterinnen und Berater zu verfassen, ist allerdings im Laufe der Entstehung immer weiter in den Hintergrund gerückt, bis sich das Thema Beratung im Anhang wiedergefunden hat.
An wen richtet sich dieses Buch also? Dieses Buch richtet sich an alle, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben – egal, ob beruflich oder privat, egal, ob im Kleinen oder im Großen – an ihre Grenzen gestoßen sind und mit den bekannten und von der Allgemeinheit akzeptierten Haltungs- und Herangehensweisen nicht mehr weiterkommen oder nicht mehr zufrieden sind. An alle, die sich fragen, was die ‚Mechanismen‘ sind, die dieser ‚Hilflosigkeit‘ zugrunde liegen, ohne die Hilflosigkeit selbst zu verdammen. Und an alle, die im weitesten Sinne mit Menschen arbeiten und diese begleiten.
Eine kleine Warnung ist an dieser Stelle jedoch vonnöten: Dieses Buch bietet keine alternativen Handlungsmöglichkeiten, um etwas zu erreichen. Dann wäre es nämlich wieder nur das Versprechen von Machbarkeit. Das kann es nicht sein.
‚Warum sollte ich dieses Buch dann überhaupt lesen?‘, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Nun, aus Neugierde auf sich, auf andere und auf die Welt. Um sich an einem möglichen Erleben der Welt zu reiben. Oder vielleicht, weil Sie Lust haben, Ihr Erleben der Welt zu hinterfragen und es zu erweitern. Vielleicht aber auch, weil Sie das Terrain außerhalb der Machbarkeit schon kennen und die Beschreibung eines anderen dazu lesen möchten. Vielleicht, weil Sie ahnen, dass da noch mehr wartet als nur mehr des Gleichen. Oder vielleicht einfach nur, weil es manchmal erleichternd ist, dass andere etwas Ähnliches erleben wie man selbst.
Und am Ende der Machbarkeit? Es kann eine große Freude darin liegen, Trauer, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und Unzufriedenheit anzunehmen und zu erleben. Lernen Sie, all das zu lieben. Das kann anstrengend sein, keine Frage. Aber es ist der Ausdruck der Sehnsucht, die viele von uns antreibt, sich in die Welt zu bringen. Trauen Sie sich, diese ‚unangenehmen‘ Ausdrucksformen des Lebens als genauso wertvoll da sein zu lassen wie Freude und Zufriedenheit. Das bringt eine Freiheit, die keine Freiheit ,von‘, sondern eine Freiheit ,zu‘ ist. Die Freiheit, zu tun, weil Sie da sind und weil dieses Tun von Ihnen ausgeht. Nicht gegen andere, sondern mit allem was da ist.
Denn am Ende der Machbarkeit wartet – das sei gleich am Anfang gesagt – auch wieder Tun. Aber eben Tun von einem anderen Ort aus. Einem inneren Ort. Einem Ort, der die eigenen Bedürfnisse, die physische Existenz, das Zusammenleben, Regeln, Sachzwänge und das Zusammenspiel all dieser Aspekte in ihrer schieren Unfassbarkeit mit Freude annimmt. Es lohnt sich, diesen Ort zu erkunden. Die Welt wird danach wahrscheinlich dieselbe sein. Aber vielleicht ändert sich ein klein wenig Ihr Erleben dieser Welt.
1 Ich verwende ‚Beratung‘ als einen Sammelbegriff für jede Form von Tätigkeit, in der Menschen anderen Menschen den Auftrag geben, mit ihnen an der eigenen Situation zu arbeiten. Das schließt Seelsorge, Psychotherapie und Coaching genauso mit ein wie Organisationsberatung oder Fachberatung.
Teil 1: Was ist Machbarkeit? Oder: Die Grenzen von innen erforscht
Warum überhaupt Machbarkeit? Nun, es ist einfach: Versuchen Sie mal, sich eine Welt vorzustellen, in denen Ihre Handlungen keine auch nur annähernd vorhersagbaren oder nachvollziehbaren Konsequenzen haben. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie gehen am Morgen aus der Tür und stehen in einem anderen Treppenhaus als dem Ihren. Sie erschrecken und wollen zurück in Ihre Wohnung. Geht aber nicht, weil Ihr Schlüssel nicht in das Schloss der Tür passt, aus der Sie gerade herausgekommen sind. So könnte irgendein psychodelischer Thriller anfangen, der sich dann natürlich mit dem Thema beschäftigt, ob der Hauptdarsteller2 nicht einfach nur verrückt oder auf einem Trip ist.
Moment für Moment so zu erleben, dass sich unser Leben als Kontinuum darstellt und irgendwie handhabbar ist, stellt für die meisten von uns die Grundlage geistiger und seelischer Gesundheit dar und ist unabdingbar für das tägliche Überleben. Dieser Zusammenhang – ich tue etwas und ein zu erwartendes Resultat tritt ein – beruht auf der Annahme der Machbarkeit. Sie ist das Prinzip, das unserem Alltagsleben zugrunde liegt. Eine subtile Angst vieler Menschen ist es, dass dieses Grundprinzip plötzlich nicht mehr funktioniert. Genau deswegen ist es der Aufhänger für dieses Buch. Ein Buch, das die bange Frage aufwirft: Wo endet diese Grundannahme? Bevor wir uns der Frage widmen, was sich am Ende dieser Grundannahme alles abspielt, müssen wir aber erst einmal das genauer kennenlernen, worum es eigentlich geht, nämlich die Machbarkeit.
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, sich einer Grenze zu nähern: von der bekannten Seite oder von der unbekannten Seite her. Wir werden in diesem Buch beides tun. In Teil 1 pirschen wir uns von der bekannten Seite – also von der Machbarkeit aus – an die Grenze heran und werfen einen Blick hinüber. In Teil 2 lassen wir uns auf der anderen Seite absetzen und schauen, was uns das bringt. Erst dann haben wir das Areal der Machbarkeit und der ,Nicht-Machbarkeit‘ soweit erkundet, dass wir uns eine altbekannte Alternative zur Machbarkeit in Teil 3 und Teil 4 genauer anschauen können.
Sie brauchen Teil 1 und Teil 2 nicht zu lesen, um Teil 3 oder Teil 4 dieses Buchs zu verstehen. Ganz im Gegenteil: Direkt mit Teil 3 oder Teil 4 zu starten, ist genauso gut. Und wenn Sie dann über ein paar Fragen stolpern, schmökern Sie einfach in Teil 1 und Teil 2. Für alle, die sich dem Ende der Machbarkeit langsam annähern wollen, hier also die schrittweise Erkundung der Machbarkeit: je Kapitel jeweils ein Einzelaspekt, der für sich genommen Machbarkeit beleuchtet. Zusammen genommen erlauben die Einzelaspekte dann, Machbarkeit in ihrer Wirkung zu sehen.
Innen versus Außen: Über eine Grenze, die keine ist
Es gibt eine Grenze, die Sie nicht dauerhaft überwinden können, egal, wie sehr Sie es wollen und versuchen. Es ist die Grenze zwischen dem Ich und dem, was nicht ‚Ich‘ ist. Diese Grenze hat unter anderem eine Eigenschaft: Egal, wie sehr Sie sich anstrengen, Sie werden immer von innerhalb dieser Grenze erleben und agieren; zumindest, solange Sie sich als physisches Wesen in einer physischen Welt befinden. Sie können Außenperspektiven einnehmen, selbstlose Taten vollbringen oder Drogen nehmen und auf einen tollen Trip kommen. Derjenige, der das tut, kann all das nur aus einem erlebten Inneren heraus tun, weil es immer eine Instanz gibt, die es erlebt. Und das ist das ‚Ich‘ oder eben das Innen; zumindest für den Moment.
Wohlgemerkt: Ich rede von uns als physische Wesen in einer physischen Welt mit einem Erleben von uns und dieser Welt. Ob Sie nun daran glauben oder nicht, es gibt Menschen, die Einheitserfahrungen machen. In solchen Momenten löst sich das Ich auf. Es ist weg. Und weil es weg ist, gibt es auch kein Erleben von Innen und Außen mehr. Genau genommen, gibt es in diesem Moment gar kein Erleben mehr. Wir wissen das, weil uns Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, davon berichtet haben. Dazu mussten sie allerdings in ihr Alltags-Ich zurückkehren – und schon ist die Grenze zwischen Innen und Außen wieder da. Eigentlich war sie auch nie weg, aber dazu später mehr.
Wir sind auf der Suche nach den Grenzen des Machbaren. Machbares kann – davon gehen wir jetzt einmal vereinfachend aus – nur in einer physischen Welt stattfinden.3 Warum? Weil nur hier die Möglichkeit besteht, eine Situation zu erleben, dann zu handeln, um die Situation zu ändern, und dann objektiv zu überprüfen, ob und wie sich die Situation zu dem entwickelt hat, was wir uns vorher vorgestellt haben. Und all das natürlich auf der Basis der Vorstellung und dem Erleben (Innen), das ich von der Situation und der Welt (Außen) habe. Das möge uns als Definition für Machbarkeit für den Augenblick reichen.
Ich sage das, weil uns damit Einheitserfahrungen im Moment nicht interessieren. Der erlebte Unterschied zwischen Innen und Außen ist eine Grundvoraussetzung für Machbarkeit, und genau den gibt es in Erleuchtungs- bzw. Einheitserfahrungen für die Dauer dieser Erfahrung nicht.
Nun wäre es schön, wenn diese erlebte Grenze zwischen Innen und Außen irgendwie fix wäre. Das würde die Sache mit der Machbarkeit extrem vereinfachen. Dann hätten wir einfach eine Menge begrenzte Innen, die im Inneren Ideen von dem entstehen lassen, wie das Außen sein soll, und dann solange an dieser Grenze zwischen Innen und Außen agieren, bis das gesamte Außen so ist, wie es in der inneren Idee davon aussieht. So einfach ist es aber nicht.
Es geht schon da mit los, dass es diese Grenze ‚objektiv‘ gar nicht gibt. Objektiv bedeutet in diesem Fall, dass sich alle, oder zumindest eine interessierte Mehrheit, einig darüber sind, dass diese Grenze zwischen Innen und Außen existiert. Aber dem ist nicht so. ‚Klar‘, könnten Sie jetzt denken, ‚das Innen ist unser physischer Körper, der durch die Haut begrenzt ist‘. Nun, schon hier haben Sie den Teil der Biologen, Ökologen und Mediziner verloren, die sich mit diesem Thema beschäftigen; und die sollten es ja wissen, das sind die Fachleute. Die werden einfach ein bisschen genauer hinschauen und plötzlich ist die Haut nicht mehr die Haut, sondern eine Art eigenes Universum mit Millionen von verschiedenen Einzelwesen – Zellen, Zellkonglomerate, Bakterien, … – die alle vor allem eines tun, nämlich miteinander kommunizieren. Neben dem Kommunizieren ist noch das Regenerieren eine wichtige Tätigkeit und das Aufrechterhalten der bestehenden Struktur.4 ‚Und eine Grenze‘, werden Ihnen die Fachleute sagen, ‚ist die Haut schon gar nicht‘. Ganz im Gegenteil. Kein Organ ist so durchlässig wie die Haut.
Allerdings bringt uns diese Diskussion nur bedingt weiter. Selbst wenn wir uns für die Annäherung an das Thema Machbarkeit darauf einigen, dass die physische Grenze zwischen Innen und Außen, also zwischen dem physischen Ich und allem anderen, die Haut ist, bleibt die Frage, wie man diese Grenze auf einer Ebene des individuellen Erlebens finden soll. Oder genauer: wer diese Grenze definiert. Und da gibt es genau eine Antwort: Sie tun das. Und zwar mit Ihrer eigenen Grenze zwischen Innen und Außen. Und Sie tun es permanent, wenn auch einen Großteil der Zeit unbewusst.
Sie bestimmen jeden Moment neu, wo diese Grenze verläuft. Nehmen wir ein in unserer Zeit gängiges Beispiel, den Kult um den schlanken Körper, den Versuch, abzunehmen. Dieses Unterfangen können Sie nur betreiben, wenn Sie das Fett, das Sie loswerden wollen, vom Innen ins erlebte Außen verbannen. Es befindet sich natürlich nach wie vor innerhalb Ihrer Haut, also Ihres physischen Körpers, aber in dem Moment, in dem Sie es zu ,Mein Fett, das ich loswerden will‘ machen, ist es nicht mehr Teil Ihres erlebten Ichs. Machen Sie Ihr Fett nicht zu einem Teil des Außen, dann wird es schwierig, es loszuwerden, weil Sie nur noch ein Bruchteil Ihres Ichs wären, sobald Sie das Fett weggehungert hätten.
Aber auch auf nicht-physischer Ebene finden wir diese von Ihnen verschiebbare Grenze zwischen Innen und Außen. Zum Beispiel bei schlechten Angewohnheiten. Wir tun etwas. Wir tun es immer und immer wieder und es gefällt uns selbst nicht. Wir werden uns dessen bewusst und nennen es ,schlechte Angewohnheit‘. Genau in dem Moment, in dem wir uns dessen bewusst werden, ist es vom ‚Ich‘ zum ‚Meines‘ geworden. In diesem Moment gibt es mich (Innen) und meine schlechte Angewohnheit. Und schon ist die schlechte Angewohnheit auf die andere Seite der Grenze verbannt: ins Außen. Und dort wartet die Machbarkeit!
Selbst in die andere Richtung funktioniert das: Wir eignen uns einen Teil der äußeren Welt an und machen ihn zum Ich. Wir holen ihn von außen nach innen. Ein Beispiel? Das neue iPhone ist da und natürlich wollen wir es haben. Wir fühlen uns unvollständig, solange wir noch mit dem alten Modell herumlaufen. Dann kaufen wir es schließlich – und mit einem Mal fühlen wir uns wieder glücklich und ‚ganz‘. Dabei spielt es keine Rolle, dass wir diese Mechanismen intellektuell komplett durchschauen. Das Erleben bleibt das gleiche.
Ähnlich funktioniert das mit dem ‚Selbstdefinieren‘ der Grenzen zwischen Innen und Außen auch auf einer kollektiven Ebene. Nehmen Sie einen beliebigen Staat dieser Welt, über dessen Grenzen Flüchtlinge hereinströmen. In der Regel ist eine große Sorge, dass der Staat für den Lebensunterhalt der Flüchtlinge aufkommen müsse, was die Ressourcen für die eigenen Bürger angeblich schmälert. Die Frage ist also: reinholen (zu einem von uns machen, einbürgern) oder draußen lassen (vielleicht noch in Flüchtlingslagern unterbringen – also physisch reinholen – aber sicher nicht einbürgern, auch nicht temporär)? Wenn im selben Land aber Fachkräfte fehlen, wird der Staat alles daransetzen, diese Fachkräfte aus anderen Staaten anzuwerben und langfristig zu binden. Am besten über Einbürgerung, wobei es keine Rolle spielt, ob diese Fachkräfte aus demselben Land kommen wie die Flüchtlinge, die man nicht nach ‚Innen‘ holt.
Zugegeben, ein sehr einfaches Beispiel, obwohl so erlebt. Alles, was es verdeutlichen soll, ist, dass es keine feste Grenze zwischen Innen und Außen gibt und dass diese Grenze permanent vom Innen neu definiert wird.
Diese Grenze ist unabhängig von einer physischen Grenze. Für die Machbarkeit ist diese Grenze zwischen erlebtem Innen und Außen allerdings essenziell, weil nur an dieser Grenze Handeln möglich ist. Ziel von Machen ist es, das Außen zu verändern, um das Erleben zu verbessern, oder zumindest nicht zu verschlechtern. Erleben können aber immer nur einzelne im Innen. Selbst wenn es ein kollektives Erlebnis ist. Dazu aber später mehr. Für jetzt gilt: Gäbe es kein Außen, dann gäbe es nichts zu verändern und damit kein ‚Machen‘.
Was genau ist aber Machbarkeit, wenn das Feld, in dem sie stattfindet, nicht zu fassen ist, weil es von mir oder dem Innen, dem ich angehöre, permanent neu definiert wird? ‚Und wer bin ich dann überhaupt‘, werden Sie jetzt möglicherweise fragen, ‚wenn ich ja angeblich meine Grenzen zumindest auf der Erlebens-Ebene beliebig verschieben kann?‘. Können Sie nicht. Oder, um exakt zu sein: können die meisten von uns nicht. Oder, um noch exakter zu sein: wollen die meisten von uns nicht.
Warum wollen wir das nicht? Nun, es liegt am Ego. Wir werden diesem Ego im Laufe des Buchs noch öfter begegnen; dieser Instanz, die jedem von uns innewohnt und die in den letzten Jahrzehnten mit dem großen Einzug der so genannten ‚östlichen Weisheiten‘ in die westliche Welt vollkommen zu Unrecht in Verruf geraten ist. Lassen Sie uns – nur für den Moment und einmal mehr sehr ungenau – sagen, das Ego sei unser Alltags-Ich. Der Teil des Ichs – oder eben auch erlebten Innen –, der uns in unserer Alltagswelt am Überleben hält. Dafür wird er alles tun! Und eine Strategie, die das Ego von Anfang an verfolgt, auch um uns vor anderen zu schützen, ist, eine Identität aufzubauen. Etwas, von dem es sagen kann: Das bin ich. Ich mit meiner Geschichte. Ich mit meinen Stärken und Schwächen. Ich mit meinen Freuden und Schmerzen. Und jeder neue Moment wird vom Ego – also von der Ich-Instanz, die den Alltag meistert – in diese Identität integriert, indem er zu einer Erinnerung gemacht wird, Zusammenhänge hergestellt werden, Bewertungen angehängt werden und noch vieles mehr, bis die Identität ein bisschen gewachsen ist, ohne dass dabei Widersprüche zurückbleiben. Das letzte, was das Ego bei diesen heroischen Bemühungen brauchen kann, ist die Idee, dass Sie selbst Ihre Grenzen wählen und definieren. Was Ihr Ego auch nicht mag, ist, dass ich über Ihr Ego rede und gleichzeitig Sie adressiere, als gäbe es außer Ihrem Ego noch eine andere Ich-Instanz. Wäre das so, wäre nämlich die ganze, schöne Arbeit, eine Identität aufzubauen, futsch! Warum? Weil das Ego dann etwas wäre, das von Ihrer anderen Ich-Instanz, die ich gerade in Ihnen anspreche, ins ‚Außen‘ manövriert werden könnte. Wie gemein!
Einmal mehr der Hinweis, dass es nicht darum geht zu bewerten, ob das nun gut oder schlecht ist. Was uns hier interessiert ist, was das mit Machbarkeit zu tun hat.
Teil Ihrer Identität ist ein in sich stimmiges Abbild der Außenwelt und Ihrer Beziehung zu dieser Außenwelt. Ist dieses Bild nicht mehr stimmig, passiert genau das, was wir (vorläufig) als Machen definiert haben: Die Außenwelt muss an das angepasst werden, was laut Vorstellung des Egos am besten für Ihre stimmige Identität5 ist.
Leider wird hier schon klar, dass die bisherige Definition von Machen nicht ausreichend ist. Warum? Weil das Agieren an der Grenze zwischen Innen und Außen natürlich unweigerlich die Grenze selbst verändert. Sich das einzugestehen, wäre für unser Ego allerdings ein weiteres Mal unmöglich. Außer natürlich, es findet eine geeignete Bewertung dafür. Eine, die es annehmen kann und die der hart erarbeiteten Identität nicht zuwiderläuft. Persönliches Wachstum zum Beispiel ist für viele eine solche akzeptable Bewertung; oder soziales Engagement oder eben jedes Verhalten, das auf Werten beruht, die gesellschaftlich gerade ‚gelten‘.6
Verwirrt? Hier noch einmal die Grundaussagen zum Thema Innen und Außen: Solange Sie leben, werden Sie die Grenze zwischen Ich und allem anderen, also zwischen Innen und Außen, nicht überwinden oder auflösen können. Auch wenn Sie vielleicht gerne hätten, dass es eine feststehende Grenze ist, weil Sie sich darüber identifizieren, ist das doch nicht der Fall. Schlimmer noch, die Grenze wird von Moment zu Moment von Ihnen selbst neu definiert und dabei achten Sie darauf, dass Ihre Identität konsistent bleibt. Um das zu gewährleisten, müssen Sie bisweilen das Außen an Ihre innere Idee vom Außen anpassen. Dazu gehört es auch, einen Teil Ihrer Identität, also Ihres Innen, ‚ins Außen‘ zu schieben, um diesen anpassen zu können, wenn nötig.
Gibt es diese Grenze zwischen Innen und Außen nun wirklich? ‚Ja, weil ich sie ja andauernd erlebe‘, könnten Sie nun antworten. Oder: ‚Nein, weil eine Grenze, die ich zumindest theoretisch beliebig verschieben kann, eigentlich keine Grenze ist‘, könnten Sie auch sagen. Tatsache ist: Es spielt keine Rolle, ob es die Grenze gibt oder nicht. Es spielt nur eine Rolle, diese kennen zu lernen, sich dabei kennen zu lernen und soweit es geht herauszufinden, wer es ist, der diese Grenze zieht. Wozu das? Weil an dieser Grenze ‚‚Machen‘ stattfindet. ‚Machen‘ ist – für den Moment – das Agieren an der Grenze zwischen Innen und Außen, in der Überzeugung, damit den gewünschten Effekt im Außen zu erzielen. Letztlich hat dieses Agieren das Ziel, durch die erreichte Veränderung im Außen eine Verbesserung im Innen zu erleben. In der Regel ist diese angestrebte Verbesserung ein höherer Grad an Konsistenz Ihrer Identität.
Wenn Sie nun Machbarkeit begreifen wollen, müssen Sie notgedrungen den Ort kennenlernen, an dem Machen stattfindet. Aber dieses Erkunden Ihrer Grenze ist ein risikoreiches Unterfangen. Und Sie – oder besser: Ihr Alltags-Ich, dem Sie täglich danken sollten, dass es Ihre physische, psychische und soziale Existenz sichert – sind Ihr ärgster und stärkster Gegner bei dieser Suche. Sie arbeiten gegen sich!
Noch ein kleiner Hinweis: Zwei verwandte Ansätze, die sehr oft als Gegenentwurf zur Machbarkeit oder gar zum Machbarkeitswahn genannt werden, sind Empathie und Selbstlosigkeit. Lassen Sie uns zum Ende des Abschnittes und mit dem Wissen um die Grenze zwischen Innen und Außen und um das Alltags-Ich kurz hinschauen, wo die Gefahren bei diesen beiden Ansätzen liegen:
Wir sind empathische Wesen. Das heißt, wir können uns in das Innen eines anderen Wesens hineinversetzen, dessen Innenperspektive einnehmen, dessen Gefühle mitfühlen und dessen Außen aus seiner Innenperspektive betrachten. Kein Überleben ohne diese Fähigkeit. Und es sieht so aus, als wäre das ein Weg, einen Teil der Grenzen, an denen Machbarkeit stattfindet, nämlich die zwischen Ich und Du, aufzulösen und damit eine echte Alternative zur Machbarkeit zu haben. Aber hier spielt uns in den meisten Fällen unser Ego einen kleinen Streich: Es lässt uns in diesen Momenten glauben, wir könnten uns in den anderen hineinversetzen und selbst zurücktreten. Bis zu einem gewissen Grad geht das auch, aber all das wieder nur aus Ihrer Innenperspektive. Einem können Sie nämlich nicht dauerhaft entkommen, und zwar der Tatsache, dass alles, aber auch alles, was Sie erleben, zwar vielleicht von etwas im Außen angestoßen wird, aber immer nur von Ihnen in Ihrem Innen erlebt werden kann. Empathie? Ja! Aber immer nur im Innen für etwas im Außen. Ein anderes Innen können Sie, egal, wie sehr Sie das wollen, nicht direkt erleben. Sonst wäre es wieder eine Einheitserfahrung. Und noch einmal: Das ist möglich. Nur gibt es in einem solchem Zustand sowohl die Machbarkeit als auch deren Alternativen nicht mehr, eben weil es Ihr Innen nicht mehr gibt und damit niemanden mehr, der all das erlebt. Wenn Ihnen also jemand erzählt, er verstehe Sie vollkommen, dann heißt das in der Regel eigentlich, dass er das, was er von Ihnen im Außen erlebt, in Einklang und Resonanz mit seinem Innen bringen kann.
Empathie ist eine wunderbare Gabe, die man gar nicht genug üben kann. Aber sie ist in den meisten Fällen kein ‚Gegenentwurf‘ zur Machbarkeit. Nicht zumindest, wenn sich Empathie nur auf einen Teil aller Beteiligten richtet. Nehmen Sie als Beispiel Flüchtlinge, die durch Schlepperbanden unter lebensgefährlichen Umständen und um den Preis ihres gesamten Habs und Guts auf die Reise ins Zielland geschickt werden. Empathie empfinden wir in erster Linie für die Flüchtlinge, nicht die Schlepper. Und aus Empathie fangen wir an zu handeln. Das ist wichtig und notwendig, bleibt aber im Bereich der Machbarkeit. Denn über Empathie nur mit einem Teil der Beteiligten, also in unserem Fall mit den Flüchtlingen, ziehen wir eine weitere Grenze, die ein Innen und ein Außen konstituiert. Wir haben Empathie für die Flüchtlinge, die Schlepper allerdings schieben die meisten von uns auf die Seite der Bösen, genauso wie die Politiker und Milizen, die vielleicht in den Ursprungsländern für Unruhe und Unsicherheit sorgen oder sich den Besitz aneignen, der allen gehören sollte. Und damit schaffen wir einmal mehr ein Innen und ein Außen und agieren gegen das Außen, um das Innen zu verbessern. Das ist Machbarkeit.
Daran ist nichts Falsches, denn wenn unser Tun auch nur ein Leben rettet, war es das wert. Aber dennoch sind wir mit daran beteiligt, die Situation strukturell zu verhärten, weil wir Grenzen schaffen und uns als empathische Wesen für das ‚Innerhalb‘ dieser Grenzen zur Verfügung stellen, nämlich all denjenigen, die unsere Empathie ‚verdienen‘. Während die anderen ins Außen verbannt werden. Das macht die Situation greifbarer und erleichtert uns die Entscheidung, was wir machen sollen. Aber was ist mit denen im Außen?
Die radikale Art der Empathie ist die, die sich auf alle Beteiligten richtet. Ohne Grenzen zu ziehen. Die so gut wie möglich bei allen die Fragen stellt: Was bewegt sie, was motiviert sie, wie sieht deren Wirklichkeit aus? All das, ohne irgendein moralisches Urteil zu fällen. Verstehen und nachvollziehen wollen. Und das schließt Sie selbst natürlich mit ein.
Dann finden sich vielleicht neue Handlungsmöglichkeiten, weil ich nicht mehr gegen irgendwen agieren muss und damit die Machbarkeit ein bisschen entmachtet habe. Aber das fordert sehr viel. Vor allem die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit den Fragen: Was bewegt mich, empathisch zu sein, und was ist mein Nutzen davon? Eben die Fragen nach dem ,um zu‘ im Innen, wenn ich anderen im Außen helfe.
Ähnlich ist es mit der Selbstlosigkeit. Wie wollen Sie denn ganz für andere da sein, wenn da kein Selbst ist, also niemand, der das tun kann? Und was ist auch falsch daran, das eigene Ego genauso ernst zu nehmen, wie alles andere, das wir im Inneren erleben oder das uns im Außen begegnet? ‚Ganz‘ und damit gesund können Sie nur sein, wenn Sie alle Teile Ihres Ichs, also auch Ihr Ego und dessen ‚egoistische Wünsche‘, liebevoll und dankend als immer anwesend annehmen.
Nur ein gesundes, selbstbewusstes und starkes Innen, das sich seiner Bedürfnisse, Ängste und Wünsche bewusst ist, kann sich der Macht der Machbarkeit bei Bedarf entziehen. Ansonsten ist das Risiko sehr groß, dass sowohl Empathie als auch Selbstlosigkeit mit einem unentdeckten persönlichen ,um zu‘ einhergehen. Und das ist eine der subtilsten Formen der Machbarkeit. Dann sind es nämlich genau Empathie und Selbstlosigkeit, die den Blick auf die eigenen versteckten Ziele und Bedürfnisse versperren. Dann sind Empathie und Selbstlosigkeit unbewusst und unerkannt an hoch egoistische Ziele gebunden. Ich fälle kein moralisches Urteil darüber, denn darum geht es mir hier nicht. Wichtig ist nur zu verstehen, dass diese beiden Ansätze sehr oft zu einer Verhärtung der Situation führen, die durch sie eigentlich verbessert werden soll, und das sich dahinter einmal mehr eine sehr subtile Form von Machbarkeit versteckt: anderen sich und seine Energie zur Verfügung zu stellen, um sich mit den eigenen, eventuell widersprüchlichen Bedürfnissen im Innen nicht auseinandersetzen zu müssen; egal, ob das bewusst oder unbewusst passiert. Und das gilt für einzelne Personen genauso wie für Gruppen, Staaten oder Organisationen.
Ans Ende der Machbarkeit gelangen Sie in diesem Fall, indem Sie sich ,sich selbst‘ und der Frage nach dem eigenen Nutzen von Aktionen zuwenden, die aus Empathie oder Selbstlosigkeit heraus passieren, und zwar ohne zu bewerten, ob die Aktionen weniger wert sind, wenn Sie aus einem egoistischen Motiv heraus passieren.
Hardware versus Software: Über eine hilfreiche, aber fatale Vereinfachung der Welt seit Descartes und über die Hoffnung, den Heiligen Gral doch noch zu finden
Eigentlich ist es eine sehr simple Unterscheidung. Die zwischen Körper und Erleben. Ken Wilber würde sie in seinem Modell als rechts und links bezeichnen. Descartes seinerseits hat lange davor die Bezeichnungen Res Extensa und Res Cogitans gewählt. Um was geht es dabei und was hat das mit Machbarkeit zu tun?
Fangen wir zuerst mit einer Metapher an, die schon bald zu kurz greifen wird, aber für den Anfang eine gute Orientierung liefert: die Unterscheidung zwischen Hardware und Software. Richtig, wir bemühen den Computer, um uns der Tatsache zu nähern, dass es zwei parallele Universen gibt, in denen wir als Individuen permanent leben: Es gibt unseren Körper (oder die gesamte physische Welt) und es gibt unser Erleben, genau genommen, unser inneres Erleben.
Unser Körper ist ein biochemischer Organismus, den wir bis in sehr kleine Details vermessen und dessen funktionale Abläufe wir sehr weit erforscht haben. Das geht soweit, dass wir Gehirnaktivitäten messen und ungefähr zuordnen können, was ein Mensch wohl in einem bestimmten Moment innerlich erlebt. Ist zum Beispiel eine bestimmte Gehirnregion aktiv und hat bestimmte Schwingungs- und Aktionsmuster, geht es wahrscheinlich um soziales Verhalten. Ist eine andere Gehirnregion auf eine bestimmte Art aktiv, geht es wahrscheinlich um Emotionen. Haben Schwingungsmuster eine bestimmte Frequenz, können wir mit fast absoluter Sicherheit sagen, dass der betroffene Mensch entweder in einer Tiefschlafphase ist oder sich in einem tief meditativen Zustand befindet.
Diese Erforschung unseres Körpers und der gesamten physischen Welt hat uns viele gute Dinge gebracht. Krankheiten können mit messbarem Erfolg geheilt werden, wir können uns in einer unglaublichen Geschwindigkeit von Ort A zu Ort B begeben und wir können mithilfe des Internets mit Menschen visuell und auditiv kommunizieren, die deutlich außer Sicht- und Hörweite sind. Das ist schön. Wir reden von Hardware. Wir reden von physischer Materie, die sich unter bestimmten Rahmenbedingungen nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten verhält. Das hat den Vorteil, dass Dinge in einem für uns brauchbaren Rahmen vorhersagbar werden, und das wiederum führt dazu, dass Dinge machbar werden.7
Ein Beispiel: Sie möchten eine Tasse Tee trinken. Sie haben kaltes Wasser und brauchen heißes. Nun wissen Sie, dass, wenn Sie das Wasser in einen Topf füllen, ihn auf den Herd stellen, die Platte einschalten und eine gewisse Zeit warten, danach heißes Wasser im Topf ist. Sie haben Wasser heiß gemacht. Das Wasser wird sich nicht entschließen, durch diesen Vorgang zu Schokolade zu werden. Das kann es nicht, weil es bestimmten physikalischen und chemischen Gesetzen gehorcht.
Nun ist das wieder ein sehr plakatives Beispiel, aber es reicht uns vollkommen aus, um zu verstehen, was die Hardware-Seite unserer täglich erlebten Welt ist. Es ist alles, was Naturwissenschaftler jemals erforscht oder entwickelt haben, was Materie betrifft, was durch Modelle und Gesetzmäßigkeiten beschreibbar ist und dessen Verhalten in bestimmten Rahmenbedingungen beobachtbar, vorhersagbar und messbar ist. Wissenschaftstheoretiker würden mich jetzt wahrscheinlich am liebsten steinigen, aber für ein Grundverständnis der Unterscheidung Hardware vs. Software reicht das aus.
Jetzt kommen wir das erste Mal zum Thema Quantenmechanik.8 Denn auch die Physik-Laien unter uns haben inzwischen begriffen, dass wir nicht bei unserem newtonschen Weltbild stehengeblieben sind, bei dem alles irgendwie über Kausalzusammenhänge verbunden ist. Es gibt da in der Physik eine Welt, in der es auch andere Zusammenhänge gibt. Synchronizität zum Beispiel, also gleichzeitige, nichtmaterielle Verbundenheit, bei der Distanz keine Rolle spielt. Und ja, all das ist real. Real bedeutet in diesem Zusammenhang: Jeder Mensch, der sich die Mühe macht, die Theorie, einschließlich ihrer Modelle zu verstehen und Versuchsaufbauten entsprechend nachzubauen, kann das Verhalten von Einheiten auf dieser Ebene unserer Welt wiederholen, messen und, wenn er Lust und viel Zeit hat, diese Welt noch weiter erforschen. Das heißt, kurz gesagt, es gibt diesen Teil der Wirklichkeit objektiv (beobachterunabhängig, messbar und wiederholbar).
Den Teil der Wirklichkeit, der beobachterunabhängig, messbar und dessen ,Verhalten‘ wiederholbar ist, bezeichnen wir für jetzt als Hardware. Descartes hat den Hardware-Teil der Wirklichkeit als Res Extensa bezeichnet und gefordert, dass wissenschaftliches Arbeiten sich doch bitte auf diesen Teil unserer Wirklichkeit beschränken solle und nicht auf die Res Cogitans, denn das innere Erleben sei nicht beobachtbar. Das hatte den Vorteil, dass jede Art von Scharlatanerie und Aberglaube keine Chance mehr hatte, und es hat uns auf unseren heutigen Lebensstandard gebracht. Descartes sei Dank!
Bezogen auf unsere Metapher der Hardware und der Software, wäre die Hardware der ,materielle‘ Teil an einem Computer, der in der Lage ist, durch Stromimpulse zwei physische Zustände – in der Regel mit Null und Eins bezeichnet – zur Verfügung zu stellen, lange Ketten von diesen Zuständen zu speichern und diese nach bestimmten Regeln einzulesen, zu kombinieren und wieder auszugeben.
Alles andere ist Software. Das heißt, welche ,Bedeutung‘ die Nullen und Einsen haben, deren Kombination und deren Zusammenspiel ist Interpretationssache. Wenn Sie einen Code aus Nullen und Einsen haben, ist es tatsächlich nicht möglich, eindeutig zu sagen, was dieses Programm tun wird, wenn Sie es auf einem Computer laufen lassen. Sie müssen es ausprobieren und sehen, was passiert. Der gleiche Code kann auf zwei unterschiedlichen Computern (also zum Beispiel einem Mac und einem IBM) – noch dazu mit verschiedenen Betriebssystemen – sehr unterschiedliche Sachen bewirken.
Ähnlich ist es mit uns Menschen. Das, was Descartes als Res Cogitans bezeichnet hat, also alles, was wir innerlich erleben, denken und fühlen, ist nicht messbar. Alles, was wir machen können, ist, es zu erleben und dann zu kommunizieren oder es zu erleben und uns entsprechend zu verhalten – was genau genommen auch eine Art der Kommunikation ist. Und dann sind wir darauf angewiesen, dass ein anderer es hört oder sieht, es wiederum in seine innere Erlebniswelt einordnet und hoffentlich irgendwie ,verstanden‘ hat, also in unserem Sinne interpretiert hat.
Es gibt unglaublich viele Methoden, auch dieses innere Erleben ,messbar‘ zu machen. Und einige davon funktionieren sehr gut. Davon ,profitieren‘ wir zum Beispiel, wenn Google uns Werbung anzeigt, die uns tatsächlich interessiert. Das funktioniert, weil unser inneres Erleben und das daraus resultierende Verhalten sich in bestimmten, groben Grundzügen bei den meisten von uns ähneln. Bis heute ist es aber so, dass diese Vorhersagen bei ca. 10 % der Google-User nachweisbar nicht annähernd zutreffen und die Werbung keinerlei Effekt hat. Für naturwissenschaftliche Forschung (also Hardware) wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Stellen Sie sich vor, eine Fluggesellschaft kann Ihnen nur mit 90 % Sicherheit sagen, dass das Flugzeug – trotz Steuerung – dort ankommt, wo Sie hinwollen und nicht in einer komplett anderen Stadt landet und zwar ohne, dass irgendjemand mitbekommen hätte, wie das passiert ist.
Mit all dem konfrontiert, sind verschiedene Wissenschaften entstanden, die sich von den Naturwissenschaften unterscheiden. Psychologie und Soziologie sind zwei davon. Sie beschäftigen sich mit dem individuellen Erleben von Menschen oder Gruppen von Menschen und dem daraus resultierenden Verhalten. Dort hat man sich darauf geeinigt, dass eine gewisse Mehrheit, die sich in einem bestimmten Rahmen ähnlich verhält, ein ausreichend wiederholbares und messbares Ergebnis ist. Auch das ist gut so, weil wir dann eine Art Rahmen, also eine Normalität, haben, in dem sich die meisten von uns vorhersehbar bewegen und verhalten9.
Und weil es da immer noch dieses innere Erleben gibt, auf das einfach keiner wirklich und komplett zugreifen kann, außer dem, der es erlebt, gibt es die Philosophie. Die beschäftigt sich genau mit den Fragen, die für jeden einzelnen von uns im inneren Erleben relevant sind. Hier braucht es nur noch eine gute Reihe von Argumenten und genügend ebenfalls geschulte Menschen, die dieser Kette von Argumenten zustimmen oder nach bestimmten Regeln der Logik widersprechen, und die Ergebnisse gelten als nachvollziehbar oder valide. Nicht mehr als wiederholbar oder als messbar, das würde hier aber auch keinen Sinn ergeben.
Dieses innere Erleben ist in gewisser Weise die Software, die auf Basis der vorhandenen Hardware – also unseres physischen Körpers und der physischen Welt insgesamt – funktioniert.
Nun ist all das nicht neu. Seit Descartes haben viele Menschen genau diese Trennung beschrieben und immer wieder versucht, dabei exakt zu sein.10
Wozu wir allerdings nichts sagen können – so gerne wir es würden und so dringend viele Menschen danach suchen – ist der Zusammenhang zwischen unserer Hardware und unserer Software, also zwischen dem, was auf physischer und körperlicher Ebene messbar passiert und unserem inneren Erleben. Egal, was Sie bei einem Menschen auf körperlicher Ebene messen, Sie werden trotz der Komplettvermessung unseres menschlichen Gehirns nicht wissen, was er erlebt. Das hat verschiedene Gründe.
Zum einen hat Descartes – und viele andere vor und nach ihm – ein Dilemma erkannt, weswegen er ja genau dazu geraten hat, die Finger vorläufig von der Res Cogitans zu lassen: Es ist das Dilemma, dass wir inneres Erleben nur nach außen bringen können, wenn wir es auf irgendeine Art kommunizieren. Kommunizieren heißt aber, das innere Erleben in Worte oder andere Ausdrucksmittel zu fassen. Das ist zuallererst immer eine Komplexitätsreduzierung. Das, was ,draußen ankommt‘, ist nie das, was drinnen los ist. Zum anderen ist Kommunizieren immer an ein Kommunikationssystem gebunden, also verbale und nonverbale Sprache und deren Bedeutung, was an sich im Rahmen der Sozialisierung erlernt wird und damit nicht eindeutig ist. Zudem muss irgendjemand das Kommunizierte interpretieren und das geschieht wiederum immer anhand des inneren Erlebens der empfangenden Person.
Es wird sehr schnell deutlich, dass es in Bezug auf die Res Cogitans – also unser inneres Erleben – nebst anderen vor allem ein großes Dilemma gibt, und das ist die Tatsache, dass es nur einen Menschen gibt, der Ihr inneres Erleben erlebt, nämlich Sie. Und dabei wird es auch bleiben.
Um noch einen Schritt weiter zu gehen, schauen wir uns kurz die Konstruktivisten an. Die sagen, dass jeder von uns sich die Welt im Innern konstruiert. Deren Folgerung –zumindest die der radikaleren Konstruktivisten – ist, vereinfacht gesagt, dass wir gar nichts über die äußere Welt sagen können, weil bei all dem ja immer inneres Erleben involviert ist und es damit überhaupt keine objektive Welt gibt oder zumindest das Kommunizieren darüber sinnlos ist. Es gibt Bücher über Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen, und es ist sehr unterhaltsam, sich und seine eigenen Überzeugungen beim Lesen dieser Bücher zu beobachten. Für die Frage nach Machbarkeit und ihren Grenzen ist das allerdings nicht besonders hilfreich, zumindest, wenn wir anerkennen, dass es eine objektive ,Hardware‘-Welt gibt.11 Und in dem Moment, in dem Sie aus Unachtsamkeit gegen einen Laternenpfahl laufen und ein Mitmensch herzlich darüber lacht, werden Sie die Existenz dieser objektiven Hardware-Welt schmerzlich anerkennen.
Einem weiteren Dilemma begegnen Forscher, die einen direkten Kausalzusammenhang herstellen möchten zwischen messbaren Abläufen auf Körper ebene und dem, was ein Mensch im Inneren erlebt. Sie sind immer darauf angewiesen, dass ihnen der Mensch, an dessen Körper sie die Messungen durchführen, kommuniziert, was er im Moment der Messung erlebt.12
Nun ist das aber nicht die letzte Schwierigkeit bei der Suche nach einem Zusammenhang zwischen messbaren Aktivitäten auf der körperlichen Ebene und den Inhalten inneren Erlebens. Leider ist über andere Experimente inzwischen hinlänglich bekannt, dass inneres Erleben zu Veränderungen auf der körperlichen Ebene führt. Das anschaulichste Beispiel dafür sind Traumata, also Situationen, die im inneren Erleben nicht zu verarbeiten sind und die nachweislich einen veränderten Stoffwechsel im Gehirn zur Folge haben. Das heißt, selbst wenn man einen Kausalzusammenhang zwischen körperlicher und innerer Erlebensebene beweisen wollte, müsste man auf zirkuläre Zusammenhänge,13 untersuchen und das macht die ganze Sache schon wieder so komplex, dass es kaum mehr nachvollziehbar ist.
Weder der Konstruktivismus noch der Versuch, Kausalzusammenhänge zwischen Innen und Außen herzustellen, bringen uns hier weiter, weil beide Ansätze zwar das gut gemeinte Ansinnen haben, die Welt greifbarer zu machen, indem sie Komplexität reduzieren. Jedoch negieren sie dabei jeweils eine der beiden Seiten, also Hardware bzw. Software, vollständig. Während die Konstruktivisten Machbarkeit komplett infrage stellen, machen die anderen Machbarkeit zu einem Absolutismus. Das entspricht allerdings nicht dem Alltagserleben, das die meisten von uns haben.
Es gibt noch ein paar weitere Schwierigkeiten, aber für unser kleines Unterfangen, uns dem Thema Machbarkeit zu nähern, reichen die bisher beschriebenen vollkommen aus.
Wo stehen wir jetzt mit all den Überlegungen zu Hardware und Software, zur Res Extensa und zur Res Cogitans, zu einer objektiv messbaren Welt und einer innerlich erlebten Wirklichkeit?
Wir einigen uns darauf, dass es beide gibt; darauf, dass Dinge dann objektiv und messbar sind, wenn es jedem interessierten Menschen möglich ist, entsprechendes Verhalten mit gleichen Messergebnissen zu wiederholen, und dass jede innere Wirklichkeit nie ganz kommuniziert und dadurch nie von einem anderen Menschen komplett und genau so erlebt werden kann, wie sie der Erlebende erlebt.
Außerdem einigen wir uns darauf, dass inneres Erleben und messbare Körperaktivitäten zusammenhängen, wir aber über die Art, wie sie zusammenhängen, leider (oder zum Glück?) bis heute kaum etwas sagen können. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Veränderungen auf der einen Ebene und Veränderungen auf der anderen parallel ablaufen.
Zusätzlich einigen wir uns darauf, dass es nie möglich sein wird, über Messungen auf physischer Ebene Aussagen über die Inhalte inneren Erlebens machen zu können, ohne Interpretation, die wiederum auf innerem Erleben anderer beruht.
Während Machbarkeit auf der Hardware-Ebene, also der physischen Welt der wiederholbaren und messbaren Ergebnisse, funktioniert, scheint es auf der Software-Ebene, also der Ebene des inneren Erlebens, nicht ganz so einfach zu sein. Und der Versuch, von der Machbarkeit auf Hardware-Ebene auf die Machbarkeit auf Software-Ebene zu schließen, ist ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Das heißt, Machbarkeit hat im inneren Erleben offensichtlich wenig bis gar nichts verloren und hat dort ihre Grenzen.
Am Ende dieses Abschnitts möchte ich noch eine Nebenbemerkung zum Thema Quantenphysik anbringen und zu den damit häufig verbundenen, so genannten Beweisen von Gott und von Phänomenen, die wir uns anders nicht erklären können. Mit der Unterscheidung zwischen innerem Erleben und messbarer, objektiver Wirklichkeit, also zwischen Software und Hardware, ist es leicht, ein paar Aspekte einzuordnen. Hier zwei Beispiele:
Beispiel 1: Telepathie gehört dem inneren Erleben an. Warum? Weil Telepathie die Gleichzeitigkeit von im Innern verschiedener Menschen erlebter Phänomene ist. Quantenphysik und Versuchsaufbauten wiederum, die beweisen, dass zwei ,Teilchen‘ gleichzeitig komplett ortsunabhängig die gleiche Information bereitstellen – also sich so verhalten, als hätten sie eine Verbindung, physisch aber eigentlich keine haben – gehören der objektiven Welt an. Letzteres beweist allerdings mitnichten, dass es Telepathie gibt. Alles, was es beweist, ist, dass es auf der Hardware-Ebene eine Struktur gibt, auf deren Basis Telepathie funktionieren könnte. Wohlgemerkt: könnte. Und Telepathie wird sich nie naturwissenschaftlich beweisen lassen, außer wir finden eine Möglichkeit, inneres Erleben objektiv messbar zu machen.
Beispiel 2: Gott gehört dem inneren Erleben an. Warum? Weil jeder von uns ein eigenes Gottesbild hat.14 Oder anders formuliert: Gott können Sie nur erleben, nicht messen. Keine Modelle und keine Theorien zu finden, die das Verhalten bestimmter ,Teilchen‘ oder die Dualität von Energie und Masse erklären, gehört der objektiven Welt an. Daraus zu schließen, dass es Gott gibt, der da am Werke ist, hat nichts mit den Ergebnissen der Quantenphysik zu tun, sondern ist individuelle Interpretation dieser ,Nicht-Nachvollziehbarkeit‘ und damit inneres Erleben.
Und hier wird das größte Dilemma dessen sichtbar, was mit der Unterscheidung zwischen Res Cogitans und Res Extensa und der von uns allen befolgten Forderung Descartes‘ nach der wissenschaftlichen Zuwendung zur Res Extensa leider auch passiert ist: Wir haben nicht nur dem objektiven Teil der Welt einen deutlich höheren Stellenwert gegeben. Wir haben gleichzeitig das innere Erleben als ,nicht real‘ abgestempelt und versucht, es zu eliminieren, weil es nicht messbar ist.
Nur was messbar und objektiv beweisbar ist, ist real. Und damit haben wir alles, was im inneren Erleben passiert, unserer Welt verwiesen. Das war nötig, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Es ermöglicht uns, mit dem gefühlten Maß an Autonomie, Gesundheit, Bildung, Bewusstheit und Freiheit zu leben, wie es viele von uns heute tun. Niemand wird mehr in der Lage sein, Macht über einen anderen Menschen auszuüben durch Drohungen, die sich auf dessen individuelles inneres Erleben beziehen (Flüche, der Zorn Gottes usw.), wenn diesem die Unterscheidung zwischen innerem Erleben und objektiver Wirklichkeit bewusst ist.
Leider war der Preis für diese Unterscheidung aber, dass wir jetzt mit Mitteln der objektiven Welt, die wir über Jahrhunderte erforscht haben, zu beweisen versuchen, dass das innere Erleben genauso real ist, wie die objektive Wirklichkeit, und wir nach Gott in der physischen Welt suchen. Dort werden wir ihn nicht finden. Genau wie wir unser inneres Erleben nicht objektiv nachweisen können werden. Wie auch? Genau die Qualität des Nichtmessbaren ,macht‘ es ja zum subjektiven und inneren Erleben. Deswegen ist dennoch alles, was wir dort erleben, nicht weniger real als das, was objektiv beobachtbar und messbar ist. Schlimmer noch: Das eine gibt es nicht ohne das andere und umgekehrt. Nur ,funktioniert‘ Machbarkeit in ihrer reinen Form offensichtlich nur auf Basis der Messbarkeit auf der einen Seite dieser Koexistenz: der Hardware-Welt.15 Ohne Messbarkeit ist kein Überprüfen der Ergebnisse von Machen im Außen möglich.





























