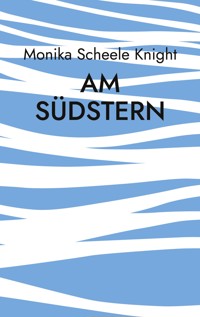
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
«Im toten Körper ist der Mensch gleichzeitig da und nicht mehr da. Im ersten Augenblick nehme ich nur diese verstörende Gleichzeitigkeit wahr, als ich John zum ersten Mal tot sehe. Da liegt mein Sohn, 15 Jahre alt, ganz er. Ich sehe sein Haar, seinen Mund, seine Hände. Ich denke ein bisschen erstaunt zunächst nur das: Er ist so ganz und gar er. Ebenso eindeutig ist aber alles Leben aus seinem Körper entwichen. Ich sehe die Totenflecken, die Hautverfärbungen, sehe, dass dies eindeutig ein toter Körper ist. John ist da und nicht mehr da.» Am 5. März 2016 ist John gestorben. In diesem Buch geht es um Trauer und Trost in den ersten fünf Jahren nach seinem Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Hier ruht eine große Liebe«
»Und ewig mit Sehnsuchtsblick schaut die Liebe dir nach«
(Inschriften auf Grabsteinen, Alter Luisenstädtischer Friedhof in Berlin)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
LITERATURVERZEICHNIS
1
Und ich weiß schon: Solange meine Seele in mir wohnt, werd ich das Dunkel dieses Augenblicks schöpfen und trinken und bluten
(David Grossman: Aus der Zeit fallen)
Im toten Körper ist der Mensch gleichzeitig da und nicht mehr da. Im ersten Augenblick nehme ich nur diese verstörende Gleichzeitigkeit wahr, als ich John zum ersten Mal tot sehe. Da liegt mein Sohn, 15 Jahre alt, ganz er. Ich sehe sein Haar, seinen Mund, seine Hände. Ich denke ein bisschen erstaunt zunächst nur das: Er ist so ganz und gar er. Ebenso eindeutig ist aber alles Leben aus seinem Körper entwichen. Ich sehe die Totenflecken, die Hautverfärbungen, sehe, dass dies eindeutig ein toter Körper ist. John ist da und nicht mehr da.
Ich bin vergleichsweise ruhig, denn ich habe vier Tage lang Zeit gehabt, mich auf diesen Augenblick vorzubereiten. Ich habe das Zusammentreffen in diesen Tagen mit großer Wehmut herbeigesehnt. John ist nachts zu Hause in seinem Bett in Berlin an SUDEP gestorben, das steht für Sudden Unexpected Death in Epilepsy, also einem plötzlichen und unerwarteten Tod bei Epilepsie. Ich war gerade beruflich in Erfurt.
Johns Körper war von der Polizei mitgenommen worden, um ein Fremdverschulden auszuschließen. Ein Standardverfahren, wie es hieß. Mein Mann Scott und ich hatten vier Tage auf die Freigabe durch die Staatsanwaltschaft gewartet. In der Zwischenzeit wussten wir nur, dass der Körper unseres Kindes irgendwo in Berlin in einem Kühlfach liegt. Wir hatten uns so danach gesehnt, bei ihm zu sein.
Wir begegnen John in einem Abschiedsraum am Richardplatz in Berlin-Neukölln. Unsere Bestatter arbeiten mit einem hier ansässigen Fuhrunternehmen zusammen. Sie haben Johns Körper aus der Rechtsmedizin abgeholt und hierhergebracht.
Ich kenne den Richardplatz schon lange. Zu Studienzeiten Mitte der neunziger Jahre hatten wir uns gewundert, dass es mitten in Berlin so einen klassischen Dorfanger gibt. Diese alte Atmosphäre, Böhmisch-Rixdorf, das klang außerdem angenehm exotisch nach Osteuropa. Wir kannten den Platz vor allem vom Ausgehen am Abend. In den letzten Jahren waren wir vor Weihnachten hier häufiger mit John auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Nun erfahre ich den Richardplatz wiederum neu und anders. Das Hochzeits- und Bestattungsfuhrwesen mitten am Platz organisiert seit 120 Jahren Leben wie Tod der Menschen: ein rustikaler Hof, sauber und großzügig, mehrere Gebäudeflügel, eine Remise mit historischen Kutschen, Tore mit schweren Scharnieren, roter Klinker. Wir könnten auf dem Land in meiner norddeutschen Heimat sein.
Johns Körper wird bis auf Weiteres hier aufbewahrt, und so sehe ich ihn zum ersten Mal tot. Sehe, wie er gleichzeitig anwesend und abwesend ist. Im Anblick seines Körpers wird der Verlust real, doch die erste Begegnung hat auch etwas Befreiendes. Sobald ich ihn sehe, wird mir klar: Die Liebe hört mit dem Tod nicht auf. Seit Johns Geburt gibt es kein Ich ohne ihn, und daran ändert sein Tod nichts.
An seinem Körper stößt mich nichts ab, im Gegenteil, alles zieht mich zu ihm hin. Ich trete näher an John heran. Ihm läuft Flüssigkeit aus dem Mund, die wir vorsichtig abtupfen. Entweder ist es noch Schaum von den erfolglosen Wiederbelebungsversuchen oder schon die Autolyse. In den letzten Tagen habe ich viel über das Sterben gelesen. Praktisch sofort nach dem Tod beginnt die Selbstverdauung des Körpers, wenn ich es richtig verstehe, seine Auflösung von innen. Ohne Sauerstoffzufuhr entsteht ein Überschuss an Kohlendioxid und durch die entstehende Übersäuerung platzen Zellmembranen. Die freigesetzten Enzyme verspeisen die Zellen von innen heraus und produzieren schwefelhaltige Gase, den typischen Fäulnisgeruch. Bakterien zersetzen die Organe und den Magen-Darm-Trakt, dabei wird auch Flüssigkeit nach oben gespült.
Ich denke: Noch bewohne ich meinen zukünftigen Leichnam. Eines Tages wird auch aus meinem Mund Flüssigkeit laufen. Es kommt mir nicht schlimm vor, sondern vollkommen normal.
Auf Johns Brustkorb kleben noch die Pflaster von den Wiederbelebungsversuchen, vorsichtig entfernen wir sie. Muss ein Toter gewaschen werden? Nicht zum ersten Mal in den letzten Tagen fällt mir auf, wie wenig ich über den Tod weiß. Was muss überhaupt mit dem Körper gemacht werden? Unsere Bestatterin Lea erklärt, dass nichts muss. Wir waschen die Flecken der Pflaster von der Haut. Wir ziehen John die Kleidung an, die wir zu Hause sorgfältig ausgesucht haben. Am Ende hatten noch drei Pullover auf seinem Bett gelegen, die in die engere Auswahl kamen, drei Lieblingspullis. Das letzte Mal haben wir gewissenhaft das getan, was zuvor fünfzehneinhalb Jahre lang morgens nebenbei und auf die Schnelle passierte: einen Pullover ausgesucht.
Wir haben John bis zu seinem Tod jeden Tag anund meistens mehrfach umgezogen. John war schwerstbehindert, er war Autist und chronisch an einer therapieresistenten Epilepsie erkrankt. In seiner Bewegungsfähigkeit war er nicht eingeschränkt gewesen, im Gegenteil. «John ist ein lebhafter, meist freundlicher Junge mit einem großen Bewegungsdrang», so stand es in seinem Zeugnis. Durch seine kognitiven Einschränkungen konnte er sich aber nicht allein anziehen. Wir sind daher gewohnt, das zu tun.
Nun aber lassen sich die Arme und Beine nur schwer bewegen. Lea und ihr Vater erklären uns, wie man einen toten Körper anzieht. Die steifen Gelenke kann man vorsichtig durch Massieren biegbarer machen. Um den Pullover anzuziehen, müssen wir die Ärmel auf links gedreht über unsere eigenen Arme ziehen, Johns Hand nehmen und ihm die Ärmel überstreifen. Wenn man erst einmal weiß, wie es funktioniert, ist es einfach.
Mehrfach müssen wir Johns Körper auf die Seite bewegen, die Bestatter helfen uns. Beim Anziehen spüre ich körperlich, was ich beim ersten Anblick gesehen habe: Jegliche Energie ist aus Johns Körper gewichen. Ich sehe es, ich spüre es in meinen Handlungen, mein Kind ist tot, da gibt es kein Vertun, und keine Hoffnung, dass das alles nicht wahr ist. Die Bewusstwerdung steigt mit jedem Handgriff.
Die Totenfürsorge ist schwer und dennoch wichtig für mich. Ich weiß nicht, wie ich diese Realität sonst verstehen können sollte, gegen die sich alles in mir wehrt. Dies sind die letzten Handlungen, die wir für John tun können und ich möchte mir so wenige der kostbaren Momente aus der Hand nehmen lassen wie möglich. Es tut bei allem Schmerz unglaublich gut, ihn zu sehen und berühren zu können. Mir ist deutlich bewusst, dass es bald nie wieder möglich sein wird.
Wir haben Schuhe mitgebracht. Lea sagt taktvoll: «Ohne Schuhe ist es umweltfreundlicher. Wenn John aber sehr an seinen Schuhen gehangen hat, also, wenn sie eine besondere Bedeutung für ihn oder für euch haben, dann könnt ihr sie ihm natürlich trotzdem anziehen.»
«Nein, nein,» sagen wir schnell. Wir hatten gar nicht darüber nachgedacht. Wir hatten einfach alles mitgebracht, was wir ihm normalerweise anziehen. Wir sind solche Anfänger, es ist unglaublich. Warum ist das so? Geht das nur uns so? Haben alle anderen das Memo über den Tod bekommen, mit allem, was man darüber wissen muss, nur wir nicht? Selbstverständlich ohne Schuhe.
Zu viert heben wir John in einen schlichten und unbehandelten Kiefernsarg. Es ist ein Sarg mit Überlänge. Wie groß John genau war, wissen wir nicht. Er stand beim Messen nie still. Manchmal sah es nach 1,93 m aus, manchmal nach 1,94 m. Jedenfalls groß. Leas Satz ist einer der Momente, die immer wieder klar vor mir stehen: «Da brauchen wir einen Sarg mit Überlänge.» Gefolgt von meinem Gedanken: Wie bin ich hierhergekommen, zu einem Sarg mit Überlänge, für mein Kind? Alles erscheint unwirklich.
Scott und ich haben Johns Kissen, seine Bettdecke, ein Wimmelbuch und ein Holzpuzzle dabei. Es gab nicht viele Spielsachen, mit denen John etwas anfangen konnte, aber Wimmelbücher und Holzpuzzles hat er gerne gemocht. Wir legen das Kissen unter seinen Kopf, die Decke über die Beine und die Sachen an seine Seite. In der Nacht schlafe ich das erste Mal seit Johns Tod sechs Stunden durch. Und wache erschrocken auf: Wie kann ich nur sechs Stunden schlafen, wenn mein Kind tot ist? Aber ja, so gut hat es getan, ihn endlich zu sehen.
2
Die Begegnung mit dem Tod ist eine intime Erfahrung. Das erste Problem daran ist, dass John mir nicht sagen kann, ob ich über meine Trauer um ihn schreiben darf. Ist es übergriffig, darüber zu sprechen?
Der Tod kann als das größte Rätsel gelten, oder im Gegenteil nur schlicht als das Ende des Menschen. Alles, was man über den Tod sagen kann, scheint banal. Das ist das nächste Problem.
Ich habe nichts bahnbrechend Neues zu erzählen, ich möchte niemanden bekehren oder belehren, ich kann keine Ratschläge geben und habe kein Rezept für die Erlösung vom Schmerz einer Trauer. Problem Nummer drei.
Worum geht es also? Um die Erzählung: «Das ist passiert, und so war es.» Ein Bericht vom Weiterleben.
Das Schwerste ist, immer wieder zu entdecken, was man ohnehin schon weiß. Elias Canetti. Wir wissen alle, dass wir eines Tages sterben werden. Wir wissen, dass jeder und jede von uns zu einem jeden Zeitpunkt sterben kann, und doch müssen wir das immer wieder neu entdecken.
3
In der Nacht von Johns Tod bin ich beruflich in Erfurt. Als Freiberuflerin betreue ich Gruppen in verschiedensten Situationen, leite Reisen, halte Vorträge, unterrichte Schulklassen, moderiere Gespräche. In Erfurt arbeite ich an einem Messestand bei der Thüringen-Ausstellung. Scott und John sind zu Hause in Berlin.
Abends telefoniere ich mit den beiden, beziehungsweise eher mit Scott, da John nicht sprechen kann. Aber mit dem Telefon auf Raumklang höre ich ihn im Hintergrund fröhlich lautieren. Die beiden Männer haben schon zu Abend gegessen, sitzen im Wohnzimmer und sehen sich auf YouTube Tiny desk concerts von NPR an. Ich höre an ihren Stimmen, dass es ihnen gut geht. Scott hält John den Hörer hin und ich sage: «Die Arbeit ist fast fertig. Noch zwei Tage, mein Schatz, dann komm ich zurück.»
Weil wir nicht genau wissen, was John versteht, formuliere ich es noch einmal anders: «In zwei Tagen kommt Mama nach Hause.»
Wie habe ich das früher gehasst, wenn Mütter von sich selbst in der dritten Person sprechen. Aber was soll ich machen. Wenn ich sichergehen möchte, dass John mich versteht, muss ich über meinen Schatten springen. John gluckst fröhlich. Ich bin müde, Scott und ich legen bald danach auf. Alltag. Alles wie immer.
Mitten in der Nacht klingelt in meinem Traum ein Handy. Der Traum will weiter, aber das Telefon hört nicht auf zu klingeln. Ich wache langsam auf und merke, dass es mein Smartphone ist, das da in der Wirklichkeit klingelt. Verschlafen erkenne ich, dass es nach Mitternacht ist. Es ist Scott. Warum ruft er mich so spät noch an? Ich bin verärgert, er weiß doch, dass ich früh aufstehen muss. Ich nehme ab und höre Scott in einer seltsam heiseren Stimme sagen: «Es tut mir so leid, Monika. Es tut mir so leid.»
«Was ist los?», frage ich ungeduldig. Was soll das, so ein kryptischer Anruf mitten in der Nacht, denke ich immer noch verärgert.
«John ist tot», kommt es tonlos vom anderen Ende zurück.
Ich bin sofort wach und denke gleichzeitig dennoch, dass ich träume. Was? Wie? Es muss ein Albtraum sein, jetzt aber schnell aufwachen. Doch Scott sagt: «Ich bin in sein Zimmer gegangen, um ihn noch einmal auf die Toilette zu setzen. Und da lag er tot im Bett. Der Notarzt ist hier, wir haben versucht, John wiederzubeleben, aber es geht nicht. Er ist tot.»
Wie Scott es mir so ruhig beschreibt, sickert in mir die Erkenntnis ein, dass es wahr sein muss. Trotzdem denke ich gleichzeitig immer noch, es sei ein Traum.
«Der Arzt ist hier. Soll ich ihn dir geben? Ich geb ihn dir mal», sagt Scott.
Der Arzt erklärt es mir noch einmal. John ist tot. Er sagt, es müsse noch ein weiterer Arzt kommen, um den Totenschein auszustellen. Er wisse nicht genau, was passiert sei. Vielleicht ein epileptischer Anfall. Er hat von Scott schon Johns Krankheitsgeschichte erfahren. Ich verstehe nicht, warum jetzt noch ein anderer Arzt kommen muss. Es ist alles verwirrend, aber mir fällt noch nicht einmal ein, nachzufragen. Allein die Tatsache, dass offensichtlich mitten in der Nacht ein fremder Mann in unserer Wohnung ist, macht aber die Vorstellung zugänglicher, dass das alles wirklich passiert und kein Traum ist.
Scott kommt zurück ans Telefon. Ich erkläre ihm, wo er für den Arzt die neuesten Befundberichte aus dem Epilepsiezentrum findet.
«Ich komme sofort», sage ich. «Ich packe meine Sachen und melde mich von unterwegs.»
Mir ist bewusst, dass ich nichts mehr tun kann und es deshalb auch nicht auf die Minute ankommt, aber ich möchte so schnell wie möglich zu John. Ich war mit dem Zug nach Erfurt gefahren, damit Scott und John zu Hause mit dem Auto beweglich sind. Wie soll ich nun nach Berlin kommen? Ich bin gute 300 km weit weg. Erst einmal raus, denke ich und werfe meine Kleidung in den Koffer. Meine Sachen sind überall in der Wohnung verstreut, ich bin kopflos und weiß nicht, ob ich sie alle einsammle.
Es ist eine Airbnb-Wohnung, in der ich mich für zehn Tage eingemietet habe. Sie gehört einer Studentin, die gerade zu Hause bei ihren Eltern in Hamburg ist. Ihre Kleidung liegt im Schrank, ihre Schuhe stehen an der Eingangstür, überall hängen Fotos von ihrer Familie und ihren Freunden. Mit meinen Kollegen hatte ich mich noch darüber unterhalten, wie eigenartig es ist, sozusagen in das Leben eines anderen Menschen einzuziehen. Ich denke noch, dass ich den Müll mitnehmen sollte. Ist das Geschirr abgewaschen? Was denke ich da? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Mein Kind ist tot. Das erste Mal denke ich das. Auf so eine merkwürdig distanzierte Weise. Nicht John ist tot, sondern Mein Kind ist tot. Der Gedanke macht schwindelig.
Draußen werfe ich den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten, laufe zum Geldautomaten und hebe den maximalen Tagessatz von 500 Euro ab. Geld werde ich bestimmt brauchen. Ich verhalte mich erstaunlich strukturiert, wie auf Autopilot. Nachts fährt kein öffentlicher Nahverkehr, aber an einer Straßenbahnhaltestelle finde ich die Telefonnummer eines Taxi-Unternehmens und lasse mich zum Bahnhof bringen. Dort finde ich heraus, dass der erste Zug nach Berlin allerdings erst am Morgen fährt. Natürlich gibt es mitten in der Nacht keinen Zug. Was habe ich gedacht?
Ich stehe vor der Anzeigentafel und weiß nicht weiter. Bei der ersten Hürde löst sich meine schöne Strukturiertheit auf. Ich fühle mich hilflos wie ein Kleinkind und auf diese Stufe hat sich auch mein Denken zurückgezogen: Wenn Du nicht weiterweißt, bitte jemanden um Hilfe.
Ich laufe zu einem Hotel neben dem Bahnhof und frage den Nachtportier, was ich nun machen soll: «Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass mein Sohn gestorben ist. Ich muss so schnell wie möglich nach Berlin. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es fährt kein Zug. Können Sie mir helfen? Kann man hier vielleicht irgendwo ein Carsharing-Auto mieten?»
Der Portier guckt mich erschrocken an, ist aber sofort hilfsbereit. Er spricht mir seine Anteilnahme aus und sagt: «Ein Auto mieten, das geht hier in Erfurt nachts nicht. Aber wissen Sie was, Sie können in diesem Zustand sowieso nicht selbst fahren. Zu dieser Zeit bleibt Ihnen nur ein Taxi. Ich guck mal im Internet nach, was das kosten darf. Nicht, dass man Sie da übers Ohr haut.»
Seine Worte hallen in mir nach: Sie können in diesem Zustand sowieso nicht selbst fahren. In was für einem Zustand ich wohl bin, frage ich mich, als ob es bei der Frage um jemand anderes geht. Ich stehe merkwürdig neben mir. Das ist bestimmt der Schock, denkt der Teil von mir, der noch Zugang zur Vernunft hat, und der wie von außen auf den anderen Teil blickt, der immer tiefer in ein mir bisher unbekanntes Nichts fällt.
Eine Taxifahrt von Erfurt nach Berlin kostet laut Internetauskunft 700 Euro, also mehr, als ich in bar habe. Der erste Fahrer, den ich draußen vor dem Bahnhof anspreche, möchte nicht nach Berlin. Der zweite willigt ein bisschen unzufrieden ein, nennt mir den korrekten Preis und hat auch ein Lesegerät für Kreditkarten.
Während der knapp dreistündigen Fahrt telefoniere ich nahezu die ganze Zeit mit Scott, mit dem Notarzt, dann mit einem anderen Arzt, der für die Ausstellung des Totenscheins gekommen ist, zwischendurch mit einem Kriminalpolizisten. In unserer Wohnung sammeln sich immer mehr Menschen.
«Wann kommen Sie denn in Berlin an?», fragt der Polizist.
«Das Navi sagt, noch eine Stunde und 15 Minuten», erwidere ich.
«Also, so eine Wartezeit kann ich leider nicht rechtfertigen», sagt der Polizist. «Wir dürfen den Leichnam nicht allein lassen. Wenn Sie ihn jetzt noch sehen wollten, dann müssten wir hier in Ihrer Wohnung bleiben. Das dauert zu lange. Es ist mitten in der Nacht. Das kann ich auch gegenüber meinen Kollegen nicht rechtfertigen. Tut mir leid, aber wir müssen gehen und wir müssen den Leichnam mitnehmen. Das ist die normale Routine, wenn jemand zu Hause verstirbt.»
Ich sage dem Polizisten, wie wichtig es mir ist, John zu sehen. Meine Versuche, ihn umzustimmen, bleiben aber erfolglos. Johns Körper wird beschlagnahmt und abtransportiert. In mir löst sich nun alles auf. Die ganze Zeit habe ich darauf hin gehandelt, möglichst schnell bei ihm zu sein. Nun wird John noch nicht einmal mehr da sein, wenn ich ankomme.
Gegen drei Uhr nachts fahren wir auf der Autobahn am Messegelände vorbei. Der Taxifahrer sagt: «Ah, das erkenne ich wieder! Das da hinten ist doch dieser Funkturm! West-Berlin ist das. Ich war schonmal hier, aber im Osten. Da kenn ich jemand. Der ist da aus Erfurt hingezogen. Vielleicht kann ich den sogar besuchen! Muss ich nur noch warten, bis es Morgen ist. Statt einfach direkt zurückzufahren nach Erfurt. Wo ich schonmal hier bin! So weit weg kann der ja nicht wohnen.»
Ich muss daran denken, wie es John einmal sehr schlecht gegangen war, ungefähr im Alter von drei Jahren. Wir hatten Wochen im Krankenhaus verbracht, John hatte Tag und Nacht Krampfanfälle gehabt, die durch keine der ausprobierten Medikamente in den Griff zu bekommen waren. Um sein Gehirn näher zu untersuchen, mussten wir in ein anderes Krankenhaus gefahren werden, und weil kein Krankentransport zur Verfügung stand, fuhren wir mit dem Taxi. John trug einen Schutzhelm, um sich während eines Anfalls nicht den Kopf zu verletzen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand uns beiden nach all den schlafgestörten und durchrüttelten Wochen die tiefe Erschöpfung nicht ansehen konnte. Im Radio lief Another day in paradise von Phil Collins und der Taxifahrer sprach die ganze Fahrt über von Dieter Bohlen, der gerade ein Buch mit pikantem Tratsch herausgebracht hatte.
Ein vorbeihuschender Gedanke: Taxifahren mit John und verrückten Taxifahrern, das wird es jetzt auch nie mehr geben. Realität, die immer nur für kleine Augenblicke einsickert. Schon in der nächsten Sekunde fühlt sich wieder alles unwirklich an.
So auch unsere Wohnung, als ich endlich zu Hause ankomme. Hier scheint alles anders als vorher. Ich kann nicht sagen, was genau. Auf dem Weg ins Wohnzimmer sehe ich aus dem Augenwinkel das Chaos in Johns Zimmer und einen Fleck auf dem Boden, aber das ist es nicht. Die Wohnung macht einen kalten und fremden Eindruck. Das ist nicht unsere Wohnung. Ha, jetzt hat sich der Albtraum verkalkuliert, jetzt wache ich gleich auf, denke ich für einen kleinen Moment. Doch mit Scott im Wohnzimmer sitzen ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau. Ich hatte schon am Telefon gehört, dass zwei Notfallseelsorger gekommen sind. Ich begrüße sie und setze mich neben Scott aufs Sofa. Es kommt mir komisch vor, wie wir da so steif nebeneinandersitzen. Wie auf einer Hühnerstange. Ich schaffe es wieder und wieder nicht, meine Wahrnehmung damit in Einklang zu bringen, dass das hier alles gerade tatsächlich passiert.
4
Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen.
(Äthiopisches Sprichwort)
Sarah ist Sozialpädagogin, Musikerin und ehrenamtliche Notfallseelsorgerin. Sie ist die Frau, die mich in der Nacht von Johns Tod in unserem Wohnzimmer begrüßte. Fast zwei Jahre später habe ich sie gesucht und gefunden. Wir treffen uns in einem Café in Prenzlauer Berg.
Scott und ich haben kaum noch eine Erinnerung daran, was wir in der Nacht von Johns Tod mit Sarah und ihrem Kollegen gesprochen haben. Gleichzeitig erinnere ich mich aber, dass ich die beiden als sehr hilfreich empfand.
Wenn ich vor Johns Tod das Wort Notfallseelsorge gehört habe, verband ich damit Katastrophensituationen wie den Amoklauf in Winnenden, das Loveparade-Unglück in Duisburg oder den Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen. »Notfallseelsorger sind vor Ort im Einsatz, um den Überlebenden und Angehörigen beizustehen,« hieß es in diesen Situationen in den Medien.
Dass die Notfallseelsorge auch in Familien kommt, in denen jemand gestorben ist, zudem mitten in der Nacht, war mir bis zu Johns Tod nicht bewusst.
Als wir Sarah zwei Jahre später wieder begegnen, denke ich als Erstes daran, was wir in der Nacht von Johns Tod wohl gesprochen haben. Sarah kann sich daran auch nicht genau erinnern. Im Gespräch wird mir erst richtig bewusst, dass dieser Ansatz aber womöglich ohnehin in die Irre führt. In der Nacht von Johns Tod ging es nicht in erster Linie um das Sprechen. Scott und ich befanden uns in einem Bewusstseinszustand, in dem wir einerseits extrem aufnahmefähig und verletzlich waren, aber andererseits auch vieles an uns vorbeirauschte. Wir standen unter Schock und hatten eine Welt betreten, in der Worte nicht unbedingt weiterhelfen. Die beiden Seelsorger waren auf eine unaufdringliche Weise da, sie trugen unser Leid mit, sie vermittelten ein Stück Ruhe und Halt. Solche grundlegenden Impulse konnten wir uns in diesem Moment nicht selbst geben, wir brauchten sie von außen.
Wir haben miteinander gesprochen, aber bei diesem Sprechen ging es vermutlich eher darum, das zu erreichen, was unter den Worten liegt. Sprache als Navigationshilfe für das eigentliche Terrain. Das ist sie in gewisser Weise immer, aber in einer existenziellen Krisensituation wird ihr Werkzeugcharakter noch deutlicher als sonst.
Sarah erinnert sich daran, dass die Polizei Johns Körper mitnehmen wollte, ohne dass Scott ihn noch einmal gesehen hatte. Sie wusste, dass damit eine unwiederbringliche Chance verpasst würde, bat die Polizei um einen Moment Aufschub und ging mit Scott ins Johns Zimmer.
John lag noch von den Wiederbelebungsversuchen auf dem Boden und die beiden setzten sich neben ihn. Sarah erinnert sich an Scotts Worte: «Danke, dass du mein Sohn gewesen bist.»
Scott weiß nicht mehr, dass er das gesagt hat, erinnert sich aber daran, wie gut es ihm getan hat, sich von John verabschieden zu können.
In unserem Gespräch erzählt Sarah auch von dem Fleck auf dem Boden ins Johns Zimmer. Nachdem sie gehört hatte, dass die Polizei mit der Beschlagnahmung des Körpers nicht auf mich warten wollte, ahnte sie, wie furchtbar das für mich wird. Deshalb hatte sie die Rettungskräfte gebeten, den Fleck nicht wegzuwischen. Durch ihn hätte ich wenigstens eine Chance, das Geschehen mit der Realität zu verknüpfen. Ich erfahre das erst jetzt, fast zwei Jahre nach Johns Tod. Tatsächlich hatten wir den Fleck noch Tage nach seinem Tod nicht aufgewischt, während er genau diesen Prozess des Bewusstwerdens begleitete.
5
In der Nacht von Johns Tod verabschieden sich die Notfallseelsorger irgendwann und wir bleiben allein in unserer Wohnung zurück. Scott und ich haben beide kein Gefühl dafür, ob es Tag oder Nacht ist, aber draußen ist es dunkel, also muss es wohl noch Nacht sein und damit zu früh, unsere Angehörigen anzurufen. Sollen sie ruhig noch schlafen, bevor das Chaos auch über sie hereinbricht: unsere Eltern, Geschwister und Freunde. Es ist Samstag, die Schule kann sogar noch bis Montagmorgen warten. Zuerst sind hier jetzt nur wir, Scott und ich, zwei verwaiste Eltern, wie konnte das passieren, diese Frage kommt wieder und wieder in uns hoch.
Wir halten uns aneinander fest, vor Schock können wir noch nicht einmal weinen. Keine Axt für das gefrorene Meer in uns. Die Zeit vergeht, ohne dass wir ein Gefühl dafür haben. In meinem Kopf fühlt es sich an wie nie zuvor in meinem Leben. Dieser Satz ist unbefriedigend, aber es ist schwer, den Zustand besser zu beschreiben. Es hat sich ein bisher unbekannter Raum geöffnet. Vielleicht ist das nur der Schock, und was er mit der Wahrnehmung macht. Ich kann nur sagen, dass es ein neues Gefühl ist, und wie alle Gefühle, die man zum ersten Mal empfindet, ist es sehr intensiv. Offenheit ist der einzige Begriff, der mir dazu einfällt. Obwohl alles in unserer Wohnung genauso aussieht wie immer, fühlt es sich anders an. Als sei eine Dimension dazugekommen, die ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Es gibt irgendwie keine Grenze mehr zwischen Innen und Außen. Ich bin das Schlafzimmer, das Schlafzimmer ist Ich.
Morgens informieren wir unsere Familien, können aber kaum mehr sprechen als ein paar Sätze. Sobald es neun Uhr morgens ist, suche ich in den Unterlagen der Polizei nach der Telefonnummer des Bestattungsinstituts, das John in der Nacht mitgenommen hat. Ich habe so eine Sehnsucht danach, ihn zu sehen.
«Das geht nicht», sagt man mir. Der Tonfall ist nicht besonders freundlich. «Wir haben Ihren Sohn in eine Gerichtsmedizin gebracht. Die Staatsanwaltschaft muss entscheiden, ob er obduziert werden soll. Sie dürfen Ihren Sohn erst sehen, wenn der Leichnam freigegeben ist. Für alles Weitere müssen Sie mit der Polizei sprechen.»
Ich rufe bei der Polizeidienststelle an, erfahre dort aber nur, dass der zuständige Kriminalbeamte erst am Montag wieder im Einsatz ist. Dann wird er seinen Bericht schreiben und an die Staatsanwaltschaft schicken, die über eine Autopsie oder Freigabe entscheidet.





























