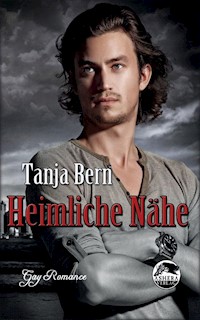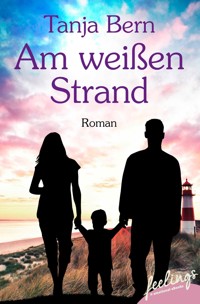
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Prickelnde Gefühle und knisternde Spannung: Ein knisternd-romantischer Liebesroman! Hvide Sande, ein beschaulicher Fischerort am weißen Sandstrand in Dänemark: Als der Schriftsteller Robin Falk einen Jungen in den Dünen findet und durch ihn die geheimnisvolle Esther North kennenlernt, gerät sein beschauliches Leben gehörig durcheinander. Eigentlich will er in seinem Strandhaus nur in Ruhe seine Bücher schreiben, doch die junge Frau zieht Robin magisch an. Trotz Esthers zögerlicher Zurückhaltung sucht er ihre Nähe. Erst durch ihren Sohn Marvin scheinen endlich die unsichtbaren Barrieren zwischen den beiden Erwachsenen zu fallen. Ganz scheint Esther sich nicht auf Robin einlassen zu können, denn ihre mysteriöse Vergangenheit bleibt ihm weiterhin verborgen. feelings-Skala (1=wenig, 3=viel): Erotik: 1, Humor: 1, Gefühl: 3 »Am weißen Strand« ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/feelings.ebooks. Genieße jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tanja Bern
Am weißen Strand
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
1
Die Halme des Strandroggens bogen sich im Wind und berührten fast den Boden. Meeresgischt lag wie Nebel über dem Strand. Die Feuchtigkeit wehte herauf bis zum Dünenkamm. Robin spürte das Salz auf seiner Haut. Die Böe zerrte so sehr an ihm, dass ihn das Gefühl überkam, fliegen zu können. Die Wellen schäumten auf den Sand, und das aufziehende Tief schob eine dunkelgraue Wolkenwand auf ihn zu.
Langsam stieg Robin die improvisierten Holzstufen hinunter, die Kletterleiter, die man in den Sand gelegt und oben am Hügel befestigt hatte. Auf der anderen Seite, die nun hinter ihm lag, war die Anhöhe nur mit Stroh ausgelegt, sodass man nicht im Sand abrutschte.
Der sonst weiße Strand von Hvide Sande wirkte heute grau vom Nieselregen. Nur wenige Menschen gingen heute am Meer spazieren, einige Hundehalter und Jogger ließen sich allerdings nicht abhalten.
Robin wandte sich um, ließ seinen Blick über die Gräser schweifen, hielt Ausschau nach seinem Hund, der gerade in den Dünen verschwand. Er pfiff kurz und lief dann weiter zum Strand hinunter, Jacky würde ihm folgen.
Nur wenig später preschte sein Wolf an ihm vorbei, das Fell voller Sand, mit hechelnder Zunge und ohne Frage gut gelaunt. Vor vier Jahren hatte Robin den Hund als Welpen zu sich geholt. Man versicherte ihm damals, dass Jacky ein kleiner, zierlicher Rüde bleiben würde. Robin bezweifelte das schon, seit der Hund ihm damals das erste Mal seine tapsigen Pfoten, die gar nicht zu seinem kleinen Körper passen wollten, auf den Oberschenkel gelegt hatte. Mittlerweile erinnerte Jacky an einen Wolf, und sein graues Fell wirkte stets so, als besäße Robin keine Hundebürste für ihn.
Schlank und schnell wie eine Gazelle raste Jacky über den Sand, ignorierte die zerbrochenen Muscheln, die Robin in die Fußsohlen stachen. Vom Sturm angespült oder von den Möwen achtlos fallen gelassen, harrten die zerstörten Schalen im Sand aus, um arglose Touristen oder wahlweise ihn zu ärgern.
»Das nächste Mal nehme ich zumindest meine Sandalen mit«, murmelte Robin und tänzelte auf Zehenspitzen über die zum Teil spitzen Muschelreste. Er nahm es sich jeden Tag vor und ging dann doch barfuß zum Strand hinunter. Endlich spürte er wieder bloßen Sand unter den Füßen und genoss die Kühle, die heute davon ausging. Jacky hatte längst Anschluss gefunden, tollte mit einem Terrier in den Wellen, die das Meer heute weit auf den Sand spülte.
Seit drei Monaten lebte er nun nahe dem Fischerort. An sein altes Leben in Deutschland wollte er zurzeit nicht denken. Hier in Dänemark am Meer fand er endlich wieder zu sich selbst. Auch wenn sich sein ursprünglicher Traum, vom Schreiben leben zu können, gerade anders entwickelte als erhofft.
Jacky lief viel zu weit ins Meer, und er pfiff den Hund zurück. Die Strömung trieb ihre fiesen Spiele bei diesem Wetter, und er wollte vermeiden, Jacky aus dem Wasser fischen zu müssen wie schon einmal. Der Hund reagierte und kam auf ihn zugelaufen. Liebevoll strich Robin ihm über das Fell und zeigte ihm an, dass sie Richtung Hvide Sande laufen würden.
Der Regen wurde stärker. Robin zog die Kapuze seiner Wachsjacke über. Er näherte sich den Wellen, hielt einen gewissen Abstand und konnte doch nicht verhindern, dass seine Hosenbeine umspült wurden. Ihn störte es nicht, Salzränder am Saum gehörten hier an diesem Ort einfach dazu.
Ein Blitz zuckte über den stahlgrauen Himmel. Der Donner ließ sich Zeit, der Wind hingegen nahm zu. Robin dachte an seinen Freund Mika. Besorgt kramte er sein Smartphone aus der Innentasche seiner Jacke, ignorierte die Tropfen, die das Display verschmierten, und tippte eine SMS.
Du bist doch heute nicht rausgefahren, oder?
Jacky drückte sich an sein Bein, zuckte zusammen, als ein weiterer Donner über den Strand hallte. Er legte dem Hund beruhigend eine Hand auf den Kopf und sah sich um. Die Gegend leerte sich, die Menschen flüchteten. So idyllisch dieser Ort sein mochte, es war die Nordsee. Bei diesem Wetter konnte sich das Meer in ein wildes Untier verwandeln. Der Dünenkamm war nicht umsonst so hoch gebaut. Überflutete Ferienhäuser wollte niemand.
Sein Handy klimperte, und es rutschte ihm fast aus der Hand, als er nachschaute, ob Mika zurückgeschrieben hatte.
Bin schon wieder an Land. Bist du am Meer? Wenn ja, komm weg da.
Die Nachricht beunruhigte ihn. Der Fischer wusste, wovon er sprach. Robin sollte sehen, dass er mit dem Hund zurück in die sicheren Dünen kam.
»Komm, Jacky. Ab nach Hause.«
Eine Windböe stieß ihn regelrecht um. Robin landete im Sand, fluchte, weil das Smartphone ihm aus den Händen glitt. Hastig rappelte er sich auf, nahm das Gerät an sich und verbarg es wieder in der Tasche. Jacky war vorgerannt, wartete nun ungeduldig, dass er ihm folgte.
Robin warf einen Blick zurück. Die Wellen stiegen, selbst die Möwen flogen nicht mehr, ihre Schreie verstummten. Der Himmel wirkte wie eine Bedrohung.
Rasch stieg Robin die improvisierten Stufen hinauf und rutschte, trotz des Strohs, auf der anderen Seite hinunter. Dennoch lächelte er, als sein Blick das grüne Blockhaus traf, das er sein Eigen nannte. Es schmiegte sich an den Dünenhügel und barg alte Erinnerungen. Früher hatte das Haus seinen Eltern gehört, aber die unternahmen nicht mehr so weite Reisen. Nun gehörte ihm dieses Kleinod am Meer. Es verkörperte seinen Traum so sehr, dass er weiterhin daran festhielt, auch wenn sein jetziger Beruf ihm eher einen Hungerlohn einbrachte.
Ob er den Sturm in die Geschichte einbauen sollte? Vielleicht …
Das Wetter trieb ihn in das Häuschen, und er atmete erleichtert auf, als er die Eingangstür hinter sich schloss. Rasch rief er den Hund zu sich, der gerade auf die Couch springen wollte.
»Erst unter die Dusche, mein Freund. So gehst du mir nicht auf die Polster. Du siehst aus wie ein Wolf, den man drei Wochen im Sand vergraben hat.«
Jacky himmelte ihn an, doch seine Stimmung sank merklich, weil Robin ihn am Halsband sanft ins Badezimmer dirigierte. Die Kälte des Meeres konnte diesem Hund nichts anhaben, er liebte den Fjord, Pfützen, Regen. Aber sobald er unter die Dusche sollte, benahm sich Jacky, als wolle man ihn foltern. Mit einem ergebenen Ausdruck ließ sich der Hund die Prozedur gefallen. Robin duschte ihn ab, rieb ihn einigermaßen trocken und entließ ihn, schlüpfte dann selbst aus den Sachen, an denen Sand und Salz klebten. Draußen heulte der Sturm um die kleinen Häuser. Robin hörte den Regen, wie er an die Glasfront des Wintergartens prasselte. Im Gegensatz zu dem Hund genoss er die heiße Dusche.
Plötzlich bellte Jacky, und es klopfte an der Tür. Fluchend drehte Robin das Wasser ab, schnappte sich ein Handtuch und ging zum Eingang. Mika stand tropfnass und mit einem frechen Grinsen da, drängelte sich an ihm vorbei. Sein Freund sah verwegen aus. Nasse Haarsträhnen hingen ihm in die Stirn, und seine letzte Rasur war mehrere Tage her. Er schüttelte sich wie ein Hund.
Robin sah ihn böse an. »Dem Hund hab ich das mühsam hier im Haus abgewöhnt, und du tropfst alles voll.«
»Ach komm. Geh und wasch dir den Schaum aus deinen Haaren und dann mach uns einen Kaffee.«
»Den Kaffee machst du!« Er warf Mika ein Handtuch vors Gesicht und schlüpfte wieder unter die Dusche.
Als sich Robin das kurze Haar trocken rubbelte, zog verführerischer Kaffeeduft durch das Haus. Er ließ seinen braunen Schopf einfach feucht und zerzaust, zog sich seinen Jogger an und legte die schmutzige Kleidung vorerst in die Duschwanne.
Mika durchforstete gerade seine Küchenschränke und seufzte. »Keine Kekse?«
»Doch, aber vor dir versteckt.«
Robin langte auf die Schrankoberseite − er war einen halben Kopf größer als Mika − und brachte Schokoladenkekse zum Vorschein. Sein Freund schnappte sich die Dose und überließ es Robin, den Kaffee plus Tassen mitzubringen.
»Was treibt dich denn bei dem Wetter nach Årgab?«
Der kleine Vorort von Hvide Sande war etwas außerhalb, mitten in den Dünen, und bestand fast nur aus Ferienhäusern.
»Ich hab vielleicht einen Job für dich.«
Robin war ihm dankbar, dass er Deutsch redete, sein Dänisch war immer noch etwas eingerostet. Aber hier verbrachten so viele deutsche Touristen ihren Urlaub, dass wohl alle Einheimischen ihre Sprache verstanden, die einen mehr, die anderen weniger. Mika konnte hervorragend Deutsch, weil sein Vater aus Hannover kam. Er reichte Mika eine große Kaffeetasse mit dampfendem Inhalt und setzte sich zu ihm.
»Wo?«, hakte Robin nach.
»Bei Nils im Restaurant.«
»Du weißt, dass ich beschissen koche, oder?«
Mika lachte laut auf. »Du sollst auch nicht kochen, sondern kellnern.«
Kellnern, dachte er. Wie in einem schlechten Film. Wobei es durchaus unangenehmere Arbeiten gab, als in einem schönen Hafenrestaurant den Touristen Essen zu servieren. Fische ausnehmen zum Beispiel oder Kisten stapeln oder Netze flicken.
»Okay, das hört sich eigentlich gut an.«
»Kommst du heute Abend mit raus?«, fragte Mika und machte dazu seinen Unschuldsblick, auf den nur Jacky hereinfiel. Der Hund sprang an ihm hoch und leckte ihm übers Gesicht, sodass Robin amüsiert schnaubte.
»Deshalb bist du hier. Und ich dachte, du bist auf einen Kaffee hergekommen«, sagte Robin gespielt beleidigt.
»Ich trinke doch mit dir Kaffee.«
Robin verzog das Gesicht, rieb sich sachte über die leicht brennenden Augen. Hatten seine Kontaktlinsen zu viel Duschgel abbekommen?
»Mika, ehrlich gesagt ist mir heute überhaupt nicht danach, Fische zu töten. Außerdem, was ist denn bitte mit dem Sturm?«
Mika warf einen Blick aus der Fensterfront. Der Wind hatte feuchten Sand gegen das Glas geweht, und die Sicht nach draußen wirkte verschwommen.
»Der Sturm geht vorbei, zieht Richtung Festland. Aber heute würde ich nicht zum Fischen rausfahren. Ich war heute Nacht schon und hatte einen guten Fang.«
»Und was hast du dann mit mir vor?«, fragte Robin und zog die Augenbrauen zusammen.
»Du hast mir doch erzählt, dass du bei dieser einen Stelle ins Stocken geraten bist, oder?«
»Die habe ich bisher ausgelassen«, antwortete Robin und rutschte ein bisschen im Sessel herum.
»Und ging es da nicht um dieses Riff?«
Manchmal redete Robin mit Mika über das Buch, das er gerade schrieb. Sein Freund fand diese Art Job ziemlich faszinierend. Bei Robin war die Traumblase dagegen geplatzt, nachdem er die ersten Tantiemenabrechnungen gesehen hatte. Wer sollte davon leben? Nun ja, wie hatte Mika augenzwinkernd gesagt? »Musst nur genug Bücher schreiben, dann sammelt es sich.«
»Robin?«
Blinzelnd begegnete er Mikas Blick. »Ja, die Szene will nicht so, wie ich will.«
»Dann musst du ihr entweder deinen Willen aufzwingen, oder du gibst nach.«
»Wenn ich nachgebe, stürzt das den halben Plot um. Aber er will einfach nicht tot sein!«
Ein Lachen brach aus Mika hervor. Prustend hielt er sich die Hand vor den Mund, damit er keine Kekskrümel ausspuckte. Er wischte sich anschließend über die Bartstoppeln. »Hat er auch einen Namen?«
»Jeff. Er ist eigentlich nur eine verflixte Nebenfigur, die gefälligst ertrinken soll. Aber der verdammte Kerl spukt in meinem Kopf herum und hangelt sich jedes Mal wieder aufs Riff, wenn ich versuche, über die Szene nachzudenken.«
»Hast du mal überlegt, ob er seinen Tod nur vortäuscht?«
»Und dann kommt er zum Schluss wie ein Springteufel aus der Torte hervor?«
»Na ja, so in etwa«, sagte Mika mit einem Grinsen.
»Aber was hat das mit der Bootstour zu tun?«
»Aaach, Robin, ich habe einen Kutter, kein Boot.«
»Irgendwann lerne ich es«, sagte Robin mit gespielt zerknirschtem Ausdruck.
»Es gibt da einige Felsen, nicht ganz ein Riff, aber haarig genug, dass man als Fischer aufpassen muss. Vielleicht hast du ’ne Idee, wenn wir da mal hinfahren.« Der Schalk saß ihm nun regelrecht im Nacken. »Du könntest mal reinspringen und gucken, ob man sich auf so glitschige Felsen überhaupt retten kann.«
»Du suchst also wieder ein Abenteuer«, erkannte Robin belustigt.
Sein Freund war ein ruheloser Pirat, wenn es um seine Freizeit ging. Er liebte alles, was auch nur entfernt verboten oder schwierig erschien. Dennoch war Mikas Vorschlag scherzhaft gemeint, Robin sah es an seinem Gesichtsausdruck. Aber manchmal musste man verrückte Dinge tun, um ein Buch wirklich authentisch schreiben zu können. Er dachte nach. Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. »Du hast nicht zufällig einen Neoprenanzug für mich?«
2
Robin krallte sich an die Reling, als eine Welle den kleinen Fischkutter hochhob. Die Gischt spritzte ihm ins Gesicht, und Mika amüsierte sich darüber. Er hörte seinen Freund durch den Steuerraum nur gedämpft, aber die Wildheit in Mikas Lachen ließ ihn schmunzeln. Mit geschlossenen Augen genoss Robin das Gefühl der Freiheit.
Der Kutter senkte sich mit einem Ruck. Robin geriet ins Taumeln. Ein Eimer kullerte ihm an die Füße, und er hielt ihn auf, steckte ihn zwischen zwei Brettern fest, damit er nicht über Bord ging. Das Fischernetz links von ihm war an der großen Winde aufgerollt. Fender hingen innen an der Reling, schaukelten hin und her.
»Und bei dem Wellengang willst du zu diesem Riff?«, rief Robin seinem Freund zu.
Wollte er wirklich dort ins Wasser gehen? Er könnte Jeff einfach seinen Willen aufzwingen, ihn sterben lassen. »Blöde Nebenfigur«, knurrte er. Robin mochte diesen Fiesling sowieso nicht. So einfach gestaltete sich das Schreiben aber nicht. Vielleicht könnte sich der Charakter ja weiterentwickeln und …
»Da sind die Felsen, Robin.« Mika schaute zu ihm hinaus. Er wirkte wie ein Freibeuter mit seinem wehenden Haar, dem Dreitagebart und im windumpeitschten Hemd.
»He Pirat!«, witzelte Robin. »Gib mir ’ne Buddel voll Rum, bevor ich mir im Wasser den Arsch abfriere.«
Sein Freund schnaufte belustigt und fasste sich an den Bart. »Der muss noch länger werden, was?«
»Unbedingt.«
»Aber frieren wirst du nicht. Geh schon mal runter und quetsch dich in den Anzug.«
Robin mochte Neopren nicht. Schon letztens beim Surfen hatte er sich in so ein Ding zwängen müssen, und ihm hatte es wirklich alles eingequetscht, was ihm wichtig war. Davon abgesehen war er auf dem Surfbrett eher eine Lachnummer. Vielleicht blieb er besser beim Adventure Golf.
Er kletterte unter Deck und bewunderte erneut, wie gepflegt das Schiff trotz seines Alters war.
Der Fischkutter war eine Perle unter den Trawlern im Hafen. Er mochte alt sein, aber Mika liebte und pflegte ihn wie einen Sportwagen. Rechts befand sich ein am Boden angeschraubter Tisch aus poliertem Holz, daneben eine Eckbank, fest mit der Schiffswand verbunden. Eine Schlafkoje, die man mit einer Schiebetür schließen konnte, damit man bei stärkerem Seegang nicht aus dem Bett fiel, war auf der anderen Seite.
Mikas Neoprenanzug passte viel besser als der aus dem Surfkurs. Robin schlüpfte hinein und sah aus dem Bullauge auf das wellige Wasser. Er musste sich am Tisch festhalten, da Mika mit dem Kutter einen Bogen fuhr. Nach einiger Zeit schien das Schiff regelrecht zu schweben. Verwundert stieg Robin die engen Holzstufen hinauf und sah auf das Meer. Die Heckwelle glitzerte im Licht der tief stehenden Sonne, die See war unerwartet ruhig. Wie konnte das sein?
Mika stellte den Motor ab und beschäftigte sich anschließend mit dem Anker. Der Kutter schaukelte angenehm auf den nun geruhsamen Wellen.
»Wo ist der raue Seegang hin?«, fragte Robin und beobachtete Mika bei seinem Tun, das Schiff zu sichern, damit sie nicht abtrieben. Die Kette des Ankers rasselte, als Mika sie hinabließ.
»Die Landzunge schützt uns hier vor dem Wind, außerdem hat der vorhin ein wenig gedreht.«
»Das hast du doch geahnt, oder?«
»Dass der Wind dreht? Nö. Aber ich weiß, dass es hier geschützt ist.« Er grinste frech.
»Verkauf dich nicht unter Wert«, murmelte Robin. Mika besaß ein außergewöhnlich gutes Gespür, was die See und das Wetter betraf.
Robin sah in die ausgefransten Wolken, die sich teils vor die Sonne schoben. Still wanderte sie wie ein brennender Ball zum Meer hinunter und tauchte das Wasser in Gold. Dann sah er die Felsen, von denen Mika erzählt hatte. Das Riff in seiner Geschichte war größer, aber dieses hier wirkte ebenso gefährlich. Die See brach sich an dem Gestein, das im Meer aufragte wie die Hörner eines Ungeheuers.
»Lass dich von der Strömung zur anderen Seite tragen, aber pass auf, dass sie dich nicht gegen die Felsen presst«, erklärte Mika ruhig.
»Ist das nicht gefährlich?«
»Natürlich.« Mikas Blick, mit dem er Robin bedachte, sagte klar: Bist du eine Memme oder ein Mann?
Robin entschied, dass er definitiv keine Memme war. Außerdem wusste er, dass Mika ihn retten würde, falls er tatsächlich in ernste Schwierigkeiten geraten würde.
»Ich muss aber erst ein bisschen rumschwimmen, damit ich etwas ausgelaugt bin.«
»Wieso das?«
»Weil der Blödmann, wegen dem ich das hier mache, schon eine Weile im Wasser verbracht haben muss.«
»Der gute Jeff ist also erschöpft.«
Sie sahen sich an und lachten auf. Diese Buchfigur entwickelte definitiv ein Eigenleben, das musste man ihr lassen.
»Pass aber auf die Haie auf«, sagte Mika sorglos.
»Was?«, krächzte Robin. »Erzähl mir nicht so ’n Mist, wenn ich dabei bin, ins Wasser zu springen.«
Mika gluckste belustigt. »Die Haie, die du hier findest, würden wahrscheinlich nicht mal an deinen Zehen knabbern, weil sie so Schiss vor dir haben.«
»Weiß ich doch, aber du glaubst gar nicht, was meine Gedanken mir für Streiche spielen können.«
»Na ja, ich weiß ja nicht, in welcher Kulisse dein Buch spielt. Aber ein gefährlicher Hai könnte ja ein Ansporn für Jeff sein, auf die Felsen zu kommen.«
»Er soll doch eigentlich sterben«, grummelte Robin.
»Irgendwie glaube ich das nicht. Und jetzt los! Ab ins Wasser mit dir.«
Robin lächelte und stieg auf die Reling. Mit einem Hechtsprung tauchte er ins Meer. Das Wasser umspülte ihn, er wurde von tiefem Blau eingehüllt. Mikas Anzug hielt die Kälte fern, und einen Augenblick fühlte er sich wie einer der Seehunde. Ein silberner Fischschwarm schreckte auf und flitzte davon. Robin brach durch die Oberfläche, schwamm davon, ließ den Kutter hinter sich zurück … und dachte an Jeff. Wie von selbst schlüpfte er in die Persönlichkeit dieser Buchfigur. Erinnerungen, die ihm zuvor gar nicht bewusst gewesen waren, rauschten an Robin vorbei, als wäre der imaginäre Mann real. Völlig unerwartet begriff er, warum Jeff bisher so ein sturer, arroganter Kerl war. Seine Vergangenheit zwang ihn, so zu sein.
Das Riff tauchte wieder vor Robin auf, er war nicht wirklich erschöpft, aber er spürte deutlich seine Armmuskeln. Doch das genügte nicht. Er musste in die Angst eintauchen, die Jeff befiel, wenn er gegen das Meer ankämpfte.
Die Dämmerung setzte ein. Vor Robins innerem Auge verwandelte sich das ruhige Meer in eine stürmische See in der Nacht. Er schwamm zu den Felsen, hütete sich vor dem scharfen Gestein unter Wasser und suchte einen Halt auf den Klippen, die von glitschigen Algen bewachsen und von Muscheln bevölkert waren. Getragen von einer Welle streckte er die Hand aus, griff nach einer Kante und rutschte sofort wieder ab, weil das Wasser über ihm zusammenschlug.
Im Augenwinkel sah er Mika, der ihn gespannt beobachtete. Er harrte auf dem Kutter aus und gestikulierte, doch Robin konnte es nicht deuten. Das Meer zog ihn in die Tiefe, und er stieß sich die Schulter an einem der Felsen. Über ihm bildete sich Schaum, die Strömung verhinderte, dass er an die Oberfläche kam. In Robin stieg Panik auf, er bekam keine Luft.
Etwas packte ihn am Kragen, zog ihn mit Wucht hinauf. Robin war so erschrocken, dass er wild zappelte, bis er endlich an die rettende Luft kam. Keuchend und hustend versuchte er, über Wasser zu bleiben.
»Komm hier rüber! Zu den anderen Felsen«, hörte er Mika brüllen. Verwirrt sah sich Robin zu dem Kutter um, der verlassen und wie ein großes Tier auf dem Wasser schwamm. Er begriff, dass sein Freund bei ihm war.
»Robin, nun komm!«
Es brauchte nur eine Geste von Mika, dann begriff er, schwamm von den Klippen und der Strömung fort, umrundete sie. Der junge Fischer zerrte ihn schließlich lachend auf das Riff.
»Versuch niemals von der Seeseite auf diese Felsen zu kommen«, sagte Mika und hielt das Gesicht in die Sonne. Wasser perlte von seinem zottigen Haar, von seinem Bart.
»Scheiße, das hättest du mir auch vorher sagen können«, murrte Robin heiser und hustete unterdrückt.
»Hab ich doch«, protestierte Mika. »Und was ist jetzt mit Jeff?«
Robin seufzte tief auf und setzte sich breitbeinig auf die Felsen. »Er wird leben. Außerdem heißt er eigentlich Jeffrey und hatte eine echt schwierige Kindheit und Jugend. Der verflixte Kerl wirft meinen ganzen Plot um, aber ich glaube, er ist es wert.«
»Na, dann hat sich diese Fahrt doch gelohnt.«
Die untergehende Sonne tauchte den Kutter in einen wahren Farbenzauber. Das Abendrot machte einem zarten Violett Platz und zerfaserte zu einem tiefdunklen Blau.
Erst jetzt fiel Robin auf, dass sein Freund vollständig bekleidet ins Wasser gesprungen war, um ihm zu helfen. Er sah, wie Mika zitterte, dies aber ignorierte.
»Wollen wir zurück zum Kutter?«
Mika nickte, und zusammen ließen sie sich ins Wasser gleiten, schwammen zum Schiff und kletterten die Metalleiter am Rumpf hinauf an Deck.
»Hast du Wechselsachen mit, Mika?«
»Ja klar.«
Sie verschwanden beide in der Kajüte und zogen sich um. Robin brauchte ewig, um sich aus dem durchnässten Anzug zu pellen. Als er wieder nach oben kam, stand Mika bereits im Steuerraum und brachte das Schiff nach Hvide Sande. Ein Krabbenkutter kam ihnen entgegen. Die Fischer grüßten und riefen Mika etwas Dänisches zu, das Robin nicht verstand. Die seitlichen Ausleger des Schiffes waren mit ihren Netzen tief im Wasser, und der alte Kutter fuhr gemächlich der Nacht entgegen, um die Krabben vom sandigen Boden zu bergen.
Nach einiger Zeit sah Robin die schützenden Molen des Hafens. Mika steuerte den Fischkutter sicher zu seinem Anlegeplatz, und sie vertäuten das Schiff. Robin kletterte auf den Steg und tätschelte den blauen Rumpf von Freija, wie Mika den Kutter genannt hatte.
»Kommst du noch auf ’n Bier mit?«
Robin zauste sich das feuchte Haar. »Ich kann nicht. Jacky muss noch mal raus.«
»Wahrscheinlich ist er wieder tödlich beleidigt, dass du ihn nicht mitgenommen hast«, feixte Mika.
Jacky war leider kein Schiffshund. Robin und Mika hatten es ausprobiert, sie mussten die Tour aber abbrechen, weil sich der Hund ständig übergab.
Robin verabschiedete sich von Mika, schwang sich auf sein Rad, das an einen Fahrradständer gekettet war, und fuhr durch die Dünen nach Hause. Der mit Gräsern bewachsene Wall rechts von ihm, der die Gegend vor dem Meer schützte, hob sich wie ein Schatten vom Himmel ab. Sein Scheinwerfer beleuchtete gerade so den schmalen Kiesweg.
Zu Hause begrüßte ihn kein freudiger Hund, denn der lag beleidigt auf dem Sofa und starrte durch die Fenster, nur sein Schwanz wedelte ein wenig.
»Ach komm«, säuselte Robin und kraulte ihm den Kopf.
Jacky bellte leise und wälzte sich herum.
»Komm mit!«, sagte Robin auffordernd zu ihm.
Der Hund wusste, was das bedeutete. In die Dünen! Jacky sprang auf und lief zur Tür. Draußen überlegte Robin, ob Hunde überhaupt beleidigt sein konnten. Sein Wolf schnüffelte hier und dort, wedelte aufgeregt mit dem Schwanz und hüpfte durch den Strandroggen. Robins Fernbleiben war vergessen. Aber er verhielt sich jedes Mal so seltsam, wenn Robin etwas allein unternahm und er mal im Haus bleiben musste − und das kam selten vor. Andere wurden fröhlich begrüßt, er wurde für mindestens zwei Minuten mit Verachtung gestraft, sobald er zur Tür hereinkam. Stirnrunzelnd fragte er sich, was er dem Hund da unbewusst antrainiert hatte.
Vielleicht war er doch einfach beleidigt, schloss Robin grinsend.
Er ging zurück ins Haus und ließ die Tür zur Terrasse offen, damit Jacky noch etwas herumstreunen konnte. Er vertraute dem Tier, denn Jacky blieb immer in Rufweite. Außerdem war hier jede richtige Straße weit entfernt.
Die Szenen mit Jeff mussten sich noch zu einem vollständigen Bild verweben. Die Figur entpuppte sich gerade zu einer sehr interessanten Persönlichkeit, aber die inneren Eindrücke mussten noch sacken. Also schnappte sich Robin einen Roman, der von einem Geisterjäger handelte. Er hörte Jacky draußen im Garten herumwuseln und lehnte sich zurück.
Der Junge in der Geschichte befand sich gerade allein in einem Spukhaus. Die gruselige Atmosphäre des Buches ließ Robin angenehm erschauern. Er vertiefte sich in die Zeilen, nur das Zirpen der Grillen begleitete sein Lesen.
Er mochte ja selbst Geschichten schreiben, auf die Erzählungen anderer würde er trotzdem niemals verzichten. Er war ein Bücherwurm, zumindest nannte Mika ihn immer so. Nun, es gab schlimmere Bezeichnungen. Memme zum Beispiel. Aber heute hatte er ja zum Glück bewiesen, dass er keine war, auch wenn sein Freund ihn aus der Strömung hatte fischen müssen. Das brachte ihn allerdings zu der Erkenntnis, dass Jeffrey in seinem geschwächten Zustand auf Hilfe angewiesen war. Er brauchte jemanden, der sich mit den dortigen Strömungen auskannte, der ihm auf die Felsen half, sonst käme er nicht auf das Riff. Aber wer sollte ihm auf offener See helfen?
3
Esther wartete mit klopfendem Herzen. Die Zeit wollte nicht vergehen. Unruhig drehte sie sich im Bett herum, starrte durch die Ritzen der Rollläden, durch die das Licht der Straßenlaternen fiel. Sie sah neben sich, die andere Betthälfte war leer. Ein seltsames Gefühl durchzog sie, das ihr die Brust eng werden ließ.
Seufzend stand sie auf, ließ ihren ursprünglichen Zeitplan platzen und ging ins Bad. Sie gönnte sich eine schnelle Dusche, zog sich die bereitgelegten Sachen an und verließ das Schlafzimmer. Bevor Esther die Tür schloss, betrachtete sie den halbdunklen Raum noch einmal.
Leises Schnarchen kam von nebenan. Auf ihre Lippen legte sich ein Lächeln. Vorsichtig schob sie die Kinderzimmertür auf, sah zu ihrem Sohn und stieg dann die Treppe im großen Haus hinunter. Den Koffer hatte sie längst gepackt. Ihre Schlaflosigkeit heute Nacht würde sie nur früher an ihr Ziel bringen. Esther ließ alles zurück, bis auf wenige Habseligkeiten, die sie nun durch den Flur zog. Draußen wehte ihr Schneeregen entgegen. Sie fröstelte. Das feuchte Haar, das sie nicht einmal richtig geföhnt hatte, klebte ihr am Kopf. Sie schüttelte ihn, um es zu lockern. Rasch hievte sie den Koffer ins Auto und ging ein letztes Mal in ihr Zuhause, um das Wichtigste zu holen.
Sie würde Marvin nicht wecken, sie hatte eine Decke für ihn im Auto, also hob sie ihren Sohn auf die Arme und ging mit ihm vorsichtig die Treppe hinunter. Im Vorbeigehen hangelte sie nach ihrer Handtasche. Behutsam setzte sie den Kleinen ins Auto, kuschelte ihn in die Decke und zog ihm warme Socken über. Den Kindersitz stellte sie in die Schlafposition. Marvin blinzelte nur müde und schlief unbesorgt wieder ein. Er war fünf Jahre und für Esther das Wundervollste, das es in ihrem Leben gab. Sie strich ihm zärtlich über die hellblonden Locken. Ihre Handtasche landete auf dem Beifahrersitz, sie setzte sich hinters Steuer und ließ den Wagen an. Immer noch pochte ihr Herz viel zu rasch. Die Kälte wollte nicht weichen, und sie schaltete die Sitzheizung an, aus der Lüftung kam bisher nur eisige Luft. Sie konnte nicht einordnen, ob sie nur äußerlich oder auch innerlich fror. Ihr Blick glitt zum Haus. Esther ließ ihr altes Leben zurück. Tränen verschleierten ihr die Sicht, doch sie wusste, sie tat das Richtige.
Ihre Fahrt führte sie nach Norden, raus aus dem Ruhrgebiet. Es war vier Uhr morgens, die Autobahn wirkte menschenleer. Ihr iPhone hatte sie nicht mitgenommen, aus gutem Grund. Sie hatte sich ein günstiges Smartphone zugelegt, dessen Nummer nur sehr wenige kannten.
Endlich griff die Autoheizung und hüllte das Innere in kuschelige Wärme. Esther fuhr sich durch das Haar, wuschelte es auf, damit es trocknen konnte.
Das ungute Gefühl wich, als zwei Stunden später seitlich von ihr glutrot die Sonne aufging. Plötzlich stieg Aufregung in ihr auf, weil es sich wie eine Fahrt in den Urlaub anfühlte. Nur dieses Mal würde sie nicht zurückkehren.
»Mami?«, kam es verschlafen von hinten.
Esther wandte sich kurz um und lächelte Marvin zu. »Guten Morgen, mein Schatz. Hast du Hunger?«
»Hmm«, antwortete ihr Sohn und gähnte herzhaft, sie sah es im Rückspiegel. »Ich muss auch Pipi.«
»Okay, beim nächsten Rastplatz halten wir an. Wir wäre es mit einem Ekelfrühstück?«
Marvin kicherte, denn dies war bei ihnen ein Running Gag. Alles, was mit McDonald’s zu tun hatte, galt als vermeintlich eklig, obwohl sie und Marvin zwischendurch gern dort aßen. Der Spruch kam damals von Jannik.
Rasch verdrängte Esther jegliche Gedanken an ihren Mann und hielt Ausschau nach der Raststätte, zu der sie schon zwei Hinweisschilder gesehen hatte. Marvin streckte sich und schien sich überhaupt nicht zu wundern, dass er sich nicht in seinem Bett befand. Die Fragen kämen später, so gut kannte sie ihn. Er überdachte gewisse Situationen sehr sorgsam, obwohl er noch so klein war.
Die Sonne stieg höher, der Himmel hellte sich merklich auf. Die Felder, die sie im Augenwinkel an sich vorbeirauschen sah, wirkten wie graue Flickenteppiche, die nun endlich in Farbe getaucht wurden. Erste Sonnenstrahlen ließen den Nebel, der über den Wiesen schwebte, verdunsten. Vereinzelt sah Esther Schneeflecken, die sich weigerten wegzutauen, obwohl es schon März war. Sie fuhr die Ausfahrt raus und brachte den Wagen auf dem Parkplatz nahe dem Schnellrestaurant zum Stehen. Ihr fiel ein, dass Marvin noch im Schlafanzug war. Sie packte ihn zumindest in eine warme Winterjacke und zog ihm Schuhe an. Rasch liefen sie hinein, erledigten ihre Toilettengänge und fanden sich mit warmen Croissants auf einem sonnenbeschienenen Platz wieder. Esther nippte an ihrem Kaffee, starrte hinaus.
»Wo fahren wir hin, Mama?«
Sie sah ihrem Sohn in die hellblauen Augen. »Ans Meer, Liebling.«
»Kann ich dort baden gehen?«
»Jetzt ist es noch zu kalt, aber im Sommer auf jeden Fall.«
Marvin überlegte und blinzelte kurz. »Dann bleiben wir aber lange.«
»Ja …«
Bitte frag nicht nach Papa, bat sie im Stillen. Der Kleine knabberte nur auf seiner Unterlippe herum und schwieg.
Später fuhren sie weiter Richtung Norden und passierten bei Flensburg die Grenze zu Dänemark. Einsame Gegenden mit Sträuchern, Pferden und Kühen zogen an ihnen vorbei. Die Landwirtschaft schien hier ein wichtiger Bestandteil der Umgebung zu sein. Esther spürte das Meer schon, als riefe es nach ihr. Mit Herzklopfen folgte sie den Anweisungen ihres Navis und verließ die dänische Autobahn. Esther fuhr an einem Feld vorbei, schaute noch auf einige knorrige Bäume, die vom Wind gebeugt waren, und blickte plötzlich auf eine Dünenlandschaft, die sich so weit erstreckte, wie ihre Sicht reichte. Die abrupte Landschaftsveränderung zum Holmsland Klit faszinierte sie jedes Mal aufs Neue. Ein Lächeln glitt über ihre Lippen.