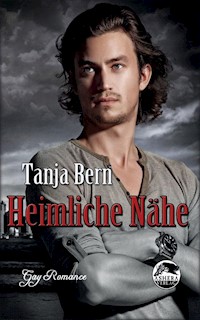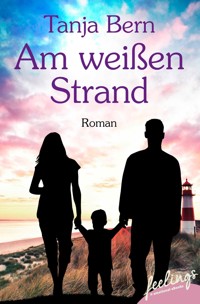4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ihre Urgroßmutter Johanna krank wird, bietet Emilia an, sie zu betreuen. Sie kümmert sich liebevoll um die alte Dame, die ihr viele Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt. Emilia taucht tief in die Wirren des Zweiten Weltkrieges ein und entdeckt ein wohlgehütetes Familiengeheimnis: Ihre Urgroßmutter flüchtete damals aus Pommern - und trotz all der Schrecken fand sie die große Liebe. Briefe ihres damaligen Geliebten, die die alte Frau sorgsam versteckt hielt, zeugen von den tiefen Gefühlen.
Nach Johannas Tod erwacht in Emilia der Wunsch, mehr über die bewegte Vergangenheit ihrer Urgroßmutter herauszufinden. Sie begibt sich nach Südschweden in die Pension des charmanten Lars Tjorveson. Hier will sie zur Ruhe kommen und nach dem Menschen suchen, der Johanna so viel bedeutet hat. Doch in dem kleinen Ferienort findet sie letztendlich so viel mehr als nur die Wahrheit ...
Wer bist du? Wo gehörst du hin? Und wem schenkst du dein Herz?
Alle Romane der Familiengeheimnis-Reihe sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverWeiterer Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmung12345678910111213141516171819202122232425262728EpilogWeiterer Titel der Autorin:
Die Töchter von Tarlington Manor
Über dieses Buch
Verschollene Briefe, eine Reise nach Schweden und das Geheimnis der wahren Liebe.
Als ihre Urgroßmutter Johanna krank wird, bietet Emilia an, sie zu betreuen. Sie kümmert sich liebevoll um die alte Dame, die ihr viele Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt. Emilia taucht tief in die Wirren des Zweiten Weltkrieges ein und entdeckt ein wohlgehütetes Familiengeheimnis: Ihre Urgroßmutter flüchtete damals aus Pommern – und trotz all der Schrecken fand sie die große Liebe. Briefe ihres damaligen Geliebten, die die alte Frau sorgsam versteckt hielt, zeugen von den tiefen Gefühlen. Nach Johannas Tod erwacht in Emilia der Wunsch, mehr über die bewegte Vergangenheit ihrer Urgroßmutter herauszufinden. Sie begibt sich nach Südschweden in die Pension des charmanten Lars Tjorveson. Hier will sie zur Ruhe kommen und nach dem Menschen suchen, der Johanna so viel bedeutet hat. Doch in dem kleinen Ferienort findet sie letztendlich so viel mehr als nur die Wahrheit …
Ein ergreifender Familiengeheimnis-Roman über die Fragen, wer man ist und wohin man gehört – und über die eine große Liebe.
Über die Autorin
Tanja Bern ist in Herten geboren und lebt heute mit ihrer Familie und drei Katzen in einem kleinen Stadtteil von Gelsenkirchen. Sie ist dem Ruhrgebiet immer treu geblieben, obwohl sie eine Vorliebe für die nordischen Länder hegt. Wenn sie in der Natur sein und schreiben kann, ist sie glücklich. Und wenn ihre Helden sich dann noch verlieben, schlägt ihr Herz höher …
Tanja Bern
Das GEHEIMNIS derschwedischenBRIEFE
Roman
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: Nicole Meyer, designrevolte.de unter Verwendung von Motiven von © Bildagentur Zoonar GmbH / shutterstock, © NoonBuSin / shutterstock, © DieterMeyrl/ istock und © DavidMSchrader/ iStockphoto
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5446-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Oma Hilla, die mich zu diesem Buch inspiriert hat. Sie musste 1945 aus Schönlanke in Pommern flüchten. Durch die Gespräche mit ihr begannen meine Ideen für die Geschichte erst richtig zu leben.
Vielen, vielen Dank, Oma!
1
Berlin, August 2018
Emilia trat in das Patientenzimmer, grüßte lächelnd und wandte sich an die junge Frau, die unbeirrt weiter etwas in ihr Netbook tippte. Emilia prüfte die Infusion und schüttelte leicht den Kopf.
»Frau Larien, Sie müssen bitte die Hand ruhig halten, solange der Tropf noch nicht durchgelaufen ist. Sonst stockt es immer.«
Genervt blickte die Patientin Emilia an. »Ich kann das hier nicht stundenlang liegen lassen, das muss bis morgen fertig werden.«
»Okay, aber Sie möchten gesund werden, oder?«
»So schnell wie möglich!«
»Gut, dann lassen Sie die Infusion durchlaufen.«
Mit einem wütenden Schnauben klappte Frau Larien das Gerät zu und starrte auf den stummen TV-Bildschirm. Ihre Mitpatientin verfolgte mit Kopfhörern die Seifenoper, die gerade ausgestrahlt wurde.
Oft ließen die Patienten ihre Wut und Hilflosigkeit an den Schwestern aus. Meist prallte das an Emilia ab, da sie wusste, wie schlecht es einigen von ihnen ging.
Sie huschte ins Schwesternzimmer, nahm rasch einen Schluck ihres kalten Kaffees und ging zum anderen Ende des Flurs. Landschaftsgemälde schmückten die weiß gestrichenen Wände. Emilia schaute sich im Vorbeigehen gern die harmonischen Ansichten der Seen und Wälder an. Für einen Augenblick blitzte dann der Gedanke an Urlaub auf. Aber dieser stand ja in absehbarer Zeit bevor.
Als Emilia die Tür zum nächsten Patientenzimmer öffnete, verharrte sie kurz und verzog leicht das Gesicht. Die Luft war abgestanden und viel zu warm. Sie überlegte, ob es besser wäre, die Fenster zu öffnen oder sie wegen der Augusthitze geschlossen zu halten. Auf jeden Fall musste frische Luft in den Raum. Also stellte sie die Fenster auf Kipp und ließ die Tür zum Flur vorerst offen. Frau Schneider schlief mit offenem Mund, und Emilia fühlte kurz ihren Puls. Sie sorgte sich um diese Patientin, die wegen einer Beinthrombose aus dem Altenheim eingeliefert worden war. Die Frau erwachte immer nur kurz und schien manchmal schon in andere Sphären abzutauchen.
»Schwester Emilia, haben Sie Durchzug gemacht?«, fragte die andere Patientin und versuchte sich aufzurichten. Emilia legte ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter und stellte ihr Kopfteil höher.
»Ich lüfte nur einen Moment. Hier ist es ziemlich stickig.«
»Mir macht ein bisschen Sauerstoffmangel im Zimmer doch nichts aus.« Frau Krutter zeigte auf den flexiblen Kunststoffschlauch an ihrer Nase.
Mit einem leisen Lachen wies Emilia auf Frau Schneider. »Aber sie hat keine Sauerstoffbrille. Ich mache beim Rausgehen die Tür wieder zu, lasse aber die Fenster noch offen, in Ordnung?«
»Wenn’s sein muss«, murmelte Frau Krutter augenzwinkernd.
»Haben Sie Angst, dass Sie sich verkühlen?«, fragte Emilia schmunzelnd.
»Nein, aber der Wind könnte mich …« Frau Krutter stockte und räusperte sich. »… aus dem Bett wehen, so dünn, wie ich bin«, fuhr sie dann heiser fort.
»Klingeln Sie, wenn ein Wirbelsturm durch die Fensterspalten hereinweht, dann komme ich sofort und rette Sie.«
»Dann ist es ja gut.« Sie lachte fast lautlos und hustete unterdrückt.
Auf dem Flur atmete Emilia erleichtert auf. Hier war die Luft wesentlich angenehmer.
Emilia mochte ihren Beruf. In der Klinik fühlte sie sich in ihrem Element und genoss den Umgang mit den Menschen. Bevor sie ein Zimmer betrat, schaute sie kurz in die Patientenakte. Der junge Mann auf Zimmer 303 musste einen Ultraschall bekommen, und sie hoffte, dass er sich mittlerweile ein wenig auskannte, um allein in die Abteilung zu finden. Sie hatte gleich Feierabend.
Emilia öffnete die Tür und grüßte die beiden Männer in den Betten. Sie steuerte den Fensterplatz an, wo Herr Lehmann lag.
»Wo muss ich denn dieses Mal hin?«, fragte er mit einem schelmischen Lächeln.
»Heute ist endlich der Ultraschall dran. Gestern hat es ja nicht mehr geklappt, wofür ich mich noch einmal entschuldigen möchte.«
»Nun ja, Notfälle gehen eben vor.«
»Wissen Sie noch, wie Sie in die Abteilung kommen?«
»Ich denke schon.«
Herr Lehmann stand auf, richtete seinen Jogginganzug, und nahm die Unterlagen von Emilia entgegen. Er wuschelte sich durch das braune Haar und ging in Richtung Tür. Emilia folgte ihm.
»Schwester?«
Sie hielt inne, wandte sich dem anderen Patienten zu.
»Ich wollte nur Bescheid sagen, dass meine Infusion schon seit einer halben Stunde durchgelaufen ist«, bemerkte er.
»Ich kümmere mich sofort darum. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder bei Ihnen.«
Tim, einer der Krankenpfleger, schaute ins Zimmer hinein und begegnete Emilias Blick. »Da bist du ja, ich hab dich schon gesucht. Du sollst zur Pflegeleitung kommen.«
Sie schaute ihn verdutzt an. »Dann müsstest du hier bitte die Infusion abstöpseln.«
»Ich übernehme das. Melde dich direkt bei Thea.«
Emilia überließ Tim den Patienten und begab sich zu den Fahrstühlen. Mit einem unguten Gefühl in der Magengegend fuhr sie zwei Stockwerke tiefer.
Ob es Probleme mit ihrem Urlaub gab? Sie hatte ihn schon vor Wochen eingereicht. Müsste sie ihn wieder einmal verschieben? Während sie die Tür öffnete, schrieb sie den Gedanken an eine Last-Minute-Buchung innerlich ab.
Thea blickte auf. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch und ordnete einen Stapel Papiere. Mit einer raschen Geste strich sie sich das kurz geschnittene Haar nach hinten.
Emilia setzte sich ihr gegenüber und seufzte. »Sag schon, mein Urlaub ist gestrichen.«
Thea blinzelte, sah sie an und senkte dann den Kopf über ihre Unterlagen. »Darum geht’s nicht.«
»Oh, muss ich wo aushelfen?«
»Hör auf zu raten, ja?« Thea holte tief Luft und sah Emilia mit ernster Miene an. »Dein befristeter Vertrag läuft Ende August aus und kann leider nicht verlängert werden.«
Es wurde so still, dass Emilia einen unangenehmen Druck in den Ohren verspürte. Ihr Herz pochte heftig gegen ihren Brustkorb.
»Tut mir leid, Emilia. Ich hab es auch erst vor ein paar Tagen erfahren. Es hat nichts mit dir oder deinen Fähigkeiten zu tun. Das versichere ich dir. Aber von oberster Stelle kam die Order, dass einige der befristeten Verträge auslaufen müssen.«
»Bisher wurden die Verträge doch immer verlängert«, entgegnete Emilia und fühlte sich wie in einem Albtraum.
»Es ist wegen der Fusion mit der Franziskus-Klinik. Der Zusammenschluss der Kliniken mag nicht sofort zustande kommen, aber wir werden dann nicht das Personal von zwei Häusern halten können.«
»Und ihr beginnt jetzt schon mit dem Stellenabbau«, sagte Emilia mehr zu sich selbst und versuchte, ihre aufwallenden Gefühle unter Kontrolle zu halten.
»Ja. Und weil dir noch Urlaub zusteht, wollte ich dich fragen, ob du ihn jetzt schon nehmen möchtest.«
Theas mildes Lächeln gefror, als sie Emilias Gesichtsausdruck sah.
In Emilias Kopf drehte sich alles. Dieses Krankenhaus war zu ihrem Lebensinhalt geworden. Sie arbeitete gern hier, hatte sich nie über die oft viel zu langen Arbeitszeiten und das recht niedrige Gehalt beschwert. Sie hatte fast all ihre Hobbys aufgegeben, Partnerschaften waren gescheitert, weil sie in diesem Job ihre Berufung gefunden hatte. Emilia fühlte sich, als wäre ihr der Boden unter den Füßen weggerissen worden.
Sie rutschte mit dem Stuhl nach hinten, sodass es ein kratzendes Geräusch gab, und stand auf.
»Gibt es noch Formalitäten?«, fragte sie tonlos.
»Eigentlich nicht. Was ist mit dem Urlaub?«
»Ich nehme ihn«, sagte Emilia leise und ging zur Tür. Sie kämpfte mit den Tränen.
»Nun warte doch mal«, rief ihr Thea hinterher.
Emilia schüttelte den Kopf und eilte zu den Aufzügen. Eine der Fahrstuhltüren öffnete sich. Rasch trat sie hinein und betätigte den Knopf für das Türenschließen, um Thea zu entkommen. Den verdutzten Patienten im Rollstuhl ignorierte sie.
Ein Kälteschauer überlief sie, obwohl es auch im Aufzug viel zu warm war. Noch immer raste ihr Herz, und ihr war ein bisschen übel.
Ungeduldig schaute sie auf die Anzeige der Stockwerke. Ihr Blick fiel auf die verspiegelte Wand. Ihre dunkelblauen Augen wirkten fast schwarz, ihre Sicht verschwamm vor Tränen.
Der Mann im Aufzug beäugte sie. Kurzerhand zog sie das Band von ihrem Zopf und schüttelte das Haar auf, um sich hinter ihren karamellfarbenen Locken zu verstecken. Ihre Hand fuhr in die Tasche ihres Krankenhauskittels und fand einen Kugelschreiber mit dem Emblem der Klinik. Sie starrte wie betäubt darauf.
Als der Fahrstuhl ruckend anhielt und sich die Türen öffneten, stieg sie ohne einen Gruß aus. Den Kuli legte sie auf einen Sims.
Ob die Kollegen es gewusst hatten? Nein, ihre Freundin Miriam hätte sie gewarnt.
Bewusst ging sie jedem aus dem Weg. In Windeseile klaubte sie ihre persönlichen Sachen zusammen und flüchtete durch einen Hinterausgang des Krankenhauses. In der Nähe befand sich die Einfahrt der Rettungswagen, und Emilia nahm einen Trampelpfad über die Wiese vor dem Gebäude.
Vor ihr lag eine Allee mit parkenden Autos. Die Straße war still an diesem Nachmittag. Trotz des schönen Wetters waren keine Bewohner auf den Balkonen der Reihenhäuser zu sehen. Emilia stolperte über einen Ast, fing sich und lief zu einer kleinen Grünanlage. Eine alte Weide bot ihr Schutz vor der Sonne, und sie ließ sich am Stamm hinuntergleiten.
Wie gelähmt starrte sie auf das Krankenhausgebäude, das aus einem Alt- und einem Neubau bestand. Beide existierten in symbiotischer Weise miteinander. Emilia hatte sich in diesem Bild wiedergefunden. Sie fühlte sich der Klinik eng verbunden. Hier wurde sie gebraucht. Ihre Person gewann eine gewisse Bedeutung, weil die meisten Patienten sie sehr mochten und für ihre Fürsorge echte Dankbarkeit zeigten. Nach der Trennung von Lucas, ihrem letzten Partner, hatte sie drei Jahre all ihre Energie in diese Arbeitsstelle gesteckt.
Verloren, dachte sie mit aufkeimender Verzweiflung. Das alles ist jetzt verloren.
Sie musste hier weg. Jetzt sofort.
Abrupt raffte sie sich auf und lief eilig die Allee hinunter; ihr Auto würde sie später vom Parkplatz holen. Die Bäume spendeten Schatten, ein leichter Wind rauschte durch das Laub. An einer Kreuzung zögerte sie kurz, dann wandte sie sich Richtung Süden. Sie nahm ihren Weg kaum wahr, aber der Fußmarsch tat ihr gut, beruhigte sie.
Der Duft von gebratenem Fisch lag in der Luft und ließ ihren Magen knurren. Doch Emilia ignorierte das Gefühl. Sie presste ihre Tasche an sich und schaute sich um. Menschen liefen plaudernd am Teltowkanal entlang, schlenderten über die Promenade des Tempelhofer Hafens oder gingen ins Einkaufszentrum shoppen. Emilias Blick schweifte über die Jachten, die sacht auf den Wellen schaukelten. Ohne lange zu überlegen, stieg sie zu einem der Stege hinunter und lief an den Schiffen vorbei, weiter zum Hafenbecken. Kein Boot lag am Ende der Anlegestelle, und so konnte sie sich an den Rand setzen.
Dieser Platz war schon früher einer ihrer Zufluchtsorte gewesen. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie ihn ewig nicht mehr aufgesucht hatte. Die Arbeit im Krankenhaus hatte sie völlig vereinnahmt, ihr kaum mehr Freizeit gelassen.
»Aber ich hab es ja selbst so gewollt«, sagte sie leise.
Emilia zog die Knie an und schlang die Arme darum. Wind kam auf, kräuselte das Wasser des Kanals. Sie sehnte sich nach Schatten, weil die Nachmittagssonne auf sie niederbrannte, doch etwas in ihr weigerte sich, diesen Platz zu verlassen. Rechts von ihr grollte entfernter Donner, und sie schaute hinauf zu den Wolken. Eine Gewitterfront näherte sich.
Emilia blickte auf die Oberfläche des Kanals. Böen trieben das Wasser vor sich her. Vereinzelte Regentropfen fielen vom Himmel. Dennoch schien die Sonne auf die Hafenpromenade, zu der sich Emilia nun umdrehte. Die meisten Passanten suchten eilig Schutz vor dem heraufziehenden Unwetter.
Ein Blitz zuckte über den Himmel. Emilia zählte im Stillen: einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, um abschätzen zu können, wie nah das Gewitter war. Der Donner folgte erst bei sechsundzwanzig, deshalb blieb sie sitzen.
Ihre Gedanken kreisten nur um ein einziges Thema. Ich habe mich aufgeopfert, und sie lassen mich fallen wie eine heiße Kartoffel.
»Emilia?«
Die unerwartete Stimme ließ Emilia zusammenzucken. Sie spürte an einem leichten Beben des Stegs, dass sich jemand näherte, und wandte sich um. Miriam hatte ebenfalls Feierabend, weil sie wie Emilia Frühschicht gehabt hatte.
»Ich hab mir gedacht, dass ich dich hier finde.«
»Hast du es gewusst?«, fragte Emilia tonlos.
»Nein, Thea hat es mir gerade gesagt.«
»Aber du darfst doch bleiben, oder?«, fragte Emilia besorgt. »Du hast doch einen unbefristeten Vertrag.«
Sie wusste, wie sehr ihre Freundin auf den Job angewiesen war. Ohne das Gehalt würde sie ihre Mietwohnung in Berlin nicht halten können, geschweige denn ihren kleinen Schrebergarten, den sie beide liebten.
»Ich kann zum Glück bleiben. Sonst müsste ich zurück nach Paderborn zu meinen Eltern.«
»Du arbeitest ja auch schon länger in der Klinik.«
»Emilia, es tut mir so leid!«
Der Regen wurde heftiger. Miriam verzog das Gesicht. Sie spannte einen Schirm auf. »Komm, wir holen uns ein Eis, okay?«
Emilia stand auf, und Miriam nahm sie unter ihren Schirm. Das Gewitter grollte nun viel näher. Sie hasteten über den Steg und liefen in das Einkaufszentrum hinein.
Vor ihnen breitete sich die hohe Halle aus, in der sich elegante Geschäfte aneinanderreihten, alles besaß einen sehr edlen Touch.
Miriam schleifte Emilia bis zur Eisdiele Artista und spendierte ihr ein Schokoeis. Sie setzten sich auf die hellen Stühle und genossen schweigend die kühle Erfrischung.
»Kann ich dir irgendwie helfen, Lia?«
Emilia mochte den vertrauten Kosenamen und seufzte leise. »Ich hab keine Ahnung. Das kommt alles so … so plötzlich und … ich muss erst mal einen klaren Kopf bekommen.«
»Wie lange bist du noch da?«
»Bis einschließlich Freitag. Dann beginnt mein Resturlaub. Den hat Thea mir noch bewilligt.«
Emilia musste sich verabschieden. Von den Patienten, den Kollegen, dem Ort an sich …
Ihr kam ein erschreckender Gedanke. »Ich weiß nicht mal, ob ich hier wohnen bleiben kann.«
»Was? Wieso denn? Du hast doch deine kleine Eigentumswohnung.«
»Ja, aber ob ich hier in Berlin so schnell eine unbefristete Stelle finde?« Miriam wollte protestieren, aber Emilia hielt sie mit einer Geste auf. »Ich weiß, was du sagen willst. Aber will ich wirklich immer wieder das Krankenhaus wechseln? Nie länger an einem Ort arbeiten?«
»Vielleicht …« Miriam hielt inne und winkte ab. »Ja, verdammt, du hast recht. In den letzten Jahren ist es schwer geworden.« Sie griff nach Emilias Hand. »Ach, Lia … vielleicht ist das auch ein Neuanfang für dich.«
»Den ich mir nicht ausgesucht habe«, gab sie zurück.
*
Emilia schloss ihre Wohnung auf und legte den Schlüssel auf die Kommode. Wie gelähmt blieb sie im Flur stehen. Was sollte sie jetzt bloß tun?
Draußen fuhr ein Lastwagen am Haus vorbei. Ihre Fenster besaßen einen guten Schallschutz, jedoch spürte sie das große Fahrzeug, weil der Boden vibrierte und die Gläser in der Vitrine leise klirrten.
Eigentlich waren die Straßen in ihrer Siedlung nicht stark befahren. Erst seitdem unweit von ihr der Asphalt aufgerissen wurde, fuhren die Baufahrzeuge ein und aus. Die Geräusche weckten sie aus ihrer Starre. Sie trat hinaus auf ihren kleinen Balkon, sah hinunter auf die ausgeschachtete Grube und fühlte genauso ein Loch in ihrem Innersten. Langsam ließ sie sich auf den türkisen Klappstuhl sinken.
Emilia beobachtete die sich wiegenden Äste der Esche, die ihr oft Schatten spendete. Der Baulärm verebbte, sie hörte, wie die Bauarbeiter leise diskutierten. Es verschwamm zu einem monotonen Geräusch, das sich mit dem Wind mischte.
Es hieß, wenn sich eine Tür im Leben schloss, öffnete sich immer eine andere …
In diesem Moment konnte Emilia diesen neuen Zugang nicht erkennen. Nervös knetete sie ihre Finger, versuchte, ihrer Gefühle Herr zu werden.
Es ist doch nur ein Job!
Nein. Aus ihr unerfindlichen Gründen fühlte es sich nach viel mehr an. Das aufkommende Schluchzen konnte sie unterdrücken, die Tränen nicht. Sie liefen über ihre Wangen, tropften auf ihr Shirt. Unwirsch fuhr sie sich durch das Gesicht, um die verräterischen Spuren zu beseitigen.
Ihr Smartphone meldete einen Anruf. Wahrscheinlich ihre Mutter. Dumpf hallte der Klingelton durch den Flur, da sich das Telefon noch in der Tasche befand. Emilia ignorierte es. Sie wollte mit niemandem sprechen.
Als die Bauarbeiten wieder einsetzten, stieg Wut in ihr auf.
»Kann man denn keine Minute einfach mal Ruhe haben?«, schimpfte sie leise. Sie ging zurück in die Wohnung, schloss die Balkontür und sperrte jeglichen Lärm aus. Spontan und um weitere Gefühlswallungen zu unterdrücken, holte sie den Honigwein aus dem Kühlschrank, der noch von ihrem siebenundzwanzigsten Geburtstag übrig war.
Mit einem flauen Gefühl im Magen ließ sie sich auf die Couch im Wohnzimmer fallen und nahm einen Schluck von dem süßen Getränk. Ihre Gedanken flatterten wie ein gefangener Vogel hin und her. Plötzlich war sie befreit von all den Überlegungen, die sich hauptsächlich um ihre Patienten drehten. Vielmehr strömte nun alles Mögliche auf sie ein, als wäre der Jobverlust ein Auslöser.
Erneut nippte sie an dem Weinglas und starrte dann die goldene Flüssigkeit darin an.
Was tat sie denn da? Sonst griff sie doch auch nicht zum Alkohol!
Abrupt stellte sie das Glas ab, das mit einem Klirren auf dem Tisch landete.
Emilia raufte sich die Haare. Tief in ihrem Innern hörte sie die Stimme ihres verstorbenen Vaters: Schatz, du bist ein Meister im Verdrängen. Du siehst den kleinsten Kratzer des anderen und willst helfen, ohne zu merken, dass dir eine ganze Hand fehlt.
Wie oft hatte er Ähnliches zu ihr gesagt und ihr anschließend mit einem warmherzigen Lachen einen Kuss auf die Stirn gedrückt. Wieder ließen sich die Tränen nicht zurückhalten, diesmal ließ Emilia sie einfach fließen.
Früher, da hatte sie doch noch Träume gehabt. Hoffnung hatte sie in so vieler Hinsicht beseelt. Jetzt fühlte sie … nichts. Nur eine ungewisse Furcht. Aber wovor?
Sie erkannte, dass es keine Existenzangst war. Emilia wusste, dass sie zurechtkommen würde und rasch eine neue Stelle in ihrem Bereich bekommen könnte, zumindest befristet. Warum also klopfte ihr Herz so wild? Wieso grub sich ein flaues Gefühl in ihren Magen?
Sie fühlte sich entblößt. Ihr Leben lag in Scherben vor ihr, und sie war nicht fähig, sie aufzusammeln.
Eine erschreckende Erkenntnis überkam sie. Lief sie womöglich schon lange auf diesen Splittern herum, ohne es zu bemerken? Hatte sie alles mit ihrem Job entschuldigt?
Vielleicht hatte Miriam ja recht, und sie brauchte tatsächlich einen Neuanfang.
2
Vogelgezwitscher weckte Emilia. Sie blinzelte ins Sonnenlicht, da sie vergessen hatte, die Rollläden herunterzulassen. Mit einem Seufzen drehte sie sich auf die andere Seite.
Es war ihr erster freier Tag. Gestern hatte sie sich von allen im Krankenhaus verabschiedet. Bei dem Gedanken daran fuhr ihr ein kleiner Stich ins Herz, doch er bohrte sich nicht mehr so tief wie noch vor ein paar Tagen. Sie hatte sich mit der Situation abgefunden. Was blieb ihr auch anderes übrig?
An Schlaf war nicht mehr zu denken. Sie legte sich auf den Rücken, schob die Bettdecke zur Seite und beobachtete das Licht-und-Schatten-Spiel der Bäume an der Wand. Manchmal fühlte sie sich in ihrer Siedlung wie in einer kleinen Oase mitten in Berlin.
»Und heute mal kein Baulärm«, murmelte sie.
Unruhe überkam sie. Emilia konnte noch nicht ganz fassen, dass sie freihatte. Immer wieder überkam sie das Gefühl, sie müsste zur Arbeit oder für jemanden einspringen.
Als es an der Wohnungstür schellte, setzte sie sich erschrocken auf. Rasch sprang sie aus dem Bett und kämpfte kurz mit dunklen Punkten vor ihrem Sichtfeld. Ihr Kreislauf war wohl noch nicht wach. Sie schnappte sich ihren leichten Seidenmorgenmantel. Vielleicht war es ja der Paketbote. Ihre Nachbarn bestellten recht viel aus dem Internet und waren dann nie zu Hause. Also nahm sie häufig ihre Päckchen an.
Sie betätigte den Türöffner und wollte in den Hausflur treten, als sie entgeistert innehielt. Vor ihr stand einer der Bauarbeiter. Sein Unterhemd war verschwitzt, den Helm hatte er noch auf.
»Bitte entschuldigen Se die Störung, Frau Arndt, aber wir müssen det Wasser abstellen.«
»Ach verflixt! Das hättet ihr auch gestern schon sagen können.«
»Det ging nich.«
»Warum denn nicht?«
»Uns issn Missgeschick mit dem Bagger passiert, also vorhin, nich’ gestern.«
»Ihr habt die Wasserleitung getroffen?«
»Also, icke wars nich«, sagte er grinsend.
»Sie sind nur der arme Tropf, der den Leuten am Samstag früh so eine gute Nachricht verkünden darf?«
»Ick sollte auch det Hemd ausziehen, so wie in de Werbung, aber … na ja …« Er zuckte mit den Schultern und lachte leise.
Emilia schmunzelte. Attraktiv war er wirklich!
»Na ja?«
»Verführen will ick ja keenen.« Er tippte sich an den Helm. »Ick werd dann mal den andern Bewohnern Bescheid sagen.«
Emilia beobachtete, wie er die Stufen hochhechtete. »Möchtet ihr da unten vielleicht Kaffee?«, rief sie ihm nach.
Auf halber Treppe hielt er inne, sah zu ihr hinunter und grinste wieder. »Den ham wir. Trotzdem danke!«
Emilia ging zurück in die Wohnung. Duschen konnte sie ja einfach auf der Arbeit und …
Nein, konnte sie nicht!
Ihr Gefühlsbarometer sank abrupt.
Rasch füllte sie alle möglichen Gefäße und Eimer mit Leitungswasser, bis es nur noch aus dem Hahn tropfte.
Sie seufzte tief auf und bereitete sich einen Kaffee zu. Während das dunkle Gebräu durchlief, aß sie ein Knuspermüsli mit ein paar Weintrauben, die sich noch in ihrem Obstkorb gefunden hatten. Als die Maschine gluckerte, Emilia endlich ihren Kaffee in Händen hielt, umfasste sie die Tasse und genoss den tröstlichen Duft.
Mit dem Getränk setzte sie sich an ihren PC. Sie sollte irgendetwas Aufmunterndes tun. Stattdessen durchforstete sie das Internet nach Stellenanzeigen in und um Berlin.
Ein Pop-up öffnete sich. Emilia warf einen Blick darauf. Einer ihrer Facebook-Kontakte hatte sie auf eine Veranstaltung eingeladen. Emilia blinzelte. Sternschnuppennacht-Party? Verwundert öffnete sie den Link.
Ein besonderes Naturschauspiel!
Wenn die Erde die Umlaufbahn des Kometen Swift-Tuttle und den Meteorschauer der Perseiden streift, wird es Tausende von Sternschnuppen regnen. Wir werden das feiern! Komm zum Schillerpark, um zusammen mit uns die Sternschnuppen fallen zu sehen.
Die Einladung kam von Miriam.
»Natürlich, du willst mich ablenken«, murmelte Emilia und lächelte. »Sternschnuppen also.«
Die wohl inoffizielle Party begann um zehn Uhr abends und würde bis in die Nacht dauern.
Emilia sah auf den Tab mit den Stellenanzeigen, der auf dem Bildschirm minimiert war. Vielleicht sollte sie heute Abend mal die Jobsuche minimieren. Spontan sagte sie zu.
Als hätte Miriam nur darauf gewartet, schrieb sie sofort zurück: Ich freu mich, dass du kommst, Lia!
Emilia antwortete nur mit einem Herz-Emoticon.
Der weitere Tag verlief schleppend. Emilia wusste nichts mit sich anzufangen. Als die Wasserleitungen gegen Mittag immer noch abgestellt waren, nahm sie einen Eimer Wasser und säuberte die Wohnung, bis sie verschwitzt und mit schmerzendem Rücken auf die Couch fiel. Aber der Putzmarathon hatte ihr den Kopf frei gemacht.
Sie schmierte sich ein Leberwurstbrot, ging hinaus auf den Balkon und schaute den Bauarbeitern zu. Sofort erkannte sie den jungen Mann von heute Morgen. Er gab dem Baggerführer Anweisungen.
Emilia setzte sich auf den Klappstuhl und dachte an die Sternschnuppen, die heute Nacht vom Himmel fallen würden. Es konnte bestimmt nicht schaden, sich etwas zu wünschen.
*
Es dämmerte bereits, als Emilia zum Schillerpark lief. Er befand sich im selben Viertel wie ihr Wohnort, dennoch war es ein etwa zwanzigminütiger Fußmarsch.
Es kühlte merklich ab, die Temperaturen sanken auf ein angenehmes Maß. Emilia näherte sich dem Park und sog den Geruch von frischem Laub ein. Feuchtigkeit lag in der Luft. Ein paar Schäfchenwolken hingen wie Wattebäusche am Himmel, und die untergehende Sonne ließ sie in einem zarten Rosa erstrahlen. Zu großen Teilen war der Himmel klar.
Sie bog in den ersten Waldweg ein und fand sich auf einem unebenen Pfad wieder, der von dicht stehenden Bäumen gesäumt war. In der näheren Beschreibung der Veranstaltung war die Schillerstatue als Ort angegeben.
Emilia horchte auf. Von Weitem erklang Gitarrenmusik, und ein Lachen hallte durch den Wald, der sich nun zu einer großen Wiese hin öffnete. Sie konnte die Terrassenanlage erkennen. Wie ein Festungswall umrahmte die Bastion das Herzstück des Parks – das aus Bronze gegossene Schillerdenkmal, das schon seit fast achtzig Jahren hier stand.
Emilia blieb kurz stehen und genoss die Atmosphäre. Ihr wurde bewusst, dass sie ohne die Kündigung heute nicht hier wäre.
Die hohe Mauer hinter der Statue war zwar mit Graffiti beschmiert, aber Emilia verspürte dennoch einen Funken Ehrfurcht.
»Lia, da bist du ja!«
Sie wandte sich um und fand sich in Miriams Armen wieder.
»Hallo, Miri! Bist du schon länger hier?«
»Seit ’ner Stunde oder so.«
Emilia sah sich um. Es befanden sich ungefähr zwanzig Leute auf der Anlage. Der Gitarrenspieler saß auf den Stufen der Bastion und zupfte gedankenverloren eine Melodie, andere standen zusammen, unterhielten sich und tranken Alcopops. Es herrschte eine fröhliche und entspannte Stimmung.
Miriam holte eine kleine Flasche aus einer Getränkekiste. »Hier, dein Begrüßungsschluck.«
Lächelnd nahm Emilia das Getränk und stieß mit ihrer Freundin an.
Der Abend hüllte nach und nach alles in feinen Nebel, sodass der Ort für eine Weile von geheimnisvollen Schleiern umgeben war. Miriam war schon leicht angetrunken und ging von einem zum anderen, um zu lachen und zu scherzen.
Später klarte die Nacht auf, aber bisher waren keine Sternschnuppen zu sehen gewesen. Nur eine Frau schaute unbeirrt in den Himmel, als könnte sie die fallenden Lichter heraufbeschwören. Neugierig ging Emilia zu ihr, stellte sich neben sie, tat es ihr nach und betrachtete die Sterne.
»Dein Wunsch muss groß sein, wenn du die Sternschnuppen so sehnsüchtig erwartest«, sagte Emilia und suchte den Blick der anderen.
Die Frau tauchte wie aus einem Traum auf, als hätte sie stumm mit dem Himmel Zwiesprache gehalten. Ihr Lächeln erschien Emilia so echt und freundlich, dass sie ihr die Hand reichte. »Ich heiße Emilia.«
Fast ein wenig überrascht nahm die Frau Emilias dargebotene Hand. »Ich bin Karina.«
»Wann es wohl anfängt?« Emilia zeigte hinauf zum Firmament.
»In der Zeitung stand, dass man es zwischen zwei und vier Uhr am besten sehen könne.«
Verstohlen sah Emilia auf die Uhr. Das waren noch fast zwei Stunden.
»Da!« Karina zeigte zum dunklen Himmel, und Emilias Blick folgte ihrer Hand.
Ein feiner Lichtstrahl blitzte hervor und schoss zwischen den übrigen Sternen Richtung Westen. Fast ehrfürchtig sah Karina hinauf.
Emilia lächelte. »Hast du dir was gewünscht?«
»Natürlich«, antwortete Karina. »Du nicht?«
Emilia seufzte und suchte den Himmel ab. »Das war deine Sternschnuppe.«
»Das … ist irgendwie ein schöner Gedanke«, sagte Karina leise wie zu sich selbst. »Jeder bekommt seine Sternschnuppe.«
Emilia atmete tief durch, hob erneut den Blick. Wie ein schwarzes Seidentuch spannte sich der Nachthimmel über den Park. Die Sterne glitzerten wie ein geheimes Versprechen. Sie sah die blinkenden Lichter der Flugzeuge und erkannte den hellen Polarstern.
»In so einer Nacht werden einige Wünsche auf einmal unwichtig«, flüsterte Karina.
Emilia riss sich von den Sternen los und betrachtete die Frau, deren Alter sie überhaupt nicht einschätzen konnte.
Still standen sie nebeneinander, das Lachen und die Gespräche der anderen verblassten. Sie fühlte sich, als befände sie sich mit Karina in einer Seifenblase, die sie von allem abschirmte. Wie lange sie fast bewegungslos neben ihr stand und nach oben blickte, konnte sie nicht sagen, aber als die nächste Sternschnuppe über den Himmel jagte, formte sich ein einziger Wunsch in ihr, der sie überraschte.
Ich möchte wieder glücklich sein.
War sie das überhaupt jemals gewesen?
Emilias Augen füllten sich mit Tränen. Wie zur Antwort verglühten mehrere Sternschnuppen in der Atmosphäre.
Miriam gesellte sich zu ihnen, griff nach Emilias Hand. Gemeinsam hielten sie nach dem Himmelsphänomen Ausschau.
*
Am Montagmorgen wurde Emilia von einer Nachricht auf ihrem Handy geweckt. Eigentlich war es nur ein gedämpfter Ton, den sie sonst nicht als störend empfand. Heute riss er sie aus dem Schlaf.
Sie griff nach dem Smartphone und blinzelte auf die Anzeige. Karina hatte ihr eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt. Emilia lächelte. Neue Kontakte waren sicher von Vorteil, wenn man sein Leben umkrempeln wollte.
Sie setzte sich auf.
»Will ich das wirklich? Mein Leben umkrempeln?«
Ja!, flüsterte es tief in ihr.
»Okay, okay, ich tu ja, was ich kann«, murmelte sie und schlurfte in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen.
Den Baulärmhörte sie nur gedämpft. Heute war das Wetter für die Arbeiter allerdings sehr ungünstig. Es war bewölkt und sehr windig. Nieselregen wehte durch die Luft.
Emilia steckte eine Brotscheibe in den Toaster, goss sich eine Tasse Kaffee ein und schaltete den PC an. Das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit öffnete sie ihren Facebook-Account, nahm Karinas Anfrage an, las die neusten Meldungen und kommentierte sogar einen Beitrag. Es mochte nur virtuell sein, trotzdem überkam Emilia das Gefühl, sich mit jemandem zu unterhalten.
Sie vermisste ihre Arbeitskollegen und die Patienten. Doch sie genoss auch die Ruhe beim Frühstück. Kein Stress, weil sie pünktlich sein musste. Keine Nervosität, weil sich der Verkehr staute und die Uhrzeit voranschritt.
Emilia lehnte sich zurück und nahm einen Schluck Kaffee. Sie dachte an früher, als sie oft bei ihrer Urgroßmutter gewesen war. Zu ihr hatte sie immer engen Kontakt gehalten, Johanna Arndt war einfach etwas Besonderes. Damals hatten sie im Tegeler Forst nach Kräutern und Pilzen gesucht. Emilia erinnerte sich noch gut an den selbst gemachten Tee, an die leckeren, in Butter geschmorten Steinpilze.
Das alles schien schon ein ganzes Leben her zu sein. Trotzdem roch Emilia plötzlich den Duft der getrockneten Pfefferminze. Sie lächelte versonnen. Diese Erinnerungen schienen ewig verschüttet gewesen zu sein.
Eine Bö peitschte die Zweige der Esche gegen die Scheiben. Emilia schrak auf. Sie stellte die Tasse ab und ging zum Fenster. Der Wind bog die Äste zur Seite, abgerissenes Laub flog durch die Luft. Zwischen den Regentropfen sah sie feinen Hagel. Die Bauarbeiten standen still, alle Männer hatten sich unter eine große Plane verzogen.
»Toll, und ich muss einkaufen gehen«, grummelte sie.
Emilia wartete fast eine Stunde, aber das Wetter besserte sich nicht. Also scherte sie sich nicht weiter darum, schlüpfte in ihren Regenparka und lief zum Supermarkt.
Emilia liebte ihren Stadtteil. Viele Künstler und Menschen unterschiedlicher Kulturen lebten hier zumeist friedlich zusammen und schenkten dem Berliner Wedding eine bunte, lebendige Mischung.
Als sie durch das Englische Viertel ging, begegnete ihr niemand, die Straßen waren menschenleer. Jeder verschanzte sich in seiner Wohnung. Sie kam sich vor wie in einem dieser Endzeitfilme. Als wollte der Regen seinen Teil dazu beitragen, ergoss er sich in Strömen auf den Asphalt und durchnässte Emilias Schuhe. Im Laufschritt eilte sie zum Lebensmittelmarkt und atmete auf, als sie ins Trockene kam.
Die Verkäuferin begrüßte sie und feilte weiter ihre Nägel. Emilia schien die einzige Kundin zu sein.
Wenig später stellte sie ihre Waren auf das Laufband und schaute skeptisch nach draußen. Es donnerte leise, und die dunkelgrauen Wolken verschluckten immer mehr das Tageslicht.
Die Kassiererin zog die Milchtüte über den Scanner. »Det Wetter is heute so scheiße, der Regen nistet sich noch den janzen Tach hier ein.«
»Ja …«, antwortete Emilia nur und seufzte, als draußen der erste Blitz zuckte. »Ich glaube, ich warte hier noch ein bisschen, bis das Schlimmste vorbei ist.«
»Is keen Problem«, antwortete die Kassiererin Kaugummi kauend und nannte Emilia den Preis für ihre Einkäufe.
Ein junger Mann stürmte in den Supermarkt und schüttelte sich wie ein Hund. Er nahm die Kapuze ab und sah sich um. Als er Emilia an der Kasse entdeckte, stahl sich ein Lächeln auf seine Lippen.
»Ach, kiek ma da, die Frau Arndt.«
Der charmante Bauarbeiter von gestern fuhr sich durch das feuchte Haar und kam auf sie zu.
»Tach, Benny«, rief die Verkäuferin.
»Tach, Lotte, wat haste denn fürn Wetter bestellt?«
»Icke? Komm du ma an meene Kasse. Ick bestell nur Sonne.«
Benny zwinkerte Lotte zu und blieb vor Emilia stehen. »Hat ’ne richtige Kodderschnauze, die Lotte«, flüsterte er ihr zu. »Magste ’nen Kaffee mit mir trinken?« Er nickte in Richtung Kaffeeautomat, der am Eingang stand.
»Gerne. Ich wollte sowieso das Gewitter abwarten.«
Es störte Emilia nicht, dass Benny das förmliche Sie hatte fallen lassen. Sie folgte ihm zur anderen Seite des Ladens und ließ sich einen Kaffee ausgeben.
»Du kommst nich’ von hier, oder?«
»Jein, ich bin vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen. Meine Urgroßmutter lebt schon länger hier. Aber ich bin weiter nördlich aufgewachsen.«
»Dann zügle ich mal meine Berliner Schnauze«, sagte er verschmitzt. »Sonst verstehste mich hinterher nich.«
Emilia schmunzelte, und Benny zwinkerte ihr zu.
»Mittlerweile krieg ich es ganz gut hin, also euch zu verstehen.«
Benny schlürfte seinen heißen Kaffee und wollte etwas dazu sagen, als das Geräusch quietschender Bremsen ihn unterbrach.
Emilia sah auf die Straße, und ihr stockte das Herz. Ein silberner Mercedes verlor die Kontrolle, erwischte einen roten Kleinwagen und fuhr ungebremst gegen eine Laterne.
Metall knirschte. Lotte schrie erschrocken auf, als ein Fahrzeugteil mit Wucht gegen die Scheibe des Supermarktes flog. Das Fenster zerbrach an der Stelle, und die Scherben flogen bis zum Kassenbereich.
Ohne lange zu überlegen, stellte Emilia den Kaffee auf den runden Stehtisch und eilte hinaus in den Regen. Benny folgte ihr.
Eine Frau stieg aus dem roten Auto, sie schüttelte verwirrt den Kopf und hielt sich den Nacken. Der Mercedesfahrer rührte sich nicht. Sein Kopf lag auf dem Lenkrad.
»Sieh nach ihr, Benny! Und ruf einen Krankenwagen! Schnell!«
»Ick hab keen Handy! Wir dürfen auf der Arbeit …«
Emilia kramte ihr Smartphone aus der Tasche. »Hier!«
Ein anderer Autofahrer war stehen geblieben, und Emilia wandte sich an ihn. »Könnten Sie bitte ein Warndreieck aufstellen?«
Er nickte nur und ging zu seinem Kofferraum.
Emilia eilte zu dem Mercedesfahrer und öffnete die Tür. Vorsichtig hob sie seinen Kopf vom Lenkrad und lehnte ihn wieder gegen den Sitz. Er hatte eine Platzwunde an der Stirn, seine Lider flatterten.
»Hallo, können Sie die Augen öffnen?«
Er stöhnte leise und kämpfte darum, sie anzusehen. »Ich … ich glaub schon.«
Der Fremde, der das Warndreieck aufgestellt hatte, kam näher, bot Emilia seinen Autoverbandskasten an.
»Danke!«
»Bin ich … gegen die scheiß Laterne gefahren?«, fragte der Verletzte und blinzelte.
»Ja, ziemlich heftig sogar.«
»Die Karre ist … einfach weggerutscht.«
Schweiß brach ihm aus, und er atmete nun schwerer.
»Ist alles gut, der Krankenwagen kommt gleich.«
»Krankenwagen? Muss das sein?«
»Besser ist es. Sie sind übel am Kopf verletzt.«
Verwirrt tastete er sich an die Stirn, zog die Finger mit einem Schmerzenslaut zurück und schaute verwundert auf das Blut an seinen Händen.
Während Emilia sich bemühte, den Mann zu beruhigen, suchte sie in dem Verbandskasten nach einer Kompresse für die Stirn. Sie packte das sterile Päckchen aus und verarztete seine blutende Wunde.
Immer noch prasselte der Regen herab, deshalb entschied sie sich dafür, den Mann im Auto zu lassen. Er begann zu zittern. Emilia wollte sich schon den Parka ausziehen, als Benny ihr zu Hilfe eilte, und ihr eine Decke reichte.
»Oh, wunderbar, wo hast du die denn jetzt her?«
»Ist ’ne Pferdedecke, von der Frau. Der geht’s zum Glück gut, die hat sich nur ’n bisschen den Hals verrenkt.«
Der Krankenwagen näherte sich mit Sirenengeheul. Emilia atmete erleichtert auf. Sie überließ den Sanitätern alles Weitere und trat zurück, nachdem sie den beiden Männern einen kurzen Bericht gegeben hatte.
Sie stand im Regen und sah zu dem demolierten Mercedes.
»Hey, komm, wir gehen in den Laden.«
Nur vage drang Bennys Stimme zu ihr durch. Er setzte ihr die Kapuze auf das nasse Haar, nahm sie am Arm und zog sie ins Trockene. Zurück im Supermarkt, atmete Benny hörbar auf.
»Wie heißt du eigentlich?«
Sie riss den Blick vom Unfallort los und sah ihn an. »Emilia.«
»Ick heiß eigentlich Benjamin, aber so nennt mich echt keener.« Er wuschelte sich durch das kurze hellbraune Haar, schien ein wenig nervös zu sein. »Wow, du wusstest genau, was zu tun ist.«
»Ich bin Krankenschwester«, sagte Emilia. Sie verspürte einen ziehenden Schmerz im Herzen und senkte den Blick.
»Das erklärt einiges. Ach, hier«, sagte er und gab ihr das Handy zurück.
Emilia verstaute es in ihrer Tasche.
Sie konnte sich kaum von dem Unfall lösen, ein Gefühl stieg in ihr auf, das sie innerlich frieren ließ.
»Emilia?«
Sie begegnete Bennys Blick. Er hielt ihr den inzwischen wahrscheinlich kalten Kaffee hin.
»Den willste bestimmt nich’ mehr, oder?«
Sie schüttelte den Kopf. Benny ließ den Becher in den Abfalleimer fallen. »Ick muss jetzt zurück zur Arbeit«, sagte er und schaute sie abwartend an.
Hoffte er, dass sie den Weg mit ihm gemeinsam zurückging? Sie sah ihn prüfend an. Ja, es schien so.
»Ich bleib noch einen Moment hier. Die Polizei braucht sicher eine Zeugenaussage.«
»Ach so, okay. Dann … na ja … bis später! Wir sehen uns bestimmt noch.«
»Ja.«
Benny hob in Lottes Richtung grüßend die Hand und verließ den Supermarkt.
Die Verkäuferin stand mit einem Besen neben der Kasse und schaute auf die Scherben im Eingangsbereich. »Meenste, ick kann det auffegen?«
»Ich denke schon«, antwortete Emilia.
»Mann, det wird der Chefin aber nich’ jefallen«, schimpfte Lotte, während sie die Scherben beseitigte.
Wenig später kamen zwei Polizeibeamte und nahmen Emilias Aussage auf.
3
Am Abend saß Emilia auf der Couch und ließ den Tag Revue passieren. Vor allem grübelte sie über dieses seltsame Gefühl nach, das sie nach dem Unfall überkommen hatte. Die innere Kälte, die sie hatte frieren lassen.
Was bedeutete das?
Früher hatte sie nie die Zeit gehabt, über so etwas nachzudenken. Jetzt ließ es sie nicht mehr los.
Es kann so schnell vorbei sein, fuhr es ihr durch den Kopf. Ein unachtsamer Moment …
»… und man fährt gegen eine Laterne«, sagte sie leise.
Doch das war nicht das Entscheidende. Als sie hinterher im Laden gestanden hatte, war ihr bewusst geworden, dass genau dies ihre Aufgabe war: helfen, medizinisch betreuen, für jemanden da sein. Doch auf einmal fühlte sie wieder den Druck, der sie so lange beherrscht hatte. Und sie empfand ihn nun nicht mehr als positiv.
Mit einem tiefen Seufzer stand sie auf und holte aus dem Kühlschrank eine Tafel Schokolade. Sie brach zwei Riegel ab und genoss die schmelzende Süße.
Das Telefon klingelte. Emilia schaute verwundert auf die Uhr. Wer rief denn nach neun noch an?
Schon auf dem Display des Hörers sah sie den Anrufer. Ihre Urgroßmutter. Rasch nahm sie das Gespräch entgegen.
»Oma! Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Lia? Ach bitte, kannst du herkommen?« Die Stimme ihrer Urgroßmutter klang brüchig. »Ich bin hingefallen und komme einfach nicht mehr hoch.«
Emilia fuhr der Schreck in die Glieder. »Ich komme!«
Sie legte auf, eilte in den Korridor und schlüpfte in die erstbesten Schuhe. Im Hausflur stolperte sie fast auf den glatten Stufen. Innerlich ermahnte sie sich zur Ruhe. Es nutzte ihrer Urgroßmutter nichts, wenn sie sich hier den Hals brach.
Es regnete noch immer, die Wolken spiegelten sich auf dem nassen Asphalt. Emilia stieg rasch in ihren kleinen Peugeot und fuhr in Richtung Stadtgrenze. Die Straßenlaternen blendeten sie, ihr Licht schien zu zerfasern. Sie griff in ihr Handschuhfach und holte ihre Brille hervor. Ihre Sicht wurde klarer, und sie atmete auf. Ihre Kurzsichtigkeit war nur gering, aber im Dunkeln bei schlechtem Wetter brauchte sie eine Sehhilfe, sonst fühlte sie sich unsicher.
Nach etwa zehn Minuten parkte sie vor dem Mehrfamilienhaus, in dem ihre Urgroßmutter wohnte, und hastete zur Haustür. Fahrig kramte sie in ihrer Tasche nach dem Schlüsselbund.
»Verdammt …«
Endlich bekam sie Metall zu fassen und zog die Schlüssel heraus. Im Laufschritt eilte sie die Treppe hinauf. Rasch schloss sie auf und betrat die Wohnung.
»Oma Hanna?«
Schon immer nannte Emilia sie bei ihrem Kosenamen.
»Hier, Lia. Im Wohnzimmer.«
Johanna Arndt war unglücklich zwischen Sofa und Tisch gefallen. Die Tischdecke hing halb herunter, eine Vase war zerbrochen, und die alte Frau hielt sich den Arm.
Emilia ließ ihre Tasche fallen und kniete sich neben sie.
»Tut dir was weh?«
»Ja, der Arm und die Hüfte. Ich komm einfach nicht mehr hoch.«
Behutsam half Emilia ihr auf. Sie spürte, dass Johanna völlig kraftlos war.
»Es tut mir leid, Lia.«
»Was soll dir denn leidtun, Oma? Ich bin nur froh, dass du noch ans Telefon gekommen bist.«
»Ja, das war wirklich ein glücklicher Zufall. Es ist vom Tisch gefallen, und so konnte ich es am Boden erreichen.«
Emilia strich ihr eine Strähne aus der Stirn. Das noch immer volle Haar war von einem silbrigen Weißton. Liebevoll fuhr sie über die weichen Wellen ihrer Urgroßmutter. Johanna liebte ihre Frisur, die sie seit den Fünfzigerjahren trug. Sie sah damit aus wie eine der Filmdiven jener Zeit. Ihre zierliche Gestalt und das gepflegte Gesicht unterstrichen diesen Eindruck. Dennoch war ihr mittlerweile das hohe Alter anzusehen, auch wenn Emilia das nie vor ihr zugeben würde.
»Den Kopf hast du dir aber nicht gestoßen, oder?«
»Nein. Aber mein Arm tut sehr weh.«
»Mir wäre es wirklich lieber, wenn wir ins Krankenhaus fahren würden. Meinst du, dass du bis zum Auto laufen kannst?«
»Ja, ja, das wird schon gehen.«
Sie benutzten den Fahrstuhl, und Emilia führte ihre Urgroßmutter zum Auto. Bewusst wählte sie ein anderes Krankenhaus als das, in dem sie gearbeitet hatte. Auch weil Johanna dort schon einmal behandelt worden war.
Leider war die Notaufnahme ziemlich voll.
»Setz dich hierher, Oma! Ich kläre das eben.«
Selbst auf dem Stuhl schwankte Johanna leicht. Emilia ging zur Aufnahme. Die Frau an der Anmeldung tippte seelenruhig etwas in ihren PC und grüßte nicht einmal. Ungeduldig wartete Emilia.