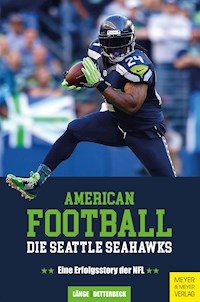
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Meyer & Meyer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine Zeitreise für alle deutschsprachigen Seattle-Seahawks-Fans und solche, die es werden wollen. Dieses Buch nimmt Footballbegeisterte mit in den Pacific Northwest, wo Sport und Fankultur einer ganzen Region zu neuem Selbstbewusstsein verhalfen. Es erzählt, wie der Sohn eines Müllwagenfahrers zum größten Trash Talker der NFL wurde, wie ein Beast die Erde zum Beben brachte und wie sich die Nummer 12 zum Symbol einer Bewegung entwickelte. Historische Momente, herzzerreißende Niederlagen und legendäre Erfolge – "American Football - Die Seattle Seahawks: Eine Erfolgsstory der NFL" ist für diejenigen, die ihr Lieblingsteam besser kennenlernen, Wissen vertiefen und in Erinnerungen schwelgen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Ines
Für Anja, Eva und Jonas
Allgemeine Hinweise:
Dieses Buch steht in keiner Weise in Verbindung mit und ist weder lizensiert noch unterstützt von der NFL oder den Seattle Seahawks.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir uns entschlossen, durchgängig die männliche (neutrale) Anredeform zu nutzen, die selbstverständlich die weibliche mit einschließt.
Das vorliegende Buch wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder die Autoren noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch vorgestellten Informationen resultieren, Haftung übernehmen.
Sollte diese Publikation Links auf Websiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
LÄNGE | DETTERBECK
AMERICANFOOTBALL
DIE SEATTLE SEAHAWKS
** Eine Erfolgsstory der NFL **
American Football: Die Seattle Seahawks
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Details sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie das Recht der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren – ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2021 by Meyer & Meyer Verlag, Aachen
Auckland, Beirut, Dubai, Hägendorf, Hongkong, Indianapolis, Kairo, Kapstadt, Manila, Maidenhead, Neu-Delhi, Singapur, Sydney, Teheran, Wien
Member of the World Sport Publishers’ Association (WSPA)
eISBN 9783840337772
E-Mail: [email protected]
www.dersportverlag.de
INHALT
Vorwort
Foreword
Prolog
I Entstehungsjahre
II Kingdome
III Die Ära Knox
IV Die Nummer 12
V Umbruchjahre
VI Die Ära Holmgren
VII Mosiula Mea‘alofa Tatupu
VIIILumen Field
IX Die deutschen Seahawks
X Die Ära Carroll
XI Seattle und Seahawks-Football
XIIAus dem Leben zweier 12s
We’re thankful
Anhang
1 Literaturverzeichnis
2 Bildnachweis
VORWORT
Da ich mein ganzes Leben in Seattle verbracht habe, war es schon immer schwierig für mich, richtig zu begreifen, welchen Einfluss ein Team wie die Seahawks außerhalb der Stadt hat. Ich sah die Trikots von Matt Hasselbeck, als ich in der Mittelschule auftauchte. Es schien damals, als würde jedes Kind in der Nachbarschaft das Videospiel Madden 2007 aus seiner Plastikverpackung schälen, als Shaun Alexander das Cover zierte. Ich verfolgte, wie Hunderttausende von Seahawks-begeisterten Seattleites die Straßen der Innenstadt überfluteten. Sie blieben der Arbeit fern und unterstützten ihre Kinder beim Schuleschwänzen, nur um den ersten Super Bowl der Stadt im Februar 2014 feiern zu können. All das konnte man als lokales Phänomen abtun. Das Gleiche gilt für den ohrenbetäubenden Lärm, den ich als Reporter bei den Heimspielen der Seahawks erlebt habe.
Um aber die ganze Tragweite von Pete Carrolls Predigten zu verstehen, um die ikonische Natur eines von Skittles besessenen Running Backs zu erkennen und um die Überlegenheit eines Haufens knallharter Defensive Backs zu würdigen, musste ich Seattle verlassen.
Ich musste nach Übersee.
Meine Großeltern zogen in den 1960er-Jahren aus dem Mittleren Westen nach Seattle und hatten Seahawks-Dauerkarten für die Premierensaison 1976. Mein Großvater mütterlicherseits, Willie Lee, war ein weitgereister Ingenieur für Boeing Airlines, er starb 2002. Ich stelle mir noch heute seinen Gesichtsausdruck vor, würde er erfahren, dass ich dafür bezahlt werde, von einem Seahawks-Spiel in London zu berichten.
Ich landete in London am 9. Oktober 2018 und spürte fast sofort die Schockwellen, die von einem Jahrzehnt spannender Seahawks-Siege, herzzerreißender Niederlagen und per Griff in den Schritt vollendeter Touchdown-Läufe ausgingen. Während einer Woche, die ich auf der anderen Seite des Ozeans verbrachte, hatte ich Kontakt zu Seahawks-Fans aus der ganzen Welt und dokumentierte ihre Zuneigung zu einem Team, das in der oberen linken Ecke der Vereinigten Staaten versteckt ist. Am Vorabend der dominanten Vorstellung Seattles gegen die Raiders im Wembley-Stadion veranstaltete die örtliche Seahawks-Fangruppe eine Party, um das Team zu feiern und gleichzeitig Geld für den verstorbenen Quarterback Tyler Hilinski von der Washington State University zu sammeln. Während ich dieses Vorwort schreibe, trage ich – als stolzer WSU-Absolvent – meinen weiß-roten „Hilinski’s Hope“-Pullover aus dieser Nacht.
Als ich mich an diesem Abend mit Fans aus Tausenden von Meilen Entfernung austauschte – von denen mich einige mit wer weiß wie vielen Seahawks-Spielern verwechselten –, spürte ich ihre aufrichtige Begeisterung dafür, Menschen von jenseits des großen Teichs zu treffen und sich mit denen zu unterhalten, die ihre Liebe zu Seattles beliebtester Profimannschaft teilten. Menschen, die in der Achterbahn der Gefühle mitfuhren, als Hasselbeck in der Verlängerung verkündete, dass sein Team jetzt punkten würde. Menschen, die ihre Verschwörungstheorien rund um Super Bowl XL erzählten. Menschen, die sich daran erinnerten, wie Doug Baldwin die Nummer 15 trug. Die sich erinnerten, wie Brandon Browner Greg Jennings einen Body Slam verpasste. Die sich an das Kam-gegen-Cam-Duell in den Play-offs der Saison 2014 erinnerten und daran, wie Richard Sherman seine Überlegenheit durchsetzte, als wären das alles private Kindheitserinnerungen. Es war ein greifbares Gemeinschaftsgefühl.
Am Ende meiner Reise hatte ich eine ungesund hohe Zahl an Pubs besucht und die perfekte Menge internationaler Selfies gemacht. Ich kehrte nach Hause zurück und war mir um den Einfluss des Teams bewusst, das ich seit über zwei Jahrzehnten dabei beobachtete, wie es sich von einem Emporkömmling in den frühen 2000er-Jahren zu einem wahren Powerhouse in den 2010er-Jahren entwickelt hatte.
Ich glaube, jeder, der über ein NFL Team berichtet, spürt den Eindruck, den ein Team auf die Menschen in der Umgebung macht. Und jeder, der als Reporter mitreist, spürt den Eindruck, den dieses Team auf das ganze Land macht. Man trifft die Fans, die vor vielen Jahren aus Seattle weggezogen waren und die die Spiele der Seahawks in Pittsburgh, New York, Chicago, Washington D.C., Dallas, Carolina und so weiter in ihren Kalendern markiert haben. Man trifft Leute, die Podcasts in Georgia aufnehmen. Leute, die in Seahawks-Bars in Arizona kellnern. Aber nichts übertrifft das unbeschreibliche Gefühl, jemanden in einer völlig anderen Sprache über seine Liebe zu Steve Largent sprechen zu hören oder darüber, wie er Kenny Easleys Karriere von Anfang an verfolgt hat oder davon, wie er sein Walter-Jones-Trikot entstaubt.
Die Seahawks gehören der Stadt Seattle. Das war schon immer klar. Aber wie dieses Buch zeigt, gehören sie auch den Fans überall auf der Welt.
Michael-Shawn Dugar
Seahawks-Reporter für The Athletic
FOREWORD
Living in Seattle my entire life, it was hard to adequately grasp the impact a franchise like the Seahawks has outside of the city. I saw the Matt Hasselbeck jerseys as I showed up to middle school. Seemingly every kid in the neighborhood peeled off the plastic on Madden 2007 when Shaun Alexander graced the cover. I watched hundreds of thousands of Seahawk-loving Seattleites flood the streets of downtown, playing hooky from work and voluntary aiding in their children’s truancy in order to celebrate the city’s first Super Bowl in February 2014, but all of this was easy to chalk up as a local phenomenon. Ditto for the deafening noise I experienced during Seahawks’ home games as a beat writer.
To fully understand the significance of Pete Carroll’s preachings, to truly comprehend the iconic nature of a Skittles-obsessed running back and to honestly appreciate the transcendence of a bunch of badass defensive backs, I had to venture out.
I had to go overseas.
My grandparents moved to Seattle from the Midwest in the 1960s and had Seahawks season tickets in the inaugural season in 1976. My maternal grandfather, Willie Lee, was a well-traveled metallurgical engineer for Boeing Airlines. He died in 2002. To this day I think about the look he would have had on his face upon learning I’d be paid to cover a Seahawks game in London.
I landed in London on October 9, 2018 and almost immediately felt the shockwaves stemming from a decade of thrilling Seahawks victories, heartbreaking losses and touchdown runs punctuated by crotch grabs. Over the course of one week spent across the water, I interacted with Seahawk fans from all over the world, chronicling their affection for a team tucked away in the upper left-hand corner of the United States. On the eve of Seattle stomping the Raiders at Wembley Stadium, the local Seahawks fan group threw a party simultaneously celebrating the team and raising money for the late Washington State University quarterback Tyler Hilinski. As I write this foreword, the proud WSU alumnus that I am, I’m wearing my white and red “Hilinski’s Hope” sweatshirt, purchased that night.
In sharing stories that evening with 12s from thousands of miles away – some of whom mistook me for who-knows-how-many Seahawks players – I sensed their genuine excitement in meeting and engaging with people from across the pond who shared their love of Seattle’s most popular franchise. People who could recall the roller coaster of emotions when Hasselbeck declared in overtime that they were going to score. People who shared their conspiracy theories from Super Bowl XL. People who remembered Doug Baldwin wearing number 15, Brandon Browner body slamming Greg Jennings, the Kam on Cam violence in the 2015 playoffs and Richard Sherman asserting his superiority as if these were all childhood memories. It was a tangible feeling of community.
By the end of the trip, I had frequented an unhealthy number of pubs, taken the perfect number of international selfies and returned home uniquely aware of the influence of the team I had spent more than two decades watching grow from an up-and-comer in the early 2000s to a legitimate powerhouse in the 2010s.
I imagine everyone who covers an NFL team feels the impression the team has on the people in the community. And anyone who travels while covering an NFL team feels the impression that team has across the country. They meet the fans who relocated years earlier and have Seahawks games circled on their calendar in Pittsburgh, New York, Chicago, Washington D.C., Dallas, Carolina and the like. They meet people who host podcasts in Georgia. People who wait tables at Seahawks bars in Arizona. But nothing beats that indescribable feeling of hearing someone speaking in an entirely different language rant about their love of Steve Largent or tell their stories of following Kenny Easley’s career from the beginning or dusting the cobwebs off of their Walter Jones jersey.
The Seahawks belong to the city of Seattle. That much has always been obvious. But, as this book will illustrate, they also belong to 12s all over the world.
Michael-Shawn Dugar
Seahawks beat writer for The Athletic
PROLOG
Wir gingen, als wir die Plakate an den Schaufenstern der Geschäfte sahen. „Deutsche! Wehrt euch!“, stand da schwarz auf weiß – und: „Kauft nicht beim Juden!“
So ließen wir, die Familie Sarkowsky, Deutschland hinter uns. Thüringen. Gera, wo ich, Herman, am 9. Juni 1925 zur Welt kam. Meerane, wo wir lebten. Vaters Konfektionshaus in der Badergasse 2, wo ich beim Verkaufen half. Unsere Wohnung in der Zwickauer Straße 56, wo ich mit meinen Brüdern Leo und Fritz aufwuchs.
Für unsere Eltern war es nicht der erste Aufbruch, aber wohl der schmerzhafteste. Meine Mutter Paula stammte ursprünglich aus Polen. Mein Vater Irving, den alle Itsche nannten, kam als kleines Kind während eines Pogroms von Russland nach Deutschland. Sie hatten sich immer als Deutsche gefühlt. Waren in Deutschland aufgewachsen. Hatten sich dort kennengelernt, geheiratet und drei Kinder bekommen. Sich ein Geschäft aufgebaut.
Doch als die NSDAP 1932 stärkste Partei wurde und mit ihr der Antisemitismus seinen festen Platz in der Gesellschaft gefunden hatte, wusste mein Vater, dass Deutschland nicht mehr der Ort war, an dem er mit seiner jüdisch-orthodoxen Familie leben wollte.
Er war in den Tagen vor unserem Aufbruch immer wieder fort gewesen. Hatte Silber, Geld und Gut über die Grenze geschmuggelt. Alle hielten ihn für verrückt, weil er solch große Angst vor Hitler hatte. Mutter wollte nicht gehen, doch meinen Vater ließ dieses ungute Gefühl einfach nicht los. Er hatte verzweifelt versucht, unsere Verwandtschaft ebenfalls zum Aufbruch zu überreden, aber nur ein Cousin hörte auf ihn.
Wenn ich darüber nachdenke, ist Aufbruch eigentlich das falsche Wort. Wir brachen nicht auf, sondern unser Leben in Deutschland ab. Wir brachten uns vor den Nazis in Sicherheit. Wir flohen – auch wenn die Flucht sich recht gemütlich anfühlte, denn wir fuhren ohne Probleme mit dem Auto über die Grenze zur Tschechoslowakei. Das war 1934, da war ich gerade neun Jahre alt, meine Brüder sieben und elf. Herausgerissen aus unserer Kindheit.
Wir lebten für kurze Zeit in Karlsbad. Mein Vater, ein willensstarker Mann mit Geschäftssinn und einem guten Plan, wusste da bereits, dass er in die USA wollte. Anfang 1935 bekamen wir unsere Visa und buchten die Überfahrt von Bordeaux in Frankreich nach New York. Wir überquerten den Atlantik auf der „SS Washington“, was sich später als sehr passend herausstellen würde.
In Brooklyn hatten wir es als Immigrants und trotz finanzieller Rücklagen nicht leicht. Neues Land, neue Sprache, neue Kultur. Wir Kinder kannten kein Wort Englisch, als wir in den USA ankamen.
Vater fühlte sich in der großen City nicht wohl, denn er kam aus einer Kleinstadt. So entschied er sich bald, ins Pelzgeschäft einzusteigen, dessen Zentrum im Westen lag. Also packten wir nach knapp zwei Jahren an der Ostküste erneut unsere Koffer. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir kurz vor Thanksgiving 1937, nach sechs Tagen Eisenbahnfahrt, in Seattle im US-Bundesstaat Washington eintrafen.
ENTSTEHUNGSJAHRE
„Das Erste, was ich am Morgen nach der Bekanntgabe in der Zeitung las, war, dass es so etwas wie einen Seahawk überhaupt nicht gibt.“
John Thompson, General Manager (1976-1982), über den Teamnamen
***
„Teil einer neuen Franchise zu sein – das ist das, worauf ich rückblickend am meisten stolz bin.“
Jim Zorn, Quarterback (1976-1984), über seine Karriere
***
„Wir werden das erste Expansionsteam sein, das die Saison mit zwölf Siegen und zwei Niederlagen beendet.“
Jack Patera, Head Coach (1976-1982), über die Ziele im Premierenjahr
*Saison durch Spielerstreik verkürzt
AUS DER VOGELPERSPEKTIVE
Ein Gefühl von Unbehagen machte sich in ihm breit. Er hatte es nun nicht mehr selbst in der Hand. Den Entscheidern bei der National Football League (NFL) lagen alle nötigen Unterlagen vor – die finanziellen Garantien, die Konzepte der Gruppe, die Namen der Beteiligten.
Da stand er, in seinem Arbeitszimmer, in diesem noch recht neuen, klotzförmigen Bürogebäude am südlichen Zipfel des Lake Union mit Downtown Seattle direkt im Rücken, und ließ den Blick übers Wasser schweifen. Über die weißen Boote, die im sanften Wellengang schaukelten, rüber zu dem Wasserflugzeug, das just in diesem Moment mit zwei etwas unbeholfen anmutenden Hüpfern seine Schwimmflächen auf den See setzte. Und er fragte sich: Hatte er wirklich alles getan, um seiner Stadt nach jahrelangem Warten endlich das ersehnte NFL-Team zu bescheren?
Fehlende Hingabe konnte man ihm nicht vorwerfen. Er hatte die Mehrheitsanteile an seinen geliebten Portland Trail Blazers aus der US-Basketballliga NBA verkauft. Die NFL verlangte dies – und so sehr er mit den Vorgaben der Liga haderte, sah er für den Football in Seattle eine zu große Zukunft, als dass er das Vorhaben wegen einer Formalie hätte platzen lassen wollen. Er hatte eine Gruppe Investoren – angesehene und finanzkräftige Herren aus Seattle – zusammengetrommelt, um das Expansionsteam zu kaufen. Er war sich sicher, dass dies eine gute Investition für die Region sein würde.
Das Näschen für gute Geschäfte hatte er von seinem Vater geerbt, einem Kaufmann. Eigentlich wollte er nach Abschluss der High School an der University of Washington Journalismus studieren, denn er mochte das Schreiben. Er hatte schon damals für die Schülerzeitung Sportberichte verfasst. Wieso also nicht darauf aufbauen? Doch nach der Rückkehr aus Übersee – er war zunächst bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Fernmeldetruppe in Japan stationiert gewesen – belegte er an der Uni Businesskurse.
Ein Freund seines Vaters bot ihm in den Semesterferien ein Praktikum in der Immobilienbranche in Oakland an. Er nahm an, tauchte ein ins Baugeschäft und ließ den Journalismus hinter sich. Nach dem Studium zog er für eine Festanstellung nach Nordkalifornien. Sein 20-jähriges Ich wollte raus aus dem Elternhaus in Capitol Hill, einem Stadtteil von Seattle.
Er fühlte sich auf Anhieb wohl in Oakland. Im Beruf lernte er schnell hinzu und Fertighäuser verkauften sich gerade prächtig. Alles lief perfekt – bis ihn sein Chef nach zwei Jahren aus dem Nichts vor die Wahl stellte: entweder zurück nach Seattle gehen und dort die Geschäfte der Firma fortführen oder gefeuert werden. Und weil er seinen Job nicht verlieren wollte, kehrte er zurück in den Pacific Northwest und versuchte, in Tacoma, im Süden von Seattle, die nagelneuen Bauobjekte seiner Firma zu verkaufen. Doch niemand im nassen, kühlen Nordwesten wollte Häuser im kalifornischen Stil. Sein Chef erkannte das viel zu spät. Er wollte fortan nichts mehr mit dem Projekt zu tun haben und übergab es an seinen Schützling. Und was machte der? Er verkaufte dank ein paar Veränderungen an den Immobilien und mit der Hilfe eines befreundeten Maklers alle Häuser und hatte 1952 seine ersten 10.000 US-Dollar auf dem Konto.
Mit der neuen Freiheit des eigenen Geldes kaufte er seiner damaligen Freundin einen Verlobungsring und für sein fortan eigenständig geführtes Business neue Grundstücke. Er investierte, verkaufte und reinvestierte – und tat das irgendwann nicht mehr nur auf dem Häusermarkt in Tacoma, sondern im ganzen US-Bundesstaat Washington und die Pazifikküste hinunter. Und dann auch außerhalb der zockfreudigen Immobilienbranche: in der Pferdezucht und im Sport.
1970 hatte er die Möglichkeit, für 3,7 Millionen US-Dollar ein Profi-Basketballteam nach Portland, Oregon, zu holen – und wurde Mehrheitseigner bei den Trail Blazers.
Zweifellos hatten er und sein General Manager in Portland gerade zu Beginn viele Fehler gemacht, das wollte er nicht beschönigen. Sie hatten Verantwortliche ohne NBA-Erfahrung verpflichtet, mehrfach den Cheftrainer gewechselt und in den ersten Jahren nur wenige Spiele gewonnen. Erst mit der Verpflichtung eines jungen und hochtalentierten Centers namens Bill Walton schien langsam Ruhe einzukehren bei den Trail Blazers. Das Team spielte erstmals seit seiner Gründung wirklich vielversprechenden Basketball.
Eine neue Sportorganisation aufzubauen und zu etablieren, das war eine Herkulesaufgabe, schwieriger als jeder einzelne seiner Immobiliendeals zuvor. Er war dankbar für diese intensive Zeit. Die lehrreichen Erfahrungen – die Schwierigkeiten der ersten Jahre und die Fehler bei der Auswahl des Personals – konnte ihm keiner mehr nehmen.
Er blickte noch einmal hinüber zu den Wasserflugzeugen auf dem Lake Union, wo sich gerade wieder eine Propellermaschine mühsam in Bewegung setzte. Er stellte sich vor, wie sie gleich abheben, an den schwimmenden Häusern vorbei und über die alte Kohlevergasungsanlage mit ihren verrosteten Rohren in den Himmel steigen würde. Dann leicht in Richtung Westen abdrehen und über die George Washington Memorial Bridge fliegen würde, unter der ein nach dem Stadtteil Fremont benannter Troll aus Stahl und Beton hauste.
Vielleicht würde das Flugzeug dann eine Kurve nach Westen machen in Richtung Bainbridge Island. Auf dem Weg über die Elliot Bay könnten seine Insassen an klaren Tagen einen Blick auf die schneebedeckten Berge der olympischen Halbinsel erhaschen. Unten im Wasser würde sich gerade eine Fähre ihren Weg durch die Wellen bahnen, mit Kurs auf Colman Dock am südlichen Ende von Seattles Hafenviertel.
In all den Jahren des Geschäftemachens an der weiten Pazifikküste hatte er die Stadt und ihre Schönheit zwischen Wasser und Wäldern, zwischen dem erhabenen Mount Rainier und den verzweigten Inseln des Puget Sound nie vergessen. Nun wollte er seine Erfahrungen hier in Seattle und für Seattle einbringen.
Die Maschine würde jetzt direkt über die City fliegen, rechts vorbei am 1914 erbauten Smith Tower, dem bis zur Fertigstellung der futuristischen Space Needle höchsten freistehenden Bauwerk an der Westküste, und dann weiter gen Süden. Vor seinem geistigen Auge entdeckte er nun auch endlich die wellenförmigen Betonstreifen an den Außenseiten des King County Multipurpose Stadiums, kurz Kingdome. Bald würden dort, am Rande des Stadtzentrums, wo jetzt eine Großbaustelle lärmte, hoffentlich tausende Fans einem American-Football-Team zujubeln.
Das Flugzeug würde nun kehrtmachen und in einer großzügigen Runde über den weiter östlich gelegenen Lake Washington und den Campus der gleichnamigen Universität hinweg an seinen Ausgangspunkt zurückkehren. Es würde etwas unsanft, aber vom Wasser abgefedert, auf dem See aufsetzen.
Der Gedanke an die ruckelige Landung holte ihn aus seinem Tagtraum zurück in die Gegenwart. Er konnte jetzt der Stadt, die 1937 einen 12-jährigen Buben aus Deutschland nach langer Reise willkommen hieß, die ihn seit seiner Ankunft im Pacific Northwest so gut behandelte, die sein Zuhause war, eine große Freude bereiten. Er hatte sich dazu entschlossen, viel in dieses Geschenk für seine Heimatstadt zu investieren. Aus Dankbarkeit. Aus Lust, Neues zu wagen. Aus Liebe zum Sport.
Ja, er – Herman Sarkowsky – war sich sicher, er hatte alles in seiner Macht Stehende getan, um Seattle zu einem NFL-Team zu verhelfen. Nun konnte er nur noch darauf hoffen, von der Liga den Zuschlag zu bekommen.
DER TRAUM VOM FLIEGEN
Der Hunger nach Profisport existierte in Seattle bereits vor dem Durchbruch einer gewissen Basketballmannschaft in den 1960er-Jahren. Lange vor den SuperSonics und noch länger vor dem Aufstieg ihres Leverkusener Star-Forwards Detlef „Det the Threat“ Schrempf, hatten die Eishockeyspieler der Seattle Metropolitans von 1915 bis 1924 den professionellen Sport temporär in der Stadt angesiedelt – und mit ihm sogar den Stanley Cup, die nordamerikanische Meisterschaft.
Doch so schnell die Mets Erfolg in die Stadt gebracht hatten, so schnell waren sie auch wieder weg, als sie vor ihrer zehnten Saison ohne Eisstadion dastanden. Die Seattle Ice Arena wurde in eine große Garage umfunktioniert, das Team aufgelöst. Zurück blieben eine enttäuschte Fanbasis – und jede Menge neuer Parkplätze für eine rasch wachsende Stadt.
Die erhoffte nachhaltige Beziehung zwischen einem Profiteam und Seattle entwickelte sich erst ab 1967 mit den erwähnten SuperSonics, die zu dieser Zeit das einzige Major-League-Team in der Region waren. Benannt war die Basketballmannschaft ganz avantgardistisch nach der sogenannten Supersonic Transport Division, in der die in der Gegend ansässige Firma Boeing an einem revolutionären Überschallflugzeug tüftelte. Das Forschungsprojekt wurde 1971 eingestellt. Die Basketball-SuperSonics aber blieben – zumindest vorläufig.
Gestillt war das Verlangen nach Unterhaltung bei den sportbegeisterten Seattleites damit keineswegs. Der Traum vom professionellen American Football war nicht erst auf Initiative von Herman Sarkowsky und seinen Mitstreitern groß. Seit Mitte der 1950er-Jahre hatten immer wieder Investorengruppen versucht, ein Team nach Seattle zu holen, doch alle scheiterten an der nicht in adäquatem Format vorhandenen Unterkunft.
Das größte Hindernis für eine weitere Major-League-Franchise – so werden die einem großen Sport-Dachverband angehörigen, aber privat geführten Organisationen in den USA genannt – war seit den 1950er-Jahren die Tatsache, dass der Metropole ein zeitgerechtes Stadion für Outdoorveranstaltungen fehlte, um große Zuschauermassen zu beherbergen.
In einem Sportsystem, das den Argumenten Geld und Immobilien immer die größte Aufmerksamkeit gewidmet hat, war dies ein absoluter Dealbreaker. Ohne moderne Spielstätte würde keine namhafte Profiliga die Stadt als ernst zu nehmenden Expansionskandidaten betrachten, geschweige denn ihr ein Team zusagen.
Darin bestand das Problem. Denn gleichzeitig würde es ohne zugesagtes Team schwer sein, die Finanzierung eines Stadions zu realisieren. Schließlich wäre eine leer stehende Spielstätte weder erstrebenswert noch rentabel.
Diese Pattsituation geriet erst aus dem lähmenden Gleichgewicht, als der örtliche Bezirk King County im Februar 1968 im dritten Anlauf Anleihen in Höhe von rund 40 Millionen US-Dollar für den Bau eines überdachten Stadions bewilligte. Jetzt war nicht nur die NFL daran interessiert, in eine nagelneue Spielstätte in Seattle einzuziehen. Auch die Major League Baseball (MLB) wollte nun eine Franchise im Pacific Northwest ansiedeln.
Im Juni 1974 stimmten die 26 Teambesitzer der NFL auf Empfehlung des Expansionskomitees über Seattle als neuen Ligastandort ab. Die Bewerberstadt benötigte die Zusage von 20 der 26 Stimmberechtigten, erreichte am Ende aber eine nahezu einstimmige Entscheidung. Wenige Monate nach der Aufnahme Tampa Bays als 27. wurde also Seattle zum 28. Team der National Football League. Als NFL-Chef Pete Rozelle die Expansion bekannt gab, hatte sich die Stadt am Puget Sound gegen ein Gebot aus Memphis durchgesetzt.
Die NFL, das machte Rozelle in einem Statement klar, war dem Ziel einer flächendeckenden US-Profiliga einen Schritt nähergekommen: „Seattle war immer eine attraktive Stadt für die Liga. Sie liegt im einzigen Teil des Landes, in dem wir noch keine Franchise haben.“
Nun war nur noch eine Frage zu klären: Wer würde das Team besitzen – und damit in den prägenden ersten Jahren des Aufbaus anführen? Bereits vor der Bekanntgabe der Expansion – ziemlich exakt seitdem King County grünes Licht für den Stadionbau gegeben hatte – war in Seattle das Wetteifern um die Franchise-Rechte ausgebrochen. NFL-Teams sind im Gegensatz zu Vereinen in Deutschland vor allem private Wirtschaftsunternehmen, die viel Geld abwerfen, ein bisschen aber auch Spielzeuge der Reichen.
Die positiven Entwicklungen im Pacific Northwest sprachen sich bis nach Minneapolis herum, wo ein Mann endlich seine Chance auf ein NFL-Team gekommen sah. Der Tycoon Wayne Field gründete im Februar 1969 die Seattle Sea Lions Management Corp., die später als Seattle-Kings-In-itiative bekannt werden sollte und keine Zweifel daran ließ, dass sie sich die Rechte am Team sichern würde.
Einziges Manko: Field kam nicht aus Seattle, er war also kein Einheimischer, wie es die Liga damals für Teambesitzer vorsah. Kurzerhand tat er sich mit Hugh McElhenny, einer College-Football-Legende von der University of Washington, zusammen. McElhennys Erfolgszeiten bei den Huskies lagen da zwar schon gut 20 Jahre zurück, doch das Team der Universität im Norden Seattles und seine Legenden waren äußerst populär. Man war sich nun in ganz Washington sicher: Field und McElhenny würden den Zuschlag als Besitzer erhalten.
Jedoch hatten sie zwei Faktoren zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt: Herman Sarkowsky mit seiner 1972 gegründeten Seattle ProfessionalFootball Inc. und dem durch die NFL auf 16 Millionen US-Dollar festgelegten, unerwartet hohen Kaufpreis für die Franchise-Rechte.
Während die Stadt ihr Footballteam herbeisehnte und die Seattle-Kings-Initiative sich im Übereifer beinahe vorzeitig zur Besitzergruppe krönte, versammelte Sarkowsky gemeinsam mit dem befreundeten Immobilienmogul David „Ned“ Skinner heimlich, still und leise eine finanzstarke, elitäre Gruppe einheimischer Investoren.
Als damaliger Eigentümer der Portland Trail Blazers aus der NBA kannte Sarkowsky die Tücken der Sportwelt und wollte seine Expertise nun weiter nördlich an der Pazifikküste einsetzen. Zwei Jahre nach der Gründung seines Basketballteams in Oregon widmete er sich mit Skinner dem einen großen Ziel: ein professionelles Footballteam im Nordwesten der USA anzusiedeln.
Herman Sarkowsky
Wie Sarkowsky verdiente auch Skinner sein Geld mit Immobilien. Der Erbe einer in Schiffbau und -fahrt tätigen Familie war einer der ersten Besitzer der Space Needle in Seattle, die mit ihrem ufoähnlichen Aussehen noch heute die Skyline der Stadt prägt.
Alleine hätten aber selbst die beiden Immobilienmillionäre den von der NFL überraschend hoch angesetzten Kaufpreis der Franchise nicht stemmen können. 16 Millionen US-Dollar waren – gerade bei angespannter Börsenlage – auch für Sarkowsky und Skinner eine Nummer zu groß. Deshalb machten sie sich auf die Suche nach Teilhabern. Sie wünschten sich Partner, mit denen es nicht nur finanziell, sondern auch menschlich gut passen würde – besonders in schwierigen Zeiten.
„Der Sport bringt in Menschen seltsame Emotionen hervor“, erklärte Sarkowsky damals die gründliche Suche. Am Ende standen auf Sarkowskys und Skinners Liste die Namen von vier einflussreichen Unternehmern aus Seattle: Howard Wright, Lamont Bean, Lynn Himmelman und Lloyd W. Nordstrom. Gemeinsam wollten die sechs Einheimischen den von außerhalb kommenden Field und seinen Posterboy McElhenny ausstechen und die Franchise kaufen. Sie mussten sich nur noch einigen, wer der 51-prozentige Mehrheitseigner des Teams werden würde.
Dass Sarkowskys Konsortium plötzlich Favorit auf Seattles neue Franchise war, lag vor allem an Kaufhausmagnat Nordstrom, der das NFL-Team kurzerhand zur Familienangelegenheit machte. Lloyd war als letzter Investor zur Gruppe gestoßen. Er wollte eigentlich nur einer von mehreren Teilhabern werden. Doch da die NFL einen Mehrheitseigner vorsah, wandte er sich an die finanzkräftige Verwandtschaft und bat sieben Mitglieder der Nordstrom-Familie um Unterstützung.
Sechs zogen mit und gaben jeweils eine Million US-Dollar – nur Neffe John war nach dem Börsencrash 1974 nicht besonders risikofreudig. Am Ende aber beugte er sich der Tradition in seiner sportverrückten Familie, Investitionen stets gemeinsam anzugehen. Die Finanzierung war gesichert. Auf die perfekte Mischung aus Geld, Prestige und Engagement in der Region hatten Field und McElhenny keine Antwort – sie zogen ihre Bewerbung zurück.
Am 5. Dezember 1974 erteilte NFL-Chef Pete Rozelle dem Konsortium um Sarkowsky und Nordstrom die Genehmigung zum Kauf der neuen Franchise. Seattle hatte endlich ein professionelles American-Football-Team. Eines, dessen Mehrheitseigner zunächst nur eine untergeordnete Rolle in der Besitzergruppe spielen wollte. Und eines, dessen leitender Geschäftsführer ein gebürtiger Thüringer war.
Knapp 50 Jahre später ist der Erfolg der Seattle Seahawks der Beweis dafür, dass bei der Gründung der Franchise Menschen mit Bausachverstand am Werk waren. Herman Sarkowsky hatte mit seinen Partnern ein Team konstruiert, wie er es auf dem Häusermarkt gelernt hatte. Mit einem starken Fundament, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist.
EIN FEDERKLEID FÜRS TEAM
Rund eineinhalb Jahre vor dem ersten Spiel der Seattle No-Names begann nun also die Suche nach einem General Manager, einem Head Coach – und natürlich einer Identität fürs Team.
Es muss bei einem Abendessen bei einem Ligameeting in Hawaii gewesen sein, so jedenfalls rekapituliert es der im März 1975 ernannte General Manager John Thompson. Man habe am Tisch gesessen, habe Logoentwürfe und Namensideen auf Servietten gekritzelt, erinnert sich Cathy Sarkowsky, die Tochter des im November 2014 verstorbenen Teambesitzers.
Thompson, so erzählte er es einst selbst, habe vorgeschlagen, einen Wettbewerb für die Namensfindung auszurichten – und so kam es dann auch. Bis Ende Mai hatten Fans Zeit, Namensvorschläge an die Seattle Professional Football Inc. zu senden. Nach einem Tag lagen 1.171 Zuschriften mit 300 Ideen im Briefkasten, am Ende der Frist waren es sogar 1.741 Vorschläge aus 20.365 Einsendungen.
Neben den fünf Favoriten Seahawks, Sockeyes, Mariners, Evergreens und Olympics waren auch abenteuerliche Namen dabei, die man für erlogen hielte, hätten nicht die Seahawks selbst sie vor einigen Jahren bestätigt.
Die Seattle About Timers hätten das lange Warten der Fans auf eine Franchise symbolisiert. Die Seattle Running Salmon wären womöglich entgegen der Strömung, entgegen allen Widerständen, flussaufwärts geschwommen. Die Seattle Killer Whales und Seattle Vampires hätten in der Unterhaltungsindustrie irgendwann Konkurrenz durch den Kinofilm Free Willy und die Twilight-Romane bekommen. Die Seattle Bigfoots oder Seattle Sasquatches wären wohl genauso belächelt worden wie die Seattle Identified Flying Objects, weil sie wie ihre Namen der menschlichen Fantasie entsprungen sind. Die Seattle Space Needlers hätten den SuperSonics das Logo streitig gemacht. Bei den Seattle 747s wäre schwarzer Flugzeughumor in jeder Schwächephase des Teams unvermeidbar gewesen. Und die Washington Georges dürften im Jahr 2021 in der US-Hauptstadt unter den Vorschlägen auftauchen, wo sich das Team gerade von seinem rassistischen Namen getrennt hat.
Zwei Wochen nach Fristende, am 17. Juni, entschieden sich Sarkowsky, Nordstrom und Thompson per Abstimmung für die Alliteration. Für den einheimischen und aggressiven Titel. Für die Seattle Seahawks. Zuvor hatten diesen Namen nur eine kurzlebige Football-Franchise aus Miami und Seattles unterklassiges Eishockeyteam temporär in den 1940er- und 1950er-Jahren verwendet.
Der von über 150 Personen eingereichte Vorschlag hörte sich nach einem angriffslustigen Vogel an, so die Teambesitzer. Die im Losverfahren bestimmte Gewinnerin des Namenswettbewerbs, Hazel Cooke, erzählte nach der Bekanntgabe, sie habe Seahawks vorgeschlagen, weil der Hawk ein stolzes, mutiges, leidenschaftliches Tier sei. Sie hoffe, dass sich das Team daran orientiere. Als Dauerkartenbesitzerin konnte sie sich im ersten Jahr direkt ein Bild davon machen.
Bei den Farben und beim Logo waren die Seahawks an Vorgaben der NFL gebunden: Königsblau, Grün und Silbergrau. Die Liga hatte sich dabei an den Tönen des Nordwestens orientiert, am Ozean und an den Wäldern. Das Silber der Helme würde im Flutlicht des Kingdomes tolle Reflexionen erzeugen, waren sich die Teambesitzer sicher.
Über die Jahre wandelte sich die Corporate Identity der Seahawks wie die Töne von Meer und Bäumen – von hell zu dunkel und von dunkel zu hell. 2002 wurde aus dem silbergrauen Helm per Fanvoting ein blauer. Zum Königsblau gesellte sich das dunklere Navy Blue. Aus einem kräftigen Grün wurde ein saftiges, fast giftiges. Es kam 2009 auf einem Ausweichtrikot erstmals zum Einsatz – und landete nach einer Niederlage direkt in der hintersten Ecke der Kleiderkammer.
Erst mit der durch den Ausrüsterwechsel von Reebok zu Nike angestoßenen Trikotrevolution etablierte sich bei den Seahawks 2012 das tiefe Blau als primäre Farbe. Farbklekse in leuchtendem Action Green, stellvertretend für die vom Regen verwöhnte Region, sorgten für starken Kontrast. Weiße Akzente für die schneebedeckten Bergspitzen der Region und Wolfsgrau für die Regenwolken über der Stadt komplettierten den neuen Look. Nur das Logo war fortan und zum Unmut vieler Fans nicht mehr auf den Ärmeln der Spieler zu finden, sondern nur noch exklusiv auf den Helmen.
Bei dem Symbol, das die Seahawks auf ihren Helmen trugen, ließen sich die NFL-Designer 1975 von einer indigenen Kwakwaka’wakw-Transformationsmaske aus der Kultur des Nordwestens inspirieren. Zu der Zeit, als das Logo der neuen Franchise entstand, gehörten Stämme aus Alaska und dem nördlichen British Columbia mit ihrer Masken- und Totempfahlkunst zu den bekannteren im Pacific Northwest. Sie erfreuten sich in Seattle großer Popularität, doch der Grund dafür ist kontrovers.
Immer wieder fuhren Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Touristen und Goldsuchende auf Dampfschiffen die Küste gen Norden entlang und entdeckten auf dem Weg nach Nordkanada und Alaska die Totempfähle der Einheimischen. Dass bei solchen Expeditionen die Kunstwerke, Eigentum der Stämme, gestohlen wurden, beweist der Pfahl, der heute als Replik auf dem Pioneer Square in Seattles Zentrum steht.
Er war im Original bei einer Reise von Geschäftsleuten und Künstlern aus Seattle im September 1899 bei einem Zwischenstopp auf Tongass Island aus dem Eigentum des Tlingit-Volkes, dem Rabenstamm, entwendet worden. Ein führender Matrose der Schiffsreise sollte anschließend erzählen, dass die Einheimischen zum Zeitpunkt des Diebstahls alle beim Fischen gewesen seien. „Nur einer war in seinem Haus geblieben und sah zu Tode erschrocken aus“, so R. D. McGillvery, der weiter ausführte: „Wir suchten uns den schönsten Totempfahl aus.“ Mit mehreren Kollegen fällte er den Pfahl, zersägte ihn ob seiner Größe in zwei Teile und verlud ihn auf dem Schiff, wofür er von den Expeditionsmitgliedern 2,50 US-Dollar erhielt. Nach ihrer Rückkehr schenkten die Schiffsreisenden den gestohlenen Totempfahl der Stadt Seattle. Die aber kennzeichnete ihn nicht als Diebstahl, sondern schuf eine Heldengeschichte vom vor Zerstörung geretteten Kulturgut und machte den Pfahl zum Symbol für Seattle als „Gateway to Alaska“.
Noch immer steht er – nach Vandalismus im Jahr 1938 irreparabel zerstört und durch eine von Nachfahren der Tlingit geschnitzte Replik ersetzt – im Zentrum von Seattle, obwohl die einheimischen Stämme traditionell keine Totempfähle anfertigen.
Die Tlingit forderten nach dem Diebstahl aus ihrem Dorf rechtliche Konsequenzen und eine Entschädigung von 20.000 US-Dollar, erhielten am Ende aber nur deren 500. Ihre Vorwürfe wurden von einem Anwalt angefochten, der selbst bei der Expedition dabei gewesen war. Die Klage wurde schließlich von einem Richter abgewehrt, der Tage zuvor bei einem Besuch im Rainier Club, einem Gentlemen’s Club in Seattle, sehr gut unterhalten worden sein soll.
Trotz dieses historischen Makels sind die Pfähle zu einer im Tourismus der Stadt verwendeten Symbolik geworden, derer sich wohl auch die NFL bediente, als sie 1974 das Logo der Seahawks entwarf. General Manager John Thompson bestätigte bereits 1975 im Seattle Post-Intelligencer, dass die Design-Taskforce der NFL sich beim Entwurf auf einen Kunstband bezogen hatte, der die Kultur indigener Völker festhielt.
In Robert Bruce Inveraritys 1950 veröffentlichtem Buch mit dem Titel Art of the northwest coast indians findet sich die Maske, auf der das Seahawks-Logo basiert. In ihrer geschlossenen Form stellt sie einen Adler dar, geöffnet ein menschliches Gesicht. Verortet wird sie zwischen Alaska und Seattle, auf der Nordostseite von Vancouver Island in Kanada.
Angemessener wäre es gewesen, wenn die Liga sich von der Kunst der im Raum Seattle beheimateten Suquamish und Duwamish, zweier Stämme der Küsten-Salish, hätte inspirieren lassen. Deren Häuptling, Chief Sealth, ist Namensgeber von Seattle und ziert das Siegel der Stadt.
Nachdem Name, Farben und Logo geklärt waren, blieb die Frage: Was ist eigentlich ein Seahawk? Die deutsche Wikipedia-Seite definiert den Seahawk sinngemäß übersetzt als Fischadler (im Englischen: Osprey), der laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) hierzulande selten geworden und nur noch im Nordosten anzutreffen ist.
John Hinterberger, damals Kolumnist für die Seattle Times, begab sich am Tag nach der Bekanntgabe in einem amüsanten Text auf die Suche nach einer präzisen Antwort. Er studierte Enzyklopädien und Vogelführer für den nordamerikanischen Raum und kam zu dem Schluss, dass Seahawk ein Spitzname sein müsse für den Skua, eine Art Raubmöwe. Dieses Tier passte ganz gut zu einem American-Football-Team. Der Skua ist tollkühn, er attackiert Möwen und andere fischfressende Vögel in der Luft über dem Wasser, bis diese ihren Fang fallen lassen. Als guter Flieger schnappt er sich die fallen gelassene Beute seines Kontrahenten noch im Flug. Das klingt nach einem wahren Ballhawk, wie ihn Jahrzehnte später die Defensive der Seahawks in mehrfacher Ausführung hervorbringen würde. Bedenklich – und ebenfalls ein Vorbote ereignisreicher Zeiten: Skuas sind Einzelgänger, die nur Attacke im Kopf haben. Das geht so weit, dass sie ihre eigenen Eier und ihre Jungen fressen oder ihr Nest in der Nähe von anderen Vögeln bauen – und das gewiss nicht zur Kontaktpflege.
Das Nest ist ein gutes Stichwort: Die Seahawks bauten ihres im (fast) natürlichen Habitat des Skuas, am nordöstlichen Ufer des Lake Washington in Kirkland. Bei der Konstruktion auf einem Grundstück Ned Skinners verwendeten sie wie ihr Wappentier viel Holz. Mit seinen vertäfelten Außenwänden, schlichten Balkons und flachen Walmdächern sah Seattles Hauptquartier einer Kaserne zum Verwechseln ähnlich. Zu diesem Zeitpunkt ahnte aber wohl noch niemand, dass der erste Trainer der Seahawks sich nahtlos in diesen militärischen Stil einfügen würde.
ERSTE FLUGVERSUCHE
Mit dem Beginn des Premierenjahres 1976 verpflichteten die Seahawks ihren Head Coach – oder: Sie versuchten es zunächst erfolglos. Lloyd W. Nordstrom war großer Fan von Bill Walsh, einem smarten, 45-jährigen Assistenztrainer bei den Cincinnati Bengals. In Ohio arbeitete Walsh unter Paul Brown, dem Gründer, Namensgeber und Ex-Trainer der Cleveland Browns.
Der Seahawks-Besitzer wollte mit Walsh ein Vorstellungsgespräch führen und fragte deshalb Brown um dessen Erlaubnis, so schilderte Nordstroms Neffe John es viele Jahre später. Brown – nicht daran interessiert, seinen Schützling ziehen zu lassen – erzählte Nordstrom daraufhin von Walshs Alkoholproblemen und all dem Theater, das sie in Cincinnati mit ihrem betrunkenen Assistenztrainer hätten. Nordstrom kaufte dem Coach die Lügengeschichte ab, darum kam es nie zum Interview.
Cheftrainer der Seahawks wurde letztlich ein anderer. Am 3. Januar ernannte General Manager John Thompson den 42 Jahre jungen Jack Patera – zuvor Assistenztrainer für die Defensive Line bei den Minnesota Vikings – zum ersten Head Coach der Franchise und versprach, dass die Seahawks innerhalb der ersten vier Jahre in einem Super Bowl spielen würden.
Die Realität aber sah völlig anders aus, denn Patera hatte die schwierige Aufgabe, ein komplett neu zusammengestelltes Team konkurrenzfähig zu machen. Das gelang wenig überraschend nicht von heute auf morgen.
Als die Seahawks am 9. Juli ihr erstes Trainingslager auf dem Gelände der Eastern Washington University tief im Osten des US-Bundesstaates eröffneten, erlebte ihr Mehrheitseigner das nicht mehr. Lloyd W. Nordstrom war am 20. Januar, nur wenige Tage nach der Verpflichtung von Jack Patera, an einem Herzinfarkt verstorben. Bei einer Zusammenkunft der Ligabosse in Mexiko spielte er Tennis mit seinem Neffen Jim, fiel bei einem Aufschlag wie vom Blitz getroffen zu Boden – und stand nie wieder auf.
Nach Lloyds Tod übernahm der nicht sonderlich NFL-affine Bruder Elmer gemeinsam mit seinem Sohn John vonseiten der Nordstroms die Verantwortung über die Franchise. Sie erlebten gemeinsam mit den anderen Besitzern, wie ihr neuer Head Coach unverblümt an die Arbeit ging.
Patera war ein fülliger Disziplinfanatiker mit schroffer Art und weichem Kern. Ein Old-School-Trainer, der sein weißes Poloshirt gerne in die am Bund etwas zu enge Hose stopfte. Bei ordnungsverliebten Mentoren wie Bud Grant, Tom Landry und Don Shula schien das nicht wirklich überraschend – und immerhin verschaffte es ihm von vornherein einen gewissen Respekt bei Presse, Fans und Spielern. Vielleicht konnte man das Wort Respekt auch mit Angst ersetzen, zumindest ein bisschen.
Die Spieler schätzten Patera trotz seiner toughen Art für die direkte Ansprache und seinen Beschützerinstinkt. Sie wussten bei ihm stets, woran sie waren, auch wenn sie mit seinen Trainingskonzepten – Trinkpausen waren verpönt – nicht immer zurechtkamen. Sie respektierten ihn für die kleinen Gesten, wenn er die Umkleidekabine zur reinen Spielerzone ohne Pressevertreter und Trainer erklärte oder im Flugzeug die First Class für die Spieler freiräumte. Sie mochten seinen überraschenden Humor, wenn aus dem mürrischen Blick ein freches Lächeln wurde.
Jack Patera
Pateras oberstes Ziel war stets, aus seinen Spielern eine Einheit zu machen. Wie ihm das gelang, schien ihm nicht besonders wichtig zu sein: Als Feindbild taugte die gegnerische Mannschaft ebenso gut wie er selbst als Trainer. „Wir tolerieren euch, bis wir euch ersetzen können“, verkündete er 1976 vor dem ersten Trainingslager, so wie es ihm einst selbst als Spieler bei den Baltimore Colts eingetrichtert worden war. Das war eine ungeschönte Ansage, die aber eben der Realität in der NFL entsprach.
Mit Härte und Disziplin wollte Patera seine Spieler an die Liga gewöhnen. Das bedeutete beispielsweise, dass die Athleten auf Reisen mit dem Team zu jeder Zeit eine Krawatte tragen mussten. Im Flugzeug, im Bus, in der Hotellobby – überall. Auswärtsreisen waren für ihn Geschäftsreisen. Die Spieler nahmen dies zum Anlass, ihn vor dem letzten Spiel der Premierensaison alle mit umgebundenen Krawatten auf dem Trainingsplatz zu empfangen. Patera fand das lustig – bis er herausfand, dass der Equipmentmanager die Bälle fürs Training im Hotel vergessen hatte.
Für den Zeugwart war es die letzte Reise mit dem Team. Ähnlich erging es unter dem Patera-Regime einem Spieler, der sich weigerte, seinen Bart zu rasieren. Der Trainer feuerte ihn.
Wer sich den Vorgaben nicht unterordnete, musste gehen. Wer mitzog, der trank möglichst vor dem Training drei Eimer Wasser, denn für eine Trinkpause war während der intensiven, von Militärdrills geprägten Patera-Einheiten keine Zeit. Ging es nach dem Trainer, dann musste das Training kurz sein. Seine Philosophie: Wer zu lange auf dem Platz steht, trainiert seine Fehler.
Reporter fürchteten Pateras Unmut, wenn er auf kritische Nachfragen zur Leistung seines Teams und zur Strategie mit hochrotem Kopf und knapp antwortete – oder gar von einer Niederlage schlecht gelaunt die Worte: „Irgendwelche Fragen?“, grummelte und nach sieben Sekunden die Pressekonferenz beendete, weil die versammelten eingeschüchterten Journalisten nicht schnell genug reagierten.
Patera bekam in den Medien durchaus Kritik ab für seine Methoden. Deshalb ließ er es sich nicht nehmen, bei den Presserunden unter der Woche die schreibende Zunft in den Wahnsinn zu treiben. Wenn er vom Trainingsplatz zurückkehrte, ging er zunächst in sein Büro und wartete bis nach der Deadline für den Andruck der Zeitungen. Erst dann trat er vor die Reporter.
Fans feierten Patera für seine Risikofreude. Mit einer Vielzahl an Trickspielzügen versuchte er, spielerisches Unvermögen zu kaschieren und Gegner zu überraschen. „Um mehr Spiele zu gewinnen, mussten wir zocken“, sagte er einmal. Er hätte Teams gerne mit Physis und sauberer Ausführung geschlagen, doch seiner Mannschaft habe dazu schlicht das Talent gefehlt.
Patera war mit seinem Hang zu Zucht und Ordnung wohl der ideale Coach für die Rumpftruppe, die er sich gemeinsam mit General Manager John Thomson in 39 Runden Expansion Draft mühsam zusammengebastelt hatte. Mit den Tampa Bay Buccaneers im Wechsel durften die Seahawks sich Ende März 1976 am Spielerpersonal der 26 anderen Teams bedienen.
Ergänzend zu den Veteranen selektierten Seattles Verantwortliche im regulären NFL Draft, der Auswahl von Nachwuchstalenten, abwechselnd mit den restlichen 27 Teams später 25 Rookies, darunter Defensive Tackle Steve Niehaus als zweiten Pick überhaupt und wenig später den damaligen Wide Receiver und die heutige Radiostimme der Seahawks, Steve Raible. Der erste Quarterback der Seahawks, Jim Zorn, kam als Free Agent nach Seattle, Wide Receiver Steve Largent per Trade für einen Acht-Runden-Pick von den Houston Oilers. Besonders Largent, ein schmächtiger, nicht besonders schneller Passempfänger, sollte sich schnell als Glücksgriff herausstellen.
Die ersten Jahre Seattles in der NFL sind schnell erzählt. „Wir werden das erste Expansionsteam sein, das die Saison mit zwölf Siegen und zwei Niederlagen beendet“, hatte Jack Patera vor dem Trainingslager 1976 zu seinen Schützlingen gesagt.
Am Ende stand die Bilanz exakt umgekehrt in der Tabelle. Die Seahawks gewannen nicht oft, aber das schien die von der puren Existenz ihres Teams euphorisierten Fans nicht besonders zu stören. Sie kamen in Scharen und feierten jeden Spieltag, als ob ihr Team gerade die Play-offs erreicht hätte.
Den allerersten Sieg überhaupt feierten die Seahawks ausgerechnet im sogenannten Expansion Bowl am 17. Oktober gegen die Buccaneers in der erbarmungslosen Hitze Floridas. In die NFL-Geschichtsbücher ging der wenig ansehnliche 13:10-Erfolg auch unter anderen Spitznamen ein: „Hanky Bowl“ lautete einer, wegen der 39 von Schiedsrichtern festgestellten Strafen, für die eine gelbe Flagge flog. „Comedy of Errors“ schrieb die New York Times über das Aufeinandertreffen der bis dato sieglos durch die Saison getaumelten Teams.
Die Seahawks verdankten es einem von Mike Curtis geblockten Field Goal 42 Sekunden vor Schluss, dass sie das Duell der zwei neuen NFL-Teams für sich entschieden. Auf den Auswärtssieg in Tampa Bay folgte am 7. November beim 30:13 gegen die Atlanta Falcons der erste Heimerfolg der Seahawks-Geschichte. Das faszinierende Zusammenspiel von Quarterback Zorn und Receiver Largent tröstete über ein Dutzend Niederlagen in der Premierensaison hinweg.
Vor ihrer zweiten Spielzeit wechselten die Seahawks aus ihrer Division, der NFC West, in die AFC West, so wie es von der NFL von vornherein geplant gewesen war. Die Liga wollte damit sicherstellen, dass sowohl Tampa Bay als auch Seattle in den ersten zwei Jahren mindestens einmal gegen alle anderen Teams spielten und trotz unterschiedlicher Ligeneinteilung zweimal direkt aufeinandertrafen.
Die Neuauflage des Expansion Bowls am fünften Spieltag der Saison 1977 endete erneut mit einem Erfolg der Seahawks (30:23). Vier weitere Siege und fünf Niederlagen später hatte Seattle mit einer 5-9-Bilanz den Rekord für die bis dato meisten Siege einer Franchise in ihrem zweiten Jahr aufgestellt.
„Auch 1977 freuten sich die Fans über unser Expansionsteam, weil wir vielversprechend spielten“, erinnerte sich Running Back Sherman Smith später: „Die Menschen erkannten, dass wir da etwas am Laufen hatten.“
Ja, es lief in Seattle, vielleicht sogar schon etwas zu gut für ein noch so junges Team. Der Trend setzte sich 1978 fort: Die Seahawks erzielten erstmals eine positive Bilanz (9-7), Patera wurde zum Trainer des Jahres gewählt und die Zorn-Largent-Kombination war kaum mehr zu stoppen.
Langsam jedoch verflog die Euphorie der Anfangsjahre. In einer weiteren 9-7-Saison wechselten sich grandiose Comebacksiege wie das 31:28 gegen die Falcons und enttäuschende Pleiten wie das 0:24 zu Hause gegen die Los Angeles Rams mit unterm Strich demoralisierenden sieben Yards Raumverlust für die Offensive ab. Die Entwicklung des Teams stagnierte.
Diese wöchentlichen Schwankungen setzten sich auch Anfang der 1980er-Jahre fort. Auf eine 4-12-Saison mit zum Schluss neun Niederlagen in Serie folgte eine nur marginal bessere Runde inklusive desolater 0:32-Heimpleite gegen die New York Giants, von der den Spielern neben dem Ergebnis wohl nur die knappe Kabinenansprache nach Ende der Partie in Erinnerung bleibt. „Herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt das schlechteste Team in der National Football League. Wir sehen uns morgen“, sagte ein verbitterter Jack Patera und beorderte das Team tags darauf zum Straftraining.
Nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Partien gewannen die Seahawks immerhin noch fünf Partien. Doch die halbwegs versöhnliche 6-10-Bilanz, das wusste Patera, änderte nichts daran, dass er mit dem Rücken zur Wand stand.
Nach einem 0-2-Start in die Spielzeit 1982 zogen die Besitzer die Notbremse. Der Spielerstreik für eine fairere Aufteilung der NFL-Einnahmen kam ihnen genau zur rechten Zeit.
Patera, das schrieben Steve Raible und Reporter Mike Sando in ihrem Buch Tales from the Seattle Seahawks sideline, war gerade zum Angeln auf der olympischen Halbinsel, tief im Wald, als er einen Notizzettel an der Windschutzscheibe seines Autos fand, er solle sofort in der Lake Quinault Lodge, einer Unterkunft in der Nähe, anrufen.
Der Dialog, den Patera dann per Telefon mit der zierlichen alten Dame an der Rezeption führte, ist im Originalton zu schön, um ihn zu übersetzen. “Dammit, Jack, those bastards fired you!“ – “What?“ – “Yeah, you got a message down here to call (general manager) John Thompson. They fired you and John.“ – “Well, I’ll be damned.“





























