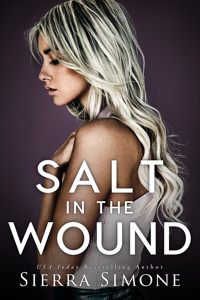6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sieben Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Neu Camelot Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die erotische Neu-Camelot-Trilogie der USA TODAY-Bestsellerautorin Sierra Simone endlich auf Deutsch. Eine BDSM-Romance, Ménage-à-trois-Saga in drei Teilen. Band 1 – Greer Es begann mit einem Kuss an meinem sechzehnten Geburtstag und resultiert Jahre später in einer Hochzeit. Es begann damit, dass der Präsident seinen besten Freund geschickt hat, um mich zu ihm zu bringen, und endet damit, dass mein Herz für zwei Männer schlägt. Es begann mit fast vergessenen Geheimnissen, gefährlichen Sehnsüchten und es endet damit, dass wir alle drei in einer Liebe miteinander verbunden sind, die schärfer schneidet, als zerbrochenes Glas. Mein Name ist Greer Galloway und ich liebe die beiden mächtigsten Männer der Welt. Dies ist meine Geschichte. Die Geschichte einer American Queen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Ähnliche
American Queen
Neu Camelot Trilogie 1
Sierra Simone
© 2019 Sieben Verlag, 64823 Groß-Umstadt© Umschlaggestaltung Andrea GunscheraAus dem Englischen übersetzt von Corinna BürknerOriginalausgabe © Sierra Simone 2016
ISBN Taschenbuch: 9783864438455ISBN eBook-mobi: 9783864438462ISBN eBook-epub: 9783864438479
www.sieben-verlag.de
Inhalt
Prolog Der Hochzeitstag
Teil 1 Die Prinzessin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil II Die Königin
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Die Autorin
Prolog
Der Hochzeitstag
Liebe ist langmütig,
die Liebe ist gütig.
Sie ereifert sich nicht,
sie prahlt nicht,
sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig,
sucht nicht ihren Vorteil,
lässt sich nicht zum Zorn reizen,
trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht,
sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles,
glaubt alles,
hofft alles,
hält allem stand.
Hält allem stand. Mein Blick hängt an dieser letzten Zeile des Bibelverses fest, während meine Cousine Abilene und ihre Mutter immer noch an meinem Schleier herumzupfen. Der gesamte Vers des 1. Korintherbriefs ist auf einen Marmorklotz gemeißelt, der sich in der inneren Vorhalle der Kathedrale befindet. Jede andere Braut, die davorstand, hatte diese Worte vielleicht als tröstend oder gar aufmunternd empfunden. Vielleicht bin ich die einzige Braut, die jemals vor diesen massiven Türen zum inneren Heiligtum stand, und sich fragt, ob Gott sie vielleicht zu warnen versucht.
Doch als ich daran denke, was mich am Ende des Gangs zum Altar erwartet, wer mich dort erwartet, straffe ich meine Schultern und schaue blinzelnd woandershin. Vom ersten Moment an, in dem ich Ash getroffen hatte, war mir klar gewesen, dass ich dafür bestimmt war, ihn zu lieben. Ich wusste, dass es mir bestimmt war, ihm zu gehören. Es gibt keinen Ort, an den ich ihm nicht folgen würde. Kein Opfer, das ich nicht bringen würde, wenn er es von mir verlangte. Es gibt nichts, was ich ihm nicht komplett und aus freien Stücken geben würde.
Ich werde seine Liebe in mir tragen, daran glauben, darum hoffen, bis zu dem Tag, an dem ich sterben werde. Auch wenn es mich meiner Seele beraubt.
Und es wird mich meiner Seele berauben.
Mein einziger Trost ist, dass ich es nicht allein durchmache.
Ich hole tief Luft und trete vor die Türen, die sich gerade öffnen. Die Klänge von Pachelbels Kanon in D-Dur schweben durch das Kirchenschiff. Mein Großvater nimmt meinen Arm und führt mich Richtung Altar. Die Gäste haben sich erhoben, die Kerzen flackern, mein Schleier sitzt perfekt.
Und dann sehe ich Ash.
Mein Pulsschlag stolpert kurz, wird schneller, überschlägt sich dann selbst, wobei er zu meinen Lippen, meinem Gesicht und in mein Herz rast. Ash sieht aus, als wäre er dafür geboren, einen Smoking zu tragen. Seine breiten Schultern und die schmalen Hüften füllen den maßgeschneiderten Anzug perfekt aus. Selbst wenn er nicht auf der oberen Stufe zum Altar stünde, würde es immer noch so aussehen, als wäre er größer als alle anderen. Einfach nur, weil er Ash ist. Er muss Macht und Stärke nicht aussenden, denn er ist manifestierte Macht und Stärke. Wir sehen uns an und ab diesem Moment ist all diese Macht und Stärke gebündelt und auf mich gerichtet. Sogar über die Distanz des Kirchenschiffs hinweg beginnen wir, im Gleichtakt zu atmen.
Es scheint, als durchführe ihn ein Schock, als er mich komplett sieht. Das Kleid, den Schleier, mein zittriges Lächeln. Freude durchströmt dabei meine Brust. Es war sein Wunsch, dass wir uns erst zur Zeremonie sehen. Er wollte diesen Moment. Und ich muss zugeben, die Art, wie sein schönes Gesicht darum kämpft, die Emotionen in den Griff zu kriegen, und wie mein eigenes Blut sich erwärmt bei seinem Anblick, zeigt mir, dass es sich gelohnt hat. Egal wie überholt diese Tradition ist, egal wie umständlich es für die Gäste ist, egal wie endlos sich die Stunden ohne ihn heute Morgen angefühlt haben, es war es wert gewesen.
Dann, während mein Großvater mich näher und näher bringt, sehe ich ihn.
Direkt neben Ash stehend. Sandbraunes Haare, schlank, mit eisblauen Augen und einem Mund, geschaffen für Sünde und Entschuldigungen. Manchmal in dieser Reihenfolge. Embry Moore. Ashs bester Freund. Sein Trauzeuge, sein Vizepräsident.
Denn natürlich trete ich nicht einfach so vor den Altar, um den Mann zu heiraten, in den ich verliebt bin, seit ich sechzehn war. Ich trete vor den Altar, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu heiraten.
Die Hunderte von Gästen verschwinden, die riesigen Blumengestecke und Kerzen lösen sich auf. Und für einen kleinen Moment sind wir nur die Braut, der Bräutigam und sein Trauzeuge. Nur ich, Ash und Embry. Keine Präsidentschaft, oder Vizepräsidentschaft, oder ein frisch gestrichenes Büro für die First Lady, das nach den Flitterwochen auf mich wartet. Keine Horden von Kameras in der Kathedrale, oder davor, und die Sitzplätze sind nicht besetzt mit Botschaftern, Senatoren und Prominenz.
Nur wir drei. Ash, ernst und mächtig. Embry, gequält und blass. Und ich. Mit Bissspuren und Knutschflecken an den Innenseiten meiner Oberschenkel, und einem hämmernden Herz.
Kurz bevor ich am Altar zum Stehen komme, sehe ich, dass der Trauzeuge ebenfalls einen Fleck trägt. Er schaut am Hals oben aus dem Kragen seines Smokings heraus. Groß, rot und ganz frisch.
Kurz bevor ich am Altar zum Stehen komme, sehe ich auch, dass das schmale weiße Viereck in Ashs Jacketttasche kein seidenes Einstecktaschentuch ist, sondern zweifelsfrei die Spitze meines Unterhöschens. Niemand, der meine Unterwäsche nicht kennt, würde das ahnen. Doch er trägt es so unverhohlen zur Schau, als wäre es eine Trophäe. Als ich das Höschen das letzte Mal gesehen habe, befand es sich in Embrys kräftiger Faust …
Mein Großvater hebt den Schleier an und küsst mich auf die Wange, bevor er ihn wieder über mein Gesicht fallen lässt. Ash reicht mir die Hand. Ich lasse meine Finger in seine Hand gleiten. Gemeinsam treten wir vor den Priester. Als wir an der richtigen Stelle zum Stehen kommen, kümmert sich eine meiner Brautjungfern darum, dass mein Kleid glattgestrichen ist.
Erst als Ash meine Hand loslässt, um unter meinen Schleier zu fassen und mit dem Daumen über meine Wange zu streicheln, merke ich, dass ich weine. Er hebt den Daumen an seine Lippen und leckt sich meine Tränen von der Haut. Seine dunklen grünen Augen glimmen mit einem Versprechen. Und hinter ihm fasst sich Embry unbewusst an den Fleck an seinem Hals, von dem ich mir sicher bin, dass Ash ihn dort hinterlassen hat.
Ich bekomme eine Gänsehaut.
Der Priester beginnt und die Gäste setzen sich. Ich frage mich ein letztes Mal, ob Gott möchte, dass ich das hier aufhalte. Ob er es kaum erträgt, auf uns drei herunterzublicken. Ob Gott mich vorhin nicht warnen wollte, denn was glaubte ich eigentlich, was ich erdulden konnte? Was glaubte ich wirklich, waren die zwei mächtigsten Männer der Welt bereit, von mir zu erdulden?
Doch als ich Ashs noch immer unmissverständlich heiße Blicke sehe und bemerke, wie Embry immer noch an der roten Stelle an seinem Hals herumfingert, entscheide ich, dass dieses Märchen hier nicht anders hätte enden können.
Was ich damit sagen will, ist, Gott kann mich so oft warnen, wie er will. Doch das bedeutet nicht, dass ich auf ihn hören muss.
Teil 1Die Prinzessin
Kapitel 1
Achtzehn Jahre zuvor
Als ich sieben Jahre alt war, hat mich ein Zauberer verflucht. Es war auf einem Wohltätigkeitsball, glaube ich. Bis auf den Zauberer unterschied sich dieses Event nicht wesentlich von den anderen, zu denen mich mein Großvater mitnahm. Abendkleider und Smokings, Kronleuchter, die in opulenten Hotel-Ballsälen glitzerten, während in unauffälligen Ecken Streichquartette musizierten. Angeblich sammelte man mit diesen Events Geld für verschiedene Einrichtungen und Zwecke, die von den Reichen und Gelangweilten vertreten wurden. Doch in Wirklichkeit waren es Geschäftsmeetings. Politische Allianzen für diese oder jene Kandidatur wurden geschlossen, für potenzielle Spenden wurde geworben. Hier wurden die ersten Verbindungen für Geschäftsbeziehungen geknüpft, und Hochzeiten innerhalb der oberen Zehntausend abgesprochen. Denn was waren Hochzeiten anderes als lebenslange Business-Deals unter Reichen?
Ein paar Dinge hatte ich schon als kleines Mädchen durchschaut, aber sie haben mich nie belastet. So war das Leben eben. Zumindest das von Opa Leo. Und es fiel mir nie ein, es infrage zu stellen.
Darüber hinaus mochte ich es, die schönen teuren Kleider zu tragen, die Opa Leo mir kaufte. Ich mochte es, dass Erwachsene mich nach meiner Meinung fragten. Ich genoss den Anblick all dieser wunderschönen Frauen und gut aussehenden Männern. Am meisten aber genoss ich es, mit Opa Leo zu tanzen, der mich immer auf seine Schuhe stellte und es nie vergaß, mich rundherum zu drehen, sodass ich mich fühlen konnte wie eine Prinzessin in einem Märchen.
Später am Abend, nachdem uns das große schwarze Auto abgeholt hatte, um uns zurück in das Penthouse in Manhattan zu bringen, ließ er mich fröhlich schnattern, über all das, was ich gesehen und gehört hatte. Er fragte mich, wer was gesagt habe und wie es betont war. Ob die Leute dabei glücklich oder böse ausgehen hatten. Er fragte mich, wer müde ausgesehen habe, oder abgelenkt, und wer sich etwas in den Bart gemurmelt habe während der Ansprachen. Viel später wurde mir klar, dass mein Opa sich auf mich als eine Art Spionin verlassen hatte. Eine Art Beobachterin, denn die Menschen benehmen sich in Gegenwart von Kindern anders als unter Erwachsenen. Sie passen nicht so auf. Sie sprechen leise mit ihren Freunden, wägen sich dabei in der Sicherheit, dass das Kind davon sowieso nichts mitbekommt.
Aber ich bekam es mit. Ich war von Natur aus aufmerksam, neugierig und bereit, in kleine Anmerkungen und Gesten tief hineinzulesen. An der Seite von Opa Leo verbrachte ich Jahre damit, diese natürliche Waffe zu schärfen und in etwas Brauchbares zu verwandeln. Etwas, was er für die Partei benutzte, das ich aber für ihn anwendete, weil ich ihm helfen wollte. Ich wollte, dass er stolz auf mich war, und wollte es auch, weil etwas süchtig Machendes darin lag. Es machte süchtig, die Menschen zu beobachten, zu entschlüsseln, wie sie tickten, sie zu lesen wie ein Buch, bei dem man vor dem Ende den Plot-Twist schon herausgefunden hatte.
Aber an dem Abend, als ich den Zauberer traf, war das alles noch Zukunftsmusik. Im Moment war mir schwindelig und ich war überdreht vom im Kreis drehen sowie dem heimlichen Stibitzen von mehr als einem Teller Dessert bei der mir zuzwinkernden Kellnerin. Ich drehte mich noch immer im Kreis, als mein Großvater mich zu sich in die Nähe der Türen des Ballsaals winkte. Ich hopste hinüber und erwartete einen seiner üblichen Freunde. Die politischen Strippenzieher von Washington, oder die schnippischen und gelangweilten Geschäftsleute.
Es war jemand anderes. Etwas anderes. Ein großer Mann, etwa Mitte zwanzig, aber mit den dunklen Augen einer Krähe und einem dünnlippigen Mund, der mich an die Illustrationen von bösen Zauberern in meinen Märchenbüchern erinnerte. Allerdings hing er nicht wie die bösen Zauberer gebeugt über einem Gehstock, oder trug einen langen Mantel. Er hatte einen Smoking an, sein Gesicht war glattrasiert, das Haar kurzgeschnitten und perfekt gekämmt.
Mein Opa strahlte mich an und stellte uns einander vor.
„Mr. Merlin Rhys, ich möchte, dass sie meine Enkeltochter Greer kennenlernen. Greer, dieser junge Mann hier zieht von England hierher und wird ein Berater für die Partei.“
Die Partei. Schon als ich sieben war, hatte die Partei Einfluss auf mein Leben, wie auf das aller anderen auch. Ich vermute mal, dass das eben passiert, wenn dein Opa ein ehemaliger Vizepräsident ist. Insbesondere wenn dieser ehemalige Vizepräsident dem verstorbenen Penley Luther im Weißen Haus gedient hatte, dem toten und verehrten Halbgott der Partei. Es war Präsident Luther, auf den sich in allen Reden und Kommentaren bezogen wurde. Es war Luthers Name, der beschworen wurde, wann immer sich eine Krise auftat. Was würde Luther tun? Was würde er nur tun?
Mr. Merlin Rhys sah auf mich herunter. Im goldenen Schimmer des Ballsaals waren seine schwarzen Augen unlesbar.
„Ich würde meinen, das hier ist ein wenig langweilig für ein Mädchen in deinem Alter“, sagte er sanft und doch wieder nicht so sanft. Es lag eine Herausforderung in seinen Worten, versteckt irgendwo zwischen den sauber gefalteten Konsonanten und den luftigen Vokalen. Aber ich konnte es nicht herauspuzzeln, konnte es nicht aus seinen Worten heraussieben. Ich schaute ihm weiter ins Gesicht, während mein Großvater wieder sprach.
„Sie ist meine Begleitung“, sagte Opa Leo liebevoll und verwuschelte mir das Haar. „Mein Sohn und meine Schwiegertochter befinden sich auf humanitärer Mission im Ausland. Sie ist für ein paar Monate bei mir. Sie ist sehr artig. Stimmt’s, Greer?“
„Ja, Opa“, sagte ich folgsam. Doch als ich sah, wie Merlin die Stirn runzelte, überkam mich etwas Kaltes. Als ob sich ein kalter Nebel um mich gelegt hätte, nur um mich, und langsam entzog er mir alle Wärme.
Ich sah auf meine Fußspitzen hinunter, bekam eine Gänsehaut und versuchte, es mir nicht anmerken zu lassen. Auf dem glänzenden Leder spiegelte sich das Schimmern und Glitzern der vergoldeten Decke. Ich betrachtete diesen Schimmer, versuchte, mir auf das alles einen Reim zu machen, während Merlin und mein Großvater Strategien für die Zwischenwahlen besprachen.
Ich fühlte Angst. Dieselbe sich heranschleichende Angst, die mir im Nacken kribbelte, wenn ich nachts aufwachte und sah, dass meine Schranktür offen stand. Dennoch war mir bewusst, dass ich in Sicherheit war. Dass Opa Leo auf mich aufpasste, dass dieser Fremde mir nicht in einem Raum voll mit Menschen wehtun konnte. Nur fürchtete ich mich nicht zwangsläufig davor, dass er mich verletzen oder entführen könnte. Nein, es war die Art, wie sein Blick sich in meinen bohrte, das machte mir Angst. Es fühlte sich so an, als kenne er mich, verstünde mich und könne in mich hineinblicken, auf all die Momente, in denen ich auf dem Spielplatz gelogen oder gemogelt hatte. Dass er all die Nächte sehen konnte, in denen ich nicht geschlafen hatte, weil meine Schranktür offen stand und ich mich nicht getraut hatte aufzustehen, um sie zu schließen. All die Morgen, an denen ich mit meinem Vater hinter dem Haus in den Wäldern Spaziergänge unternommen hatte. Die Abende, an denen mir meine Mutter geduldig Tai Chi beibrachte. All meine Märchenbücher, die ich so liebte, all meine Schätze, die ich zusammengetragen hatte in der kleinen Schatzkiste unter meinem Bett. Alle meine albernen kleine Mädchenträume und Ängste. Einfach alles. Dieser Mann konnte das alles sehen.
Und gesehen, also wirklich gesehen zu werden, war das Furchterregendste, was ich je empfunden hatte.
„Leo“, rief ein Mann von weiter hinten im Raum. Er war auch ein Parteimitglied. Mein Opa wuschelte mir noch einmal durch die Haare und zeigte dem Mann an, dass er zu ihm kommen würde. „Einen Moment, Mr. Rhys.“
Merlin neigte ernst den Kopf und mein Großvater ging zu dem anderen Mann. Ich brachte mich dazu, ihm noch einmal in die Augen zu schauen, und wünschte mir sofort, dass ich es nicht getan hätte. Seinen Blick, so erkannte ich jetzt, hatte er bedeckt gehalten, während er mit Opa Leo sprach. Jetzt war sein Blick nicht mehr bedeckt, jetzt brannte er und er fühlte sich sehr nach Ablehnung an.
„Greer Galloway“, sagte er in diesem sanften, nicht-sanften Tonfall. Ein Dialekt, der nach Walisisch klang, schwang in seinen Worten, als ob er weder seine Stimme noch seinen Blick mehr im Griff hätte.
Ich schluckte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war ein Kind und mein mädchenhaftes Verhalten hatte bisher noch alle Freunde von Opa Leo bezaubert. Doch hier spürte ich, dass es mir nichts nutzen würde. Ich konnte mich bei Merlin Rhys nicht beliebt machen. Nicht mit Lächeln oder Grübchen oder kindlichen Fragen.
Dann ging er vor mir in die Knie. Es war selten in der Welt von Opa Leo, dass Erwachsene das machten. Sogar die Frauen, die selbst Kinder hatten, zogen es vor, über mir zu stehen und meine blonden Löckchen zu streicheln, als wäre ich ein Haustier. Merlin jedoch ging in die Hocke, sodass ich ihm in die Augen sehen konnte, ohne mir das Genick zu verrenken. Und mir wurde, trotz meiner Furcht, klar, dass dies ein Zeichen des Respekts war. Merlin behandelte mich, als wäre ich es wert, seine Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Auch wenn diese Aufmerksamkeit mit Missfallen durchzogen war, war ich dankbar dafür. Auf meine eigene kindliche Weise.
Er nahm mein Kinn zwischen seine langen, schlanken Finger und hielt mein Gesicht fest, um es sich genau zu betrachten. „Nicht ehrgeizig“, sagte er und der Blick seiner dunklen Augen suchte etwas in meinem Gesicht. „Allerdings oft leichtsinnig. Nicht kalt, aber manchmal distanziert. Leidenschaftlich. Intelligent. Verträumt und … viel zu leicht verletzbar.“ Er schüttelte den Kopf. „Es ist genau so, wie ich es mir gedacht habe.“
Ich wusste aus dem Stapel Bücher neben meinem Bett, dass die Worte eines Zauberers gefährlich waren. Mir war klar, dass ich nichts sagen sollte. Ich sollte ihm nichts versprechen, ihm nicht zustimmen, nichts ihm gegenüber einräumen, oder lügen oder ausweichen. Aber ich konnte nicht anders.
„Was haben Sie sich gedacht?“
Merlin nahm die Hand herunter. Ein Ausdruck von aufrichtigem Bedauern zog sich über sein Gesicht. „Du kannst es nicht sein. Es tut mir leid, aber das geht einfach nicht.“
Verwirrung schlich sich an der Furcht vorbei. „Was kann ich nicht sein?“
Merlin stellte sich aufrecht hin, strich seinen Smoking glatt und man sah ihm seine Entschlossenheit an. Über was auch immer. „Behalte deine Küsse für dich, wenn es so weit ist.“
Ich verstand gar nichts. „Ich küsse niemanden. Außer Opa Leo, meine Mama und meinen Papa.“
„Das ist im Moment noch deine Welt. Aber wenn du älter bist, wirst du diese Welt hier erben“, sagte Merlin und machte eine Geste, die den ganzen Raum umfasste. „Die Welt, die dein Großvater geholfen hat, zu erschaffen. Und diese Welt hängt an einem seidenen Faden, im Gleichgewicht mit Vertrauen und Macht. Einflussreiche Menschen müssen sich entscheiden, wann sie sich vertrauen oder wann sie sich bekriegen. Diese Art von Entscheidungen wird nicht immer vom Verstand getroffen. Man trifft sie mit dem Herzen. Verstehst du das?“
„Ich denke schon …“, sagte ich langsam.
„Greer. Ein Kuss von dir wird diese Welt von Freundschaft in Zorn verwandeln. Von Frieden zu Krieg. Er wird all das, was dein Großvater in harter Arbeit aufgebaut hat, zerstören. Viele, viele Menschen werden zu Schaden kommen. Das willst du doch nicht, oder? Dass dein Großvater verletzt werden könnte? Dass alles, was er geleistet hat, plötzlich umsonst war?“
Ich schüttelte vehement meinen Kopf.
„Dachte ich mir. Denn genau das wird passieren, wenn deine Lippen andere berühren. Denk an meine Worte.“
Ich nickte, denn das war eine Logik, mit der ich etwas anfangen konnte. Küsse waren magisch, jeder wusste das. Sie konnten Frösche in Prinzen verwandeln, sie erweckten Prinzessinnen aus einem tödlichen Schlaf und sie entschieden über das Schicksal von Königreichen und Imperien. Nicht eine Sekunde lang dachte ich daran, dass Merlin falschliegen könnte. Dass ein Kuss vielleicht auch harmlos sein könnte.
Oder dass ein Kuss all den Schaden, den er mit sich brachte, vielleicht absolut wert wäre.
Das Bedauern in seinen Augen ging in Traurigkeit über. „Und das mit deinen Eltern tut mir sehr leid“, sagte er sanft. „Trotz allem bist du ein sehr liebes Mädchen. Du hast alles Glück der Erde verdient. Und vielleicht, eines Tages, wirst du verstehen, was ich versuche, dir zu geben. Halte dich ganz fest an den Dingen, die dich glücklich machen. Und zweifle niemals an, dass du geliebt wirst.“ Er nickte meinem Großvater zu, der gerade wieder zu uns zurückkam.
„Ihnen muss wegen meiner Eltern nichts leidtun“, sagte ich verwirrt. „Es geht ihnen gut.“
Merlin antwortete nicht, aber er berührte mich an der Schulter. Nicht, um mich in eine Umarmung zu ziehen, nicht, um mich zu tätscheln, einfach nur, um mich zu berühren. Einen Moment lang spürte ich den Druck seiner Hand, nur um dann ein Gefühl von Luft auf meiner Haut zu fühlen, während Sorge in meine kleinen Knochen floss.
Opa Leo nahm mich in seine Arme, als er bei uns ankam, und pflanzte einen dicken, schnurrbärtigen Kuss auf meine Wange. „Ist meine Enkelin nicht etwas ganz Besonderes, Merlin?“, fragte er und lächelte mich an. „Über was habt ihr gesprochen?“
Ich öffnete meinen Mund, um zu antworten, doch Merlin schob sich glatt dazwischen. „Sie hat mir erzählt, wie wunderbar es ist, bei Ihnen zu sein.“
Großvater sah erfreut aus. „Ja. Ich liebe Oregon ja so sehr wie jeder andere auch, aber es geht doch nichts über New York City, nicht wahr, Greer?“
Ich muss wohl etwas geantwortet haben. Die Unterhaltung muss danach wohl weitergegangen sein. Es müssen mehr Worte gefallen sein über Politik, Geld und Demografien. Aber in meinem Kopf hörte ich nur Merlins Worte von eben.
Das mit deinen Eltern tut mir sehr leid.
Mit meiner wilden Fantasie war es leicht, das Schlimmste heraufzubeschwören. Es war, wie es in Geschichten immer passierte. Tragödien, Omen und Schmerz. Was, wenn meine Eltern nicht mehr am Leben waren? Was, wenn ihr Flugzeug abgestürzt, ihr Hotel abgebrannt war, sie verprügelt und ausgeraubt und zum Sterben zurückgelassen worden waren?
Das mit deinen Eltern tut mir sehr leid.
Ich konnte an nichts anderes mehr denken, hörte nichts anderes mehr.
Als Opa Leo mich an diesem Abend im Bett zudeckte, fing ich an, zu weinen.
„Was ist denn los, meine Süße?“, fragte er und seine buschigen Augenbrauen zogen sich sorgenvoll zusammen.
Mir war klar, dass er mir nicht glauben würde, dass Merlin ein Zauberer war. Vielleicht ein böser Zauberer. Oder dass er irgendwie den Tod meiner Eltern erspüren konnte, bevor er eintrat. Mir war klar, dass ich lügen musste und sagte nur: „Ich vermisse Mama und Papa.“
„Oh, meine Süße“, sagte Opa Leo. „Wir rufen sie jetzt gleich mal an, okay?“
Er zog sein Telefon hervor und wählte. Nach ein paar Sekunden hörte ich Mamas helle und Papas dunkle Stimme durch den Lautsprecher. Sie waren in Bukarest, und machten sich bereit, in einen Zug Richtung Warschau zu steigen. Sie waren glücklich und in Sicherheit und randvoll mit Versprechungen für die Zeit nach ihrer Rückkehr. Eine kleine Weile lang glaubte ich ihnen. Ich glaubte daran, dass sie wieder heimkamen. Dass mein Vater und ich wieder lange durch den Wald wandern würden und dass ich abends mehr Tai Chi von meiner Mutter lernen würde. Dass es weiterhin Abende gab, an denen ich einschlief, während sie mir Gedichte vorlasen und das Feuer im Kamin knisterte. Dass der warme Sonnenschein und die baumgrünen Tage meiner Kindheit noch immer vor mir lagen. Sicher und geborgen in einem Nest aus Büchern und Natur, das meine Eltern mir gebaut hatten.
Doch als ich später versuchte, einzuschlafen, krochen Merlins Worte wieder in meinen Kopf. Und mit ihnen die Angst.
Das mit deinen Eltern tut mir sehr leid.
In dieser Nacht habe ich kaum geschlafen. Ich fuhr hoch bei jedem Hupen, jeder Polizeisirene auf Manhattans Straßen unterhalb des Penthauses meines Großvaters. Jedes Windgeräusch an den Fenstern machte mir eine Gänsehaut. Träume durchzogen meinen Schlaf. Träume von bewaldeten Bergen an einem Ort, den ich noch nie gesehen hatte. Breitschultrige Männer krochen durch Schlamm und abgestorbene Tannennadeln, meine Eltern tanzten im Wohnzimmer, nachdem sie dachten, ich sei eingeschlafen. Meine Eltern tanzten und der Wind fuhr durch die Bäume. Männer krochen im Schlamm. Der Zug tauchte in das Tal ein.
Tanz, Bäume, Schlamm, Tod.
Immer und immer wieder.
Tanz, Bäume, Schlamm, Tod.
Als ich in der blassen Morgensonne in die Höhe schoss und meinen Großvater im Türrahmen stehen sah, sein Blick ausdruckslos vor Schock und Entsetzen, das Telefon vergessen in seiner Hand, da wusste ich, was er mir sagen würde.
Wie König Hiskia drehte ich mein Gesicht zur Wand und betete.
Ich betete zu Gott, dass er auch mich tötete.
Kapitel 2
Elf Jahre zuvor
Wie Gott es oft tut, entschied er sich dazu, mir keine Antwort auf mein Gebet zu geben. Zumindest entschied er sich nicht, mit einem Ja zu antworten.
Stattdessen ging mein Leben weiter.
Die Eltern meiner Mutter waren alt und gebrechlich, und obwohl ich eine Tante und einen Onkel in Boston hatte, machten sie deutlich, dass sie, obwohl sie eine Tochter in meinem Alter hatten, keine weiteren Kinder bei sich aufnehmen wollten.
Doch das war ziemlich egal. Von dem Moment an, in dem Opa Leo den Anruf erhalten hatte, von der Sekunde an, als die Realität des Ganzen über uns hereinbrach, stand es nie zur Debatte, dass ich nicht bei ihm leben würde. Er war gerade mal in seinen Fünfzigern und vital. Er hatte mehr als genug Platz für eine weitere Person. Er war ein vielbeschäftigter Mann, beschäftigt mit der Partei und seinem blühenden Imperium für grüne Energie. Aber Opa Leo war nicht der Typ Mann, der Nein zu irgendetwas anderem als Schlaf sagte. Er holte alle meine Sachen ins Penthaus, schrieb mich in einer kleinen, aber streng wissenschaftlichen Privatschule an der Upper Eastside ein und packte mich in sein Leben. So gut, wie es ein verwitweter Großvater eben konnte.
Ich kann mich daran erinnern, vor und nach der Beerdigung geweint zu haben, aber nicht währenddessen. Ich erinnere mich, wie ich mich in mich selbst verkroch in der neuen Schule, die so anders war als der luftige Montessori-Klassenraum in Oregon. Ich erinnere mich, dass Opa Leo mir stapelweise Bücher kaufte, um mich aufzuheitern. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Eltern so wahnsinnig vermisste, dass es sich anfühlte, als hätte mir jemand etwas Lebenswichtiges mit einem stumpfen Löffel aus der Brust geschabt. Ich erinnere mich an Merlins Worte bezüglich meiner Eltern.
Merlins Prophezeiung.
Wenn er mit ihrem Tod recht hatte, hatte er es dann auch mit den anderen Dingen? Er hatte mir gesagt, ich solle meine Küsse für mich behalten. War das eine Warnung, der ich Folge leisten sollte?
Ich war mir sicher, dass ich das sollte. Ich war mir sicher, dass Merlin in die Zukunft sehen konnte. Dass er Verhängnis sah. In meiner Trauer und Angst versprach ich mir selbst, als ich sieben Jahre alt war, dass, egal was passierte, ich niemals einen Mann oder eine Frau küssen würde. Solange ich lebte.
Nie, nie, nie.
Als ich vierzehn Jahre alt war, fragte mich mein Opa Leo, ob ich gern weiter auf eine Schule in Manhattan gehen wollte oder lieber auf ein Internat in Übersee. Meine Cousine Abilene hatte man dort hingeschickt, in der Hoffnung, dass sie sich zusammenriss und ihre Konzentration auf die Schule legte. Opa Leo dachte, dass dies vielleicht auch mein Wunsch wäre. Ich war bereits eine ausgezeichnete Schülerin, also dahingehend gab es keine Probleme. Aber ich denke, Opa Leo machte sich Sorgen darüber, dass ich zu isoliert aufwuchs. Da ich mit ihm allein lebte und wir nur zu Umwelt-Benefizveranstaltungen und Partys gingen, wo ich den Abend damit verbrachte, mich in Tratsch und Spekulationen über Politiker und Geschäftsleute zu versenken. Wo ich meine Wochenenden damit verbrachte, Großvaters Geheimwaffe zu sein, die beobachtete und ihm hinterher Bericht erstattete.
„Du bist noch jung“, sagte er. Wir saßen am Esszimmertisch und er gab mir eine Broschüre des Internats. Die Bilder sahen fast kalkulierend aus, als wollten sie mich dazu verlocken, zuzusagen. Dicker Nebel, alte Holztüren, goldene und grüne englische Sommer. „Du könntest dir die Welt ansehen. Mit anderen jungen Leuten zusammen sein. Ein bisschen in Schwierigkeiten geraten.“ Dann lachte er. „Oder wenigstens deine Cousine vor Schwierigkeiten bewahren.“
Und so landeten Abilene und ich im Herbst meines vierzehnten Lebensjahres in der Cadbury-Akademie für Mädchen.
Cadbury war ein beeindruckender Ort. Ein riesiger und weitläufiger Gebäudekomplex aus Stein und altem Glas, mit Türmen und mehreren Bibliotheken sowie einem waschechten frühsteinzeitlichen Hügel mit einer Festung quasi im Hinterhof. Ich liebte es auf den ersten Blick. Abilene liebte die Nähe zur Jungenschule etwa eine Meile entfernt. Fast jeden Abend krabbelte sie aus unserem Fenster im Erdgeschoss, um über das weiche, grüne Gras zur Straße zu schleichen. Fast jeden Abend begleitete ich sie. Nicht weil ich auch die Jungs treffen wollte, sondern weil ich mich für sie verantwortlich fühlte. Verantwortlich für ihre Sicherheit, ihre Zeit hier in Cadbury und ihren Ruf.
Wir schlichen in Wohnheimzimmer, trafen uns in den Biergärten der Kneipen, die sich nicht die Mühe machten, uns rauszuwerfen. Wir nahmen an unerlaubten Partys auf dem Steinzeithügel teil, auf dem einst Cadbury Castle stand. Meistens waren wir nicht die einzigen Mädchen, aber Abilene war immer dabei, die Anführerin, die Anstifterin.
Mit fünfzehn hatte sie den großen, schlanken Körper eines Models, mit schönen Brüsten und langem roten Haar. Sie war laut, lebhaft und hübsch. Sie trank mehr als die Jungs, spielte Lacrosse, als hinge ihr Leben davon ab und immer, immer waren Leute um sie herum. Im krassen Gegensatz dazu war ich das Ding in den Schatten und Nischen. Die meiste Zeit verbrachte ich in der Bibliothek. Oft aß ich für mich allein, auf der Wiese sitzend, mit einem Buch auf den Knien. Ich hielt mich fern von Sport, aber wählte Tanz und Kreatives Schreiben als Freizeitaktivitäten. Ich war kleiner, als ich es mir wünschte, mein Körper lag in seiner Entwicklung hinter Abilenes zurück und war für die Jungs nicht von Interesse. Ich war kraftvoll genug für das Tanzen, aber nicht dünn genug, um in einem engen Gymnastikanzug gut auszusehen. Mein Kinn zeigte den Hauch eines Grübchens in der Mitte. Etwas, das Abilene und ich in stundenlanger Mühe mit Make-up zu verdecken versuchten. Auf meiner Wange hatte ich einen Schönheitsfleck, den ich verabscheute. Meine grauen Augen fühlten sich nichtssagend an im Vergleich zu Abilenes lebendigen blauen Augen. All das wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn ich auch nur ein Quäntchen von Abilenes Ausstrahlung gehabt hätte. Aber das hatte ich nicht. Ich war ruhig, ein bisschen träumerisch. Ich fürchtete mich zu Tode vor Konflikten, war aber manchmal gedankenlos genug, welche auszulösen. Ich war fasziniert von Dingen, die meinen Schulkameradinnen total egal waren. Amerikanische Politik, alte Bücher, das Sterben der Korallenriffe und Kriege, die so lange her waren, dass selbst ihre Namen fast schon vom Winde verweht waren.
Die eine Sache, die ich in diesem Alter an mir mochte, waren meine Haare. Lang und dicht und blond. Golden im Winter und fast weiß im Sommer. Es war die eine Besonderheit, die anderen an mir zuerst auffiel. Es war das Merkmal, mit dem ich beschrieben wurde, die Sache, mit der meine Freundinnen gern spielten, wenn wir fernsahen im Gemeinschaftsraum. Abilene hasste es. Hasste, dass es etwas an mir gab, mit dem sie nicht mithalten konnte. Schon früh in den ersten Wochen in Cadbury lernte ich, dass ihr ständiges Ziehen an meinen Zöpfen keinen Beweis der Zuneigung darstellte, sondern Neid, den sie nur schlecht im Griff hatte.
Trotz meiner Haare war Abilene jedoch immer die Monarchin und ich nur die Kammerzofe. Sie hielt Hof und ich hielt furchtsam Ausschau nach Lehrkräften. Sie drückte sich vor den Schulaufgaben und ich blieb abends ewig wach, um ihre Hausaufgaben zu tippen, damit sie nicht durchfiel. Sie machte Party und ich brachte sie heim. Mit dem Handy leuchtete ich uns den Weg vom Hügel herunter, während sie an meiner Schulter hing. Ihr Haar roch nach dem verschüttetem Cidre und billigem Parfum.
„Du küsst nie die Jungs“, sagte sie eines Nachts. Wir waren fünfzehn und ich führte sie gerade die schmale Straße zur Schule entlang.
„Vielleicht würde ich lieber Mädchen küssen“, sagte ich und machte einen großen Schritt über eine Schlammpfütze. „Mal darüber nachgedacht?“
„Hab ich“, bestätigte sie lallend. „Und ich weiß auch, dass das nicht wahr ist. Es gibt eine Menge Mädchen, die dich gern küssen würden hier in Cadbury. Und doch hast du noch keine geküsst.“
Behalte deine Küsse für dich.
Selbst nach acht Jahren konnte ich immer noch Merlins dunkle Augen sehen und diesen missbilligenden Tonfall hören. Ich konnte mich noch immer an dieses gruselige Gefühl eines bösen Omens erinnern, das mich überfiel, als er den Tod meiner Eltern voraussagte. Wenn er also glaubte, dass Menschen leiden würden, wenn ich jemanden küsste, dann hatte das sicher einen guten Grund.
Einen wichtigen Grund.
Im Übrigen war es ein Klacks, das aufzugeben. Es war ja nicht so, dass die Jungs Schlange standen, um mich zu küssen.
„Ich fühle mich einfach nicht danach, jemanden zu küssen“, sagte ich fest. „Das ist der einzige Grund.“
Abilene hob ihren Kopf von meiner Schulter und hickste in die kalte Nachtluft hinein. „Warts nur ab, Greer Galloway. Eines Tages wirst du genauso wild sein wie ich.“
Ich manövrierte sie um einen Haufen Schafskacke herum und sie hickste erneut.
„Das bezweifle ich.“
„Da liegst du falsch. Wenn du irgendwann so richtig loslässt, dann wirst du die wildeste und ungehemmteste kleine Schlampe in ganz Cadbury sein.“
Aus irgendeinem Grund errötete ich. Nicht vor Empörung, sondern aus Scham. Wie konnte sie wissen, was mir manchmal durch den Kopf ging? Von den Träumen, nach denen ich mit einem Pulsieren in meiner leeren Mitte aufwachte. Nein, das konnte sie nicht wissen. Ich hatte niemandem auch nur eine Silbe davon erzählt und würde das auch nie tun.
Genau wie meine Küsse würde ich diese Dinge für mich behalten. Schließlich war ich glücklich, so, wie es war. Glücklich, dass ich mich um Abilene kümmern und vom College träumen konnte. Ich war zufrieden damit, mir selbst vorzumachen, dass das genug war.
Kapitel 3
Gegenwart
„Und so blicken wir noch weiter zurück als bis Geoffrey of Monmouth. Zu den Annales Cambriae. Für alle, die in mittelalterlichem Latein nicht auf dem neuesten Stand sind, das sind die Annalen von Wales. Wir sehen, dass die Figur des Mordred dort zum ersten Mal erwähnt wurde. Unter dem Namen Medraut.“
Man kann das Klappern der Laptop-Tastaturen durch den schmalen Klassenraum schallen hören, während die Studenten sich fleißig Notizen machen. Die meisten der Studierenden hier sind eigentlich Medizin- oder Politikwissenschafts- und Sozialwesen-Studenten und nehmen nur an meinem Kurs über „Arthurische Literatur“ teil, um ihre Leistungspunkte im Bereich Geisteswissenschaften zu erhalten. Das hält sie dennoch nicht davon ab, es auf die höchste Punktzahl anzulegen. Die Universität von Georgetown ist nämlich nicht billig, und viele der Studenten hier müssen ihre Noten hoch halten, um ihre Stipendien und Kredite zu behalten. Ich kann das gut nachempfinden. Ich bin erst seit ein paar Monaten Dozentin und kann mich noch lebhaft an die langen Nächte und die kaffeelastigen Morgenstunden erinnern, als ich meinen Master in mittelalterlicher Literatur in Cambridge gemacht habe. Manchmal kann ich es kaum glauben, dass ich es wirklich geschafft habe. Wirklich zurück bin in den Staaten, wirklich einen erwachsenen Job habe, inklusive Aktentasche aus Leder und allem.
„Mordred wird hier nur als einer derjenigen erwähnt, die neben König Artus gestorben sind“, fahre ich fort und gehe vom Podium hinüber zum Whiteboard. „Wir erhalten keinerlei Informationen über seine Rolle in der Schlacht. Ob er gegen oder mit Artus gekämpft hat, oder ob er Artus’ Sohn oder Neffe oder einfach nur einer der Soldaten war.“
Ich öffne einen der Whiteboard-Stifte und schreibe ein Fragezeichen neben Mordreds Namen in den Stammbaum, an dem wir während des Herbstsemesters zusammen gearbeitet haben.
„Die Legende des König Artus ist für viele Dinge berühmt. Den heiligen Gral und die Tafelrunde, natürlich. Aber am berühmtesten ist sie vielleicht für die epische Liebesgeschichte zwischen Lancelot und Guinevere.“ Ich male ein Herz zwischen die beiden Namen und Kichern erklingt im Raum. „Doch wie wir gelernt haben, als wir zurückgingen in der Geschichte von Chretien de Troyes bis Geoffrey of Monmouth, war die Figur des Lancelot eine Erfindung der Franzosen aufgrund deren Sehnsucht nach einer höfischen Romanze. In den frühesten Erwähnungen der Legende findet man ihn gar nicht.“
Ich mache ein X über Lancelots Namen und schreibe Erfindung der Franzosen über seinen Namen. Mehr Tastaturklappern.
„Es gibt einen anderen Hinweis auf eine Romanze, älter als die Lancelot-Geschichte und sogar noch gefährlicher.“ Ich male ein neues Herz, diesmal zwischen Mordred und Guinevere. „Wenn man nach den Annalen geht, sind die Erwähnungen von Mordred fast immer Schilderungen, wie er die Königin entführt und versucht, sie zu heiraten. Dies wird gemeinhin als der Grund für den Zwist zwischen ihm und König Artus genannt, der schon viel früher als Mordreds Vater oder Onkel dargestellt wird. Vielleicht war er einfach nur ein Rivale in Sachen Liebe.“
Ich schließe den Stift wieder und gehe zurück zum Podium. „Ich denke eher, dass Mordred, als Lancelot, die Wurzel allen Übels an König Artus’ Hof war. Vertrauen, Liebe und Familie wird nicht immer zusammen in einem Paket geliefert.“
Ich höre, wie das Ticken der alten Wanduhr hinter mir verstummt und die Studenten fangen an, ihre Sachen wegzupacken, wobei sie versuchen, noch immer aufmerksam zuhörend auszusehen. Obwohl sie in Gedanken schon aus der Tür sind.
„Das ist alles für heute. Nächste Woche fangen wir mit den Walisischen Triaden an. Und vergesst nicht, eure Vorschläge für die Abschlussarbeiten einzureichen.“
Sie sammeln ihre letzten Sachen ein und ich gehe zu dem Schreibtisch in der Ecke, um meine eigenen Unterlagen einzupacken. Ein paar Studenten kommen mit Fragen zu mir, oder um ihre benoteten Hausarbeiten entgegenzunehmen. Dann bin ich allein im Raum.
Nachdem sie alle weg sind, starre ich ein paar Minuten lang auf die leeren Sitze. Als ob ich versuchte, mich an etwas zu erinnern. Natürlich habe ich nichts vergessen und alles ist in Ordnung, aber eine Art leere Ruhelosigkeit erfasst mich dennoch.
Du hast alles, was du brauchst, erinnere ich mich selbst. Einen tollen Job, ein schönes Haus, einen Großvater, der dich liebt und eine Cousine, die deine beste Freundin ist.
Ich brauche nichts weiter. Was ich habe, ist genug.
Aber warum fühle ich mich dann immer so verloren?
Das Büro, das ich mir in Georgetown mit zwei anderen Dozenten teile, ist klein. Es ist vollgestopft mit Tischen, Ordnern und Büchern sowie stapelweise Arbeitsmaterialien. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr, dass ich sogar schon hier geschlafen habe statt in meinem kleinen Stadthaus nahe Dumbarton Park. Das ich mir natürlich nur leisten kann, weil es meinem Opa Leo gehört und er nichts von Miete zahlen hören will. Aber es hat etwas, hier in diesem alten Gebäude aus Stein zu sein. Allein auf dem Flur mit den größtenteils leeren Arbeitszimmern, wenn die Dunkelheit durch das Bürofenster sickert. Es fällt mir dann leichter, mich daran zu erinnern, warum ich dieses Leben gewählt habe. Ein Leben in Büchern und ohne Küsse. Ein Leben, in dem sich Merlins Warnung nicht wie ein Fluch, sondern wie eine getroffene Wahl anfühlt.
Ich bin es gewöhnt, bis spät in die Nacht zu arbeiten, die letzte zu sein, die das Englischgebäude verlässt, und der heutige Abend ist keine Ausnahme. Ich benote ein paar Hausarbeiten und gehe dann über zu dem Buch, das ich versuche, zu schreiben. Eine literarische Abhandlung über das Königtum, wie es aufgezeichnet ist in den multiplen Chroniken über die Artus-Legende im Laufe der Jahrhunderte.
Ich weiß, das klingt langweilig, aber das ist es nicht. Wirklich. Jedenfalls nicht für mich. Überhaupt habe ich ja schon einmal einen Zauberer getroffen, meinen ganz persönlichen Merlin. Auch wenn ich als Erwachsene über die Vorstellung von Magie lachen kann und mir selbst einrede, dass seine Warnung kompletter Humbug war. Denn ich habe sie schon zwei Mal ignoriert und nichts ist passiert.
Außer dass mir beide Male das Herz gebrochen wurde, ist nichts passiert.
Ich bin tief in meinen Gedanken vergraben, versuche, einen Gedankengang, den ich gestern Abend über die Herrschaft während des Mittelalters hatte, zu verfolgen, als ich in meinem Nacken ein Kribbeln spüre. Als spüre ich, dass jemand hinter mir steht.
Und jemand tut es.
Ich drehe mich auf meinem Stuhl herum und sehe, wie ein Mann im Türrahmen lehnt. Seine Arme hat er über der muskulösen Brust verschränkt, das Jackett seines blauen Anzugs dehnt sich über seinen Schultern. Obwohl das Jackett zugeknöpft ist, kann ich sehen, wie seine Anzughose Hüften und Oberschenkel umfasst und wie der weiße Seidenschlips flach an dem engen Hemd liegt.
Ich schaue nach oben und schlucke.
Eisblaue Augen und ein Bartschatten. Hohe Wangenknochen und eine gerade Nase, volle Lippen und eine hohe, aristokratische Stirn. Ein Gesicht wie gemacht fürs Grübeln, irgendwo in einer Moorlandschaft. Ein Gesicht gemacht für viktorianische Romane oder Regency-Dramen. Das Gesicht des prototypischen elitären Fremden auf einem Ball in einem Jane-Austen-Roman.
Nur, dass mir dieser Mann nicht fremd ist.
Vizepräsident Embry Moore.
Ich sehe zu, dass ich auf die Füße komme. „Vizepräsident Moore“, kriege ich heraus. „Ich wusste nicht …“ Um seine Augen bilden sich Lachfältchen. Tatsächlich ist er sogar ein Jahr jünger als Präsident Colchester, der sein Amt erst vor sechs Monaten übernommen hat, kurz bevor er sechsunddreißig wurde. Aber Jahre unter der Sonne und vier Einsätze im Krieg haben ihm schmale Fältchen um die Augen beschert, die sichtbar werden, wenn er lächelt.
Wie im Moment.
Ich schlucke erneut. „Vizepräsident Moore, wie kann ich Ihnen helfen?“
„Bitte, nenn mich nicht so.“
„Okay. Wie kann ich Ihnen helfen, Mr. Moore?“
Er betritt das Büro und ich kann ihn riechen. Irgendetwas Scharfes. Pfeffer vielleicht, oder Zitrus.
„Nun, Ms. Galloway, ich habe mich gefragt, ob Sie Zeit hätten für ein Abendessen.“
Oh Gott.
Ich versuche, zu sehen, wer hinter ihm steht, aber er wedelt mit der Hand. „Meine Sicherheitsleute warten am Ende des Flurs auf mich. Sie können uns nicht hören.“
Ich sollte ihn fragen, warum er hier ist. Warum hier in der Universität, in meinem Büro, um beinahe Mitternacht. Ich sollte fragen, warum er nicht angerufen oder eine E-Mail geschickt hat, oder irgendeine Sekretärin nach mir suchen ließ. Stattdessen frage ich: „Ist es fürs Abendessen nicht schon etwas spät?“
Mit noch immer verschränkten Armen blickt er auf seine Armbanduhr. „Vielleicht. Allerdings bin ich mir sicher, dass jedes Restaurant, das du dir aussuchst, gern für mich öffnet. Oder für dich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es niemanden in dieser Stadt gibt, der Leo Galloway nicht den ein oder anderen Gefallen schuldet.“
„Ich mache mich hier nicht mit dem Namen meines Großvaters wichtig“, sage ich ein wenig vorwurfsvoll. „Ich kann nicht leiden, wie sich das anfühlt.“
„Dass du vergessen willst, wer du bist, bedeutet nicht, dass wir es vergessen können.“ Sein Tonfall ist sanft.
Ich trete einen Schritt zurück und schlucke. Mein unterdrückter und würdevoller Zorn, den ich nach fünf Jahren in eine vorsichtige, ruhige Form gebannt hatte, erwacht aus seinem Schlaf. Denn Embry war einmal sehr gut darin gewesen, mich zu vergessen.
„Warum versteckst du dich hier?“, fragt er, nimmt seine Arme herunter und tritt einen Schritt vor. Sein Tonfall ist noch immer sanft. Zu sanft. Die Art von sanft, die dir Versprechungen ins Ohr säuselt, um diese dann zu brechen.
„Ich verstecke mich nicht“, sage ich und nicke mit dem Kopf in Richtung meines Schreibtischs, auf die hohen Papierstapel und die Bücher und die Hefte. „Ich arbeite. Ich unterrichte, ich schreibe an einem Buch. Ich bin glücklich.“
Embry kommt noch etwas näher, lässt mit einem langen Schritt den Platz in meinem Büro auf ein Nichts zusammenschmelzen. Er ist nah genug, dass ich ihn wieder riechen kann. Ein Duft, der sich nach all der Zeit nicht verändert hat.
Einen Moment lang schließe ich die Augen und versuche, mich zu reorientieren.
„Du warst noch nie eine besonders gute Lügnerin“, raunt er und als ich meine Augen öffne, ist er so nah, dass ich ohne weiteres mit den Fingern über seinen Kiefer fahren könnte. Ich tue das nicht, drehe meinen Kopf zur Seite und blicke stattdessen aus dem Fenster.
„Ich lüge nicht“, lüge ich.
„Komm mit mir essen“, sagt er, und ändert seine Taktik. „Wir haben uns so viel zu erzählen.“
„Fünf Jahre.“ Die Worte sind spitz, und man muss ihm zugutehalten, dass er sie nicht abwehrt.
„Fünf Jahre“, stimmt er zu.
Seltsam, dass sich so eine lange Zeit so kurz anhören kann.
Ich seufze. „Ich kann nicht mit dir essen gehen. Wenn ich mit dir gesehen werde, ist mein Gesicht sofort auf Buzzfeed und Twitter. Damit kann ich nicht umgehen.“
Embry hört mir zu, aber gleichzeitig berührt er eine weißgoldene Haarsträhne, die sich aus meinem Dutt gelöst hat. „Daher gehen wir so spät. Zu einem unangekündigten Ort. Niemand wird davon wissen, nur du, ich und der Koch.“
„Und der Secret Service.“
Embry zuckt mit den Schultern, um seine Augen werden wieder diese Fältchen sichtbar. „Sie schreiben ihre Memoiren nicht, bevor ich im Ruhestand bin. Bis dahin ist unser Abendessen unter Verschluss.“
Ich kann Nein sagen. Ich weiß, dass ich das kann. Allerdings war ich bei Embry dazu nie in der Lage gewesen. Ich möchte nicht zurück in das blitzblanke Stadthaus, tadellos eingerichtet und unfassbar seelenlos, um dort eine weitere Nacht allein in meinem Bett zu verbringen. Ich möchte nicht hoch an die Decke starren und jeden Moment, jeden Blick noch einmal vor meinem geistigen Auge abspielen, während sich meine Hand unter die Zudecke stiehlt, und ich mich an diesen pfeffrigen Zitrusduft erinnere, und die Art, wie die Schatten über Embrys Wangen fallen. Ich möchte mich nicht mehr selbst geißeln wegen einer weiteren verpassten Nacht, einer weiteren verpassten Chance. Ganz besonders nicht mit ihm.
Nur für eine Nacht könnte ich so tun, als sei ich jemand anderes.
„Abendessen“, knicke ich letztlich ein und er grinst. „Das ist aber alles.“
Er hebt die Hände hoch. „Ich werde so keusch sein wie ein Priester. Ich verspreche es.“
„Ich hörte, nicht alle Priester sind dieser Tage keusch.“
„Dann eben so keusch wie eine Nonne.“
Ich greife nach meinem Trenchcoat, der am Ständer neben meinem Schreibtisch hängt, doch er nimmt ihn für mich ab und hält ihn mir hin, sodass ich in die Ärmel schlüpfen kann. Er ist aufmerksam und charmant, und dabei gefährlich. All das, an was ich mich bei ihm erinnere. Ich bringe es nicht zustande, Augenkontakt mit ihm zu halten, während ich den Mantel überziehe und den Gürtel über meiner Bluse und dem Bleistiftrock schließe. Für einen Augenblick, einen winzigen Augenblick, stelle ich mir das Gefühl seiner Lippen auf meinem Haar vor. Ich drehe mich zu ihm um und versuche dabei, Abstand zu halten.
Embry fällt es auf und sein Lächeln wird ein wenig schwächer. „Ich kümmere mich um dich, Greer. Du musst keine Angst vor mir haben.“
Oh, aber die habe ich. Und kein bisschen Angst vor mir.
Teller’s ist ein kleines italienisches Restaurant, nur ein paar Blocks vom Campus entfernt. Es ist eins dieser köstlichen kleinen Lokale, die schon immer da waren. Embry schien nicht überrascht, als ich es vorschlug. Nach ein paar Anrufen und einer sehr kurzen Fahrt in einem schwarzen Cadillac befinden wir uns in dem alten Bankgebäude und werden zu unserem Tisch geführt. Wir sind die einzigen Gäste. Beim Laufen hallen die Schritte des Kellners auf dem Marmorboden durch den Raum. Bis auf die Lampen um unseren Tisch herum sind die Lichter im Raum gedimmt. Doch der Koch und die Kellner sind sehr höflich und glücklich, uns mit Essen zu versorgen. Der Secret Service findet ein diskretes und entferntes Fleckchen, wo sie stehen können. Für einen Moment, als man sie kurz nicht sah, nachdem Embry sein Jackett achtlos über die Lehne des Stuhls neben sich geworfen hatte, konnte ich mir einbilden, dass das hier normal sei. Ein normales Abendessen, eine normale Unterhaltung.
Ich nehme einen kleinen Schluck von dem Cocktail auf dem Tisch, versuche, damit unsere Vergangenheit wegzuwaschen, sie in Gin zu ertränken. Meine Vergangenheit mit Embry ist hoffnungslos verstrickt mit jemand anderem. Und solange ich diesen Anderen einen Schatten auf unser Abendessen werfen lasse, besteht nicht die geringste Chance, dass ich auf eine Unterhaltung hoffen kann, die nicht durchzogen ist von Schmerz und Bedauern. Dafür gibt es nur eine Lösung. Ich muss alles in eine Schachtel stecken, Kies darüber schaufeln und es so lange begraben, bis es erstickt ist.
„Wie ist es dir ergangen?“, fragt Embry endlich und lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Ich versuche, nicht zu bemerken, wie sich dabei das Hemd über seine muskulösen Schultern spannt. Wie die Haut an seinem Hals von dem blendend weißen Hemd umrahmt wird. Aber das ist unmöglich. Es ist nicht möglich, ihn nicht zu bemerken. Es ist unmöglich, sich nicht nach ihm zu verzehren. Sogar jetzt im Moment zucken meine Finger, weil sie sich vorstellen, wie sie die Haut auf seinem Hals berühren, wie sie langsam sein Hemd öffnen.
„Gut“, bringe ich endlich heraus. „Hab mich in meinem Job gut eingewöhnt.“
Er nickt. Das Kerzenlicht auf dem Tisch beleuchtet seine Wimpern und wirft Schatten auf seine Wangenknochen. „Sieht ganz so aus. Ich möchte wetten, dass du eine großartige Dozentin bist.“
Ich muss an meinen einsamen Klassenraum, mein ruhiges Büro und meine allgegenwärtige Unruhe denken.
Ich wechsle das Thema. „Und dein Job? Vizepräsident? Ich bin mir sicher, dass mehr dahintersteckt als jeden Abend mit einer anderen Frau am Arm fotografiert zu werden.“
Der alte Embry hätte darüber gelacht. Gegrinst oder gezwinkert und angefangen, damit anzugeben. Dieser Embry lehnt sich nach vorn und sieht mich über das Cocktailglas hinweg an. Seine Hände legt er in den Schoß und faltet sie.
„Ja“, sagt er leise. „Es steckt mehr dahinter.“
„Mr. Moore …“
„Nenn mich noch einmal so und ich lass dich verhaften, wegen Volksverhetzung.“
„Also gut. Embry. Warum bin ich hier?“
Er atmet tief ein.
„Der Präsident möchte ein Treffen mit dir.“
Von allen Dingen, die er hätte sagen können … von allen möglichen Gründen, die ich mir ausgemalt habe, warum ich einem Mann gegenübersaß, mit dem ich in den letzten fünf Jahren kein einziges Wort gewechselt hatte …
„Präsident Colchester“, frage ich. „Maxen Colchester? Dieser Präsident?“
„Soweit ich weiß, gibt es nur den einen.“
Ich nehme einen weiteren Schluck von meinem Cocktail. Dabei versuche ich, meine Bewegungen in den Griff zu kriegen und meinen Gesichtsausdruck neutral zu halten. Obwohl ich ganz genau weiß, wie sinnlos das bei Embry Moore ist. Als ich ihn das erste Mal sah, war er noch ein Sklave seiner Emotionen. Impulsiv und launenhaft. Doch während der letzten fünf Jahre ist er ein Meister wohlüberlegten, wohldurchdachten Verhaltens geworden. Ich erkenne an der Art, wie sein Blick über mein Gesicht gleitet, dass ich ihm nichts vormachen kann.
Mit einem Seufzen stelle ich meinen Drink ab und verzichte auf jegliche Vortäuschung von Gelassenheit. Es ist, wie er es vorhin sagte. Ich war noch nie eine gute Lügnerin und ich hasse Lügen sowieso.
„Ich bin ein bisschen verwirrt“, gebe ich zu. „Wenn der Präsident nicht gerade über den Einfluss der angelsächsischen Lyrik auf die Literaturtradition der Normannen sprechen möchte, verstehe ich nicht, warum er mit mir reden will.“
Embry hebt eine Augenbraue an. „Nicht?“
Ich senke den Blick auf meine Hände. An meinem rechten Zeigefinger befindet sich die kleinste Narbe der Welt. So klein, dass man sie gar nicht sehen kann. Man kann sie nur daran erkennen, wie sie die Linien meines Fingerabdrucks unterbricht. Eine winzige weiße Einkerbung in einer winzigen weißen Erhöhung.
Ein winziger Nadelstich von einer Narbe, die Erinnerung ein heißes Messer.
Der Geruch von Feuer und Leder.
Feste Lippen auf meiner Haut.
Das warme Rot von Blut.
„Wirklich nicht“, bestätige ich. Ich habe Hoffnungen, ich habe Fantasien, ich habe eine Erinnerung, die so machtvoll ist, dass sie mich jede Nacht bestraft. Aber nichts davon ist real. Das hier ist jetzt das reale Leben. Das hier ist der Vizepräsident, das dort drüben ist der Secret Service, und ich habe einen Stapel Hausarbeiten, die ich zu Hause benoten muss.
Ich bin keine sechzehn mehr. Und überhaupt. Ich habe mir geschworen, ich würde diesen anderen Mann in eine Schachtel stecken und vergraben.
„Er hat dich letzte Woche in der Kirche gesehen“, sagt Embry. „Hast du ihn auch gesehen?“
„Natürlich habe ich das.“ Ich seufze. „Es ist schwer, nicht mitzubekommen, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten in der Kirche, die du besuchst, an einem Gottesdienst teilnimmt.“
„Und du hast ihm nicht Hallo gesagt?“
Ich werfe meine Hände in die Luft. „Hallo, Mr. President. Ich habe Sie vor zehn Jahren einmal getroffen. Friede sei mit Ihnen, und übrigens ist die linke Abendmahlschlange immer die schnellste?“
„Du weißt, dass es so nicht ist.“
„Wirklich?“ Ich lehne mich vor. Embrys Augen blicken auf meine Brust, wo meine Bluse etwas aufsteht. Ich setze mich gerade hin und glätte den Stoff wieder. Dabei versuche ich, die Hitze in meinem Bauch, die Embrys Blick auslöst, zu ignorieren.
„Er war sowieso umzingelt vom Secret Service. Ich hätte ihm nicht Hallo sagen können, selbst wenn ich es gewollt hätte.“
„Er möchte dich sehen“, wiederholt Embry.
„Ich kann nicht glauben, dass er sich an mich überhaupt erinnert.“
„Und schon wieder gehst du davon aus, dass die Menschen dich vergessen könnten. Es wäre ja niedlich, wenn es nicht so frustrierend wäre.“
„Erzähl mir, warum er mich sehen will.“
Embrys blaue Augen funkeln im schwachen Lichtschein, als er nach meiner Hand greift. Und dann hebt er sie an seine Lippen, küsst die vernarbte Fingerkuppe mit vorsichtiger und vorsätzlicher Langsamkeit. Küsst eine Narbe, von der er nichts wissen sollte.
Mein Brustkorb läuft Gefahr, zu platzen.
„Warum du?“, frage ich mit gebrochener Stimme. „Warum bist du hier und nicht er?“
„Er hat mich geschickt. Er wäre so gern hier, aber du weißt ja, wie er beobachtet wird. Ganz besonders nach Jenny …“
Wie ein Vorhang fällt Dunkelheit über den Tisch.
Jenny.
Präsident Colchesters Ehefrau.
Verstorbene Ehefrau.
„Es ist erst ein Jahr nach der Beerdigung und Merlin ist der Meinung, dass es zu früh ist für Max, aus der Rolle des tragischen Witwers zu treten. Also darf es keine E-Mails oder Telefonate geben. Noch nicht. Du verstehst.“
Das tue ich. Ich verstehe es. Ich bin in dieser Welt aufgewachsen. Und auch wenn ich nie ein Teil davon sein wollte, verstehe ich Skandale und PR und Krisenmanagement genauso gut wie mittelalterliche Literatur.
„Also hat er dich geschickt.“
„Das hat er.“
Ich blicke hinunter auf meine Hand, die Embry noch immer festhält. Wie kam es nur dazu, dass ich zwischen diese beiden Männer geraten bin? Die zwei mächtigsten Männer der freien Welt?
Das hier ist das reale Leben, Greer. Sag Nein. Sag Nein zu Embry und, um Himmels willen, sag Nein zum Präsidenten.
Ich atme ein.
Feuer und Leder. Blut und Küsse.
Ich atme aus.
„Einverstanden. Sag ihm, ich werde ihn treffen.“
Mir entgeht nicht der Schmerz, der in Embrys Augen aufflackert. Ein Schmerz, den er schnell wieder verbirgt.
„Wird sofort erledigt“, antwortet er.
Kapitel 4
Zehn Jahre zuvor
„Du musst stillhalten“ Abilene fummelte nervös an meinen Haaren herum. „Ich krieg diese eine Strähne nicht hin.“
Ich seufzte und zwang meinen Körper dazu, stillzuhalten, obwohl ich so aufgeregt war, dass ich kaum atmen konnte. In wenigen Minuten würde ein gemietetes Auto vor den Eingang des Hotels in London fahren, in das Opa Leo uns einquartierte hatte, und uns auf eine sehr große Party in Chelsea bringen. Eine Party mit Erwachsenen und Champagner. Es würden Diplomaten und Geschäftsleute und vielleicht sogar der ein oder andere Prominente dort sein. Welten entfernt von dem schalen Bier und den krachenden Boxen auf den Bergpartys in unserer Schule.
Es war mein sechzehnter Geburtstag. Und als ein ganz besonderes Bonbon hatte mein Großvater uns erlaubt, ihn auf diese Party zu begleiten. Oder eher gesagt hatte er mich dazu eingeladen, und zögerlich zugestimmt, dass Abilene mitkommen durfte. Er konnte ja schlecht die eine Enkeltochter einladen und die andere nicht. Doch uns beiden war klar, auch wenn wir es nicht laut aussprachen, dass es einen hohen Risikofaktor in Sachen Peinlichkeiten mit sich brachte, Abilene zu so einem Event mitzunehmen. Aufgrund einer ganzen Reihe von Verstößen hatte man sie beinahe schon aus Cadbury geschmissen. Trinken auf dem Schulgelände, Nichteinhaltung der Bettruhezeiten, ein hässlicher Vorfall, der zu einer anderen Lacrosse-Spielerin mit einem blauen Auge führte. Und jedes Mal hatte Opa Leo die nötigen Strippen gezogen und die nötige Menge Geld gezahlt, damit man sie dortbehielt.
Das Letzte, was er wollte war, dass sie ihn auf einer Party vor seinen Freunden blamierte. Ich hatte ihm versprochen, dass sie sich vorbildlich benehmen würde, dass ich dafür sorgen würde. Ich versprach ihm, dass ich sie davon abhalten würde, zu viel zu trinken und zu viel zu reden, wenn er sie nur mitkommen ließ. Denn es würde sie so sehr verletzen, wenn ich mitkommen durfte, aber sie nicht.
Und Opa Leo, der schon Senatoren und Ölmagnaten das Zittern beigebracht hatte, der geholfen hatte, die strengste Umweltschutzgesetzgebung, die das Land jemals hatte, durchzusetzen, der seine Feinde täglich vernichtend kritisierte, gab meiner Bettelei mit einem Lächeln nach und erlaubte, dass Abilene uns begleitete.
Das war der Grund, warum Abilene und ich unseren Abend in dem teuren Hotelzimmer damit verbrachten, uns fertig zu machen. Warum ich gerade versuchte, auf dem Stuhl nicht herumzuzappeln, während Abilene vorsichtig eine Haarsträhne in der Frisur feststeckte.
Als wir fertig waren, stand ich auf, um mich noch mal von oben bis unten zu betrachten, bevor ich meine High Heels anzog und wir hinuntergehen konnten. Sie machte ein Geräusch hinter mir. Ich machte mir sofort Gedanken und drehte mich zu ihr um.
„Was ist los? Sieht man meinen BH?“ Ich drehte und wendete mich vor dem Spiegel, und war der Meinung, dass Abilene irgendetwas Schlimmes an mir gesehen hatte.
„Nein. Es ist … es ist alles in Ordnung.“ Ihre Stimme klang erstickt. „Lass uns gehen. Opa wartet sicher schon.“
Ich zuckte mit den Schultern und setzte mich hin, um mir die hochhackigen Riemchensandalen anzuziehen, die farblich zu dem blassrosa Abendkleid passten, das Opa mir Anfang der Woche gekauft hatte. Das Kleid hatte eine schmale Taille und eine eng anliegende Corsage. Eine zarte Schärpe hinten und einen Rock, der von oben nach unten in verschwenderischer Weise von gediegenen hin zu prächtigen Lagen von Tüll und Organza explodierte. Mit dem dazu passenden Tüll in meiner Hochsteckfrisur und den metallic-pinken Sandalen fühlte ich mich wie eine Prinzessin. Obwohl ich wusste, dass ich im Vergleich zu Abilene nicht so aussah.
Sie trug heute ein enges Kleid in elektrischem Blau mit einer Aussparung in der Form eines Schlüssellochs in der Mitte, was ihre cremig-weiße Haut zur Schau stellte. Ihr schimmerndes rotes Haar trug sie offen. Sie sah um Jahre älter aus als sie war. Reif, elegant und erfahren. Ich erstickte den üblichen Stich von müder Resignation, die mich immer überkam, wenn Abilene sich zurechtmachte. Ich war es schließlich gewohnt, ihr Schatten zu sein. Der Dr. Watson zu ihrem Sherlock, der Spock zu ihrem Captain Kirk. Also sollte mich das heute Abend auch nicht weiter stören. Auch wenn es mein Geburtstag war. Auch wenn ich das allerschönste Kleid anhatte, das ich jemals getragen hatte. Nachdem ich einen Blick auf sie geworfen hatte, wie sie so schön und verführerisch aussah, war es mir nicht möglich, irgendetwas anderes zu sehen als das Grübchen in meinem Kinn, wenn ich mich im Spiegel betrachtete. Diesen fürchterlichen Schönheitsfleck in meinem Gesicht, der sich mit nichts abdecken ließ. Die Ausdruckslosigkeit meiner Augen, obwohl wir alles aus ihnen herausgeholt hatten, was Mascara und Eyeliner hergaben.
Also untersuchte ich ein letztes Mal, ob man meinen trägerlosen BH auch wirklich nicht sah, ob ich mir nicht versehentlich den pinken Lippenstift quer über das Gesicht geschmiert hatte, oder ob ich mich nicht auf Abilenes halb gegessenen Schokoriegel gesetzt hatte. Dann öffnete ich die Tür. Abilene schob sich an mir vorbei. Sie sagte kein Wort, und auch auf dem ganzen Weg zur Lobby schwieg sie.
Die verspiegelten Aufzugstüren öffneten sich und sie eilte an mir vorbei aus der Kabine. Ihre Absätze klackerten auf dem Marmorfußboden. „Bist du sauer auf mich?“, fragte ich.
Ich zermarterte mir das Hirn und versuchte, mich zurückzuerinnern, ob ich irgendetwas getan haben könnte, das sie so sauer machte. Aber ich konnte mich an nichts erinnern. Wobei das manchmal bei Abilene nichts zu sagen hatte. So oft sie mich auch einfach so umarmte und sich darum kümmerte, dass ich ebenfalls zu Partys eingeladen wurde, mich ihren Freunden gegenüber verteidigte, genauso oft verfiel sie in eine düstere, finstere Stimmung. Dann brannte ihr Blick wie Säure und ihre Worte verschmorten mir die Haut wie Feuer. Ich hatte gelernt, diese Stimmungsschwankungen nicht anzusprechen oder sie zu beschwichtigen. Auch wenn sie in letzter Zeit häufiger auftraten. Es hatte keinen Sinn. Mit einem Sturm konnte man nicht verhandeln, man konnte nur abwarten, dass er über einen hinwegfegte.
„Ich bin nicht sauer auf dich“, sagte sie, wobei sie eilig weiterlief. Ich konnte Opa Leo bereits durch die Eingangstürscheiben sehen, und über seiner Figur lag unsere Reflexion. Abilene, Rot und Saphirblau. Ich, Gold und Zartrosa.