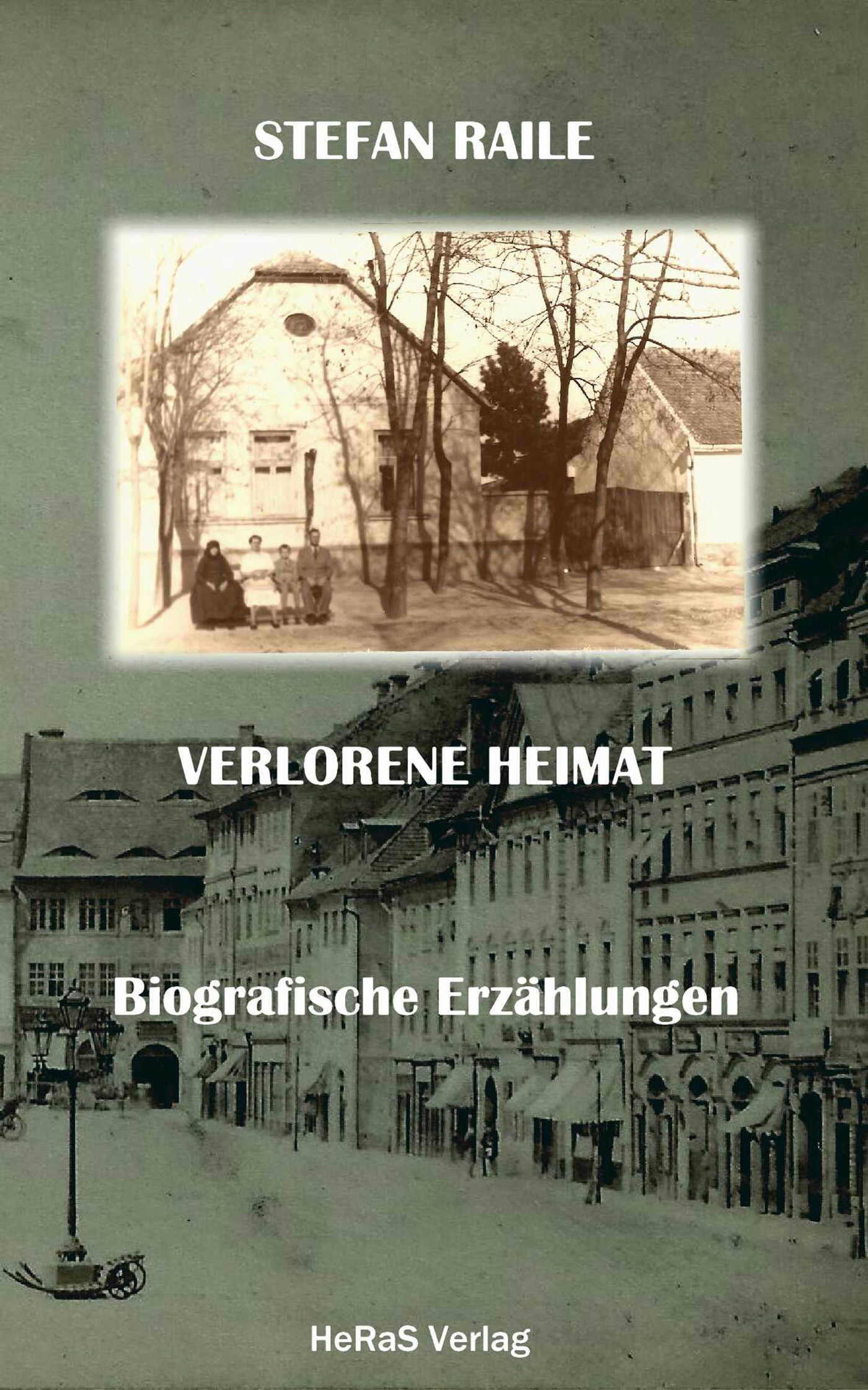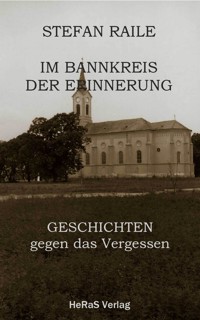Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An verschiedenen Fronten kämpften die Soldaten der vier Erzählungen: in Bulgarien und Jugoslawien während des Zweiten Weltkriegs sowie bei der NVA vor der Wende. Entstanden von 1962 bis 1989, reflektieren sie den jeweiligen Zeit-geist. Während die Gefahr, sein Leben zu verlieren, beim Kampf der faschistischen Wehrmacht gegen die Partisanen auf dem Balkan besonders groß war, blieb sie für die Soldaten der DDR gering, da die Bedrohung im Kalten Krieg nur latent existierte. Doch in den Kasernen gab es, bedingt durch die militärische Hierarchie, reichlich Konflikte, die nicht selten in bösartige Schikanen mündeten, unter denen die Rekruten am meisten leiden mussten, ganz gleich, bei welcher Armee sie dienten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Raile
An verschiedenen Fronten
Erzählungen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
BRANDOS GEHEIMNIS
DIE GALGENFRIST
LEINERS GESTÄNDNIS
EINE CHANCE FÜR MARIO HERTEL
Impressum neobooks
BRANDOS GEHEIMNIS
Das schmale Band der Landstraße schlängelte sich durch die jugoslawische Ebene. Der PKW der faschistischen Wehrmacht fuhr schnell. Am Steuer saß Obergefreiter Dieter Brando, mein Freund, hinter ihm Oberleutnant Zähler und ich – Gefreiter Wude.
Kaum zwanzig Jahre zählte ich damals. Erst vor wenigen Wochen, nach meiner Entlassung aus dem Lazarett – ich war in der Normandie verwundet worden -, war ich zu dieser Einheit gekommen, deren Hauptaufgabe darin bestand, den Kleinkrieg gegen die jugoslawischen Partisanen zu führen.
Es war keine angenehme Aufgabe, und der Kampf mitunter gefährlicher als an der Front, da er sich gewöhnlich nicht offen, sondern versteckt abspielte. Die Wälder rechts und links der Donau waren so dicht, dass man einen Gegner selbst dann nicht sah, wenn er nur wenige Meter entfernt hinter dem Unterholz kauerte.
Bei Einsätzen konnte hinter jedem Busch der Tod lauern, von jedem Baum konnten hasserfüllte Blicke das Tun der deutschen Soldaten verfolgen. Und dann knallte es plötzlich irgendwo. Geschosse pfiffen durch die Luft, trafen oft ihr Ziel. Wenn die Deutschen in Stellung gegangen waren, verstummte das rhythmische Bellen der LMGs, und über der Landschaft schwebte trügerische Ruhe. Von den Partisanen fehlte dann meist jede Spur. Das war der Krieg unsrer Einheit, der eigentlich keiner war, sondern ein Katz- und Mausspiel der jugoslawischen Freischärler mit uns.
Als unser Wagen ins Schlingern geriet, rutschte ich über die Sitzfläche und prallte mit meinem Kopf gegen den des Oberleutnants. Während ich ihn stöhnen hörte, knirschten bereits die Bremsen, und der Wagen stand nach wenigen Metern. Dieter Brando stieg hastig aus und fluchte: „Verdammt, ein geplatzter Reifen!“
Wir waren froh, dass es sich nur um eine Panne handelte, und das Dorf bereits unmittelbar vor uns lag. Hier war eine Aktion der Partisanen nicht zu befürchten. Als wir ebenfalls aus dem Wagen kletterten, griff sich der Oberleutnant an den Kopf, dorthin, wo er die spärlichen Haare sorgfältig gescheitelt hatte. Aber der Zusammenprall mit mir schien doch nicht so schlimm gewesen zu sein; denn die Unmutsfalte zwischen seinen dunklen Augenbrauen verschwand, und seine breite Stirn glättete sich wieder. Er rekelte sich und streckte seine massigen Glieder.
„Wude“, sagte er zu mir, „bis zum Dorf ist’s nicht mehr weit. Wir gehen schon mal vor.“ Und Dieter befahl er: „Sie kommen zum ‚Casino‘, wenn Sie fertig sind!“
Das „Casino“ war das größte Gasthaus des Dorfes. In ihm verkehrten hauptsächlich die Angehörigen der Wehrmacht, die ihm auch den Namen gegeben hatten.
Langsam gingen wir auf das Dorf zu, der Oberleutnant und ich. Damals behandelte er mich noch ein wenig freundschaftlich, weil wir aus dem gleichen thüringischen Ort stammten. Er war dreizehn Jahre älter als ich, und in der Heimat hätte er mich kaum beachtet. Sein Vater besaß eine Fabrik, und ich war der Sohn eines Arbeiters. Aber hier nahm man es nicht so genau.
Als ich in die Einheit gekommen war, hatte er mich zu sich befohlen und aufgeräumt festgestellt: „Welch ein Zufall: Jemand aus meiner einstigen Nachbarschaft! Freut mich, Ihnen in der Fremde zu begegnen, Gefreiter.“ Danach musterte er mich eingehend und fragte: „Sie waren verwundet?“
Ich riss die Hacken zusammen. „Jawohl, Herr Oberleutnant!“
„Tüchtig, Gefreiter. Solche Leute gefallen mir. Darum hätte ich was für Sie: Ich suche einen Burschen. Eigentlich dürfte ich nur einen gemeinen Soldaten auswählen, aber mit meinen Beziehungen ließe es sich trotzdem arrangieren, ohne Sie degradieren zu müssen.“ Er sah mich abwartend an. Als ich zögerte, fügte er hinzu: „Sie hätten es auf jeden Fall besser als bei der Truppe.“
Ohne ganz überzeugt zu sein, mich richtig zu entscheiden, willigte ich ein und zog zu ihm ins Dorf. Er wohnte beim Kantor, einem älteren Herrn, der keine Kinder hatte. Wir kamen ganz gut mit ihm aus. Allerdings kümmerte er sich auch wenig um uns. Und ich war nun der Bursche des Oberleutnants. Es ging mir keineswegs schlecht. Nur manchmal hatte ich den Eindruck, dass die Kameraden mich so eigenartig ansahen. Beneideten sie mich etwa um den Druckposten? Aber es berührte mich nicht.
An der Westfront, in der Normandie, hatte ich im Schützengraben gelegen und erlebt, wie einigen die Nerven versagten, manchen der Heimatschuss traf. Und sie freuten sich mitunter noch darüber, waren glücklich, dass sie rauskamen aus dem Elend, aus dem Dreck, der von unsrem Blut getränkt war.
Ich hatte auch erlebt, dass Kameraden überliefen. Das hätte ich nie gekonnt, obwohl mir ebenfalls vieles missfiel. Doch die Heimat verraten? Nein, ich war Deutscher, und die Desertion setzte ich der Kapitulation gleich. Aber ein Deutscher kapitulierte nicht, niemals. Das hatte ich in der Schule gelernt, in der HJ und bei der Wehrmacht hörte ich das Gleiche. Und hatte es nicht auch der Führer gesagt?
Dann wurde ich verwundet. Sechs Wochen lag ich im Lazarett. Ich bekam das Verwundetenabzeichen in Silber. So richtig freute es mich nicht. Diesmal war ich dem Tod entronnen. Und das nächste Mal?
Ich hatte keine Angst, nein, das Gefühl war mir längst fremd geworden. Nicht mal 1942, in Norwegen, behelligte es mich übermäßig. Dabei war ich damals erst achtzehn. Mir erschien das Ganze wie ein Nervenkitzel, als Spiel, in dem nur die Stärksten bestehen. Und zu ihnen wollte ich gehören. In der Normandie dachte ich schon etwas anders. Ich sah, dass die hohen Offiziere selten fielen, und die ersten Gedanken über den Sinn und Zweck des Krieges drängten sich mir auf. Zwar sollte ein deutscher Soldat nicht denken, sondern Befehle ausführen, aber was sollte ich tun, wenn die Gedanken nun mal auftauchten und sich im Bewusstsein festbissen?
Doch jetzt war ich ja in Jugoslawien. Ich begleitete den Oberleutnant, fühlte mich fast wie sein Schatten. Er behandelte mich weiter anständig, wenn auch mit einer merklichen Überheblichkeit. Manchmal meinte ich, aus seinen Blicken und seinem Verhalten zu entnehmen, dass er Angst hatte; vielleicht vor einem Attentat. Dann suchten seine Augen nach meiner MPi, auf deren Feuerstöße er anscheinend vertraute.
Minuten später erreichten wir das Dorf. Niedrige, farbig gestrichene Häuser gaben ihm das Gepräge. Am Straßenrand saßen auf roh gezimmerten Bänken ältere Männer. Sie rauchten stumm ihre Pfeifen und blickten finster.
Im „Casino“ war um diese Zeit fast nichts los. Wir nahmen nahe der Theke Platz, an einem Tisch, der für die Wehrmacht freigehalten wurde. Reserviert war außerdem ein Nebenraum für Offiziere. Dort blieben sie abends und nachts unter sich. Nur einige jugoslawische Mädchen duldete man zeitweilig.
Der Oberleutnant hatte Wein bestellt, den wir aus klobigen Gläsern tranken. Während er sich in eine Zeitung vertiefte, schaute ich mich, noch ein wenig müde, da ich schlecht geschlafen hatte, gelangweilt um. Doch schlagartig war ich hellwach, als ich die junge Frau bemerkte, über deren Schultern langes, schwarzes Haar fiel. Sie sah, derweil sie sich dem Tresen näherte, zu mir, und unsre Blicke griffen für Sekunden ineinander. Fast gleichzeitig tauchten vor mir Bilder auf, die mich, was sich vor kurzem ereignet hatte, erneut erleben ließen.
Drei Lastkraftwagen holpern über einen schmalen, unebenen Fahrweg. Rechts und links dehnt sich üppiger Wald. Undurchdringlich wirkt das Unterholz. Auf den Sitzbänken des ersten Wagens hocken neben mir Soldaten. Da ich für den Oberleutnant etwas in der Stadt zu erledigen hatte, bin ich mitgefahren. Auf den beiden LKW, die uns folgen, befinden sich Lebensmittel.
Plötzlich quietschen Bremsen, und die Wucht, mit der unser Wagen vor einem gefällten, quer liegenden Baum stoppt, drückt mich so hart gegen meinen rechten Nebenmann, dass es schmerzt. Schreie und Flüche schallen, dann bricht die Hölle los. Geschosse aus LMGs surren, schwirren und pfeifen, bohren sich in die Holzteile, zerfetzen die Plane unsres Wagens. Einige Kameraden scheinen getroffen zu sein. Sie stöhnen laut. Wir werfen uns auf den Boden, robben vom Fahrzeug … Unser SMG speit wenig später Garben von Blei aus. Doch wo ist der Gegner, wohin zielen?
Etliche – unter ihnen ich – dringen geduckt in den an dieser Stelle besonders dichten Wald ein. Dornen zerkratzen uns Hände und Gesichter, fetzen an den Uniformen. Wir beachten es nicht. Ich erkenne, dass ich am weitesten vorgerückt bin. Wenige Meter vor mir beginnt ein Kahlschlag. Ich robbe hin, sehe auf der anderen Seite eine verdächtige Bewegung und schieße. Meine Schüsse werden erwidert. Erdfontänen spritzen dicht vor mir auf, Sand rieselt über meinen Nacken. Als es still bleibt, hebe ich vorsichtig den Kopf. Ich sehe schräg vor mir – keine vierzig Meter entfernt – eine weibliche Gestalt, von vereinzelten Büschen kaum gedeckt, auf den nahen Wald zulaufen. Bevor ich die MPi erneut anlege, ist sie im schützenden Unterholz verschwunden. Allerdings habe ich auch gezögert. Und ob ich auf sie geschossen hätte, auf eine Frau?
Friedliche Stille breitet sich nun wie ein Schleier über den Wald, und ich krieche durch das Unterholz zurück zur Straße. Hier sieht es traurig aus. Drei Kameraden hat der heimtückische Überfall getötet, fünf sind erheblich verletzt worden.
Als der Einheits-Kommandeur den Sachverhalt erfährt, sagt er: „Strafaktion!“
Im Dorf werden Zivilpersonen auf den Marktplatz getrieben. Und ich bin im Einsatz, weil der Oberleutnant auch da ist, und weil er mir den Befehl gegeben hat mitzumachen.
Die Sonne sengt, der Schweiß rinnt, die Menge der Zivilisten auf dem Marktplatz nimmt zu. Der Oberleutnant leitet die Aktion.
„Wer hat sich an dem Überfall auf die deutschen Lastwagen beteiligt?“, lässt er durch den Dolmetscher – einen Dorfschullehrer – fragen.
Die Gefangenen schweigen.
„Wer kann Angaben machen?“
Drohend hallt die laute, schnarrende Stimme über den Platz. Doch wieder nur eisiges Schweigen.
„Jeden fünften erschießen!“, ordnet der Oberleutnant an. Er sagt es, ohne große Erregung.
Einige werden aus der Menge herausgezerrt und etwas abseits getrieben. Dumpf klatschen die Gewehrkolben auf die Rücken sich Sträubender. Soldatenstiefel treffen die mageren Körper der Jugoslawen.
„Legt die Waffen an!“, befiehlt der Oberleutnant.
Bedrückende Stille lastet auf dem Platz. Soldaten heben die Maschinenpistolen. Da kommt Bewegung in die größere Gruppe. Eine Gasse öffnet sich, und zwei Männer treten heraus. Sie gehen langsam auf den Oberleutnant zu. Sobald er erfahren hat, dass sie sich als Partisanen bekennen, befiehlt er: „Abführen! Die anderen lasst laufen!“
Während sich die Menge zerstreut, erfasst mein Blick die langen, schwarzen Haare einer Jugoslawin. Sie läuft nahe an mir vorbei. Um ihre Mundwinkel zuckt es, und sie atmet hastig. Ihre Augen, erkenne ich, leuchten fast so blau wie die Adria, und ich denke an einen wolkenlosen sommerlichen Himmel, der diese Farbe auch manchmal annehmen kann. Sobald ihr Blick mich streift, sehe ich, dass sich ihre Pupillen verengen, und ihre Miene einen Ausdruck erhält, den ich nicht deuten kann. Aber ich glaube, dass ich ihr schon mal begegnet bin. Als mir in den Sinn kommt, dass ich sie auf dem Kahlschlag gesehen haben könnte, spüre ich, wie es mir die Kehle zuschnürt.
Am nächsten Tag muss unsre Einheit auf dem Marktplatz antreten. Die beiden Gefangenen werden vor die Front gestoßen. Sie können kaum laufen, und nur mühsam halten sie sich aufrecht. Doch ihr Wille scheint ungebrochen, obwohl man sie in der Nacht gefoltert hat.
Jetzt dröhnen die Trommeln. Meine Hände ballen sich zur Faust, ohne dass ich es will. Ich denke daran, dass die Verurteilten ihre Heimat lieben, dass sie ihr Leben für ihre Landsleute opfern. Und dann zerreißen Schüsse meine Überlegungen, Schüsse, die für die beiden Männer den Tod bedeuten.
Oberleutnant Zähler las immer noch in der Zeitung. Er beachtete mich nicht. Doch in mir war Unruhe, und ich fühlte ein Prickeln, das mich befiel, wenn ich sehr erregt war. Wieso eigentlich? Weil dort drüben eine junge Frau am Tisch saß, die ich zu kennen glaubte? Mein Blick glitt wieder zu ihr. Doch sie bemerkte es nicht. Sie trank Sodawasser. Sobald sie ihr Glas geleert hatte, erhob sie sich. Sie wiegte sich leicht in den Hüften, während sie an unsrem Tisch vorbeiging, um das Lokal zu verlassen. Ihr Blick huschte über mich hinweg. Oder täuschte ich mich? Ob sie mich überhaupt beachtete, mich, einen deutschen Gefreiten? Aber ich sah wieder das klare Blau ihrer Augen, so rein und durchsichtig wie Kristall, und ihren Mund, der mich an rote, reife Kirschen erinnerte. Doch da war sie schon vorbei. Ihr langes Haar hüllte den Nacken ein, fiel wie ein schwarzer Flor weich und glänzend über ihre Schultern.
Als ich sie so dahingehen sah, war ich mir fast sicher, dass ich sie vor wenigen Tagen wirklich auf dem Kahlschlag gesehen hatte. Mein Herz krampfte sich zusammen, meine Fingernägel gruben sich in die Handteller. Was sollte ich tun? Den Oberleutnant informieren?
Doch da musste ich an meine Schwester Marie denken, die in einigen Wochen achtzehn Jahre alt wurde, und daran, dass nur sie mir noch von meinen Geschwistern verblieben war. Meine zwei älteren Brüder waren gefallen, der eine auf Kreta, der andere in Stalingrad. Und inzwischen hatte der Juni 1944 begonnen. Vielleicht war nun ich bald fällig, zu sterben für Führer und Vaterland? Meinen Vater konnten sie ja nicht mehr einziehen, da er aus dem Ersten Weltkrieg als Krüppel heimgekehrt war. Damals befahl noch der Kaiser, und jetzt war es der Führer. Doch was hatte sich geändert? Im Grunde genommen wohl nur der Name des Herrschers.
Auch an den Tag musste ich denken, an dem ich den Gestellungsbefehl zugeschickt bekam. Kaum ausgelernt hatte ich damals! Werkzeugmacher war ich geworden, wie der Vater. Die Arbeit hatte mir Freude bereitet, und ich kümmerte mich um nichts weiter. Ich wollte vorwärtskommen, hatte große Pläne. Freilich, bei den Pimpfen und in der HJ war ich gewesen. Meine Eltern wollten es zwar nicht, aber ich machte trotzdem mit, wollte kein Feigling sein. Die anderen hätten mich sonst verachtet, ausgestoßen aus ihrer Gemeinschaft. Ich wurde hart in dem Verband, lernte, meine Gedanken und Gefühle zu verbergen. Dort sagte man auch oft, mit einem Lächeln auf den Lippen zu sterben, solle schön sein. Man sprach vom Heldentod. Ob meine Brüder auch gelächelt haben, als sie in den letzten Zügen lagen, oder ob sie gar auf ihn, den Führer, fluchten?
Noch sehr gut erinnerte ich mich an den Abschied auf dem Bahnsteig. Meine Tante Marianne sagte: „Kämpfe tapfer für den Sieg, mein Junge!“, und lächelte dabei. Sie hatte keine Söhne. Doch meine Mutter weinte hemmungslos, und auch Vater zerdrückte einige Tränen in den Augenwinkeln. Kein Wunder, hatte er doch schon damals einen Sohn verloren. Meine Schwester klammerte sich an mir fest. Sie wollte mich nicht fortlassen. Gewaltsam musste ich mich von ihr losreißen, als der Zug anfuhr.
Dieses Bild hatte sich fest in meinem Gedächtnis eingenistet, dass ich es oft vor mir zu sehen glaubte: in Norwegen, in den Schützengräben der Normandie und nun hier, in Jugoslawien, in diesem Augenblick.
Ob das Mädchen, das soeben das Gasthaus verließ, auch einen Bruder hat, den es liebt, der unglücklich wäre, wenn es nicht mehr lebte?
Was waren das für Gedanken, die sich in mein Bewusstsein bohrten, wie ein Drehstahl ins rotierende Werkstück? Ich wusste es nicht. Aber sie waren da, wie die klobigen Gläser mit Wein vor mir auf dem Tisch und der schnauzbärtige, ölig lächelnden Wirt hinter der Theke. Ich schwieg und sagte dem Oberleutnant nichts von meinen Vermutungen, die eigentlich schon Gewissheit waren. Vielleicht, weil ich an meine Schwester dachte, die ich gern mochte, und die jetzt nur noch einen Bruder hatte?
Wenig später erschien Brando, dem der Reifenwechsel problemlos gelungen war. Wir fuhren langsam durchs Dorf, das sich mit seinen niedrigen, in die Landschaft duckenden Häusern etwa einen Kilometer dahinzog. Wir wohnten fast am anderen Ende, in einem Gebäude, das etwas abseitsstand. Unterwegs sagte der Oberleutnant: „In der Zeitung habe ich gelesen, dass uns die Alliierten aus dem Westen angreifen. Aber wir werden sie in den Atlantik zurücktreiben, wo sie ersaufen sollen wie junge Katzen. Unsren Endsieg können auch sie nicht verhindern!“
Ich nickte zustimmend. Doch innerlich lächelte ich, lächelte über die Lügen in der Presse und im Rundfunk, die dem müde werdenden deutschen Soldaten neuen Auftrieb verleihen sollten. Ich kannte die Situation in der Normandie und dachte deshalb anders als der Oberleutnant.
Aber ich sagte es ihm nicht.
Es war noch dämmrig, als ich am nächsten Morgen durch lautes Klopfen gegen mein Zimmerfenster aus dem Schlaf geschreckt wurde. Ich schnellte in die Höhe und erkannte sofort, woher die Geräusche drangen. Hastig griff ich nach der MPi, die nachts immer geladen neben mir lag. Dann näherte ich mich vorsichtig dem Fenster. Als ich es fast erreicht hatte, sah ich im Zwielicht undeutlich die Konturen eines Uniformierten, der ungeduldig von einem Bein auf das andre trat. Gerade wollte er mit einer Faust wieder gegen den Fensterrahmen trommeln, als ich die Flügel öffnete. Ich erkannte meinen Freund.
„Na endlich“, rief er verstimmt. „Du hast vielleicht einen gesegneten Schlaf. Man könnte…“ Er brach ab und fragte: „Ist der Alte da?“
„Ja, der schläft noch.“ Ich wusste, dass der Oberleutnant spät ins Bett gegangen war, weil er wie gewöhnlich den deutschen Soldatensender aus Belgrad gehört hatte, wo zum Zapfenstreich das sehnsuchtsvolle, von ihm geliebte Kriegslied „Lili Marleen“ gespielt wurde.
„Dann hol ihn aus den Federn. Befehl vom Stab: Überraschungsaktion gegen ein Partisanennest. Die Kompanie wartet schon am Dorfrand. Der Alte soll wegen der Einzelheiten den Stab anrufen!“
Brando drehte sich um und stiefelte auf die andere Seite, wo der Wagen stand.
Der Oberleutnant schlief in einem Zimmer, dessen Fenster auf den Hof führten. Anscheinend glaubte er, dort sicherer zu sein. Daran musste ich denken, während ich die wenigen Meter über den Gang zu seinem Zimmer zurücklegte. Ich klinkte an der Tür. Sie war verschlossen wie immer. Nun klopfte ich energisch dagegen. Ich hörte schlurfende Geräusche aus dem Raum, und dann knirschte der Schlüssel im Schloss. Die Tür wurde aufgestoßen, und der Oberleutnant stand mir gegenüber. Er wirkte blass. Aber vielleicht lag das auch an dem Halbdunkel, das im Gang herrschte.
„Was gibt’s, Wude?“, fragte er und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Ich informierte ihn und sagte, dass man bereits bei den Einsatzwagen auf ihn warte, er wegen Einzelheiten für die geplante Aktion beim Stab anrufen solle, bevor er sich mit mir zur Truppe begebe. Er bekam gleich Verbindung zum verantwortlichen Offizier, hörte gespannt zu, erklärte zackig, dass er das befohlene Vorgehen verstanden habe und bedeutete mir, dass ich ihm helfen sollte, Uniform und Stiefel anzuziehen. Da wir es für den Ernstfall mehrfach geübt hatten, schafften wir es schnell. Nach wenigen Minuten saßen wir bereits im PKW, der mit hoher Geschwindigkeit durchs Dorf fuhr und Unmengen von Staub aufwirbelte.
Am Ortsende befanden sich die drei Lastwagen. Soldaten standen um die Fahrzeuge herum. Als unser Auto fast heran war, ließ ein Fähnrich sie antreten. Brando bremste dicht vor der Kompanie. Die Räder wühlten sich in den sandigen Boden. Der Oberleutnant stieg aus und ließ sich Meldung erstatten. Dann wandte er sich an die gespannt Zuhörenden: „Kameraden! Uns steht eine gefährliche Aufgabe bevor – die Liquidierung einer Partisanengruppe, deren Versteck unsere Kundschafter aufgespürt haben. Ich verlange bedingungslosen Einsatz! Sobald es zum Gefecht kommt, gibt es für die Heckenschützen keinen Pardon!“
Kurz danach fuhr unser Wagen schon wieder die staubige Straße entlang. Meinen Platz im Fond hatte der Fähnrich eingenommen, und ich saß vorn neben Dieter.
Es war inzwischen fast hell. Über uns verblasste die Morgenröte immer mehr. Sie schien mit dem matten Blau des Himmels zu verschmelzen.
Aus dem Gespräch, das der Oberleutnant mit dem Fähnrich hinter mir führte, entnahm ich, dass unser Ziel eine Schlossruine war, die sich versteckt im Wald befinden sollte. Das bedeutete, wie ich später begriff, dass wir noch ein beträchtliches Stück zu Fuß bewältigen mussten.
Hinter uns brummten die Motoren der Lastkraftwagen. Manchmal heulten sie gequält auf, wenn sich die Räder in den Sand fraßen und nur mit Mühe vorwärtskamen.
Während unser Auto dahinfuhr, drängten sich unerwartete Überlegungen in mein Bewusstsein. Als Halbwüchsiger hatte ich einen Roman gelesen, der von den Türkenkriegen im Mittelalter handelte und die Schlacht bei Mohács im Jahr 1526 schilderte, wo die ungarischen Truppen vernichtend geschlagen wurden, und die Sieger anschließend bis Pest vordrangen.
War die Situation in Jugoslawien jetzt nicht ähnlich wie damals? Auch wir waren in das fremde Land eingefallen, dessen Bewohner uns nichts getan hatten. Während sich die Türken einst auf ihre Krummsäbel, Arkebusen und Kanonen gestützt hatten, vertrauten wir auf unsere Flugzeuge, U-Boote, Panzer und Maschinengewehre. Sie stellten unsere Streitmacht dar. Doch würde sie ausreichen, den Freiheitswillen der Jugoslawen dauerhaft zu unterdrücken? Ich zweifelte daran. Auch die Türken hatten sich, durch zahlreiche Volksaufstände zunehmend zermürbt, schließlich aus den okkupierten Gebieten zurückziehen müssen.
Noch in meine Gedanken vertieft, erreichten wir den Waldrand. Auf einem schmalen unbefestigten Weg, über den unsere LKWs gerade noch fahren konnten, gelangten wir zunächst weiter. Uns umgaben uralte, knorrige Eichen; zwischen ihnen schimmerten die glatten Stämme von Buchen, Ulmen und Linden im Halbdunkel. Der Boden war jetzt nicht mehr sandig. Trotzdem kamen die Wagen nur langsam voran, da an manchen Stellen die niedrig hängenden Äste bis fast auf die Mitte des Wegs reichten. Dort mussten die Fahrer besonders geschickt lavieren. Immer unebener wurde der Waldweg, und immer größere Hindernisse türmten sich vor uns auf, so dass es irgendwann gar nicht mehr weiterging. Da ließ der Oberleutnant halten, vertiefte sich noch einmal in die Karte und entschied: „Wir müssen marschieren!“
Die Kompanie formierte sich. Der Oberleutnant erteilte knappe Anweisungen, und nachdem wir eine Wachmannschaft bei den Wagen zurückgelassen hatten, schritten wir zu Fuß vorwärts.
Ich ging neben dem Oberleutnant. In seinem Gesicht zeichneten sich deutlich die Spuren der Strapazen ab. Schweiß perlte auf seiner Stirn. Dabei hatte er es verhältnismäßig leicht. Er brauchte nur seine Pistole und die Kartentasche zu tragen. Viele Kameraden hingegen schleppten MGs und Munition. Die meisten keuchten unter den Lasten. Ihr Gang wurde immer schleppender. Sie stolperten mehr, als sie gingen.
Wir erreichten eine Stelle, an der sich der Weg gabelte. Der Oberleutnant ließ halten. Mit einem großen Taschentuch wischte er sich über die feuchte Stirn, und während er sich nochmals in die Karte vertiefte, schnaufte er heftig.
„Wir gehen nach rechts“, entschied er. „Nun ist besondere Vorsicht geboten. Das Versteck der Partisanen kann nicht mehr weit weg sein.“
Der Wald lichtete sich zunehmend. Wir schienen wirklich dicht vor unsrem Ziel zu sein. Während ich es dachte, erblickte ich auch schon die löchrigen, teils geborstenen Mauern des ehemaligen Schlosses. Grau und düster ragten sie in die Höhe. Die Ruine stand auf einer Brache, die mit hohem, dichtem Gras bewachsen war.
Der Oberleutnant ließ abermals halten und gab leise, fast flüsternd, seine Anweisungen. „Sie arbeiten sich bis zum Waldrand vor. Dort beziehen Sie Stellung und warten auf weitere Befehle! Alles klar?“
Er blickte ringsum. Die Soldaten nickten stumm. Einer nach dem anderen verschwand im dichten Unterholz.
„Und wir robben weiter vor, um die Lage zu peilen“, sagte er zu mir. „Vielleicht haben die Schurken bereits Lunte gerochen und sich feige aus dem Staub gemacht, wie es zu ihrer Strategie gehört und in letzter Zeit öfter der Fall gewesen ist.“
Wortlos zwängte ich mich zwischen das Unterholz. Der Oberleutnant blieb nahe neben mir. Die Stille, die uns umgab, erschien mir wie die Ruhe vorm Sturm. Als wir fast die Lichtung erreicht hatten, fielen plötzlich Schüsse. Die Projektile flogen dicht über uns hinweg. Wir pressten unsere Köpfe auf den Waldboden. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir im Feuerhagel lagen. Als nicht mehr in unsre Richtung gefeuert wurde, blickte ich zum Oberleutnant. Aus seinem Gesicht war jede Farbe gewichen, und die Augen flackerten unstet. Er hat Angst, dachte ich und sah in diesem Moment bestätigt, was ich auf Grund meiner täglichen Wahrnehmungen längst vermutet hatte.
Als auch der Oberleutnant begriff, dass es in unserer Nähe keine Einschläge mehr gab, fasste er sich unerwartet schnell.
„Sollen sie ruhig ballern“, sagte er. „Wir haben sie umzingelt, und sie müssten mit dem Teufel im Bunde stehen, wenn sie lebend aus ihrer Mausefalle kämen.“
Ich wollte etwas erwidern, kam aber nicht dazu, weil er bereits fortfuhr: „Wude, Sie robben noch ein Stück vor, versuchen, Schwachstellen des Gegners auszuspähen und teilen mir Ihre Beobachtungen mit, damit ich unser weiteres Vorgehen bestimmen kann!“
Innerlich sträubte sich etwas in mir gegen die für mich ziemlich bedrohliche Anordnung, aber ich wagte nicht zu widersprechen, da ich mir meiner Stellung bewusst war. Mein Vorgesetzter hatte mir einen Auftrag erteilt, und als sein Untergebener musste ich ihn befolgen.
„Zu Befehl, Herr Oberleutnant!“, sagte ich deshalb und begann, erneut zu robben. Doch in mir arbeitete es heftig. Er ist feige, dachte ich. Ob mir etwas passiert, interessiert ihn nicht. Hauptsache, er rettet die eigene Haut. Wo ist denn das Vorbild des deutschen Offiziers, von dem ich so viel reden hörte, als ich noch nicht Soldat war? Und warum trug ich überhaupt die feldgraue Uniform? Weshalb musste ich die Befehle dieses Feiglings ausführen?
Solche Gedanken sind gefährlich, begriff ich. Du darfst nicht mehr darüber nachdenken, Gefreiter Wude! Du musst gehorchen! Eine andre Möglichkeit bleibt dir nicht, wenn du heil in die Heimat zurückkehren willst.
Ich überlegte wieder nüchterner. Ja, ich musste gehorchen. Eine Befehlsverweigerung hätte für mich wahrscheinlich den Tod bedeutet. Doch ich wollte leben, wollte Marie und meine Eltern wiedersehen, eines Tages meine Jugend nachholen, die mir der Führer und seine Gefolgsleute geraubt hatten. Deshalb robbte ich bis an den Rand der Lichtung, während der Oberleutnant hinter einem Baum lag, durch dessen dicken Stamm kein Projektil dringen konnte.
Unbehelligt erreichte ich mein Ziel: eine Bodenwelle, die mir Sichtschutz bot. Als ich vorsichtig über ihren Rand lugte, erkannte ich, dass in den Ruinenmauern schwarze Löcher gähnten, die ehemals Fenster gewesen waren. Aus einer dieser Öffnungen blitzte in unregelmäßigen Abständen ein grelles Mündungsfeuer auf – ein Maschinengewehr! Es streute die Kugeln blindlings in den Wald, wo unsre Soldaten hinter ihren Deckungen lagen.
Vorsichtig robbte ich zum Oberleutnant zurück und meldete, was ich beobachtet hatte. Seine wasserhellen Augen schauten zur Lichtung. Die Lider waren zusammengekniffen. Mit seinen kräftigen, gelblichen Zähnen nagte er an der Unterlippe. Über der Nasenwurzel stand eine tiefe, senkrechte Falte. Er schien angestrengt zu überlegen. Ohne seinen Blick zu wenden, sagte er völlig unerwartet: „Wir werden das Partisanennest stürmen!“
Mir lief es eiskalt über den Rücken; denn ich erkannte sofort die verheerende Tragweite des Satzes. „Aber das ist reiner Wahnsinn!“, stieß ich erregt hervor. „Keiner erreicht lebend die Ruine!“
Nachdem ich die Worte fast geschrien hatte, richtete ich mich halb auf und blickte zum Oberleutnant, um mich zu vergewissern, ob er es wirklich ernst meinte. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass ich Sekunden meinen Dienstgrad vergessen und mich unbotmäßig verhalten hatte.
„Hier befehle ich, Gefreiter, nur ich!“, maßregelte er mich laut, und seine Stimme drohte zu kippen. Das Gesicht war erneut fahl geworden, und die Augen stierten zwischen schmalen Schlitzen hervor. Ich fürchtete, er würde gleich nach der Pistole greifen. Doch er beherrschte sich.
„Es ist jetzt ein Viertel vor acht“, fuhr er kurz danach fast gelassen fort. „Um acht beginnt der Angriff. Sagen Sie den Männern Bescheid, die am nächsten liegen. Sie sollen den Befehl weitergeben!“
Mit bleiernen Gliedern schlängelte ich mich durchs Unterholz. Meine Kehle war ausgetrocknet, Dornen zerkratzten mir Hände und Gesicht. Ich spürte es nicht. Der Alte ist verrückt geworden, dachte ich, während sich das flaue Gefühl in mir noch verstärkte.
Irgendwo, fiel mit ein, musste auch Dieter liegen. Vielleicht sollte ich gerade an ihn den Befehl weitergeben, der auch ihn das Leben kosten konnte. Ich presste meine Fingernägel in die Handteller, bis es schmerzte.
Dort vorn lag einer im Gebüsch. Ich änderte etwas die Richtung und kroch zu ihm. Als ich fast heran war, drehte er sich um, und ich erkannte, dass es tatsächlich Dieter war.
„Na, alter Junge, bringst du gute Nachricht?“, fragte er in seiner gewohnt trockenen Art.
„Nein, im Gegenteil“, erwiderte ich. „Befehl vom Oberleutnant: Um acht beginnt der Sturmangriff auf die Ruine!“
„Dauert dem Alten wohl zu lange? Oder braucht er wieder mal ‘ne Auszeichnung?“
„Ich weiß es nicht. Mir ist nur eins klar: Der Angriff bedeutet Selbstmord! Ich hab Angst um dich, um uns.“
„Hier darf man nicht sentimental werden. Es wird schon schiefgehen. Nicht jede Kugel trifft!“
„Ein schwacher Trost.“
„Was willst du?“, fragte er sarkastisch. „Uns bereitet es doch Vergnügen, für die Vorgesetzten den Schädel hinzuhalten.“
„Das ist nicht dein Ernst!“
„Natürlich nicht. Aber was ändert das schon? Keiner fragt danach, was ich möchte. Nur zu gehorchen und kämpfen hat der deutsche Landser!“
„Und man kann gar nichts dagegen unternehmen!?“
Dieters Blick tastete über mein Gesicht. Für Momente verweilte er in meinen Augen. Dann meinte er: „Du könntest zu denen gehen, die dort drüben in der Ruine auf der Lauer liegen.“
„Aber die kämpfen doch auch!“
„Ja, das stimmt. Sie sind allerdings im Recht, wenn sie es tun. Schließlich ist es ihr Land, in das wir eingedrungen sind … Doch wir reden zu viel. Wir müssen den Befehl des Alten weiterleiten, sonst werden wir wegen Renitenz an die Wand gestellt.“