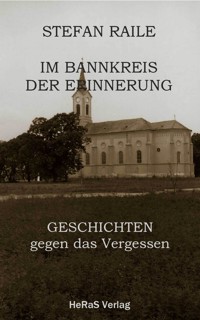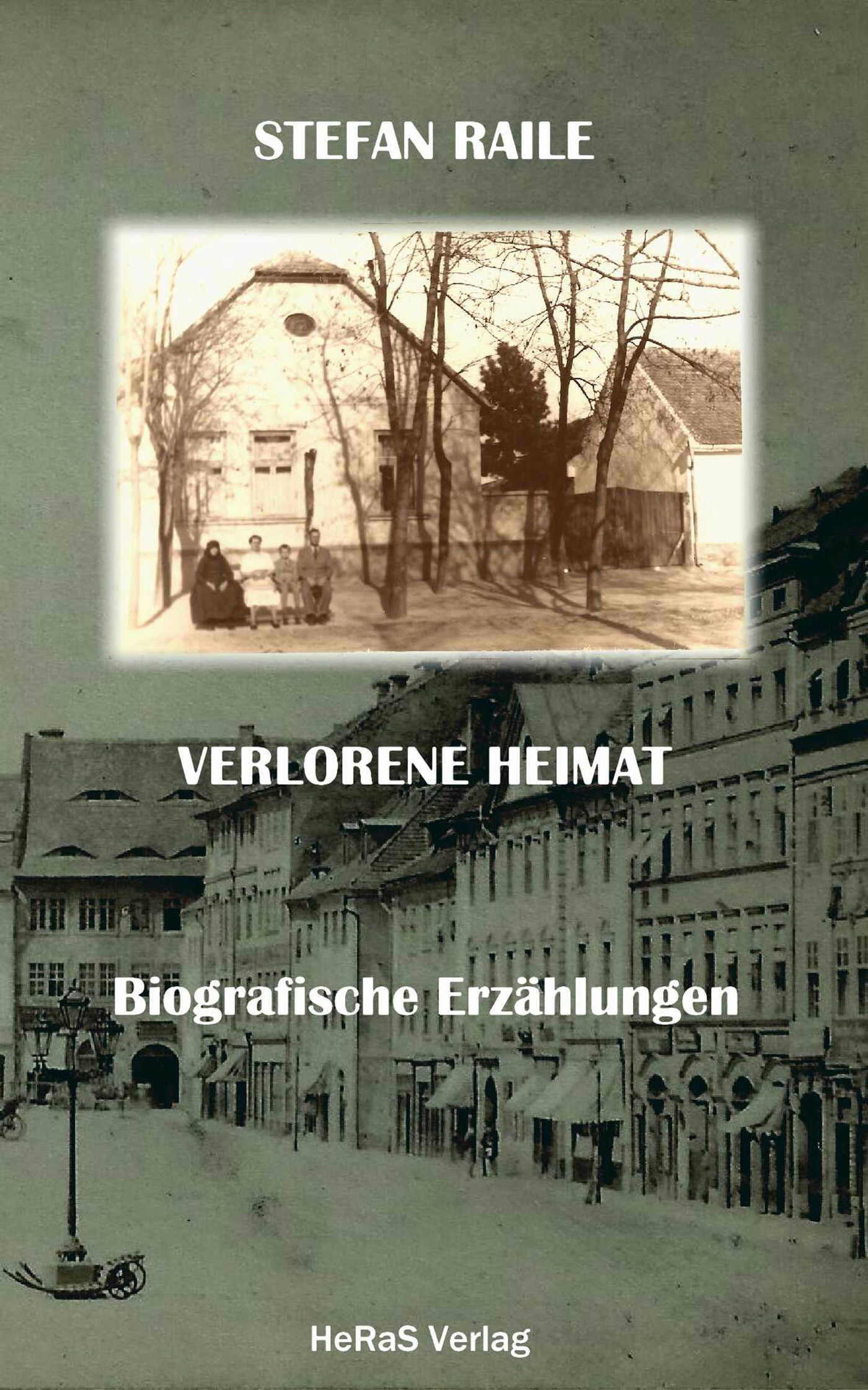
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band gestaltet authentisch, wie ein Ich-Erzähler im August 1947 aus Vaskút, seinem ungarischen Heimatdorf, in dem er eine behütete Kindheit erlebt hat, mit den Eltern, der Großmutter und über tausend weiteren deutschen Bewohnern in die sowjetische Besatzungszone vertrieben wird. Die Familie verschlägt es nach Görlitz, wo es allen schwer fällt, sich in dem ablehnenden Umfeld zu behaupten. Von Sehnsucht gedrängt, kehrt der Erzähler als Erwachsener viele Male ins vertraute Dorf am Rande der Puszta zurück und beginnt, über das, was ihm in beiden Ländern widerfahren ist, auf nachvollziehbare Weise zu schreiben, um das Geschehene als Zeitzeuge zu bewahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Raile
Verlorene Heimat
Biografische Erzählungen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
MEINE KINDHEIT AM RANDE DER PUSZTA
DER SCHWARZE REITER
GEDANKENFLUG
GEDÄCHTNIS
DER PATERNOSTER
VERSUCHUNG
DACHTRÄUME
DER MUSIKLEHRER
DAS LINEAL
FETTLEBE
SCHICKSAL
BEGEGNUNG
GANYMED
SOMBRERO
DIE MELONE
LETZTER BESUCH
DER UNTERSCHIED
WEICHSELKIRSCHE
GRABGEDANKEN
DAS HAUS
DAS ZIMMER
ENTGLEISUNG
KOLLISION
ANNÄHERUNGSVERSUCHE
TODESNACHRICHT
ZWEIFEL
GEWISSHEIT
Impressum neobooks
MEINE KINDHEIT AM RANDE DER PUSZTA
Impressum
©HeRaS Verlag, Rainer Schulz, Berlin 2020
www.herasverlag.de
Layout Buchdeckel Rainer Schulz
ISBN 978-3-95914-206-2
November 1937 – August 1947
1
Der 6. November 1937, ein Samstag, an dem mich meine Mutter, Maria Schoblocher, geborene Raile, um 18.30 Uhr im großen, östlich der Donau gelegenen Dorf Vaskút mit Hilfe einer resoluten Hebamme zur Welt brachte, soll neblig und für die Jahreszeit in einer Gegend, wo ich als Kind wie Großmutter Gertrud oft noch bis Ende Oktober barfuß gehen konnte, ungewöhnlich frostig gewesen sein. Übersetzt heißt mein Geburtsort „Eisenbrunnen“, doch auf den Straßenschildern, die gleichrangig unter der Originalbezeichnung stehen, wird er „Waschkut“ genannt und ist damit lediglich an die deutsche Orthografie angepasst worden.
Mutter empfand ihre Niederkunft, die im alten, von den ersten Siedlern fast 200 Jahre vorher errichteten, Haus erfolgte, wie ich später erfuhr, als so schwer, dass sie sich, glaube ich, nicht noch ein Kind wünschte. Aber vielleicht vermutete sie auch, keins mehr bekommen zu können; denn es hatte, seit mein Vater, der Stellmacher Johann Schoblocher, nach der im Januar 1930 mit sehr vielen Gästen gefeierten Hochzeit zu ihr und den Schwiegereltern gezogen war, über sechs Jahre gedauert, bis sie, bereits 27, mit mir schwanger wurde. Möglicherweise lag es ein wenig auch daran, dass man in den kleinen, niedrigen Zimmern durch die aus luftgetrockneten, ungebrannten Lehmziegeln errichteten Zwischenwände selbst sehr leise Geräusche hörte, so dass sich Mutter vielleicht gehemmt fühlte. Doch als Anton Raile, mein Großvater, im Dezember 1936, noch nicht einmal 60 Jahre alt, an einer rätselhaften Krankheit starb, vergingen nur wenige Wochen, bis Mutter die erste morgendliche Übelkeit verspürte und sich, weil sie es nicht mehr bis zum Plumpsklo neben dem Stall, das wir Rettrat nannten, schaffte, im Vorderhof unter einer 35 Jahre zuvor anlässlich der Geburt meiner Tante Rosalia gepflanzten Edeltanne übergeben musste. Im Nachhinein habe ich mich manchmal gefragt, ob etwas dran ist an der landläufigen Meinung, dass erst, wenn jemand die Erde verlässt, Platz für Nachkommen entsteht.
Meine Raile–Großmutter, die während meiner Kindheit für mich zur wichtigsten Bezugsperson werden sollte, war, als ich geboren wurde, 53 Jahre alt, verhältnismäßig klein, sehr schlank und außergewöhnlich vital.
Wie sie mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, habe ich im folgenden Abschnitt, der meinem Roman „Letzter Abschied“ entliehen ist, erzählt: Aus Gründen, die für mich unergründlich geblieben sind, stand Großmutters Bett einst in unsrer Winterküche. Wenn ich mich morgens zu ihr schlich, täuschte sie vor, langsam zu erwachen, schien mich überrascht zu bemerken und begann, sich flüsternd mit mir zu unterhalten.
Unsre Gespräche endeten fast immer damit, dass ich mir wünschte, sie solle mir was erzählen.
„Was denn?“, fragte sie.
„Was dir einfällt“, erwiderte ich.
Sie kannte unzählige Geschichten. Das Märchen vom goldenen Vogel, die Taten des Räuberhauptmanns Mácsanszki und Großvater Antons Erlebnis an der Piave, wo er, um den Rückzug eines Truppenteils zu sichern, als MG-Schütze mit zwei Gehilfen einen Frontabschnitt halten musste, beeindruckten mich am stärksten. Großmutter erzählte so anschaulich und glaubhaft, als wüsste sie, wo sich der geheimnisvolle Vogel aufhielt, hätte sie Großvater im Schützengraben selbst die Munition gereicht, wäre sie Mácsanszki, der seine Beute unter den Armen verteilte, fast täglich begegnet.
Was ich erfuhr, verschmolz auf wundersame Weise mit dem, was ich im Zimmer wahrnahm: Die Wanduhr mit den schweren Ganggewichten tickte lauter und schneller, wenn sich die Spannung steigerte, im rötlichen Schein, den das an kalten Tagen bereits entfachte Feuer durch die noch offene Sparherdtür warf, erschienen die bärtigen Gesichter der Räuber, Schneewittchens Augen, die im Halbdunkel leuchteten, wurden zu rettenden Lichtern für das kleine Mädchen, das sich im finsteren Wald verirrt hatte, und das Kruzifix über uns funkelte wie das Gefieder des goldenen Vogels.
2
Da von den mehr als 4700 Einwohnern die Vaskút damals hatte, fast alle katholisch waren wie wir, wurde ich am 9. November, einem Dienstag, nach vorausgegangener Vesper in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, die, 1880 eingeweiht, keinen Steinwurf vom Pfarrhaus entfernt steht, während die Glocken läuteten, im Beisein meines Paten Stefan Stehli, dessen Vornamen ich erhielt, und seiner Frau Lisbeth mit dem üblichen Zeremoniell getauft.
Wieder daheim, legte mich Mutter, erfuhr ich später, in die von Vater gebaute Wiege, und die Erwachsenen setzten sich in der gedielten Winterküche an den großen Tisch, tranken auf mein Wohl von dem Schiller, der aus unsren vorjährigen Trauben gekeltert worden war und aßen, was Großmutter auf dem Sparherd, wie zu ähnlichen Anlässen üblich, vorbereitet hatte: Tomatensuppe mit Grießklößchen, gekochtes Rindfleisch mit Kren, Hühnerpaprikasch mit Nockerln, Pfirsichkompott, Mohnkuchen und Topfenstrudel.
Sobald abgeräumt worden war, holte Vater zwei Gläser, in die er für Stefan-Vetter und sich Tresterbranntwein goss, um sie in einem Zug zu leeren, damit ich vor Hexen, an die man, noch einem starken, von den Vorfahren überkommenen, Aberglauben verhaftet, dem ringsum mehr oder weniger offen gefrönt wurde, gefeit bleiben sollte. Die Männer, weiß ich, kannten sich bereits näher, seit sie, als sie zeitgleich ein ähnliches Handwerk erlernt hatten und regelmäßig in die obligatorische Sonntagsschule gegangen waren. Später trafen sie sich bei der Levente-Jugend oder, wenn die Kapelle samstags zum Tanz aufspielte, in Lenharts Gasthaus, wobei sie, zunehmend voneinander angetan, so enge Freunde wurden, dass sie sich, als sie kurz nacheinander heirateten und mit Kindern rechneten, gegenseitig zu Taufpaten erkoren, die im Dorf mundartlich heute noch Gödi – oder Gedi?, – und ihre Ehefrauen Godl, deren Vornamen an Mädchen weitergegeben wurden, heißen.
Vater hatte durch seine Hochzeit mehr Glück als Stefan-Vetter, weil er damit nicht Geselle bei seinem Lehrmeister bleiben musste, sondern gleichberechtigt in unsrer Stellmacherwerkstatt, wo zwei Hobelbänke standen, mitarbeiten durfte und sie später, nachdem Großvater gestorben war, selbstständig erfolgreich weiterführte. Was es für ihn bedeutete, als seine Brautwerber mit der erhofften Antwort zurückgekehrt waren, hatte er gleich begriffen. Damit er das in ihn gesetzte Vertrauen der Schwiegereltern und meiner Mutter rechtfertigte, leistete er wesentlich mehr, als sie von ihm erwarteten. Er durchschnitt, um Bohlen zu gewinnen, auf dem Hof mit einer Faustsäge dicke, meterlange Hartholzstämme und fertigte daraus in der Werkstatt nach und nach Fuhrwerke, Pferdeschlitten oder für sehr reiche Bauern, die zu besonderen Anlässen ihren Wohlstand vorführen wollten, gelegentlich auch Kaleschen, die man, vor allem, wenn sie von herausgeputzten Rappen sowie Schimmeln, die oft allein zu galoppieren begannen, in die Kreisstadt Baja oder zur Kirchweih in umliegende Dörfer gezogen wurden, vielerorts bestaunte.
Ging Vater die Arbeit besonders leicht von der Hand, pfiff er gewöhnlich beschwingt, und nur manchmal, wenn ihm sein schon im Herbst 1914 gefallener Vater in den Sinn kam, den er nie bewusst erlebt und als Kind sehr vermisst hatte, summte er die traurige Melodie jenes eindrücklichen Kriegslieds, das von dem Soldaten erzählt, der, sobald die Sonne über einem bosnischen Schlachtfeld sank, mitten unter den Toten lag.
Weil mein Vater, wie Mutter wiederholt betonte, all die Jahre außergewöhnlich fleißig geblieben war, verfügten wir schon etliche Monate nach meiner Geburt über genügend Geld, um statt des alten, abgewohnten, noch reetgedeckten Hauses, vom nächsten Frühjahr bis zum Herbst ein neues zu bauen, was mein Raile-Großvater, damit er sich nicht mehr umgewöhnen musste, bis zu seinem Tod, den er möglicherweise vorausahnte, verhindert hatte.
Da nicht übermäßig gespart werden musste, entstanden sämtliche Mauern aus gebrannten Steinen, das Dach wurde mit besonders harten Flachziegeln gedeckt, und für die Schornsteinköpfe nahm man dunkelrote Klinker, von denen auch heute, nach fast achtzig Jahren, noch nichts abgeblättert ist. Die Räume hingegen erscheinen mir, wenn ich sie mir vorzustellen versuche, nachteilig angeordnet: Vom Säulengang, der, wie bereits erwähnt, mit Efeu zugesponnen war und sommers als schattiger Essplatz diente, führte eine in der oberen Hälfte verglaste Tür zur Winterküche, die zwei Fenster aufwies, das höhere, breitere zur Straße und ein niedrigeres, schmaleres, durch das man die Edeltanne sehen konnte, hofwärts. Rechterhand schloss sich ein verhältnismäßig großes, zweifenstriges Zimmer an, in dem ein runder gusseiserner Ofen stand, der, wenn Mutter winters kräftig mit Holzresten aus der Werkstatt heizte, schnell zu glühen begann und eine jähe, bullige Hitze ausstrahlte, die sich nur am Tag, während der Raum zum Wohnen diente, aushalten ließ. Sobald wir jedoch darin schliefen und uns mit den immer gleichen dicken Federbetten zudeckten, warteten wir sehnsüchtig darauf, dass es sich abkühlte. Möglicherweise empfand ich die Brüte, da ich, weil Mutter vielleicht besonders fürsorglich sein wollte - von zwei Seiten zusätzlich gewärmt -, die Nächte zwischen meinen Eltern auf der „Besucherritze“ verbrachte, was, so gut es auch gedacht war, meiner Wirbelsäule kaum dienlich gewesen sein dürfte. Außerdem wäre ich, falls es noch länger so geblieben wäre, wahrscheinlich frühreif geworden; denn wiederholt entdeckte ich morgens in den Betten vergessene Präservative, deren Verwendungszweck ich erahnte, und einmal, als Vater sich mit Mutter zum Sofa schlich, das hinter einem Tisch an der Fensterwand stand, wurde ich munter und hörte, wie er flüsternd fragte, ob sie das machen wollten, was er „bockas“ nannte, womit er, vornehmer ausgedrückt, koitieren meinte.
Da zwei Räume, die hinter dem beschriebenen Zimmer lagen, kaum oder gar nicht genutzt wurden, ist die gegebenenfalls nicht mal aus Fürsorge, sondern lediglich gedankenlos durch meine Eltern von unsren Vorfahren übernommene Gepflogenheit, die einst wegen der äußerst beengten Wohnverhältnisse entstanden sein mochte, letztlich unverzeihlich. Hätten sie mich in der angrenzenden fensterlosen Stube, zu der es zwei Verbindungstüren gab, eine vom vorderen Zimmer und eine zum Säulengang, die oben verglast war, so dass wenigstens etwas Helle ins sonst finstere Zimmer sickerte, schlafen lassen, wären sie bei jedem durch mich verursachten verdächtigen Geräusch ganz bestimmt aufgeschreckt, um notfalls rechtzeitig nach mir zu sehen.
Schließlich hatten wir ja auch gehört, wie meine Schoblocher-Großmutter, die Juliana hieß, ihren dritten Mann, den Großbauern Josef Hellenbarth, wenn er, von wirren Träumen geplagt, öfter aufschrie, mit gedämpfter Stimme zu beruhigen versuchte. Sie wohnten vom Frühsommer bis zum Spätherbst 1946 in dem stets dämmrigen Raum, bevor sie am 27. November mit dem ersten Transport, der 960 Personen umfasste, samt den wenigen Bündeln, die sie mitnehmen durften, in Güterwaggons gepfercht, nach Bayern gefahren und auf ein armseliges Barackenlager bei Würzburg verteilt wurden, wo sie, glaube ich, viele Wochen ausharren mussten.
Ihr Aufenthalt bei uns war notwendig geworden, weil man sie, als im März und April für zahlreiche aus der Slowakei eingetroffene Telepes-Familien Unterkünfte gebraucht wurden, wie andre „Volksbund“-Anhänger aus ihrem Haus gewiesen und ihnen lediglich gestattet hatte, Kleidung sowie einige persönliche Sachen mitzunehmen. Von einer Stunde zur andern verarmt, sahen sie sich gezwungen, Vater um Hilfe zu bitten, der eine Weile überlegte, ehe er zustimmte. Für sein Zögern gab es mehrere Gründe, von denen ich nur zwei nennen möchte: Zum einen waren sie wegen unterschiedlicher politischer Haltungen zerstritten. Während sich meine Eltern entschieden gegen den ein Jahr vor Kriegsbeginn gegründeten, nazistisch gesinnten „Volksbund“ stellten, wurden Oma Juliana und ihr Mann eifernde Anhänger, die den Verein wiederholt durch größere Spenden unterstützten. Die andre Ursache reichte in die Kindheit zurück: Als die Todesnachricht von der Front eingetroffen war, schien es Vater lange, dass die Mutter seine ältere Schwester, meine spätere Tante Barbara, die Wawi genannt wurde, liebevoller behandelte als ihn, weil sie sich folgsamer verhielt. Das hatte er fast schon vergessen, als ihm Jahre darauf wegen ihr Schlimmeres widerfuhr: Weil sie sich, zum Mädchen gereift, vor ihm zu schämen begann, weigerte sie sich, länger das enge Zimmer mit ihm zu teilen, und die Mutter sah, um mit einem Geliebten, den sie zu sich geholt hatte, nachts ungestört zu bleiben, nur die Möglichkeit, den Sohn im Pferdestall schlafen zu lassen, wo er sommers unter den scharfen, widerlichen Ausdünstungen ihrer Fuchsstute litt, und winters, wenn dicker Reif an den Innenwänden glitzerte, nicht nur jämmerlich unter seiner verschlissenen Decke fror, sondern jedes Mal, wenn er sich erkältete und heftig husten musste, außerdem fürchtete, er sei an der Schwindsucht erkrankt.
Zu mir entwickelte Großmutter Juliana, als wollte sie ausgleichen, was sie bei Vater versäumt hatte, in den wenigen Monaten, die sie bei uns wohnte, ein sehr inniges Verhältnis. Wenn ich die Augen schließe, meine ich, sie sitze wie seinerzeit neben mir auf der dreistufigen Treppe, die den Höhenunterschied zwischen unsrem Hof und dem Säulengang ausglich. Während sie strickte oder Strümpfe stopfte, lag ihr Mann, ausgezehrt vom Malariafieber, meist erschöpft im Bett, so dass ich ihn nur selten sah. Die heimtückische Krankheit, mit der er sich während des Ersten Weltkriegs in sumpfigen Niederungen Norditaliens angesteckt hatte, war, vielleicht bedingt durch die seelische Erschütterung, erneut bei ihm ausgebrochen, und ich habe mich manchmal gefragt, wie viel zähe Kraft er brauchte, um die weite Bahnfahrt und den öden, strapaziösen Lageraufenthalt zu überleben.
3
Auch als das Zimmer wieder frei war, kam meinen Eltern nicht in den Sinn, mich darin schlafen zu lassen. Noch weniger hätten sie es mir, aus Sorge, ich könnte, ihrer Obhut entronnen, Dummheiten begehen, in der einstigen Paradestube erlaubt, die sich, durch eine Verbindungstür zugänglich, als letzter Raum des neuen Hauses nach hinten anschloss, und in die durch ein dreiflügeliges Fenster zum Säulengang ausreichend Tageslicht fiel. Ich glaube, dass darin nie jemand übernachtet hatte, bis im Oktober 1944 Rotarmisten bei uns einquartiert wurden. Ich meine, mich zu entsinnen, dass es zehn oder mehr waren, die, um nicht das düstere Mittelzimmer benutzen zu müssen, durchs Fenster aus- und einstiegen, ohne sich vorzusehen, so dass sie mit ihren Stiefeln Holz- und Wandanstriche beschädigten. Auch die hellen, gediegenen, von einem Tischler maßgefertigten Möbel, die wahrscheinlich aus geflammter Birke bestanden, wiesen zuletzt zahlreiche Schrammen auf, nur das Ölgemälde über den Ehebetten, das eine mit kräftigen Farben gemalte Auenlandschaft abbildete, blieb unversehrt.
Die etwa vierzehn Tage bei uns untergebrachten Soldaten wirkten auf mich größtenteils noch jung. Viele waren vorher wohl im Lazarett gewesen; denn sie trugen schmuddelige Verbände um Kopf, Arme und Beine. Fast alle rauchten, und ich beobachtete öfter, wie sie, sofern die Sonne schien, ihre Papirossi mit einem Brennglas anzündeten. Sie scherzten gelegentlich mit mir, und Mutter wurde, vermute ich, wohl bloß deshalb nicht von ihnen belästigt, weil ihre Leibesfülle vortäuschte, dass sie schwanger sei. Woanders verhielten sich, weiß ich, einquartierte Rotarmisten mitunter zudringlich oder gewalttätig, und später erfuhr ich, dass es auch im Dorf Vergewaltigungen gegeben hatte. Dennoch sind mir zumindest die russischen Soldaten, die ich erlebte, menschlicher erschienen als jene serbischen Partisanen, durch die Großmutter und ich einmal zutiefst erschreckt worden waren.
Ich habe dazu die Kurzgeschichte „Angst“ geschrieben, die ich, um zu verdeutlichen, was ich meine, an dieser Stelle, leicht gekürzt, einfüge: An die Truppen, die Ende Oktober 1944 kampflos unser Dorf besetzten, habe ich unterschiedliche Erinnerungen. Vor den Rotarmisten … verlor ich bald meine Scheu, weil sie sich Kindern gegenüber freundlich verhielten. Sie schenkten uns, um uns aufzumuntern, diese oder jene Habseligkeit, und ich glaube, sie feuerten, wenn sie durchs Dorf zogen, oft nur mit ihren Karabinern in die Luft, damit wir die ausgestoßenen Patronenhülsen, nach denen alle Jungen gieperten, einsammeln konnten.
Vor den serbischen Partisanen hingegen wuchs mehr und mehr meine Furcht, besonders seit jenem Nachmittag, an dem sie, als ich mich allein mit Großmutter in der Winterküche aufgehalten hatte, bei uns eingedrungen waren. Wir blieben, sobald die beiden Männer durch heftiges Klopfen Zutritt begehrten, mucksmäuschenstill. Fast glaubten wir, sie würden, durch die Ruhe getäuscht, wieder abziehen, bis der eine so heftig gegen die von innen verriegelte Tür trat, dass sie splitternd aufsprang.
Die Partisanen, die Stiefel, Lederjacken und Schapkas trugen, hielten ihre Maschinenpistolen im Anschlag. Der Ältere, über dessen linke Wange sich eine wulstige Narbe zog, forderte Wein. Als Großmutter aus einer Korbflasche welchen in die bereitgestellten Gläser goss, schwappte so viel daneben, dass sich auf der Tischdecke ein roter Fleck bildete. Ich stand wie erstarrt, während sich die Männer ein zweites, ein drittes Mal einschenken ließen. Als sie schließlich wortlos aufbrachen, stieß der Jüngere mit seinem Stiefel die beschädigte Küchentür auf. Ich merkte, wie Kühle in den Raum wehte, konnte mich aber immer noch nicht rühren. Auch Großmutter blieb geraume Zeit an ihrem Platz, als wäre sie festgewachsen. Dann nahm sie das Tischtuch ab, hielt es, derweil sie sich schwerfällig auf ihren Stuhl setzte, mit beiden Händen und knüllte es so fest, dass ihre Knöchel weißlich hervorbuckelten.
4
Während Stefan-Vetter und mein Vater in der Winterküche weiter Schiller oder Tresterbranntwein tranken und sich mit schweren, ungelenken Zungen, die ihnen, wie ich später von Großmutter erfuhr, kaum mehr gehorchten, über frühere Erlebnisse unterhielten, muss Agnes Dobler, ohne dass wir sie bemerkten, an uns vorbei ins Nebenzimmer gegangen sein, mich aus der Wiege gehoben und im Beisein meiner Mutter sowie Godl Lisbeth an ihre pralle Brust gelegt haben. Sie wohnte mit ihrem Mann, einem Bauern, schräg gegenüber von uns in einem noch alten, kleinen Haus, hatte Ende Oktober ihren Sohn Sebastian geboren und behielt, wenn er nach dem Säugen gesättigt war, jedes Mal so viel Milch zurück, dass sie, da Mutter mich anfangs gar nicht stillen konnte, für eine reichliche Woche meine Amme wurde.
Als ich sie vor Jahren noch einmal traf und mich neben sie auf die Bank vor ihrem Haus setzte, fiel mir wieder ein, wie wichtig sie in den ersten Tagen nach meiner Geburt für mich gewesen war. Sie schien froh darüber, mich wiederzusehen, da es sie vielleicht stärker als vorher hoffen ließ, auch Sebastian, der, im Herbst 1956 nach dem niedergeschlagenen Volksaufstand bis Australien geflohen, käme, wie von ihr seit Jahren vergeblich erhofft, wenigstens einmal zu Besuch.
Während unseres Gesprächs schien sie den Eindruck zu gewinnen, dass ich mich erstaunlich gut erinnern könne, wie es einst im Ort gewesen sei, und als sie mich, um sich zu überzeugen, ob ihre Annahme stimmte, darum bat, ihr zu erzählen, was es auf unsrer Straße Besonderes gegeben habe, fiel mir mehr ein, als ich erwartet hätte. Da meine Antwort, glaube ich, viel von der einstigen Atmosphäre einfängt, gerafft aber nicht so anschaulich würde wie in meinem Roman „Letzter Abschied“, gebe ich sie ungekürzt wieder:
„Da waren zwei Läden“, sagte ich, „die sich von hier etwa gleich weit entfernt an den nächsten Straßenecken befanden. Das obere Geschäft gehörte Armin, einem Juden, der sich, da er umsichtig, leutselig und verlässlich war, auf seinen Beruf verstand wie kein andrer, das untere bewirtschaftete ein kleiner, dicklicher, ein wenig huscheliger Ungar, bei dem man selten alles erhielt, was man haben wollte. Auf halbem Weg zu ihm wurden vor der Schmiede oft Pferdehufe beschlagen, genau gegenüber surrten in einem flachen, lang gestreckten Seitengebäude mehrere Spinnmaschinen, drei Dutzend Meter aufwärts stand Metzger Oswald in seiner gefliesten, auch sommers kühlen Schlachterei am hohen, wuchtigen Hackklotz, etliche Häuser weiter, zog Morath, der schmächtige, bucklige Schuster, abwechselnd Stiefel, Sandalen und Schuhe über seinen Leisten, fast am Straßenende wurden in einem Hinterhaus große Mengen Sodawasser abgefüllt, und schließlich boten durchziehende Scherenschleifer, Kesselflicker, Lumpensammler oder Besenbinder mit gleichförmigen, leiernden Rufen ihre Dienste an.“
Immer dann, wenn mir Armin in den Sinn kommt, meine ich zu sehen, wie er im Frühling 1944, als die Akazien, die gerade weiß oder lila blühten, ihren betörenden Duft verströmten, mit Frau und Sohn von zwei ungarischen Gendarmen abgeholt und zum langen Judenzug geleitet wurde, den deutsche Soldaten auf der Großgasse nordwärts trieben. Von den Gefangenen, die aus Serbien, Kroatien und der heutigen Vojvodina verschleppt worden waren, torkelten bereits viele. Strauchelten sie, wurden sie von ihren Bewachern, denen kaum ein Verstoß entging, lästerlich beschimpft, getreten und geschlagen. Was ich, vom Kindergarten heimwärts unterwegs, unweit des Gemeindeamts beobachtete, verstörte mich. Doch als ich, kaum in unsre Straße – die damals Gróf-Szécheny-utca hieß - eingebogen, von wüstem Lärm erschreckt, zur aufgebrochenen Tür gegenüber blickte, stockte mir der Atem: Leute, die ich vermeintlich gut kannte und für redlich gehalten hatte, plünderten Armins Eckladen. Sie rissen sämtliche Schübe auf, griffen nach allem, was in den Regalen stand, zerrten an Gläsern, Büchsen und Tüten, um, von plötzlicher Gier getrieben, so viel wie möglich zu ergattern.
Drei Jahre später, im August 1947, nach langer Güterzugfahrt über Pirna - wo wir zwei Wochen in der „Grauen Kaserne“ ausharren mussten, ehe wir auf mehrere sächsische Orte verteilt wurden - bis Görlitz gelangt, fürchtete ich, dass ich alles, was einst geschehen war, Schritt für Schritt vergessen könnte. Es wird, dachte ich, versinken wie früher der Staub, der, von Fuhrwerken, Pferdehufen und den stampfenden Tritten der Rinder, die zur Hutweide geführt wurden, hochgewirbelt, als dichter, ockerfarbener Dunst zwischen Büschen und Bäumen schwebte, ehe er sich, derweil er zerbröselte, auf Häuser, Ställe, Maisschuppen, Höfe, Gärten senkte und das Wasser des Kanals trübte, der träge durch unsre Straße rann.
Doch als ich im Frühherbst 1959, zwölf Jahre nach unsrer Vertreibung, erstmals ins Dorf reisen durfte, erfasste ich, dass sich äußerlich fast nichts verändert hatte. Ich stand wie seinerzeit vor dem quittegelben Eckhaus, in dem nun, wie ich von Edit wusste, eine Telepes-Familie wohnte. Während ich die Lider senkte, konnte ich mich erinnern, wie es innen ausgesehen hatte. Ich gewahrte die große, helle Küche, die vier Zimmer und den Laden, wo die eichenen, dunkel gebeizten Regale, die bis zur Decke reichten, immer gefüllt waren, die lange, breite, täglich polierte Theke makellos glänzte, der Geruch seltener Spezereien den Raum erfüllte, solange das an der Eingangstür befestigte Glöckchen schellte, was freilich immer seltener geschah, seit Armin den gelben Stern tragen musste.
Aufgewühlt durch das, was ich nach über einem Jahrzehnt erlebt habe, als wäre es gestern geschehen, wende ich mich ab. Ich sehe die Häuserzeilen verschwommen, und was ich wahrnehme, wechselt immer schneller. Es hastet, hetzt, flutet ineinander, dass ich nicht mehr erfasse, wann etwas anfängt und wo es endet. Ich verharre wie bei meinem letzten Besuch hoch oben im Kirchturm auf dem rauen, rissigen Querbalken, rücke mein Gesicht nahe ans kleine, westwärts gerichtete Fenster, wische mit dem Ärmel über das fast blinde Glas und halte erst inne, als ich erkennen kann, was unten geschieht. Vor Lenharts Gasthaus entdecke ich den Kleinrichter, der, mit schnellen, straffen Schritten unterwegs, einen furiosen Wirbel trommelt, ehe er mit lauter, klarer Stimme die ihm vom Bürgermeister vorgegebenen Mitteilungen verliest, denen ich zu entnehmen versuche, ob auch wir fortmüssen, bis unter mir die große Glocke zu schlagen beginnt, und es so laut in meinen Ohren dröhnt, dass ich, vom Lärm betäubt, die Augen schließe.
Als es still wird, erkenne ich, dass ich auf dem Friedhof bin. Ich stehe auf dem kleinen, künstlich errichteten, Hügel, über den sehr alte, teils verwitterte, von nicht mehr genutzten Ruhestätten gerettete, Grabsteine verteilt sind, die durch ihre Auswahl daran erinnern sollen, dass im Dorf seit langem vor allem Deutsche, Ungarn und Bunjewatzen mit unstetem Geschick zusammenleben. Die größten Spannungen zwischen den drei Gruppen entstanden, glaube ich, nachdem man 1938 den „Volksbund“ gegründet hatte, dessen Mitglieder, verhetzt durch scharfmacherische Reden in Berlin, eine anmaßende Vormacht der Deutschen anstrebten. Als krassesten Ausdruck ihres Bemühens betrachte ich die Ächtung der Juden, die bei Armin damit begann, dass sein Laden mehr und mehr gemieden wurde, bis sich zuletzt bloß noch sehr wenige getrauten, bei ihm einzukaufen. Doch auch sie sahen an jenem denkwürdigen Frühlingstag 1944 tatenlos zu, wie er mit seiner Familie weggeführt wurde. Zu ihrer Ehrenrettung muss ich, um ehrlich zu bleiben, allerdings eingestehen, dass sich, als die Plünderung begann, nur vereinzelt welche daran beteiligten.
Während ich über den von Kastanienbäumen gesäumten Hauptweg gehe, der, sobald ich rechts eingebogen bin, zur Friedhofskapelle führt, entdecke ich auf den gepflegten Grabsteinen häufig meinen Familiennamen. Er hieß ursprünglich „Schobloch“, das „er“ wurde aus Gründen, die ich nicht kenne, irgendwann im Standesamt angefügt. Ich vermute jedoch, dass alle, die in Ungarn den veränderten Namen tragen, von dem Urvater abstammen. Ein Nachkomme in der dritten Generation soll mit zwei Frauen insgesamt 25 Kinder gezeugt haben. Wie viele von ihnen in einer Gegend, wo früher die Schwindsucht grassierte, das Erwachsenenalter erreichten, ist nicht überliefert.
Hingegen weiß ich, dass von den überwiegend ungarndeutschen Soldaten, die in den beiden Weltkriegen an verschiedenen Fronten eingesetzt wurden, insgesamt 372 ihr Leben verloren. Einer von ihnen war, wie bereits erwähnt, mein Großvater väterlicherseits, der bereits im Herbst 1914, gerade dreißig Jahre alt, in Serbien auf tragische Weise umkam und neben seiner Witwe Juliana zwei kleine Kinder zurückließ.
Sein früher Tod beschäftigte alle aus unsrer Familie. Obwohl mein Vater nie darüber sprach, ahnte ich, dass er, wenn er allein an der Hobelbank arbeitete und mit leiser, belegter Stimme das traurige Lied sang, das während des Ersten Weltkriegs entstanden sein musste, daran dachte. Da es manchmal auch von Großmutter Gertrud – gemeinsam mit Frauen, deren Männer großenteils im Ersten oder Zweiten Weltkrieg umgekommen waren - beim Spinnen, Stricken oder Häkeln gesungen wurde, kannte ich den schlichten Text mit der Zeit auswendig. Die erste Strophe lautet:
Die Sonne sank im Westen,
in Bosnien in der Schlacht,
und mitten unter den Toten
lag sterbend ein Soldat.
Da ich möchte, dass der sinnlose Tod meines Schoblocher-Großvaters nicht vergessen wird, erfand ich zu dem, was mir gesichert erscheint, vor etlichen Jahren noch „seine“ Geschichte, von der ich glaube, dass sie dem, was wirklich geschehen ist, nahekommt. Ich füge sie, geringfügig verändert, an dieser Stelle ein:
Vielleicht erinnere ich mich noch an meinen anderen Großvater, der mit dem Vornamen wie ich Stefan hieß, obwohl er, lange bevor ich zur Welt kam, im Ersten Weltkrieg gefallen war, weil daheim wiederholt über ihn gesprochen wurde. Ich bin mir nicht sicher, was mich stärker beeindruckte: die Tatsache, dass er, wenn seine Kinder – mein Vater und dessen zwei Jahre ältere Schwester Barbara – erwachsen sein würden, am Ufer der Donau westwärts zu wandern beabsichtigte, um nach vielen, vielen Tagesmärschen nahe ihren Quellen das kleine, von dicht bewaldeten Bergen umgebene, Dorf zu besuchen, aus dem unsre Ahnen einst in „Ulmer Schachteln“ aufgebrochen waren, oder möglicherweise doch eher der jähe, erbarmungslose Tod, der ihn wenige Wochen nach den Schüssen von Sarajevo, östlich der Drina zwischen den Fronten ereilte.
Zwei Kameraden hatten sich, hieß es, vergeblich bemüht, ihn nach einem misslungenen Sturmangriff, bei dem er von einer feindlichen Kugel niedergestreckt worden war, durch einen Drahtverhau zu ziehen. Später versuchte er, vermute ich, sich aufzurichten, sank aber, kaum dass er den Kopf ein wenig gehoben hatte, kraftlos zurück. Er empfand keinen Schmerz, merkte nur, dass er in seinem Blut lag, das unaufhaltsam aus dem Rücken floss. Am Oberkörper fröstelte ihn, doch die Beine blieben gefühllos. War es deshalb nicht gelungen, ihn zu bergen?
Nach einer Weile hob er erneut den Kopf, stützte sich auf seinen Ellbogen und wollte sich mit den Füßen abschieben, bis er begriff, dass sie sich nicht mehr bewegten. Es kam ihm vor, als wäre sein Körper schon zu einem großen Teil abgestorben. Die Starre würde sich ausdehnen, bis sie auch sein Herz lähmte, und er ahnte, dass es nicht lange dauern würde.
Das Gesicht gegen den angewinkelten Unterarm gepresst, gab er sich auf. Er würde kein Wasser mehr aus dem Ziehbrunnen trinken, nie mehr säen, stecken und ernten, den Pirol nicht mehr hören, die Akazienblüten nicht mehr riechen, Großmutter Julianas warmen Körper nicht mehr spüren, nie mehr in die erwartungsvollen Augen seiner Kinder blicken, die Eltern nicht wiedersehen.
Aus dem Dunkel, das ihn umgab, flackerten letzte Bilder. Zeigten sie ihm noch einmal die fernen Berge, von denen er so oft geträumt hatte?
5
Auf dem Rückweg verharre ich neben dem flachen, begrasten Gedenkhügel, der daran erinnern soll, dass im Dorf vor dem Ersten Weltkrieg Deutsche, Ungarn und Bunjewatzen einträchtig nebeneinander gelebt haben.