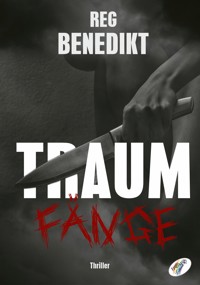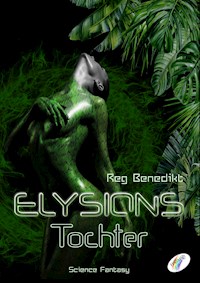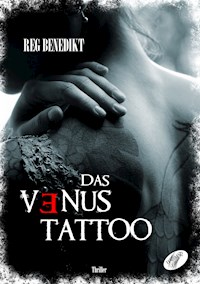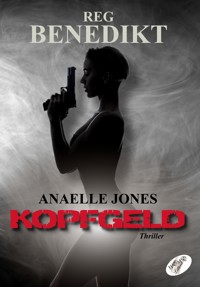
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
KOPF! GELD! JAGD!
Anaelle Duval ist eine geheimnisvolle Frau. Als reiche Erbin nimmt sie an Banketten der High Society teil und entscheidet mit ihrer Unterschrift über Firmen und Beträge in Millionenhöhe. Doch der goldene Käfig täuscht, denn unter dem Namen Anaelle Jones ist sie als Kopfgeldjägerin tätig und schlägt sich mit widerspenstigen Kautionsflüchtigen herum.
KOPFGELD, Band 1: Eine anonyme Anruferin versucht Anaelle Jones zu engagieren, um eine junge Frau namens Tamara Graham aufzuspüren, doch sie lehnt ab. Als die Mutter der Vermissten sie damit erpresst, ihre geheime Identität preiszugeben, willigt sie gezwungenermaßen ein, Tamara ausfindig zu machen. Schon bald verstrickt sich ihr Job als Kopfgeldjägerin mit der Suche nach der verschwundenen Frau ...
Spannend, gefährlich und humorvoll - REG BENEDIKT lässt einen den Atem anhalten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Anaelle Jones: Kopfgeld
Anaelle Jones: Kopfgeld
Impressum
Widmung
Über die Autorin
Anaelle Jones: Kopfgeld
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Programm
Die Träne der Aphrodite
Das Venus-Tattoo
Jägerin der Schatten
Wächterin der Dunkelheit
Elysions Tochter
Friedenszeit
Reg Benedikt
Thriller
© Reg Benedikt, Anaelle Jones: Kopfgeld (1)
© HOMO Littera
Am Rinnergrund 14/5, A- 8101 Gratkorn,
www.HOMOLittera.com
E-Mail: [email protected]
Grafik und Gestaltung: Rofl Schek
Bildnachweis: © alfa27 by stock.adobe.com
© olegkruglyak3 by stock.adobe.com
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
ISBN Print: 978-3-99144-040-6
ISBN PDF: 978-3-99144-041-3
ISBN EPUB: 978-3-99144-042-0
ISBN PRC: 978-3-99144-043-7
Manchmal ist das Paralleluniversum kein Ort, sondern passiert einfach ...
Über die Autorin
Reg Benedikt, geboren 1973, ist eine deutsche Schriftstellerin und lebt mit ihrer Frau in Berlin. Das Schreiben begleitet sie schon seit Jahren und ist inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens.
Neben spannenden Abenteuern verbirgt sich in ihren Büchern auch jedes Mal eine Liebesgeschichte, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt, denn sie ist sorgfältig verpackt in düstere Intrigen und mystische Geheimnisse – und es gibt immer ein bisschen Drama. Mit Humor und Leidenschaft lässt sie ihre Protagonistinnen am Ende siegen – vermutlich …
Veröffentlichungen bei HOMO Littera:
Die Magische Grenze-Reihe:
Jägerin der Schatten, Die Magische Grenze, Fantasy, 2019
Wächterin der Dunkelheit, Die Magische Grenze, Fantasy, 2021
Sasha Barnett-Reihe:
Die Träne der Aphrodite, Thriller, 2020
Das Venus-Tattoo, Thriller, 2020
Elysions Tochter, Science Fantasy, 2022
Sich verlieben in: Friedenszeit, Miteinanda für die Ukraine, Benefizanthologie, 2022
Prolog
Die Einsatzfahrzeuge warfen zuckendes blaues Licht durch die mondlose Sommernacht. Die halbe Nachbarschaft des heruntergekommenen Viertels hatte sich auf der Straße versammelt, um zu gaffen. Der Rest lungerte vermutlich hinter den Fenstern und Vorhängen.
Es ließ sich nicht vermeiden. Die menschliche Natur war unheilbar krank, und nichts brachte sie von ihrer Neugier ab, wenn anderen etwas Schlimmes widerfahren war.
Eine Gruppe Leute wurde von Kollegen abseits festgehalten, in dem sinnlosen Unterfangen, ihre Personalien zu erfassen und Details über den Tathergang rauszufinden. Es waren Bewohner des Hauses – allesamt verwahrlost und drogensüchtig und kaum in der Lage, zu begreifen, was vor sich ging. Die meisten wirkten ängstlich.
Ein uniformierter Beamter ließ ihn passieren, als er seinen Ausweis hochhielt. »N’Abend«, begrüßte er ihn.
Er nickte nur, zog an seiner Zigarette und machte keine Anstalten, das mehrstöckige Haus zu betreten. Es war eine Bruchbude und passte zur Gegend. Putz und Farbe blätterten großflächig vom Mauerwerk ab, das Geländer der Treppe war abgerissen und niemand hatte sich die Mühe gemacht, es wieder zu befestigen. Er ahnte bereits, wie es im Inneren aussehen würde, und war schon jetzt angepisst. Er zog ein letztes Mal an der Zigarette, brannte sie fast bis auf den Filter hinunter und inhalierte tief den aromatischen Rauch. Dann trat er sie aus und näherte sich dem Haus.
Es herrschte reger Betrieb in einer leer stehenden Wohnung im Erdgeschoss. Für seinen Geschmack zu viel. Mehrere Laboraffen untersuchten den Tatort auf Spuren und schossen Fotos. Der Leichenschnippler durchforschte seine Tasche, und zwei uniformierte Fußsoldaten standen sinnlos herum und waren so bleich im Gesicht, dass man froh sein konnte, wenn sie nicht auf die Beweise kotzten. Wie es schien, war er der Erste vom Team, der eingetroffen war. Verdammt!
»Was haben wir?«, fragte er mit erhobener Stimme, obwohl jeder seiner Sinne ihm entgegenschrie, dass hier etwas passiert war, das man nicht alle Tage erleben durfte. Drei Körper lagen in einem Raum, der wohl mal als Wohnzimmer gedient hatte. Es gab eine versiffte Couch und die Reste eines fleckigen Teppichs. Die Fenster waren mit Pappen abgedeckt. Der Ort, das ganze Haus, genügte Leuten als Behausung, die schon lange aufgegeben hatten. Fettige Pizzakartons lagen in einer Ecke sowie einige Getränkeflaschen von Softdrinks und ein paar harte Sachen. Wodka, soweit er erkennen konnte.
Er trat näher. Der Leichengeruch war deutlich wahrnehmbar, was auch die Gesichtsfarbe der Uniformierten erklärte. Es war schwer auszuhalten. »Wie weit sind Sie?«
Der Pathologe, ein kleiner Mann mit grauem Haar und ebensolcher Haut, hob kurz den Kopf von seiner Arbeit an einem der Opfer. »Noch nicht ganz durch. Aber alle drei sind erstochen worden, so viel kann ich sagen. Ich zähle auf die Schnelle wenigstens ein Dutzend Stichwunden bei jedem. Da wollte wer sichergehen.«
Er ließ den Pathologen seine Arbeit machen und warf einen Blick auf die Körper. Der erste lag vor der Couch, der andere näher bei der Tür – hatte vielleicht noch versucht, zu fliehen –, der dritte beim Fenster. Blut war überall in großen vertrockneten Lachen, über die er hinwegstieg.
»Wenn ich mir ihren Zustand so ansehe, waren sie schwer drogenabhängig«, murmelte der Pathologe, während er die Leiche vor sich begutachtete. »Ihre Körper sind verfallen, regelrecht ausgemergelt. Ihre Venen haben Ähnlichkeit mit Schweizer Käse.«
»Wo ist das Zeug, Doc?«
»Die Drogen? Wir haben keine gefunden. Vielleicht aufgebraucht?«
Hatten sie deshalb durchgedreht, weil nichts mehr im Haus war?
Er widmete sich dem Toten am Fenster und sank neben ihm in die Hocke. Er war noch jung, kaum zwanzig. Blut durchtränkte ein zerschlissenes T-Shirt, das bereits, bevor ihn jemand mit einer Klinge bearbeitet hatte, nicht schön gewesen war. Stichwunden in Oberkörper und Bauch hatten seinem Leben ein Ende bereitet. Er hatte auch aufgeschnittene Arme, eindeutig Abwehrverletzungen, sowie tiefe Wunden am Hals und im Gesicht. Sie hatten gekämpft. Aber warum? Oder um was?
Die Hand des Jungen war zur Faust verkrampft. Vielleicht im letzten Moment der Agonie.
Er schaute fragend zurück zum Pathologen, der ihn beobachtete.
»Vorsichtig. Bei dem war ich noch nicht.«
Als würde das einen Unterschied machen. Die Todesursache war wohl kaum zu übersehen. Er nahm die Hand und bog die Finger auf. Es ging überraschend leicht. Die Haut war auch nicht so kalt, wie sie sein sollte. Immerhin lagen die Leichen hier schon eine Weile. Vielleicht so lange, dass die Leichenstarre sich bereits wieder gelöst hatte? Er würde den Doc danach fragen müssen.
In der blutigen Handfläche befand sich eine kleine Plastiktüte mit weißen Pulverresten darin.
Unerwartet schlossen sich die Finger um die Tüte, und der Arm wurde weggerissen.
Vor Schreck fuhr er zurück und fluchte ungehemmt. Der Pathologe war sofort an seiner Seite und war sichtlich fassungslos. Der vermeintlich Tote schüttelte sich in zittriger Hast den Inhalt der Tüte in den Mund, ehe irgendjemand ihn aufhalten konnte. Die Hälfte verstreute sich über sein Kinn. Er atmete in wilden Stößen, es klang rasselnd.
»Schnell, einen Krankenwagen!«, rief der Pathologe mit überschnappender Stimme.
»Nehmen Sie die Tüte!«, befahl er dem Doc wütend. Wie konnten alle übersehen haben, dass der Kerl noch lebte?
Der Pathologe wollte sie dem Jungen entreißen, aber der umklammerte sie und lachte wie von Sinnen, dabei war er fast tot.
Scheiße, was war das für Zeug?
Der Typ sank zurück, mit einem verzerrten Grinsen auf dem Gesicht, während ihm Blut aus dem Mundwinkel lief. Seine Lunge kollabierte wohl. Er röchelte, als ihm ein letzter Atemzug entwich und sein Körper erschlaffte. Einzig das Lächeln blieb auf seinen Lippen, und er sah beinahe … glücklich aus.
»Ich glaub’, den Krankenwagen brauchen wir nicht mehr«, stellte er fest und bückte sich, um die kleine Tüte vorsichtig an einer Ecke an sich zu nehmen, während der Doc vergeblich nach einem Puls suchte.
Jemand hatte ein krakliges F auf das Plastik geschrieben. Sein Blick wanderte zum Fenster. Die Pappe, mit der es abgehangen war, war an einer Stelle heruntergerutscht, und er konnte die Straße und die Gaffer davor sehen. Ein Mann stand etwas abseits, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, die Schultern hochgezogen. Er wirkte nervös und unruhig, wie eine Ratte, die man ins Sonnenlicht gezerrt hatte. Sein Kinn war unrasiert, und er hatte seine dünnen strähnigen Haare zu einem lächerlichen Pferdeschwanz im Nacken zusammengebunden.
Er betrachtete noch einmal die kleine Plastiktüte, runzelte die Stirn und seufzte resigniert, bevor er sich zu den Beamten umdrehte. »Ruft Frazer an! Es geht los.«
1. Kapitel
In dichten Schwaden stieg der Dampf von dem Ofen auf. Er füllte die große Sauna, legte sich feucht auf meine Haut und sammelte sich zu Tropfen, die mir den Körper hinunterliefen. Ich hasste es und konnte nur hoffen, dass sich diese ganze dämliche Aktion lohnte.
Ich schlang das Handtuch fester um mich und klemmte es mehr schlecht als recht über der Brust zusammen, die bei Weitem nicht den Umfang hatte, die ihr zugedachte Aufgabe angemessen wahrzunehmen. Insgesamt fand ich, dass der Stoff ein paar Quadratzentimeter größer hätte ausfallen dürfen.
Der Mann mir gegenüber hatte ganz ähnliche Probleme, nur, dass sein Handtuch Schwierigkeiten hatte, über seinem fülligen Bauch zu halten, um seine edelsten Teile zu verbergen. Er ignorierte mich schon seit anstrengenden sieben Minuten. Das konnte ich ziemlich genau sagen, denn die kleine Sanduhr an der Wand verspottete mich mit ihrer Abstraktion von Zeit, bei neunzig Grad in dieser unerträglich feuchten Hitze auszuharren.
Ich fixierte ihn, aber entweder bemerkte er es nicht, was in Anbetracht der Dampfwolken und dem relativen Dämmerlicht gut möglich sein konnte, oder er wollte Kontakte vermeiden. Sein lichtes Haar klebte ihm feucht am Kopf, sein Gesicht war rot angelaufen und sein Blutdruck vermutlich in ungeahnten Höhen. Er passte perfekt auf die Beschreibung, die ich von ihm hatte. Die Größe konnte ich schätzen. Da wir gemeinsam die Sauna betreten hatten, war ich sicher, dass er knapp einen Meter achtzig war, so wie ich. Auf seiner Schulter war ein über die Jahre verblasstes Tattoo von einem Revolver nebst Munition abgebildet. Sein Name war Benjamin Kross, ein begnadeter Fälscher für fast alles, was man verlangte, wenn man den Preis bezahlen konnte.
Er erhob sich, als der alberne Sand in der Uhr bei fünfzehn Minuten aufhörte zu rieseln. Ich gab ihm einen Moment und folgte ihm schließlich. Draußen vor der Sauna atmete ich tief durch und genoss die relativ frische Luft, die wirklich nur ein kleines bisschen nach Schweißfüßen roch, und ging zu den Duschen, wo er verschwunden war.
»Wer bist du?«
Ich fuhr herum und begegnete Benjamins misstrauischem Blick. Also hatte er mich doch bemerkt.
»Anaelle«, antwortete ich ruhig.
»Wir haben telefoniert?«
Ich nickte und zog mein Handtuch ein Stück hoch. »Warum treffen wir uns hier?«
Er grinste und zeigte dabei ein schiefes Gebiss. Sein Handtuch, das sich an die nicht vorhandenen Hüften klammerte, drohte, sich zu verabschieden. Oh Mann …
»Ich muss ein wenig vorsichtig sein«, plauderte er aufgeräumt. »Und wie kann man besser verhindern, dass jemand einen hintergeht, als wenn er nackt vor einem sitzt? Keine Mikros und Waffen. Ich hab’ dich beobachtet, Süße.«
Ja, na wunderbar. »Dann weißt du, dass ich, hm … sauber bin.« Porentiefrein wäre auch passend.
»Ja …« Er musterte mich von oben nach unten und gleich wieder zurück und lächelte dabei so anzüglich, dass ich geneigt war, zu überprüfen, ob mein Handtuch noch seinen Dienst tat oder ich schon nackt vor ihm stand. Aber der Stoff lag kratzig auf meiner Haut, also ersparte ich mir die Demütigung.
»Kommen wir zum Geschäft?«, fragte ich ungeduldig, um seine taumelnde Konzentration auf das Wesentliche zu lenken. Vielleicht konnte ich den Porno in seinem Kopf stoppen, der eben mit dem Vorspann zu starten schien. Es musste eine Pausetaste geben.
»Alles, was du willst, Süße.« Seine Stimme hatte einen säuselnden Tonfall angenommen. »Hast du die Kohle?«
»Ja.«
»Okay. Zeig sie mir.«
Ich ging vor ihm her in Richtung der Umkleiden. Das Klatschen seiner nackten Plattfüße verfolgte mich, und seine Augen zerrten unermüdlich an meinem Handtuch. Ich band den Schlüssel vom Handgelenk ab, um den Spind zu öffnen, den ich für meine Sachen gewählt hatte. Eine kleine Tasche lag darin, die ich herausnahm und auf eine Holzbank stellte.
Er fummelte den Reißverschluss auf und begutachtete den Inhalt. Ein zufriedenes Strahlen erhellte sein Gesicht. »Jetzt zeig ich dir meins«, verkündete er mit einem frivolen Unterton.
Angemessen genervt verzog ich den Mund, was ihn nur auflachen ließ. Er tappte zu einem Schrank, nicht weit von meinem, und holte einen Umschlag hervor, den er mir überreichte. Ich öffnete ihn und fand einen Ausweis darin. Eine dunkelhaarige Frau schaute mir entgegen, die mit viel Fantasie Ähnlichkeit mit mir hatte. Darunter stand ein Name spanischen Ursprungs: Fernandez.
»Echt? Spanisch? Das glaubt mir doch keiner«, murrte ich kritisch.
»Bessere Arbeiten wirst du nicht finden.«
»Ja, ich weiß.«
»Niemand wird das als Fälschung erkennen.«
»Stimmt.«
»Okay. Also sind wir uns einig?«
»Fast.«
»Was ist denn noch?« Er schmunzelte wissend. »Willst du Zusatzleistungen, Süße?«
Ach, er war so bezaubernd mit seinen subtilen Andeutungen. Ich lächelte. »Du hast deine Kaution verfallen lassen.«
Sein Grinsen erstarrte. »Was?«
»Deine Gerichtsverhandlung war vor vier Tagen.«
Argwöhnisch verengte er die Augen. »Wer bist du? Ein verfluchter Kopfgeldjäger?«
Ich zuckte mit den Schultern und nickte. »Nenn mich ruhig Fernandez, wenn es dich glücklich macht, aber ich muss dich leider mitnehmen.«
Er holte so schnell aus, dass ich mein Gesicht nur in letzter Sekunde beiseitenehmen konnte, als seine Faust auch schon gegen den Metallschrank hinter mir krachte. Er heulte auf vor Schmerz, und ich nutzte die Gelegenheit und trat ihm mit Schwung die Beine weg. Er stürzte und klatschte ungeschickt rücklings auf die Fliesen.
Irgendwo schrie eine Frau erschrocken auf und verlangte nach Personal oder der Polizei, was mein Zeitfenster erheblich einschränkte. Ich griff in meinen Spind, aber eine Hand packte meinen Knöchel und riss mein Bein nach hinten weg. Ich verlor das Gleichgewicht und stürzte ebenfalls hart. Blitzschnell rollte ich mich auf den Rücken, während Benjamin schnaufend wieder hochkam.
»Mich kriegst du nicht. Ich geh’ nicht in den Knast!«
Der Satz war Standard, und man mochte meinen, alle Kautionsflüchtlinge hatten dasselbe langweilige Drehbuch. Punkt eins war, der Kopfgeldjägerin den Schädel auf die eine oder andere Art – mit oder ohne Werkzeug – einzuschlagen, gefolgt von dem freundlichen Hinweis, dass der Knast nichts für ihre zarten Gemüter sei. Bei Benjamin hatte ich nicht mit ganz so viel Ehrgeiz gerechnet. Er war nicht gut in Form, allerdings war wohl nur die richtige Motivation nötig, um zu einem verkannten Mike Tyson zu werden.
Er versuchte wegzulaufen, aber ich streckte mich und trat ihm, aus meiner ungünstigen Position auf den nassen und rutschigen Fliesen liegend, erneut die Beine weg, sodass er auf schnellstem Weg abermals zu mir nach unten kam. Ich erhob mich auf die Knie und wollte ihn an den Schultern mit Schwung auf den Bauch drehen, was sich allerdings als überraschend schwierig erwies. Es gab keine Kleidung, die man greifen konnte, stattdessen nur schwitzige, feuchte Haut und ein bisschen Körperbehaarung. Eklig! Leider funktionierte mein Plan auch nur mäßig, denn er holte aus und traf mich diesmal mit voller Wucht gegen die Brust und Schulter. Ich taumelte und fiel wieder nach hinten. So schnell ich konnte, kam ich auf die Füße, aber statt sofort nach mir zu schlagen, starrte er mich mit offenem Mund an.
Kurz schaute ich an mir hinab. War ja klar! Das verdammte Handtuch hatte mich im Stich gelassen. Wut kochte in mir hoch, weil ich wegen dieses Idioten nackt rumstand und nicht weiter war als vor fünf Minuten.
Als er tatsächlich frech grinste, obwohl er wie ein gestrandeter Wal auf den Fliesen lag und schnaufend nach Luft rang, war es mit meiner Geduld vorbei. Ich presste die Zähne zusammen, war mit einem Schritt bei meinem Spind und griff hinein. Benjamin wollte auf dem Hintern aus meiner Reichweite rutschen, und als er merkte, dass er so nicht gut vorwärtskam, stemmte er sich an der Wand hoch. Doch ich stürmte bereits auf ihn los. Sein Grinsen wich einer angemessenen, hm … Sorge um sein Wohlergehen, als er meinen Gesichtsausdruck bemerkte. Er schlug abermals nach mir, aber es wirkte ein wenig wie Notwehr. Ich blockte ihn, duckte mich unter dem zweiten Hieb weg und war bei ihm. In einer fließenden Bewegung presste ich ihm meinen Arm gegen die Kehle, irgendwo nahe seinem Doppelkinn, und schob ihn nachdrücklich an die Wand. Gleich darauf hielt ich ihm die Mündung meiner Pistole seitlich an die Schläfe.
»Du darfst mir nichts tun!«, winselte er.
Ich war atemlos und immer noch sauer. »Da sei dir mal nicht zu sicher!« Ich wuchtete ihn herum, bis sein Gesicht wenig liebevollen Kontakt mit den kalten Fliesen hatte. Gleich darauf verdrehte ich seinen Arm auf den Rücken, und als er vor Schmerz aufschrie, genoss ich es. Geübt legte ich ihm Handschellen an und trat zurück. In dieser Sekunde rutschte Benjamins Handtuch, das bis jetzt eine echt bewundernswerte Leistung gezeigt hatte. Es fiel nass zu Boden und entblößte einen bleichen und vor allem haarigen Hintern.
In sicherer Entfernung hatten sich einige Saunagäste versammelt – eine kleine Gruppe in weiße Bademäntel gekleideter Menschen, die in abartiger Faszination verharrt hatte, wer als Sieger hervorgehen würde. Es waren nur wenige Minuten vergangen, gleich würde das Personal alarmiert hereinstürmen und vermutlich auch die Polizei.
Ich sammelte mein untreues Handtuch auf und wickelte mich züchtig darin ein. Ruhig nahm ich Platz, schlug die Beine übereinander und wartete, die Pistole auf meinem Oberschenkel, während Benjamin sich an die Fliesen kuschelte, um seine Blöße zu bedecken.
»Das ist echt scheiße. Ich habe Rechte!«, maulte er die Wand an.
»Ja. Du kannst dich gerne setzen, wenn du möchtest.«
Er fluchte undeutlich und blieb stehen, bis zwei uniformierte Beamte uns Gesellschaft leisteten – ein junger Mann, der vermutlich seiner erfahreneren Kollegin zur Seite gestellt worden war. Sie scheuchten als Erstes die Saunagäste wie eine Herde blütenweißer Schafe auseinander und widmeten sich im Anschluss mir. Sie schienen ein wenig verwirrt von der Situation, die sie vorfanden. Konnte ich nachvollziehen.
Ich zeigte der Frau meinen Ausweis, und sie notierte sich die Personalien. Dann studierte sie meinen Aufzug, stockte kurz bei der Waffe, um danach mein Gesicht zu finden. »Sie sind Kopfgeldjäger?« Sie klang ungläubig.
Ich nickte. »Normalerweise habe ich mehr an.«
»Ja … ähm … okay, Frau Jones«, las sie von ihrem Zettel ab. »Ich habe ihre Daten. Was ist jetzt mit ihm?« Sie deutete auf Benjamin.
»Den dürfen Sie mitnehmen.«
Sie zögerte. »Er ist nackt«, stellte sie wenig begeistert fest.
»In der Tat«, stimmte ich zu und versuchte, nicht allzu zynisch zu klingen. »Aber er ist ja so nicht hergekommen. Sein Schrank ist die Nummer elf. Ich glaube, da ist eine Hose drin. Vielleicht auch eine Waffe. Sie sollten vorher nachsehen.« Ich lächelte freundlich. »Und mich müssen Sie entschuldigen.« Ich erhob mich, sammelte meine Unterwäsche, Jeans und T-Shirt aus dem Spind und betrat eine Umkleidekabine, um dieses unliebsame Handtuch endlich loszuwerden.
2. Kapitel
Ich fühlte mich schlapp und ausgelaugt, als ich bei meiner Wohnung ankam. Dieses Saunading war nichts, was ich öfter haben musste, und eine Prügelei auf glitschigen Fliesen auch nicht unbedingt. Dafür war die Kaution für Benjamin eindeutig zu niedrig gewesen. Aber darüber brauchte ich jetzt nicht mehr nachzudenken, denn sein nackter Hintern war inzwischen sicher in einer anheimelnden Zelle.
Ich fuhr mit dem Aufzug des Hauses in die oberste Etage. Meine Wohnung lag im Dachgeschoss, hatte eine bescheidene Größe mit einer offenen Küche zum Wohnzimmer und einem winzigen Balkon, auf den genau zwei Stühle passten und ein kleiner runder Tisch. Letzterer nur, wenn man fast im Wohnzimmer saß. Das war es auch schon. Es gab diesen Wohnküchenbalkon und ein Schlafzimmer. Daran schloss sich noch ein Bad mit Dusche an.
Als ich aus dem Aufzug trat, hielt ich verwundert inne. Meine Wohnungstür war sperrangelweit offen, was definitiv so nicht sein sollte. Mein Sessel kauerte verloren im Hausflur, und ein Bild mit modernen Mustern und Schnörkeln lehnte an der Wand. Ein bulliger Kerl trat aus meiner Wohnung, gekleidet in einen Blaumann auf dem Wir packen das! stand. Um diesem Motto gerecht zu werden, schnappte er sich auch schon meinen Sessel, wuchtete ihn hoch und wankte damit auf mich zu. Ich wich ihm aus und schaute perplex zu, wie er sich und das Möbel in den Aufzug bugsierte.
Ich ahnte Schlimmes, und mein Mund wurde trocken. Mit einem leisen Pling schoben sich die Türen zu, und der Sessel verschwand aus meinem Leben. Kurz überlegte ich, ob ich einfach umdrehen und mich anschließen sollte.
»Naila«, ertönte es quer durch den Hausflur, und meine Schultern sanken hinab. Ich drehte mich um und begegnete Abbys verschränkten Armen und verschlossenem Gesicht sowie dem Rest ihres vor Ärger bebenden Körpers, der drohend die Tür ausfüllte.
»Du ziehst … aus?«, fragte ich wenig originell – wenn ich von der Tatsache absah, dass wir nie zusammengewohnt hatten. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie sich der Spion der Nachbarwohnung verdunkelte. Ich wusste nicht mal, wer dort lebte, aber wer es auch war, er bekam heute mehr geboten als langweiliges Fernsehprogramm. Eine Realityshow im buchstäblichen Sinn. Abby neigte zum Drama. Sie liebte Szenen, schon immer. Zumindest seit ich sie kannte, und das waren etwa elf Monate. War das bereits eine Langzeitbeziehung?
Sie schien es so zu empfinden, denn sie hatte immer wieder Sachen in meine Wohnung geschleppt, so wie dieses seltsame Bild, das an der Wand lehnte. Sie war der Meinung, es wäre absolut angesagte moderne Kunst, aber es handelte sich lediglich um einen Nachdruck, noch dazu von einem Künstler, der nur im Drogenrausch malte. Zufällig durfte ich ihn mal kennenlernen. Eine bemitleidenswerte Gestalt. Der Kauf seiner Bilder hatte eher was von Sozialarbeit. Ich versuchte Abby davon abzuhalten, ihr Geld dafür rauszuwerfen, aber sie hielt mir vor, dass ich keine Ahnung hätte, und ich beließ es dabei, weil ich nicht streiten wollte.
Um den neugierigen Augen der Nachbarschaft nicht noch mehr zu bieten, trat ich an ihr vorbei in die Wohnung. Es war ziemlich leer geräumt. Ich ging zu meiner Couch und setzte mich. Das alles wollte ich nicht im Stehen über mich ergehen lassen.
»Ist das alles, was du zu sagen hast?«, erkundigte sie sich schnippisch.
Nein, natürlich nicht. »Warum?«, fiel mir noch ein. Ich sollte das wohl fragen, obwohl ich es überflüssig fand. Abby war nicht mehr glücklich – ich wusste es –, und hier segelte nun die letzte Schneeflocke auf den Eisberg des Dramas, die vermutlich alles zum Einsturz bringen würde. Ich hatte es kommen sehen und nichts daran geändert. Warum wohl nicht?
»Ich kenne dich überhaupt nicht«, ereiferte sie sich. »Du lässt mich nicht an deinem Leben teilhaben. Ich weiß nie, was du denkst oder fühlst. Ich weiß nichts von dir! Hast du dir das mal überlegt? Alles verbirgst du hinter deinem ach so schönen Gesicht!« Sie schleuderte mir die Worte entgegen. Komplimente brachte man anders vor. Ihre klangen, als sollte ich mich für etwas entschuldigen, wofür ich nichts konnte.
Ich betrachtete Abby, wie sie aufgebracht vor mir stand und nicht wusste, wohin mit ihrer Energie. Bestimmt hatte sie sich alles Mögliche zurechtgelegt, und nun tat ich ihr nicht den Gefallen, angemessen zu reagieren.
Sie hatte einen tollen Körper, um den sie sich ausgesprochen sorgfältig kümmerte. Sie war ständig im Fitnessstudio und trank irgendwelche Vitamin- und Eiweißshakes. Im Restaurant bestellte sie kaum mehr als Caesar Salad ohne Dressing, ohne Croûtons und ohne alles – und an dieser Kreation aus, nun … Blättern knabberte sie dann eine halbe Stunde wie ein Kaninchen und hatte wenig bis gar keinen Genuss daran. Sie war sehr organisiert, zählte die Kalorien und nicht eine einzige konnte sich ihrer Kontrolle entziehen. Sie plante den Tag – und zwar jeden Tag – und hatte ein perfektes Konzept über den Ablauf einer Beziehung.
»… würde das nicht reichen, habe ich heute mehrfach in deinem Büro angerufen.«
Ich hatte ihrer Aufzählung meiner Unzulänglichkeiten nicht zugehört, aber ihre letzten Worte ließen mich aufmerken. »Was? Ich habe dir doch gesagt, dass mich das den Job kosten kann.«
»Ja, das hast du.«
»Und du rufst trotzdem an?«, hakte ich fassungslos nach. »Was hast du dir dabei gedacht?«
»Ich dachte, ich kann dich überraschen«, rief sie außer sich und machte eine hilflose Handbewegung. Ihr halblanges Haar hatte sich aus dem Knoten gelöst, in den sie es gezwungen hatte. Scheinbar waren selbst die meisten ihrer Locken zu aufgeregt, um still zu verharren. »Was ist denn schon dabei? Ich wollte dir sagen, dass ich einen Tisch reserviert habe. Auf deinem Handy habe ich dich aber nicht erreicht.«
Richtig. Ich hatte in meinem Tagesoutfit, bestehend aus einem klammen Handtuch, keine Möglichkeit gehabt, ein Telefon unterzubringen, und bisher noch nicht nachgesehen, ob ich etwas verpasst hatte. Ich hatte einfach nicht daran gedacht.
»Wo warst du?«
Mir wurde langsam klar, warum sie so außer sich war. Auf keinen Fall hätte sie im Büro anrufen dürfen. »In der Sauna«, murmelte ich abwesend.
Sie rang nach Luft. Ich konnte es deutlich hören. Was war jetzt wieder?
»Du? Niemals. Machst du dich lustig über mich?«
Ich hob die Brauen. »Ähm … nein.« Aber irgendwie kamen meine Worte bei ihr nicht an. Sie brannte lichterloh und sprühte vor Entrüstung. Ihre weichen Lippen bebten und ihr Kinn gleich mit, und ich konnte sehen, dass der Wasserstand in ihren Augen bedenklich anstieg.
»Ist das nur ein Witz für dich? Unsere Beziehung? Unsere Liebe? Alles nur ein Scherz … ein albernes Spiel, der schweigsamen, verschlossenen Anaelle, die sich nicht um das Leben und die Gefühle anderer schert? Immer von oben herab, ja?«
Oh, jetzt wurde sie gemein – und dass sie Liebe als großes, unerreichbares Wort mit in das Drama einfließen ließ, fand ich überflüssig. Zu keiner Zeit hatten wir Liebesschwüre ausgetauscht – oder ich war nicht dabei gewesen.
»Beruhige dich, bitte«, fing ich an und merkte im selben Moment, dass ich Öl in ein Feuer goss, das im Begriff stand, zu einem Inferno zu werden. »Ich meine…«
»Ich soll mich beruhigen?« Sie lachte auf. »Weißt du, was die gesagt haben, als ich in deinem Büro anrief?«
Ich ahnte es, aber die Frage war obligatorisch, denn sie ließ mir keine Zeit für eine Antwort, als sie mit bebender Stimme rief: »Die kannten dich nicht! Die wussten nicht, wer du bist! Ich glaube, die hielten mich für eine verwirrte Irre.«
Genau. Ich seufzte lautlos. Goldberg & Partner war eine renommierte Versicherungs- und Anwaltskanzlei in der Innenstadt, bei der ich als Büroangestellte tätig war. Eine von vielen. Jedenfalls hatte ich Abby das erzählt. Allerdings auch, dass der Vorstand dort strenge Vorgaben hatte und jeden entließ, der private Anrufe erhielt. Dass sie mich nicht kannten, lag daran, dass ich dort nie gewesen war. Nicht mal für ein Praktikum.
»Ich habe noch etwas gefunden«, fuhr sie fort, bevor ich auch nur nach Worten suchen konnte. Sie wirbelte zur Küche herum und kam mit etwas zurück, das sie am ausgestreckten Arm mit spitzen Fingern vor sich hertrug. »Kannst du mir das erklären?«
Ich erkannte das mattschwarze Metall meiner Glock 26. Meine Zweit- und Notfallwaffe. Sie hatte einen kürzeren Lauf und ein kürzeres Griffstück, sodass ich sie unauffällig bei mir tragen konnte. Der Rückstoß des 9 mm-Kalibers war kontrollierbar, und selbst beim Durchschuss einer Barriere hatte sie noch so viel Kraft, dass sie Eindruck schinden konnte – und es passten eine Menge Kugeln in das Magazin.
Etwas oberhalb der Waffe, am Ende des ausgestreckten Arms fand ich wieder Abbys Gesicht. Sie war kurz davor, die Nerven zu verlieren, und ich beschloss, sie nicht mit den technischen Details zu langweilen. Es ging wohl nicht um die Kapazität des Magazins, sondern um die einfache Existenz der Pistole in meiner Wohnung.
»Das ist kompliziert«, begann ich, während sie vor mir aufragte. Ich streckte mich, nahm ihr behutsam die Glock ab und legte sie neben mich auf die Couch.
Sie ließ mich nicht aus den Augen. »Nein, Naila, es ist ganz simpel. Ich verlasse dich.« Ihre Worte landeten schwer im Raum, und vermutlich sollten sie etwas bei mir bewirken.
Ich lauschte ihrem Klang nach, und was immer man gemeinhin bei diesen drei nicht weniger berühmten Worten auch empfinden sollte, ich empfand es nicht. »Und deshalb nimmst du meine Möbel mit?« Das erschloss sich mir nicht unbedingt.
»Ich habe vieles für dich gekauft, um es hier schöner zu machen, und ich werde alles mitnehmen. Das ist mein Recht. Der Meinung ist Caro auch.«
Ich merkte auf. Wer war jetzt Caro? Und warum konnte diese so wunderbare Ratschläge geben?
Aber eigentlich war es mir egal – und diese Erkenntnis war doch ziemlich ernüchternd.
»Willst du mir noch etwas mitteilen?« Sie verschränkte wieder die Arme vor der Brust und starrte mich auffordernd an.
Ich ertappte mich bei dem Wunsch, dass sie einfach gehen sollte. »Vergiss dein Bild nicht.«
Sie schnaubte wütend, wirbelte auf dem Absatz herum und stürmte hinaus. Die Eingangstür fiel angemessen laut und endgültig ins Schloss.
Ratlos schaute ich mich in meiner leeren Wohnung um. Sämtliche Schränke standen offen, selbst das Geschirr fehlte zu großen Teilen. Abbys neue … Lebensberaterin namens Caro hatte wirklich gründlich interveniert.
Mein Handy klingelte, und ich nahm abwesend das Gespräch an.
»Hallo?«, fragte eine weibliche Stimme, weil ich vergessen hatte, mich zu melden.
»Ja.«
»Anaelle Jones?«
»Ja.«
»Wir haben einen Auftrag für Sie.«
Ich zögerte. »Was denn für einen Auftrag?«
»Eine vermisste Person.«
»Das ist kein Auftrag«, bemerkte ich unfreundlich. Meine Geduld war erschöpft. Außerdem tat meine Schulter weh, dort, wo mir Benjamin energisch verdeutlicht hatte, was er von mir hielt. Nach dieser körperlichen Auseinandersetzung hatte mir Abby noch den verbalen Rest verpasst. Ehrlich gesagt, hatte mir das mit Benjamin mehr Spaß gemacht.
»Ich verstehe nicht …«
Ich seufzte vernehmlich, um meinen Unmut deutlich zu machen. »Ein Auftrag beinhaltet die Worte suchen oder finden oder dergleichen. Eine vermisste Person ist nicht mal ein ganzer Satz.«
»Okay … Also wir möchten, dass Sie eine vermisste Person finden«, ergänzte meine Telefonpartnerin ein wenig säuerlich.
»So was mache ich nicht.«
»Was?«
»Ich arbeite nicht für private Auftraggeber.«
»Und dafür musste ich den Satz ergänzen?«
»Woher hätte ich sonst wissen sollen, was Sie meinen?«
»Sind Sie immer so?«
»Nein – oder doch?« Vielleicht sollte sie dazu meine, ähm … Ex-Freundin befragen. »Schönen Tag noch.«
»Warten Sie!«
»Was!« Ich hatte wirklich keine Lust auf irgendwelche verrückten Anrufer.
»Es wird sich für Sie lohnen.«
»Ich brauch’ kein Geld.«
Kurzes Schweigen am anderen Ende, dann ein bitteres Lachen. »Ah, ein Krösus. Nun, da sind Sie aber die Einzige.«
Ich hatte nicht die Absicht, mit ihr meine finanzielle Situation durchzudiskutieren. »Ja, war es das jetzt?«
»Eine junge Frau wird vermisst.«
»Und ich habe immer noch kein Interesse.« Was war daran so schwer zu verstehen? Sie schien mir nicht die Hellste zu sein – oder war sie nur stur?
»Das sagten Sie schon.«
»Und doch reden wir noch miteinander.«
»Sie legen ja nicht auf.«
Was war das hier? Ein Scherz? Ich beendete das Gespräch. Unbekannter Teilnehmer erschien als Information im Protokoll. Natürlich.
Ich legte die Pistole und das Handy auf den Dielenboden und streckte mich auf der Couch aus. Ich fühlte mich leer. Das mochte daran liegen, dass sich Abby von mir getrennt hatte, obwohl ich aus Erfahrung wusste, dass diese Verletzung heilen würde.
War ich denn verletzt? Die Dinge, die sie mir vorgeworfen hatte, stimmten alle. War also nur mein Ego angeknackst? Möglich … Es war lediglich eine Frage der Zeit, bis Frauen ausflippten, wenn sie merkten, dass sie nichts über mich wussten – außer meinem Namen und die unwichtigen Details meiner Vorlieben, vom Kaffee bis zum Sex.
Abby war nicht die Erste. Sie war allerdings die Erste, die die meisten meiner Möbel mitgenommen hatte.
Wieder klingelte mein Handy, und ich ging ran.
»Sie sind doch Kopfgeldjägerin, oder nicht?«
Meine unbekannte Teilnehmerin wieder. »Stimmt.«
»Sie suchen Personen.«
»Ja. Kautionsflüchtlinge. Leute, nach denen die Polizei fahndet und nicht private …« Verrückte lag mir auf der Zunge, aber ich entschied mich für: »Fremde.«
»Wo ist der Unterschied?«
»Vermutlich die Bezahlung.«
»Ich dachte, Sie brauchen das Geld nicht.«
Touché! »Und die Gesetzeslage«, ergänzte ich gelassen. »Woher soll ich wissen, dass Sie keine Mörderin sind, die es auf ein unschuldiges Opfer abgesehen hat, das sich nur versteckt?«
»Mein Auftraggeber…«
»Ah, also sind Sie nur die Telefonmaus«, unterbrach ich sie nicht eben höflich und mit einer Beleidigung. Sie schwieg tatsächlich einen Moment, vermutlich um sich zur Ruhe zu ermahnen. Ich hatte wirklich keinen Nerv für den Mist. »Für wen arbeiten Sie?«
»Mein Auftraggeber möchte anonym bleiben.«
Ich lachte bitter. »Was uns wieder zu dem psychotischen Mörder zurückbringt.«
Ihr neuerliches Schweigen gab mir recht.
»Sehen Sie?«
Ich wollte erneut das Gespräch beenden, als sie zugab: »Man sucht sie tatsächlich, um ihr etwas anzutun. Deshalb ist es so wichtig, sie zu finden.«
»Für die Frau dann wohl eher nicht.«
»Sie hat keine Ahnung. Sie kennt die Leute nicht, die hinter ihr her sind, und deren Mittel. Die sind sehr entschlossen. Ihr Leben ist in Gefahr.«
»Selbstverständlich.« Was auch sonst?
»Ihr Name ist Tamara Graham.« Sie nannte eine obskure Adresse am Südende der Stadt.
»Das sind Abrisshäuser«, entgegnete ich unwillig.
»Richtig. Aber dort soll sie sich aufhalten.«
»Für wen arbeiten Sie?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Ist es geheim?« Ich lächelte spöttisch. »Explodiert jetzt mein Telefon?«
»Wie bitte?«
»Ich frage nur«, gab ich nach. »Jemand ruft Sie an, will, dass Sie eine Frau finden, die angeblich in Lebensgefahr schwebt, weigert sich aber, sich zu erkennen zu geben. Was würden Sie machen?« Sie blieb stumm, und ich nickte. »Sehen Sie?«, bemerkte ich noch einmal und legte abermals auf.
3. Kapitel
Langsam bog ich mit meinem schwarzen Aston Martin Vanquish in die endlos scheinende Einfahrt ein, nachdem das schmiedeeiserne Tor sich gemächlich für mich geöffnet hatte. Der V12-Motor mit seinen rund 600 PS röhrte dumpf und völlig unterfordert, als ich über den Kiesweg schlich. Das Herrenhaus der Familie Duval wuchs langsam zu seiner gesamten imposanten Größe vor mir in den abendlichen Himmel. Es war aus dem neunzehnten Jahrhundert, aber vor gut zehn Jahren renoviert und umgebaut worden und daher weit weniger einschüchternd als andere Villen der Gegend. Die Räume waren offen gestaltet und hatten bodentiefe Fenster, die so viel Licht hereinließen, wie nur irgendwie möglich. Über zwei Stockwerke verteilten sich fünf Schlafzimmer mit der entsprechenden Anzahl Badezimmer, nebst Kaminen in fast jedem Raum. Die Mauern waren teilweise aus grob verputztem Bruchstein, mit Torbögen, und die hohen gekalkten Balkendecken passten zu den honigfarbenen Dielen. Eine großzügige Terrasse erstreckte sich auf der Südseite und ging von dort in das sieben Hektar große Grundstück über. Es existierten auf dem Anwesen außerdem noch diverse angegliederte Wirtschaftsgebäude, der obligatorische Pool, ein Tennisplatz und andere Spielereien, über deren Nützlichkeit man streiten durfte.
Ich parkte vor dem Haupteingang, stieg aus und lief die weit geschwungene Freitreppe hinauf. Ich war erst auf dem obersten Absatz angekommen, als sich die Eingangstür bereits öffnete. Eine Frau in schwarzen Jeans und einem ebensolchen Shirt hielt mir die Tür auf. Es war ihre übliche Kleidung.
»Willkommen zu Hause, Frau Duval«, begrüßte sie mich, ohne die geringste Regung in ihrem scharf geschnittenen Gesicht mit dem energischen Unterkiefer. Sie war etwas kleiner als ich und hatte eine athletische Figur mit Schultern, um die ich sie beneidete. Ihr dunkles Haar trug sie so lang, das sie es streng nach hinten binden konnte. Alles an ihr wirkte professionell und strahlte überlegene Sicherheit aus.
Genervt trat ich an ihr vorbei in die Empfangshalle. »Wir hatten doch schon darüber gesprochen, Micah. Mehrfach.«
»Hatten wir … Anaelle.«
»Danke.«
»Sehr gerne.«
Ich war nicht sicher, ob ich ihr das glauben konnte. Mein Vater hatte Micah eingestellt. Er hatte jemanden gesucht, der grundsätzliche organisatorische und persönliche Funktionen einer Art Butler wahrnehmen konnte und gleichzeitig auch als Bodyguard fungierte. Eine unkonventionelle Mischung, noch dazu von einer Frau wahrgenommen. Paul Duval hatte es gehasst, wenn ständig Unmengen an Personal um ihn herumrannten – und einen Job für zwei Aufgaben, die so eng ineinandergriffen, fand er perfekt.
Interessanterweise weigerten sich die meisten professionellen Bodyguards, die Tätigkeit eines Bediensteten wahrzunehmen und Tee zu servieren. Ziemlich wenige Hausangestellte waren umgekehrt in der Lage, eine Waffe abzufeuern, oder wollten gar ihr Leben riskieren, um ihren Arbeitgeber zu beschützen. Micah war die Einzige. Ihre Geschichte blieb weitestgehend im Dunkeln. Mein Vater hatte sie gewusst, aber mit ins Grab genommen, und Micah war so einiges, aber keine Plaudertasche. Nur so viel war klar: Sie war eine Elitekämpferin – wo auch immer sie ihre Ausbildung genossen hatte. Müsste ich raten, würde ich auf Militär tippen. Sie war ein geheimnisvoller Schatten, der mich seit zehn Jahren begleitete.
Ich ging durch die Eingangshalle, während Micah die Tür schloss und mir darauf in die Küche folgte – eine Küche, die gemacht war, um das Essen für Empfänge nicht unter fünfzig Personen zuzubereiten. Eine Kochinsel nahm die gesamte Mitte ein, und es gab ringsherum an den Wänden eine unübersichtliche Anzahl von Schränken und Haken, an denen Töpfe hingen und Utensilien, die ich noch nie benutzt hatte.
Ich öffnete den Kühlschrank, dessen Inhalt eher mit seiner Einfachheit bestach, pulte zwei Eier aus einer Schachtel und fand eine angefangene Tüte mit Toast. Als ich mich umdrehte, stand Micah hinter mir. Ich zuckte vor Schreck zusammen, und die Eier nutzten den Moment, um mir aus den Händen zu rutschen. Micah bewegte sich kaum, dennoch fing sie nur ein Blinzeln später beide Eier in der Luft auf. Es ging so schnell, dass ich es nicht mal sah. Langsam entspannte sie sich wieder, und ich meinte, es lag ein leichtes Lächeln in ihren Mundwinkeln. Sicher war ich mir allerdings nicht, denn so etwas wie Gefühle ließ sie nicht zu und wurde vermutlich vehement aus ihrem Inneren verbannt.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken«, entschuldigte sie sich artig und nahm mir auch gleich den Toast aus der Hand, wo sie die Eier doch schon hatte.
Ich gab nach und ging zu einem rustikalen Esstisch, der gut eine Hälfte der Küche einnahm. Ich setzte mich auf den Tisch, die Füße auf einem Stuhl, und beobachtete Micah, wie sie eine Pfanne nahm und mit einer Hand die Eier hineinschlug.
»Sie sind früh zurück«, bemerkte sie, ohne aufzusehen. Mehr Neugier würde sie nicht preisgeben, und es war eigentlich keine richtige Frage. Eine Frage hätte sie nie gestellt.
Ich wünschte, sie würde diese Förmlichkeiten lassen, aber alles, was ich hatte durchsetzen können, war, dass sie mich nicht ständig Frau Duval nannte. Näher wollte sie nicht herankommen.
»Abby hat sich von mir getrennt«, hörte ich mich sagen und war selbst ein wenig überrascht.
Micah ließ sich nichts anmerken.
War das gut oder schlecht?
»Waren Sie denn mit ihr zusammen?«
Ah, immer den direkten Weg. »Sie behauptet es.«
»Nun, es war abzusehen.«
Ein wenig Mitgefühl wäre nett gewesen. »Findest du?«
Rasch hob sie den Kopf, und ihre dunklen Augen trafen mich mit einem undurchdringlichen Blick.
Meine Stimme hatte wohl etwas angespannt geklungen. Ich räusperte mich und setzte ruhig hinzu: »Sie hat im Büro angerufen.«
»Obwohl sie annehmen musste, dass Sie dadurch Schwierigkeiten bekommen?«
»Ja.«
Wortlos wendete sie die Eier.
Ich wartete, aber mehr wollte sie offenbar nicht sagen. Jedes Wort wäre auch überflüssig gewesen. Abby war nicht die Erste und würde nicht die Letzte sein, die ihren Beziehungsstatus mit mir hinschmiss oder von mir hingeschmissen bekam.
Obwohl, wenn ich drüber nachdachte, trennte ich mich nicht oft. Das lag allerdings daran, dass ich die Frauen nach einer Weile meist kaum mehr wahrnahm. Ich wusste das und konnte es doch nicht ändern. Sie waren alle so beliebig. Sie klammerten sich an mich, und ich vergaß sie dann einfach. Sie bekamen nicht die Aufmerksamkeit, die sie sich wünschten, und je nach Leidensfähigkeit trennten sie sich auf die eine oder andere Art.
Das war ein Grund, weshalb ich es oft bei kurzen Begegnungen beließ, in denen der Lebenslauf zumeist aus dem Vornamen bestand.
Ich würde mich auch von mir trennen, von Anaelle Jones und Anaelle Duval – beide Frauen waren unnahbar. Anaelle Duval war gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Alexander die reiche Erbin des millionenschweren Vermögens von Paul Duval. Unsere Mutter Linda Jones war bei unserer Geburt gestorben, sodass Paul genötigt wurde, sich um zwei Kinder zu kümmern – mehr oder weniger. Es gab ja Personal. Er war nicht bereit, seinen Lebensstil einzuschränken, der sich größtenteils mit Frauen befasste – jungen Frauen, teilweise gerade alt genug, dass es keine Schwierigkeiten mit den geltenden Gesetzen gab. Sie schwärmten für ihn oder wahlweise für sein Geld. Er wiederum schwelgte in ihrer jugendlichen Naivität und hoffte, dass etwas von dieser Frische auf ihn überging, während die Frauen uneingeschränkten Reichtum und Luxus genossen.
Es waren allesamt Begegnungen auf Zeit, und Paul bestimmte, wann Schluss war. Sie mussten sich anstrengen und attraktiv für ihn bleiben, was aufgrund ihrer unverbrauchten Körper leicht war. Schwieriger war es, auch interessant zu sein. Das schaffte kaum eine. Wenn es keine Spannung mehr gab, keine Geheimnisse mehr zu entdecken, dann ließ er sie gehen. So hatte er es genannt. Eine poetische Variante von Abserviert-Werden.
Das klingt schlimmer, als es war, denn jede von ihnen bekam eine großzügige Abfindung, und keine war am Ende traurig, dass Paul sie fallen ließ.
Mein Leben wurde bestimmt von hübschen Gesichtern, die sich alle um mich bemühten, bis sie merkten, dass es Paul egal war, ob ich sie mochte oder nicht, weil er mich selbst kaum wahrnahm. Sie zogen vorbei und verschwanden in Vergessenheit.
Oh, es ging mir gut. Ich hatte ja alles, was ich mir wünschte – alles, was man für Geld kaufen konnte. Nur eine Bezugsperson hatte ich nicht. Es gab niemanden, der mich um meiner selbst willen mochte und nicht nur, um Paul zu gefallen. Sogar Kindermädchen waren ein durchlaufender Posten, denn sie reihten sich nahtlos in seine Affären ein. Es gab keine Frau unter dreißig, die vor ihm sicher war – und Paul umgab sich nur mit Frauen unter dreißig.
Alexander kam damit sehr viel besser zurecht als ich. Er besaß schon immer die Anziehungskraft eines jungen Welpen, der alle begeisterte. Mit seiner freundlichen aufgeschlossenen Art lagen ihm die Menschen zu Füßen, wohingegen ich eher zurückhaltend blieb und keinerlei Interesse daran zeigte, von Leuten gemocht zu werden, denen ich nach einem kurzen Zwischenspiel nie wieder begegnen würde.
Als ich alt genug war, um aufs Internat gehen zu können, war ich froh und schaute nicht ein einziges Mal zurück. Es gefiel mir dort, denn alles drehte sich nur um Leistung. Zum ersten Mal im Leben galt das, was ich tat, etwas und nicht, von wem ich abstammte. Zweifellos war das nicht unwichtig, denn nur Kinder von wohlhabenden Familien konnten diese Schule besuchen. Es war elitär. Aber das war nichts Besonderes, denn damit war ich aufgewachsen.
Alexander blieb bei Paul, bekam Privatlehrer und ergötzte sich am oberflächlichen Luxus, den das Leben zu bieten hatte. Es störte ihn nicht. Im Gegenteil. Er genoss alle Freiheiten, die man erkaufen konnte, sein Studium lief nebenher und stand hinter den Partys zurück, die ein Heranwachsender ohne jegliche Limits veranstalten konnte. Es machte ihn über die Maßen beliebt. Sein Geld, seine Großzügigkeit und sein mehr als attraktives Aussehen, kombiniert mit dem ihm eigenen Charme, öffneten ihm sämtliche Herzen – vor allem die der Mädchen, was eine faszinierende Parallele zu seinem Vater schuf.
Paul Duval starb vor zehn Jahren an einem Schlaganfall.
Nein, nicht beim Sex, obwohl er sich das sicher gewünscht hätte, wenn auch erst im fortgeschrittenen Alter und nicht mit Mitte sechzig. Es war bei seinem morgendlichen Tennistraining. Er fiel um und war tot – und wir erbten mit neunzehn sein komplettes Vermögen, denn trotz seines Bedürfnisses, mit jeder Frau Sex haben zu wollen, schaffte er es, dass außer unserer Mutter keine mehr schwanger wurde.
Müsste ich raten, würde ich auf eine Vasektomie tippen, aber das war sehr unwahrscheinlich, weil alles, was mit seiner Potenz zu tun hatte, sein ganzer Stolz gewesen war.
Ich war im Ausland auf Reisen, um mir die Welt außerhalb des Internats anzusehen, als ich den Anruf bekam. Mein Leben im Herrenhaus der Duvals begann mit der Beerdigung meines Vaters. Einige interessante Klauseln in seinem Testament verboten den Verkauf des Anwesens, weshalb ich zunächst wieder in das Haus meiner Kindheit einzog. Dieses Zunächst dauerte noch immer an und irgendwie arrangierte ich mich.
Alexander hingegen blieb in seinem Luxuspenthouse, in das er gezogen war. Er hatte das Herrenhaus bis zu seiner Volljährigkeit genossen, war nicht geflüchtet so wie ich und hatte keinerlei Bedarf, sich an irgendetwas zu beteiligen, was übers Geldausgeben hinausging. Wir hatten nicht viel gemeinsam, und die vergangenen Jahre der Trennung hatten uns entfremdet. Unser erstes Treffen nach gut fünf Jahren, zu diesem trübsinnigen Ereignis, verlief wortkarg und höflich.
Micah war bei meiner Rückkehr eine Überraschung gewesen. Die stille ernste Frau passte absolut nicht in das Bild der weiblichen Gesellschaft, mit der mein Vater sich vergnügt hatte. Sie schien mir auf den ersten Eindruck zu viel Selbstwertgefühl zu besitzen, um sich auf eine Liaison mit einem ältlichen Millionär einzulassen – Geld hin oder her. Sie klärte mich über ihre Aufgaben auf, und ich fragte sie, ob sie auch mit meinem Vater geschlafen habe. Ihr Gesicht war völlig reglos, als sie mit einem einfachen Nein antwortete.
Ich blieb skeptisch. Sie passte in sein Beuteschema, und erst als sie trocken bemerkte, der Andrang im Bett meines Vaters sei in den letzten Jahren so groß gewesen, dass nicht mal Maria Magdalena einen Termin bekommen hätte, glaubte ich ihr. Da sie bereits länger als die übliche Halbwertszeit der Affären für Paul gearbeitet hatte, bot ich ihr an, zu bleiben, und sie stimmte zu.
Ich fügte mich in dieses Leben. Es war das Erbe der Duvals. Eine altehrwürdige Linie reicher und einflussreicher Menschen – und sie waren nun mal unsere Familie, auch wenn wir immer die unehelichen Sprösslinge unseres Vaters sein würden. Ein Makel, den alle versuchten, geflissentlich zu übersehen. Im Umkehrschluss begannen wir die Erwartungen zu erfüllen. Ich lernte, damit umzugehen, dass jede meiner Unterschriften über Firmen entschied und Summen verschob, die sich jenseits der Normalität befanden – und das sich hinter allem auch Schicksale von Menschen verbargen. Mein Alltag bestand aus Pflichten und war mehrheitlich fremdbestimmt. Eine Tatsache, die an mir zerrte.
Das war mein Leben, Anaelle Duvals Leben.
Anaelle Jones hingegen …
Sie war ein völlig anderes Kaliber. Sie existierte schlussendlich nur, um mich am Leben zu erhalten, auch wenn sie es genau genommen in Gefahr brachte.
Micah kam zu mir und unterbrach meine Gedanken, als sie mir einen Teller mit knusprig gebratenen Eiern und goldbraunem Toast reichte. Ein Puschel Petersilie lag dekorativ auf dem Rand. Mit hochgezogenen Brauen sah ich sie an, und sie nahm es gelassen hin.
»Stil«, sagte sie bloß.
Ach so, na klar. Ich rutschte vom Tisch auf den Stuhl und fing an zu essen. »Setz dich bitte, sonst bekomme ich ein Magengeschwür, wenn du mich von da oben beobachtest.« Ich versuchte gar nicht erst, ihr anzubieten, mit mir die Mahlzeit einzunehmen. Das war auch so ein Kampf, den ich vor langer Zeit aufgegeben hatte.
Immerhin zog sie sich einen Stuhl zurecht und setzte sich neben mich. Ich biss von dem Toast ab und holte einen Zettel aus der Hosentasche, den ich ihr reichte.
Sie faltete ihn auseinander und las, was draufstand. Da es nur ein Name war, war sie schnell damit fertig. »Wer ist das?«
»Eine Frage, die du für mich klären kannst. Ich bekam einen anonymen Anruf von einer Person, die für einen anonymen Auftraggeber arbeitet, der diese Frau sucht. Alles sehr…«
»Anonym?«
Oh, ein Scherz. Ich grinste ein bisschen. »Allerdings.«
»Sie haben den Auftrag angenommen?«
»Sicher nicht! Obwohl die Anruferin sehr hartnäckig war.« Aufdringlich wäre ebenfalls eine schöne Umschreibung. Passte beides wunderbar. Lästig vielleicht auch.
»Ich verstehe. Die Neugier.« Sie sagte es wertfrei. Jedenfalls ließ sie nicht heraushören, was sie dachte.
»Sie behauptete, die Frau wäre in Gefahr.«
»Selbstverständlich.«
Glaubte sie mir nicht? »Sie meinte, jemand würde ihr etwas antun wollen.«
»Das ist die Definition von Gefahr – die Möglichkeit, dass jemandem etwas zustößt.«
Reizte sie mich mit Absicht? Ich starrte sie an, bis sie mit den Schultern zuckte. »Ich werde sehen, was ich rausfinde. Was ist mit Benjamin Kross?«
Ach der! »Falls noch mal jemand auf die Idee kommt, eine Festnahme in der Sauna zu arrangieren, lehnen wir ab.«
»Haben Sie ihn gestellt?«
Ich schnaubte – ein wenig großspurig, wenn ich meine schmerzende Schulter bedachte. »Natürlich.«
Diesmal bildete ich mir das Lächeln nicht ein, das sich in ihre Mundwinkel schlich. »Natürlich«, bestätigte sie.
4. Kapitel
Wie fast jeden Tag verließ ich am frühen Abend noch einmal die Villa. Aufgrund der reichlich vorhandenen PS meines Aston Martin, der ländlichen Gegend mit leicht gewundenen Straßen und ohne Verkehrsführung wie Ampeln, die einen aufhielten, erreichte ich den modernen Gebäudekomplex der abgelegenen Privatklinik in unter einer Stunde.
Ich betrat den geschmackvollen Empfang, mit dem extravagant gestalteten Tresen, in den man am Boden und in der Mitte Streifen von indirektem Licht eingebaut hatte, das ihn erhellte, aber doch keinerlei erkennbare Leuchtmittel offenbarte. Es wirkte sehr futuristisch. Die Wände waren mit Holz vertäfelt und der Boden aus glänzendem schwarzen Marmor. Alles verdeutlichte dem Besucher, dass der Aufenthalt hier überaus exklusiv war und nicht jedem offenstand. Dafür allerdings war die medizinische Betreuung herausragend und ging weit über plastische Chirurgie hinaus, die mit Sicherheit eine Haupteinnahmequelle der Klinik war. Das gesamte Personal, vom Chirurgen bis hin zu den Pflegekräften, wurde akribisch ausgesucht. Es wurden mehr Bewerber abgelehnt als genommen, aber wer einmal eingestellt worden war, bekam auch ein Gehalt, das man sonst in keiner Klinik verdienen konnte. Das Interesse, sich zu beweisen, war entsprechend groß.
Die einzige Gemeinsamkeit, die es eventuell zu einem staatlichen Krankenhaus gab, war der obligatorische Ficus, der auch hier in einer Ecke sein Dasein fristete, weil das künstliche Licht zwar wunderschön gestaltet war, ihn aber doch veranlasste, seine Blätter fallen zu lassen.
Die Dame am Empfang nickte mir höflich zu, ohne mich anzusprechen. Ich erwiderte ihren Gruß ebenso und betrat direkt den Aufzug, der mich in den dritten Stock brachte. Ich kannte den Weg auswendig, denn ich kam fast jeden Tag hierher, wenn ich keine Aufträge hatte. Es war ein Ritual, das mir half, zu verstehen.
Ich klopfte nicht an die Tür, sondern trat einfach ein. Ein großes helles Zimmer schloss sich an. Darin nahm ein riesiges Bett den meisten Platz ein, sowie etliche elektronische Geräte, die darum aufgestellt waren. Die Anzeigen blieben stumm, während sie einen gleichmäßigen Herzschlag aufzeigten – nebst den restlichen Vitalfunktionen. Der Mann im Bett war schmal, sein Gesicht fast so weiß wie das Bettlaken. Ein Bartschatten lag um sein Kinn. Seine bräunlich dunklen Haare waren zerzaust und ein wenig zu lang. Er schlief – vermutlich. Aber genau genommen schlief er seit fünf Jahren.
Ich trat neben das Bett und betrachtete ihn. Kurz streifte mein Blick die Monitore, die in gleichmütiger Arbeit aufzeigten, dass er noch am Leben war – wie auch immer man diesen Begriff festlegen wollte.
Langsam setzte ich mich in den bequemen Sessel davor. Die Tür hinter mir öffnete sich erneut. Auch ohne mich umzudrehen, wusste ich, dass es Schwester Sara war. Ich kannte die Dienstpläne auswendig, und über die Kameras hatte man mich sicher kommen gesehen.
»Wie geht es ihm?«, fragte ich in den Raum, obwohl die Antwort immer gleich war.
»Unverändert, aber so weit gut.« Die Frau trat um das Bett herum. Sie war unwesentlich älter als ich und ihr Lächeln freundlich. »Kann ich Ihnen etwas bringen, Frau Duval?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bleibe nicht lange. Danke.«
Sie zupfte das Laken zurecht und entfernte sich wieder.
Ich legte die Füße auf die Bettkante und lehnte mich im Sessel zurück, während ich Alexander betrachtete. Es war mein Gesicht, in das ich schaute. Schmal und ebenmäßig, sanft geschwungene Lippen, gerade Brauen – per Definition schön. Ein wenig herber, männlicher natürlich. Es war attraktiv, allerdings zu ausgezehrt. Die Züge blieben entspannt, aber leer. Wir hätten eineiige Zwillinge sein können. Bis zu unserem zwölften Lebensjahr wurden wir regelmäßig verwechselt, weil ich immer nur kurze Haare trug wie Alexander. Dieser Umstand änderte sich erst mit der Pubertät und der schlichten Tatsache, dass sich unsere Körper unterschiedlich entwickelten.
Über seinem linken Auge war eine Klappe befestigt, die die zerstörte Höhle darunter verbarg. Sie hatten den Knochen wiederhergestellt. Nichts an seinem Kopf war deformiert, nur das Auge selbst hatten sie nicht retten können. Ansonsten war er unversehrt. Inzwischen. Sein Körper hatte lange Zeit gehabt, um zu heilen. Das machte er selbstständig, ohne das Zutun von Bewusstsein. Eine funktionierende organische Maschine.
Alexander Duval befand sich seit gut fünf Jahren im Wachkoma. Die Prognosen waren inzwischen … nun, genau genommen gab es keine mehr. Anfangs versprach mir jeder Arzt, er würde bald aufwachen. Das tat er jedoch nicht. So wurde man zurückhaltender, und mittlerweile warteten alle nur noch, wie lange sein Körper durchhalten würde.
Ein Autounfall hatte ihn das Auge gekostet, und wegen verschnittener Drogen war er im Koma. Letztere hatte er selbst konsumiert – den Unfall hatte ich verursacht.
***
Nach dem Tod von Paul gingen wir unterschiedlich mit dem Druck um, der auf uns lastete. Ein Treuhänder verwaltete das gesamte Vermögen, dennoch gab es Verpflichtungen und Entscheidungen, die getroffen werden mussten.
Eine dunkle Zeit schloss sich an. Ich fühlte mich verloren und von diesem neuen Leben, in das ich gepresst wurde, überrannt. Menschen buhlten um mich, und ich wurde unangenehm an meine Kindheit erinnert und an Paul Duval, der sein Geld nutzte, sich alles und jeden zu kaufen, ohne je zu hinterfragen, ob irgendwem etwas an ihm als Person lag. Es war fast unmöglich, zu unterscheiden, sodass ich distanziert blieb und mich zurückzog, soweit es gesellschaftlich angebracht war.
Ich war einsam und vermutlich auch depressiv. Aus heutiger Sicht kann ich das zugeben. Unser Vater hatte mich nie beachtet, und doch gelang es ihm, sogar nach seinem Tod mein Leben zu bestimmen. Ich ließ zu, dass er Träume und Wünsche, die ich vielleicht hätte haben können, erstickte, bis ich selbst nicht mehr wusste, ob ich ein anderes Leben lieber leben würde. Sein letzter Wille fesselte mich an ein Anwesen, das ich verabscheute, da es mich in meiner Vergangenheit ertränkte und mit einem Vermögen bedachte, das mich verpflichtete, jemand zu sein, der ich nicht sein wollte.
Natürlich hätte ich alles ausschlagen und weggehen können, allerdings band das Erbe Alexander und mich aneinander. Beide oder keiner, lautete eine von vielen Beschränkungen, und Alexander gab mir kurz nach meiner Rückkehr deutlich zu verstehen, dass er nicht auf das Vermögen verzichten würde. Allein das monatliche sogenannte Taschengeld umfasste das Jahreseinkommen eines Normalsterblichen. Schwer, dem zu entsagen. Ich fühlte mich genötigt, nachzugeben. Immerhin hatte ich Alexander im Herrenhaus zurückgelassen, auch wenn es schlussendlich seine Entscheidung gewesen war. Er war geblieben, und ich war gegangen. Er war in die Geschäfte involviert worden, als einziger Sohn Duvals, und ich hatte studiert, wonach mir der Sinn stand.
Ich gab nach und fügte mich. Ich war es ihm schuldig – irgendwie – und der Käfig war aus Gold, also gab es wohl Schlimmeres.
Eines Abends überredete Alexander mich, ihn zu einer dieser Partys zu begleiten. Ich war vierundzwanzig. Er meinte es gut, vermutlich, wollte mich aus meiner Dunkelheit holen, aber es war nicht meine Welt, dieses Balzen um das andere Geschlecht. Ich hasste es.
Anaelle Duval hatte keine Affären – niemals, obwohl es ausgesprochen einfach gewesen wäre. Ich hätte jeden und jede haben können, weil ich war, wer ich war. Ich sah es an Alexander, aber ich ließ mich auf nichts ein, denn dazu hatte ich viel zu viel Angst, wie mein Vater zu sein. Am Ende jagte doch jeder nur meinem Vermögen nach.
Aus unserem Programm
REG BENEDIKT
Die Träne der Aphrodite (Sasha Barnett-Reihe, Bd.1)
Thriller
ISBN Print: 978-3-903238-50-3
ISBN PDF: 978-3-903238-51-0
ISBN EPUB: 978-3-903238-52-7
ISBN PRC: 978-3-903238-53-4
Sasha Barnett, ehemalige Personenschützerin, wacht ohne Erinnerung im Krankenhaus auf. Blut klebt an ihrer Kleidung, und die Polizei verhört sie als Tatverdächtige – dabei sollte sie nur in der Detektei von Hank Ruben aushelfen. Schon bald vermutet sie einen Zusammenhang zwischen den mysteriösen Geschehnissen und ihrem Auftrag, für die reiche Familie Duprais einen entwendeten Saphir wiederzubeschaffen – jedoch liegt dieser Diebstahl schon sechzig Jahre zurück ...
Umso größer ist ihre Überraschung, als unerwartet Arizona auftaucht, die ebenfalls nach dem Stein sucht und wenig begeistert ist, als Sasha ihr in die Quere kommt. Zu allem Überfluss macht es sich auch noch die unnahbare Dr. Josephine Lawson zur Aufgabe, Sasha helfen zu wollen. Die beiden Frauen sind allerdings ihr geringstes Problem, denn plötzlich steht Sashas Leben auf dem Spiel, und eine mörderische Jagd beginnt ...
www.HOMOLittera.com
REG BENEDIKT
Das Venus-Tattoo
Thriller
ISBN Print: 978-3-903238-70-1
ISBN PDF: 978-3-903238-71-8
ISBN EPUB: 978-3-903238-72-5
ISBN PRC: 978-3-903238-73-2
Sashas Job als Detektivin scheint nur noch aus dem Beschatten untreuer Ehepartner zu bestehen – und dabei hat sie mit Beziehungsdramen selbst genug um die Ohren, denn Jo hat sich völlig unerwartet von ihr getrennt. Da kommt ihr der Auftrag, den Tod einer jungen Tätowiererin aufzuklären, gerade recht. Während die Polizei von Selbstmord ausgeht, ist Ella, die Freundin der Verstorbenen, von einem Gewaltverbrechen überzeugt. Ein von der Toten hinterlassener Brief ist der Anfang einer Reihe rätselhafter Hinweise zu einem dunklen Geheimnis – und jemand scheint bereit zu sein, seine Opfer dafür qualvoll sterben zu lassen ...
www.HOMOLittera.com
REG BENEDIKT
Jägerin der Schatten (Die Magische Grenze, Bd.1)
Fantasy
ISBN Print: 978-3-903238-34-3
ISBN PDF: 978-3-903238-35-0
ISBN EPUB: 978-3-903238-36-7
ISBN PRC: 978-3-903238-37-4
Als Sina auf die geheimnisvolle Eve trifft, ahnt sie nicht, in welcher Gefahr sie sich bald befinden wird. Denn Eve ist eine Jägerin, dazu auserwählt, all jene Geschöpfe in eine Parallelwelt zu schicken, die es sonst nur in Legenden und Märchen gibt. Eine Flut von Ereignissen wird in Gang gesetzt, die Sinas alltägliches Leben und alles, woran sie bisher geglaubt hat, auf den Kopf stellt.
Als sie schließlich mit einer mächtigen Magierin verwechselt wird und ein uralter Dämon sie töten will, ist Eve die Einzige, die sie noch retten kann ...
www.HOMOLittera.com
REG BENEDIKT
Wächterin der Dunkelheit (Die Magische Grenze, Bd. 2)
Fantasy
ISBN Print: 978-3-903238-78-7
ISBN PDF: 978-3-903238-79-4
ISBN EPUB: 978-3-903238-80-0
ISBN PRC/Mobi: 978-3-903238-81-7
Riven wird als Baby von einem abtrünnigen Magier mit dämonischer Dunkelheit gezeichnet. So wächst sie als Außenseiterin in einer Welt voller blutiger Konflikte um das allmächtige Schicksalstor auf. Einzig ein verschollener Schlüssel kann den Krieg beenden, und nur Riven weiß, wo dieser zu finden ist. Als ihr Weg sie über die Magische Grenze in die Schattenwelt führt, stößt sie auf die knallharte Ermittlerin Mack, und unerwartet ist sie die Verdächtige in einem grausamen Mordfall. Doch Mack scheint auch die einzige Chance zu sein, ihr Volk zu retten …
www.HOMOLittera.com
REG BENEDIKT
Elysions Tochter
Science Fantasy
ISBN Print: 978-3-903238-94-7
ISBN PDF: 978-3-903238-95-4
ISBN EPUB: 978-3-903238-96-1
ISBN PRC/Mobi: 978-3-903238-97-8
Jacks ist die beste Dealerin auf Elysion – und sie ist eine von vielen Mutanten, die zurückblieben, als die Regierung die Kolonie sich selbst überließ. Um der Sklaverei zu entgehen, verbirgt sie ihre Herkunft. Als ausgerechnet Mitglieder der Regierung Kaat, ihre einzige Verbündete, und sie als Führerinnen zu einem geheimnisvollen Ziel tief im Dschungel Elysions engagieren wollen, ist Jacks Tarnung in Gefahr. Noch ahnt sie nicht, dass nicht die Neuankömmlinge ihre größten Feinde sind, sondern das, was in ihr selbst verborgen liegt ...
www.HOMOLittera.com
Friedenszeit
#Miteinanda für die Ukraine
Benefizanthologie
ISBN Print: 978-3-99144-008-6
ISBN PDF: 978-3-99144-009-3
ISBN EPUB: 978-3-99144-010-9
ISBN PRC/Mobi: 978-3-99144-011-6
Autor:innen schreiben für die Ukraine: Unter dem Hashtag „Miteinanda für die Ukraine“ setzten Dutzende von Autor:innen ein solidarisches Zeichen und griffen zur Schreibfeder. Ob romantisch, sinnlich, leidenschaftlich, liebevoll, fantastisch oder nachdenklich, alle Kurzgeschichten haben eins gemeinsam: Sie haben ein Happy End und erzählen von Liebe, Hoffnung, Glück und Neuanfängen.
Mit dem Kauf der Benefizanthologie „Friedenszeit“ unterstützen Sie die gemeinsame Spendenaktion „Wir für Ukraine“ der Caritas und der Kleinen Zeitung. Sämtliche Autor:innen sowie der Verlag verzichten auf ihr Honorar und ihre Bezahlung. Alle Einnahmen kommen der Spendenaktion zugute.
#Miteinanda für die Ukraine – Ein Projekt aus Liebe und Solidarität
www.miteinandafuerdieukraine.at