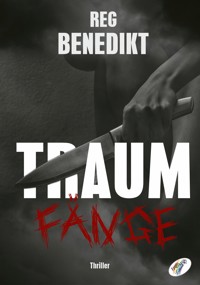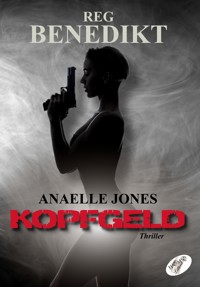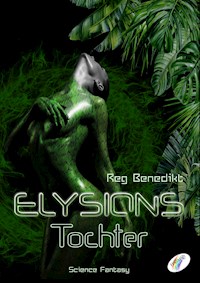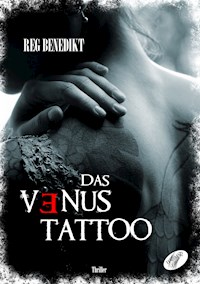5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sasha Barnett, ehemalige Personenschützerin, wacht ohne Erinnerung im Krankenhaus auf. Blut klebt an ihrer Kleidung, und die Polizei verhört sie als Tatverdächtige – dabei sollte sie nur in der Detektei von Hank Ruben aushelfen. Schon bald vermutet sie einen Zusammenhang zwischen den mysteriösen Geschehnissen und ihrem Auftrag, für die reiche Familie Duprais einen entwendeten Saphir wiederzubeschaffen – jedoch liegt dieser Diebstahl schon sechzig Jahre zurück … Umso größer ist ihre Überraschung, als unerwartet Arizona auftaucht, die ebenfalls nach dem Stein sucht und wenig begeistert ist, als Sasha ihr in die Quere kommt. Zu allem Überfluss macht es sich auch noch die unnahbare Dr. Josephine Lawson zur Aufgabe, Sasha helfen zu wollen. Die beiden Frauen sind allerdings ihr geringstes Problem, denn plötzlich steht Sashas Leben auf dem Spiel, und eine mörderische Jagd beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BENEDIKT
Inhaltsverzeichnis
Die Träne der Aphrodite
Die Träne der Aphrodite
Impressum
Widmung
Über die Autorin
Die Träne der Aphrodite
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Programm
Jägerin der Schatten
Herbstsplitter
Lesbe auf Butterfahrt
Enge Bande
Das Leuchten des Almfeuers
REG BENEDIKT
Thriller
© Reg Benedikt, Die Träne der Aphrodite
© HOMO Littera Romy Leyendecker e. U.,
Am Rinnergrund 14/5, A – 8101 Gratkorn,
www.HOMOLittera.com
E-Mail: [email protected]
Grafik und Gestaltung: Rofl Schek
Cover: © tugolukof by AdobeStock.com
Das Model auf dem Coverfoto steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des E-Books. Der Inhalt des E-Books sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Models aus.
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Handlung, Charaktere und Orte sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Die geschilderten Handlungen dieses E-Books sind fiktiv! Im realen Leben gilt verantwortungsbewusster Umgang miteinander und Safer Sex!
Originalausgabe: Februar 2020
ISBN Print: 978-3-903238-50-3
ISBN PDF: 978-3-903238-51-0
ISBN EPUB: 978-3-903238-52-7
ISBN PRC: 978-3-903238-53-4
Für meine Frau, weil du unser Leben verzauberst und immer an mich glaubst – außerdem hast du dir ein Buch ohne Monster von mir gewünscht. Bitte schön!
Über die Autorin
Reg Benedikt, geboren 1973, ist eine deutsche Schriftstellerin, die mit Vorliebe Protagonistinnen erschafft, die nicht allzu zimperlich sein dürfen. Inspiriert wird sie von Actionfilmen, Fantasy-Epen und Science-Fiction-Schlachten. Auf dem Weg zur Arbeit führt sie oftmals Gedankendiskussionen mit ihren Heldinnen. Dabei ist die entscheidende Frage nicht, ob sich ihre Charaktere verlieben, sondern vielmehr wie und wann. Reg Benedikt lebt mit ihrer Frau und diversen Fellnasen in der Nähe von Berlin.
Veröffentlichungen bei HOMO Littera:
Jägerin der Schatten, Die Magische Grenze (2019)
KAPITEL 1
Die Schreie waren unerträglich – voller Wut und Verzweiflung, als würde die Frau die schlimmsten Abgründe der Hölle durchleben. Man hatte sie ans Bett gefesselt, ihr ganzer Körper bäumte sich auf und wehrte sich gegen die breiten Lederbänder, die man ihr um die Hand- und Fußgelenke gelegt hatte. Es war kaum mit anzusehen. Mit aller Kraft warf sie sich herum und gebärdete sich wie eine Wahnsinnige.
Die Kamera zoomte näher heran.
Die blonden Haare hingen ihr strähnig ins Gesicht. Vor Anstrengung war die Haut gerötet und ihre Augen weit offen, aber blind für das, was um sie herum geschah. Sie hatte einen starren unheimlichen Blick. In ihrer Raserei, sich nicht befreien zu können, fletschte sie die Zähne, und Speichel lief über ihre Lippen.
„Es reicht“, flüsterte ich.
Der Bildschirm wurde schwarz, und in der jetzt dunklen Oberfläche spiegelte sich wieder das Gesicht der Frau. Blass war es, mit dunklen Ringen unter den Augen, und sie schaute mir betroffen und verwirrt entgegen.
Ich wandte mich von meinem Spiegelbild ab. Meine Hand zitterte, als ich die Striemen an meinem Handgelenk massierte. Um das Beben zu verbergen, faltete ich meine kalten Finger und versteckte sie im Schoß.
Das Krankenhauszimmer, in dem ich mich befand, war nicht ungewöhnlich, außer, dass es ein Einzelzimmer war. Ich war schon in Krankenhäusern gewesen – viel zu oft, aber meist mit nervenden, unangenehmen Zimmergenossen. Jetzt wurde mir das zweifelhafte Privileg eines Einzelzimmers zuteil, und ich hätte gerne darauf verzichtet.
Ich war auch nicht allein. Im Gegenteil, das Zimmer war unangenehm überfüllt. Ein Arzt war hier, indischer Abstammung, und zwei Polizisten. Einer in Uniform und einer in Zivil. Der in Zivil machte mir Sorgen. Er hatte sich als Moore vorgestellt. Er war derjenige, der mir das Leben schwer machen würde. Auch daran erinnerte ich mich deutlich. Es waren immer die ohne Uniform. Die, die sich tarnten und auftraten wie jeder andere.
Ich fühlte mich ausgesprochen unbehaglich. Nicht nur wegen des verstörenden Videos, das sie mir eben gezeigt hatten, sondern auch, weil ich im Bett saß und nur eines dieser Krankenhaushemden trug, wo es überall reinzog. Genauso gut hätte ich nackt hier sitzen können. Ich hasste das. Ich fühlte mich schutzlos, und genau so war es wohl auch gedacht.
Die Blicke des Zivilbullen lagen auf mir wie die eines Geiers, der wartet, bis seine Beute den letzten Atemzug getan hat.
„Möchten Sie uns dazu etwas sagen?“, fragte Moore mit tiefer sonorer Stimme. Er war noch keine vierzig, unrasiert, vermutlich überarbeitet wie die gesamte Polizei. Sein Anzug war zerknautscht, als hätte er darin geschlafen. Vielleicht war es sogar so.
Ich schüttelte den Kopf.
Was sollte ich denn sagen?
Ich war entsetzt. Zutiefst entsetzt über das, was ich gesehen hatte. Diese Wahnsinnige auf dem Video hatte mein Gesicht, aber mir fehlte jegliche Erinnerung an diesen – Ausbruch. Mir fehlten generell einige Passagen der jüngsten Vergangenheit und darüber hinaus. Das war mir schon aufgefallen, und es machte mich nervös. Es ist beunruhigend, wenn man versucht, sich zu erinnern, wie man zum Beispiel ins Krankenhaus gekommen war, und da nichts ist. Gar nichts. Nur Leere.
„Wie bin ich hierhergekommen?“ Selbst meine Stimme war mir nicht vertraut, so heiser klang sie – wund vom Schreien. Ein Schauer lief mir über den Rücken.
„Man fand Sie auf der Straße, in einer Seitengasse. Jemand hat den Notruf gewählt.“
„Jemand?“
„Es war niemand mehr da, als der Notarzt eintraf.“ Moore musterte mich. „Außer Ihnen. Woran erinnern Sie sich?“
Eine wirklich sehr gute Frage, und je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger wollte mir einfallen. „An meinen Namen“, sagte ich düster. „Sasha Barnett.“ Das klang immerhin vertraut. Der Rest war undeutlich und machte mir Kopfschmerzen.
„Ja, den konnten Sie uns nennen. Verraten Sie uns, wo Sie waren?“
„Ich weiß es nicht. Wo haben Sie mich denn gefunden?“
Er schien zu überlegen, ob ich ihn verspotten wollte, zuckte dann aber nur mit den Schultern. „Am Südende der Stadt. Eine wirklich unschöne Gegend. Drogenumschlagplatz, Dealer, Waffenschieber.“ Er ließ das kurz sacken. „Was wollten Sie da?“
„Keine Ahnung ... Wissen Sie es?“
Seine Stirn runzelte sich ungeduldig. Er wandte sich an den Arzt, der unbeteiligt mit meinem Krankenblatt dabeistand und vermutlich hoffte, noch rechtzeitig zu seiner Mittagspause zu kommen. „Verarscht sie mich, Doc?“ Er klang richtig wütend. Vor allem tat er so, als wäre ich nicht zurechnungsfähig.
Ärgerlich presste ich die Lippen aufeinander. Worauf lief das hinaus? Was war passiert, dass sie einen Ermittler auf mich ansetzten?
Der Arzt schüttelte den Kopf. „Nein, ich kann mir das nicht vorstellen.“ Er blätterte in meinem Krankenblatt – ich nahm an, dass es mein Krankenblatt war und nicht die Speisekarte der Kantine. Ausschließen konnte ich es aber nicht. „Sie war unter dem Einfluss eines wirklich starken Halluzinogens.“ Er las kurz in den Unterlagen und hob die Brauen, als würde er sich zum ersten Mal mit meinem Fall befassen. „Eine riskante Mischung.“ Kopfschüttelnd sah er Moore wieder an. „Sie wird sich nicht daran erinnern, was passiert ist, als sie unter dem Einfluss der Droge stand – und auch partieller Gedächtnisverlust ist nicht auszuschließen. Allerdings dürfen wir auf Besserung hoffen.“ Dabei drehte er sich mit einem glatten Lächeln zu mir.
„Dürfen wir das?“ Das wollte ich auch hoffen.
„Auf alle Fälle. Sobald Sie in Ihre gewohnte Umgebung zurückkehren, werden sich die Erinnerungslücken schließen.“
Gewohnte Umgebung. Blieb nur die Frage, wo genau das sein sollte. „Hatte ich etwas bei mir?“
Moore starrte mich misstrauisch an, schüttelte den Kopf und ging dann zu einer Tüte, die auf einem Tischchen lag. Er holte Kleidung heraus und warf sie mir hin. Ein Hemd, Jeans, Unterwäsche. Überall waren Blutflecken. Das Hemd war voll davon und ganz steif.
„Wir wissen, dass das nicht Ihr Blut ist. Also, von wem könnte es wohl sein?“ Moore war um Geduld bemüht.
„Sie haben es doch bestimmt schon durch die Datenbank laufen lassen.“ Er sah mich nur an. Das genügte mir. „Ihr Schweigen verrät mir, dass sie keinen Treffer hatten.“
Wer immer da sein Blut verloren hatte, hatte gefährlich viel davon verloren. Dass es offensichtlich auf meinen Sachen klebte, machte mir Angst. War ich Opfer oder Täter? War der andere tot?
Ich hielt Moores Blicken überraschend ruhig stand. „Sie haben gar nichts. Sie haben eine Verrückte, die mit einem Schuss hierherkam, der sie fast umgebracht hätte.“ Ich lächelte bitter. „Sie haben Blut von einem Opfer, das nirgends zu finden ist. Und ...“, ich musterte ihn rasch, „keine Tatwaffe, schätze ich. Vielleicht nicht mal einen Tatort?“ Ein kurzes Zucken seiner Wangenmuskeln verriet mir, dass ich richtiglag. „Wenn das alles ist, dann würde ich jetzt gern gehen.“
Er kochte, hatte sich aber gut im Griff. Nur an diesem Muskelreflex seines Kiefers sollte er arbeiten.
„Sie kennen sich gut aus.“ Es war eine Feststellung.
Erst als er es aussprach, wurde mir bewusst, dass er recht hatte, und schwieg lieber.
„Tragen Sie eine Waffe?“
Eine halb automatische Glock Kaliber .40 Smith and Wesson, fünfzehn Kugeln im Magazin, dachte ich sofort.
Ich blickte Moore an und schüttelte bedauernd den Kopf. „Ich erinnere mich nicht – aber, nein, ich denke nicht.“
„Ich glaube Ihnen nicht.“ Er warf mir ein Portemonnaie zu, das ich geschickt auffing. Schwarzes Leder, schlicht und unscheinbar.
Ich öffnete es und fand einen Ausweis und Führerschein mit meinem Gesicht. Kein Geld, keine Karten. „Ich dachte, ich hatte nichts bei mir?“
„Hatten Sie auch nicht. Wir haben Ihren Wagen gefunden. Er stand nicht weit weg am Straßenrand. Erinnern Sie sich immer noch nicht?“
Als würde ich es mit Absicht tun!
Ärgerlich schüttelte ich den Kopf.
Mit verengten Augen fixierte er mich. „Ich werde rausfinden, was da passiert ist. Und im Moment sieht es echt beschissen für Sie aus!“
Dieser Mann regte mich auf. Seine Fragen, sein stechender Blick und dieser verfluchte zerknautschte Anzug! „Was wollen Sie eigentlich? Man hat mich unter Drogen gesetzt und fast getötet. Blut klebt an meinen Sachen – ich finde, ich sehe aus wie das Opfer, und Sie behandeln mich wie eine Schwerverbrecherin!“ Ich senkte drohend die Stimme. „Sie sollten Ihre Taktik überdenken.“
Ein berechnendes Lächeln hob seine Mundwinkel, und ich wich innerlich zurück. Meine Reaktion hatte ihm gezeigt, dass ich keinesfalls ein scheues Rehlein war. Ich hatte ihm irgendetwas bestätigt, denn er sah sehr zufrieden aus.
Gerade öffnete er den Mund, um etwas zu sagen, als die Tür aufflog und eine Frau hereingestürmt kam. Japanerin, glaube ich, sehr schlank und zierlich, gekleidet in ein elegantes Kostüm, das lange schwarze Haar hochgesteckt. Ohne Umwege kam sie zu mir ans Bett, und ehe ich auch nur Luft holen konnte, küsste sie mich ausgiebig. Sie roch nach Erdbeeren, und ihr Mund war genau so süß wie Erdbeeren. Sommererdbeeren. Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre ich viel zu überrascht gewesen, um mich zu wehren.
Tatsächlich wollte ich aber gar nicht. Was bedeutete das nun wieder?
Sie gab mich frei und lächelte mich an. Sie hatte Mandelaugen in einem tiefen warmen Braun. „Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist, Sasha.“
Verblüfft starrte ich sie an. Davon ließ sie sich jedoch nicht irritieren und wandte sich an die Polizisten. Moore schaute reichlich verdattert aus seinem zerknautschten Anzug. Ich konnte es ihm nicht verdenken.
„Ich bin hier, um Sasha abzuholen. Die Papiere habe ich schon unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass Sie keine Einwände haben?“
Moore räusperte sich. „Ähm ... und Sie sind?“
„Mein Name ist Charlee Wang. Man rief mich an.“
Ratlos schwieg Moore, und sein bisher so wortkarger Kollege erklärte zögernd: „Man fand bei Frau Barnett eine Visitenkarte mit einer Nummer. Jemand vom Krankenhaus hat dort angerufen. Das gehört wohl zum üblichen Vorgehen.“
„Ach ja ...“ Moore nickte bedächtig. „Es stand nur die Nummer auf der Karte.“
Charlee lächelte freundlich. „Wir legen größten Wert auf Diskretion. Die Nummer ist von unserer Detektei. Hank Ruben. Sasha ist unsere Mitarbeiterin. Wenn sonst erst einmal nichts weiter ist, dann würden wir jetzt gerne gehen.“
„Geben Sie meinem Mitarbeiter noch die Adresse – bitte.“ Moore rang sich ein Lächeln ab. Dann blickte er mich an, und das Lächeln gefror. „Halten Sie sich für Nachfragen bereit, und verlassen Sie nicht die Stadt.“
Ich nickte nur. Er konnte ohnehin nichts tun, wenn ich dem nicht Folge leistete.
„Wo finden wir Sie?“
„Rufen Sie einfach in der Detektei an“, sagte Charlee bestimmt.
Es gefiel ihm nicht, derartig abserviert zu werden und mich gehen lassen zu müssen, aber es blieb ihm nichts anderes übrig. Für den Moment war ich Moore los.
Nachdem Charlee ihnen noch die Anschrift der Detektei gegeben hatte, blieb ich mit der Frau allein zurück.
Ehe ich auch nur über eine Frage nachdenken konnte, schüttelte sie den Kopf und legte sich den Finger über die Lippen. „Später“, war alles, was sie sagte, und reichte mir saubere Kleidung: Jeans, T-Shirt, Unterwäsche.
Ich wollte nicht wissen, ob das meine Sachen waren oder wem sie gehörten, solange ich nur das blutige Zeug nicht anziehen oder – schlimmer noch – im Krankenhaushemdchen bleiben musste.
Charlee ging zum Fenster und sah hinaus, während ich mich schnell anzog. Alles passte wie angegossen.
Sie drehte sich um, als ich fertig war, und verließ vor mir das Zimmer. Ich fühlte mich ein wenig wacklig auf den Beinen, aber wenn ich hier nur rauskam, wollte ich mich nicht beschweren.
Draußen vor dem Krankenhaus stand ein schwarzer Wagen – im absoluten Halteverbot. Beulen zierten die Tür, der Lack hatte schon bessere Zeiten gesehen, und als ich einstieg, roch es, als wäre vor Wochen etwas auf der Rückbank verendet. Eilig kurbelte ich die Scheibe hinunter – mehr Automatik gab der Wagen nicht her. Ich befürchtete auch, dass dies die einzige Klimaanlage war, die es gab. Es herrschten bestimmt dreißig Grad. Besonders nach dem klimatisierten Krankenhaus traf mich die Hitze und zwang meinen Kreislauf in die Knie. Wie gern hätte ich einfach tief durchgeatmet, aber das wagte ich in diesem Auto nicht. Mir war ohnehin schon schlecht.
Charlee setzte sich hinters Lenkrad, legte den Gang ein, der ausgesprochen widerwillig knirschte, und gab Gas.
„Tut mir leid wegen des Wagens“, sagte sie, während sie sich waghalsig in den Verkehr einfädelte.
Ich verstand ihre Entschuldigung nicht. Hätte es eine bessere Auswahl gegeben?
Neugierig blickte ich mich um. Der Boden hinter den Sitzen war bedeckt mit leeren Fastfoodpackungen, fettigem Papier und klebrigen Cola-Bechern. Zumindest erklärte das den Geruch. Ich nahm nicht an, dass das ihr Wagen war. Er wollte nicht zu ihr passen. Tatsächlich schien sie mir auch ein wenig angeekelt zu sein.
„Ich bin froh, dass es dir gut geht“, wiederholte sie und schenkte mir ein rasches Lächeln.
„Wie lange ...?“
„Drei Tage. Wir hatten keine Idee, wo du abgeblieben bist. Bis der Anruf aus dem Krankenhaus kam. Ich bin sofort los. Sogar Hank hat sich Sorgen gemacht.“
So wie sie das sagte, war das wohl nicht selbstverständlich.
An einer roten Ampel musterte sie mich von der Seite. „Ist bei dir alles okay?“
„Ja, klar ...“ Ich nickte tapfer. „Darf ich dich was fragen?“
„Natürlich.“
„Wer bist du?“
KAPITEL 2
„Du erinnerst dich nicht?“
Sie wollte das jetzt zum vierten Mal wissen. Ich merkte durchaus, dass sie beleidigt war, aber ich ging nicht darauf ein. Wie auch? Was sollte ich erklären oder mich entschuldigen? Wofür?
„Nicht an alles“, wich ich aus.
Ich stieg neben Charlee ein Treppenhaus hinauf, das seine besten Tage schon hinter sich hatte. Der Teppich war durchgetreten und wurde nur noch von Dreck zusammengehalten. Die Wände waren wahrscheinlich mal weiß gewesen, hatten nun aber einen gelblichen Ton angenommen, der ganz wunderbar zu den dreckigen Fenstern passte. Es roch muffig. Der Altbau war ein Bürokomplex. Die Mieten mussten erschwinglich sein, denn weder die Gegend, in der das Haus lag, noch das Haus selbst zog Kunden magisch an – und die Kunden, die sich hierher verirren würden, denen wollte man vermutlich nicht begegnen.
Vor einer Tür aus Milchglas hielt Charlee an. Ich dachte, sie würde sie öffnen, aber stattdessen sah sie mich nur enttäuscht an. „Erinnerst du dich auch nicht an uns?“
Unbehaglich schüttelte ich den Kopf. „Nein – leider.“ Obwohl ich mich bestimmt gern erinnert hätte.
„Auch nicht an Hank?“
„Hatte ich mit dem auch was?“
Verdutzt zögerte Charlee und lachte. „Nein!“, und dann ernst: „Ich hoffe nicht!“ Sie schüttelte den Kopf, als wäre allein der Gedanke schon abwegig, und öffnete. So hässlich das Treppenhaus auch war, das Vorzimmer, in das wir eintraten, war eine positive Überraschung. Es war hell und freundlich. Die Schränke und der Schreibtisch waren nicht neu, aber sehr sauber und gepflegt. Es gab nichts, was einfach nur herumlag. Alles hatte seinen Platz. Sogar die Pflanzen trugen kein einziges trockenes Blatt.
Ein ganz schwacher Duft nach Erdbeeren lag in der Luft. Erstaunlich, dass ich den noch wahrnehmen konnte, nachdem mein Geruchssinn in diesem Auto derartig gequält worden war.
Hinter dem Schreibtisch mit dem Computer führte eine weitere Milchglastür in das nächste Büro. Da dort in goldenen Buchstaben Hank Ruben Privatdetektiv stand, nahm ich an, dass es wohl Hanks Büro sein würde.
Charlee legte ihre Handtasche auf den Schreibtisch und ging zu Hanks Tür. Sie klopfte kurz, wartete aber keine Antwort ab, als sie auch schon energisch die Tür aufstieß.
„Scheiße, Charlee, kannst du nicht klopfen!“, polterte eine verwaschene Männerstimme los.
„Habe ich“, gab sie schnippisch zurück. „Sasha ist wieder da.“
Ich trat in die Tür neben Charlee und hatte dann erst mal damit zu tun, mir meine Fassungslosigkeit nicht allzu deutlich anmerken zu lassen. Im Vergleich zu dem Vorzimmer war das Büro von Hank ein Albtraum. Alle Möbel waren dunkel – und sehr männlich. Die reinste Höhle. Den Boden bedeckte ein dunkler flauschiger Teppich, der geeignet schien, Sachen, die einmal hineinfielen, nie wieder zu finden. Eine Ledercouch mit Löwenfüßen stand rechts an der Wand, ein riesiger Schreibtisch aus Eiche mit Löwenköpfen als Verzierung an den Ecken prangte in der Mitte und brach fast unter der Last aus Papierbergen, alten Essenspackungen, diesmal von einem Chinahaus, und Getränkedosen zusammen. Außerdem lagen noch diverse Kleidungsstücke oben auf dem Berg des bunten Sammelsuriums. Es stank hier fast wie in dem Auto.
„Was zum Teufel ist passiert?“
In dem ganzen Durcheinander bemerkte ich jetzt erst, dass zwischen den zerwühlten Decken auf der Couch jemand saß. Ein kleiner dicker Mann, vielleicht um die fünfzig, mit beginnender Glatze. Sein Gesicht war unrasiert und verquollen, als wäre er eben aufgestanden. Er kämpfte seine Körperfülle von der Couch hoch. Ein verbeultes T-Shirt in verblichenem Rot mühte sich, seinen recht beeindruckenden Bauch zu bedecken. Es gelang dem Stoff nur gerade so, aber auch dafür war ich dankbar. Der Rest von ihm steckte in bunt gemusterten Boxershorts. Waren das Löwen?
Rasch blickte ich fort und studierte interessiert die Aktenberge auf dem Schreibtisch.
Hank angelte nach der Hose, die zwischen dem ganzen Zeug lag, und quälte sich schnaufend hinein. Erst als er einigermaßen angezogen war, sah ich ihn wieder an. Er zerrte sich die Hose bis über den Bauchnabel hoch, wo sie jedoch nicht blieb. Kaum ließ er los, rutschte sie ihm wieder unter das Bauchfett.
„Wo sind meine verdammten Hosenträger?“
War die Frage für mich? Irritiert suchte ich Hilfe bei Charlee, die finster die Stirn runzelte.
„Ich weiß es nicht, und es ist mir auch egal“, entgegnete sie gereizt. „Ich bin nicht dein Kindermädchen, sondern Sekretärin. Du solltest dir das mal merken!“
„Jaja ...“ Er hörte schon gar nicht mehr zu, sondern verschob behutsam die Stapel auf der Suche nach seinen Hosenträgern. Dabei stellte er sich so geschickt an, dass zwar einige der Berge bedenklich schwankten, aber keiner umfiel. Mit einem ungeduldigen Schnalzen brach er seine Suche ab und kam mit einem breiten Grinsen zu uns. Tatsächlich reichte er mir nur knapp bis unters Kinn. „Also, wo warst du?“
Der Geruch von schalem Alkohol und altem Zigarettenqualm schlug mir entgegen – und von Zigarillos. Vanille würde ich meinen.
Mir stockte der Atem. Er roch wirklich abschreckend, aber vor allem erinnerte mich dieser Geruch nach Vanille an etwas ...
Völlig unerwartet wurden Bilder und Erinnerungen in meinem Kopf hochgespült. Es war, als ob jemand ein Licht anknipste. Hank Ruben hatte mich bei sich eingestellt. Jemand hatte ihn mir empfohlen, damit ich ruhiger treten und mein altes Leben verlassen konnte.
Warum? Das blieb dunkel, und ich schob es beiseite. Ich sollte ein paar kleine Aufträge abarbeiten, damit mir zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fiel. Eine Ablenkung.
„... nicht mehr mit mir? Was hat sie?“, fragte Hank an Charlee gewandt, die mich besorgt musterte.
Sie hatte ein fein geschnittenes Gesicht und volle Lippen. Sehr anziehend. Vor allem ihr Mund ... „Erdbeerchen“, flüsterte ich und hatte keine Ahnung, wo das herkam. Aber da war noch mehr. Da war ihr Körper, nackt im Kerzenschein. Ihre Haut schimmerte wie Gold. Das Haar fiel ihr offen über die Schultern, und mit wiegenden Hüften ging sie auf ein Tischchen zu und holte eine Flasche Wein und zwei Gläser. Ich lag im Bett und betrachtete ihr hübsches Hinterteil. Ein Hotelzimmer? Als sie sich wieder zu mir umdrehte, lächelte sie. Ihre Wangen waren gerötet, und ihre Lippen schimmerten verheißungsvoll.
Es war ein wunderschöner Anblick, den ich definitiv genossen hatte – und alles andere sowieso. Charlee war eine leidenschaftliche Liebhaberin gewesen. Eine unvergessene Nacht – nun ja, fast unvergessen. Immerhin war es mir wieder eingefallen. Alles fügte sich ganz logisch zusammen. Auch, dass ich Frauen bevorzugte, worüber ich bis eben gar nicht nachgedacht hatte. Aber Hanks repräsentative Erscheinung genügte eigentlich, um darüber nicht weiter nachzugrübeln.
Charlee schmunzelte verhalten. „Du erinnerst dich also?“
Allerdings. Aber mir wurde auch bewusst, dass Charlee und ich eher zufällig im Bett gelandet waren. Es hatte sich so ergeben, als wir einen untreuen Ehemann beschattet hatten und ihm bis in ein Hotel außerhalb der Stadt folgen mussten. Für den Rückweg war es schon zu spät gewesen, und so hatten wir dort ebenfalls eingecheckt. Die Frage war, ob es für Charlee mehr als ein Abenteuer gewesen war. Für mich definitiv nicht. Ich ließ mich auf keine Beziehungen ein. Bis auf ein Mal ...
Ein ungutes Gefühl stieg in mir hoch, und ich brach den Gedanken rasch ab. Das hatte Zeit.
„Erinnert sich woran?“, erkundigte sich Hank neugierig, und seine kleinen Augen huschten flink zwischen uns hin und her.
Charlee riss sich von mir los und sagte zu ihm: „Gedächtnisverlust. Sasha hat man böse mitgespielt. Die Polizei hat sie vernommen. Aber sie erinnert sich nicht mehr an alles.“
„Echt?“ Hank sah mich staunend an. „Woran denn nicht?“
Wollte er mich hochnehmen? „An alles andere“, antwortete ich auf seine schlaue Frage.
Hank war nicht der beste Privatdetektiv. Diese Erkenntnis war ebenfalls plötzlich da. Eigentlich war er eher einer der schlechtesten, und er hatte es Charlee zu verdanken, dass er überhaupt Kunden bekam und seine Miete zahlen konnte. Das Büro war für ihn gleichzeitig seine Wohnung. Übergangsweise natürlich nur, nachdem seine Freundin ihn rausgeworfen hatte. Dieser Übergang dauerte jetzt schon fast zwei Jahre.
Ein Name tauchte auf – Magnusson. Ein Kribbeln breitete sich unerwartet in meinem Magen aus. War das Angst? Wovor?
Charlee berührte meinen Arm und riss mich aus meinen Gedanken. „Sasha?“
Ich zwang mich zu einem Lächeln. „Ja, alles klar.“
„Setz dich mal, Mädchen!“, befahl Hank fürsorglich und räumte einen Ledersessel frei, indem er alles einfach auf den Boden warf. Er selbst pflanzte sich auf die einzige freie Ecke seines Schreibtisches.
„Hank!“, sagte Charlee mit einem drohenden Unterton.
Der Mann rollte mit den Augen und schupste achtlos einen Stapel Papier vom Tisch, der in einem wilden Durcheinander im Teppich versank, sodass Charlee sich ebenfalls auf eine Ecke setzen konnte.
Charlee sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren, und blieb stehen.
Er brummte nur und wandte sich dann an mich. „Hast du eine Ahnung was geschehen ist?“, wollte er wissen. „Egal was?“
„Nein, keinen Schimmer.“ Ich berichtete kurz von Moore und dem, was er mir gesagt hatte.
„Das ist nicht viel“, stimmte Hank zu und kratzte sich am stoppligen Kinn, was ein Geräusch verursachte wie ein Reibeisen. „Was für eine Droge war das?“
Ich schüttelte nur den Kopf.
„Da kann ich helfen“, meldete sich Charlee und holte ihre Handtasche von nebenan.
„Sie ist ein Goldstück“, flüsterte Hank mir schnell zu, und sein Atem trieb mir fast die Tränen in die Augen, „aber ihr Ordnungsfimmel geht mir so auf die Nerven ...“ Er richtete sich ruckartig auf, als Charlee wieder hereinkam und grinste so unschuldig, dass sie sofort misstrauisch wurde, aber sie fragte nicht, sondern reichte mir einen Zettel.
Ich faltete ihn auseinander und brauchte eine Sekunde, um zu erfassen, was das war. „Mein Krankenblatt!“
„Gute Arbeit“, rief Hank erfreut und riss mir den Zettel aus der Hand, um ihn zu studieren.
Charlee wirkte sehr zufrieden. „Eine Freundin arbeitet als Schwester im Krankenhaus. Als man mich angerufen hat, habe ich gleich bei ihr nachgefragt. Sie hat mir alles bestätigt und auf meine Bitte hin, das Blatt kopiert. Von ihr kam der Tipp mit den sauberen Sachen für dich. Woher hätte ich das sonst wissen sollen?“
„Keine übliche Droge. Irgendwas Synthetisches. Vielleicht eine neue Designerdroge. Noch nie gehört. Müsste man sich mal in der Branche umhören.“ Hank gab mir den Zettel zurück. „Das könnte uns helfen. Wenn es keine Allerweltsdroge ist, die sich jeder Junkie drückt, dann haben wir einen Hinweis.“
„Oder es hat mit den Fällen zu tun, die du bearbeitet hast“, schlug Charlee vor, und da sie mich fragend ansah, konnte ich nur ratlos mit den Schultern zucken.
„Wo war ich denn dran?“
Hank überlegte und begann dann die Stapel mit Akten zu durchsuchen.
Diese Lücken in meinem Kopf machten mich wahnsinnig, und ich hoffte wirklich, dass der Arzt recht hatte und alles wiederkam. Eine unbestimmte Angst lauerte in meinem Kopf, und immer, wenn ich nach Erinnerungen suchte und sie nicht fand, ließ die Leere diese Angst wachsen. Wer war ich?
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass mit den Erinnerungen etwas auf mich einstürzen würde, dem ich vielleicht nicht gewachsen war. War es besser sich nicht zu erinnern? Nie wieder?
Aber eine solche Wahl hatte ich nicht, das war mir klar.
Hank fand drei wirklich sehr dünne Akten, die kaum mehr als vier Blätter enthielten, und reichte sie mir. Ich schlug sie nacheinander auf. Zwei Mal die Verdächtigung von Ehebruch. Die eine Akte war über den Mann, dem Charlee und ich gefolgt waren. Mein erster Fall, und Charlee hatte mich bei den Recherchen, ähm ... unterstützt. Im anderen Fall wurde die Ehefrau verdächtigt, aber ich fand meinen Bericht am Ende und erinnerte mich wieder, dass sie nur heimlich zur Therapie ging und ihr Mann davon nichts erfahren sollte. In der dritten Akte waren Nachforschungen erforderlich, über die mutmaßliche Größe eines vererbten Vermögens. Die Erben hegten die Annahme, dass es Unterschlagungen im Nachlass gab. Ich hatte bisher kaum mehr getan, als Kontakt mit dem Auftraggeber aufzunehmen und ein paar Namen erfragt. Nichts, wofür Blut fließen musste. Auch bei den beiden Ehebruchsachen erschien mir die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie die Ursache für eine solche Gewalttat sein sollten.
Ich suchte auf dem Schreibtisch einen Platz für die Akten, und als ich keinen fand, warf ich sie einfach auf den Tisch. Sie landeten in einem überquellenden Aschenbecher. Ich tat so, als hätte ich es nicht bemerkt. „Nein, da ist nichts.“
Schweigend saßen wir da. Hank und Charlee gaben sich wirklich Mühe, aber im Augenblick würden wir kaum etwas rausfinden.
„Ich denke, wir reden morgen weiter“, schlug ich vor. „Ich bin noch ein wenig angeschlagen.“
„Natürlich. Nimm dir frei, solange du magst. Ist ja nicht so, dass du hier die großen Aufträge verpasst“, sagte Hank säuerlich.
„Ich bringe dich nach Hause“, erbot sich Charlee, wofür ich ihr dankbar war. Ich hatte nämlich keinen blassen Schimmer, wo mein Zuhause war.
***
Charlee hielt vor einem schicken Altbau, der offenbar erst saniert und umgebaut worden war. Ich war erleichtert, dass ich in einer schönen Wohnung lebte und nicht in irgendeiner Absteige. Das Haus selbst sagte mir allerdings wenig.
Unschlüssig sah ich hinaus. Die Sonne schien durch das Laub der Straßenbäume, und die Hitze flimmerte über dem Gehwegpflaster, obwohl die unerträglichen Mittagsstunden schon lange vorbei waren.
„Was ist?“
Ich blickte Charlee an. „Ich erinnere mich nicht an dieses Haus. Es ist ...“ Ich schluckte und starrte wieder hinaus. Meine Augen brannten plötzlich. „Es nervt. Das ist alles.“
„Hier“, sagte sie und legte mir etwas in die Hand. Es war ein Schlüssel. Sie lächelte. „Dein Notfallschlüssel. Du hast ihn mir gegeben, und da deiner weg ist ...“
Die Frau dachte wirklich an alles. Ich beugte mich zu ihr hinüber. Erst wollte ich sie auf die Wange küssen, überlegte es mir aber und hauchte den Kuss auf ihre Lippen. „Danke.“
Ehe mich die Dankbarkeit, Rührseligkeit oder Verzweiflung übermannten, stieg ich aus und ging ohne weiteres Zögern auf den Hauseingang zu, schloss auf und betrat das kühle Treppenhaus. Ich hörte noch, wie Charlee den Gang des Autos reindrosch und dann mit heulendem Motor davonbrauste, bevor die Tür zufiel.
Auf meinem Weg hinauf las ich die Klingelschilder und fand meinen Namen im vierten Stock. Ich wollte aufschließen, als ich den schmalen Spalt entdeckte. Die Tür stand offen. Sofort beschleunigte sich mein Herzschlag. Mein Körper reagierte und zwar nicht ängstlich, sondern mit Alarmbereitschaft und angespannter Nervosität. Behutsam schob ich die Wohnungstür auf. Ein Raum kam zum Vorschein, und je breiter der Spalt wurde, desto mehr offenbarte sich das Zimmer dahinter. Ein weitläufiges Wohnzimmer. Kartons stapelten sich, Bilder lehnten an der Wand. War ich erst eingezogen?
Eine große Couch stand im Raum. Der Fernseher kauerte verloren in einer Ecke auf dem Boden. Ich stieß die Tür ganz auf. Weitere Kartons befanden sich überall, aber die meisten waren umgefallen und ausgekippt, der Inhalt durchwühlt. Gegenüber waren bodentiefe Fenster und eine Balkontür. Die Nachmittagssonne blendete mich.
Ich schob mich seitlich in die Wohnung und ging lautlos durch das Wohnzimmer. Ein Durchgang führte in das Schlafzimmer nebenan. Filigrane Vorhänge hingen dort vor den Fenstern, bei denen ich an meinem Geschmack zweifeln musste. Es gab ein Bett, das zwischen weiteren ausgeleerten Kisten und Kartons stand.
Mehr Möbel hatte ich offenbar noch nicht. Alles versank in einem unüberschaubaren Durcheinander. Wer immer hier etwas gesucht hatte, hatte sich alle Mühe gegeben, es gründlich zu tun.
Ich ging zurück. Ein kurzer Flur im hinteren Teil des Wohnzimmers führte ins Bad. Ich versuchte, lautlos durch den verstreuten Inhalt meines Lebens zu gehen – zumindest nahm ich an, dass das ganze Zeug von mir war – und blickte durch die Tür in das Badezimmer. Wanne, Dusche, Tageslicht. Was wollte man mehr?
Auf einmal hörte ich ein kaum wahrnehmbares Geräusch, ein leiser Schritt auf Holzdielen. Es war eigentlich nur ein ungutes Gefühl, das mich dazu brachte, mich umzusehen.
Etwas Dunkles schoss auf mich zu. Ich wollte ausweichen, da traf es mich wuchtig an der Schläfe. Der Schmerz war eine grelle Explosion. Ich stolperte zur Seite, und der Fliesenboden sprang mir entgegen. Ehe ich mit dem Gesicht aufschlagen konnte, fing ich mich ab. Alles verschwamm vor meinen Augen, dennoch erkannte ich eine Gestalt über mir, dunkel, in Leder gekleidet. Der Kopf war unförmig und riesig im Vergleich zum Körper, und mit einiger Verzögerung wurde mir klar, dass der Angreifer einen Motorradhelm trug.
Er stand einfach nur da. Das Visier war verdunkelt und verbarg das Gesicht.
Was würde er tun?
Hatte er eine Waffe?
Das wäre denkbar schlecht für mich.
Plötzlich drehte er sich um und verschwand.
So schnell ich konnte, kämpfte ich mich auf die Beine, aber der Boden schwankte unter mir, und ich musste mich am Waschbecken festhalten, um nicht umzufallen. Mein Kopf zersprang fast.
Rasch sah ich mich um und ließ mich neben der Badewanne auf die Knie fallen. Dort fand ich eine geflieste Verblendung, hinter der sich die Wasseranschlüsse der Wanne verbargen. Mit zittrigen Fingern nahm ich sie ab. Ich überlegte nicht, ich tat es einfach – und erst als ich in die dunkle Öffnung dahinter griff, wusste ich, was ich finden würde. Meine Hand schloss sich um ein Stoffbündel. Es war schwer. Ich nahm es heraus und wickelte eine kleinkalibrige Pistole aus. Ich selbst hatte sie dort versteckt – vor einigen Tagen erst.
Möglichst leise lud ich die Waffe durch und stand auf. Die Welt brauchte einen kurzen Moment, bis sie aufhörte, sich um mich zu drehen, und erst dann ging ich zurück ins Wohnzimmer. Der Angreifer würde nicht mehr hier sein. Er wäre dumm, wenn er dieses Risiko einginge – oder skrupellos. Beide Alternativen waren wenig wünschenswert.
Aber ich musste nachsehen. Ich musste einfach! Immerhin konnte ich mich nicht im Bad verkriechen, und schon gar nicht konnte ich die Polizei anrufen. Das würde nur Moores wilde Verdächtigungen anheizen – zu Recht.
Ich lauschte, aber alles blieb ruhig. Vorsichtig bewegte ich mich zwischen den Kartons hindurch, stieg über Bücher und machte einen großen Bogen um eine zerschlagene Vase. Küche und Wohnzimmer waren ein einziger Raum. Die Eingangstür stand noch immer weit offen.
Ein Rascheln erklang, und mein Herz machte einen erschrockenen Satz. Es kam aus der Küche, irgendwo hinter der Kochinsel.
Er war noch da!
Mit der Pistole im Anschlag trat ich langsam näher. Es wäre Notwehr. Selbst Moore könnte nicht anderer Meinung sein.
Behutsam ging ich an der Kochinsel vorbei und rechnete jede Sekunde damit, dass der Fremde aufsprang und mich angreifen würde. Ich war bereit, auf alles zu schießen, was aus der Deckung käme.
Mit einem schnellen Schritt trat ich um die Kochinsel herum und zielte, knapp davor, den Abzug durchzuziehen.
Etwas Rotes hockte zwischen dem Inhalt meines Kühlschranks und blinzelte mich gelassen an.
Erschrocken nahm ich den Finger vom Abzug. Kurz durchdrangen mich unergründliche Katzenaugen, ehe sich die dazugehörige Katze wieder den Käsescheiben widmete, die überall lagen. Der Kühlschrank war zwar zu, aber selbst vor seinem Inhalt hatten die Einbrecher nicht haltgemacht.
Was zum Teufel hatten sie gesucht?
Ganz langsam atmete ich aus und senkte die Pistole.
„Luigi! Was machst du denn da?“
Ich wirbelte herum und verbarg die Waffe hinter dem Rücken. „Alma!“, entfuhr es mir atemlos.
Die kleine alte Frau, die vor mir stand, lächelte, und ihr ganzes Gesicht wurde zu einer unübersichtlichen Landkarte aus Fältchen. „Habe ich dich erschreckt, Kindchen?“
„Allerdings“, gab ich zu, schob die Waffe unauffällig in meinen Hosenbund am Rücken und zog das Shirt darüber.
Alma, meine Nachbarin.
Ich hatte keine Ahnung, wie alt sie war, aber sicher über achtzig. Sie war sehr rüstig und lebte mit ihrer Katze gegenüber. Kaum war ich eingezogen – das war vor wenigen Wochen gewesen –, hatte sie schon mit einem Kuchen in der Tür gestanden. Alma war eine der ersten Mieterinnen – wegen des Aufzuges, der direkt auf der Etage hielt, für den Fall, dass sie irgendwann mal nicht mehr so gut zu Fuß sein würde. Luigi war ihr dicker Kater, der sich gerade in meiner Küche durch die Kühlschrankreste fraß, benannt nach ihrem verstorbenen Mann – aus dritter Ehe, wenn ich mich nicht täuschte.
„Du bist verletzt?“, fragte Alma, aber als ich nur abwinkte, schaute sie sich eifrig in meiner Wohnung um. „Was ist passiert?“
„Scheint, als wenn hier jemand eingebrochen wäre“, erklärte ich das Offensichtliche.
Sie nickte in Anbetracht des Durcheinanders. „Wo warst du? Seit drei Tagen nehme ich deine Post raus, weil der Kasten unten überquillt. Das ist gefährlich. Jeder weiß dann, dass du nicht da bist.“
Nun, wie es aussah, hatten sie es auch so gewusst. „Das ist lieb von dir. Ich war – verreist. Dienstlich.“
„Ich werde die Polizei rufen“, bestimmte sie resolut und tippelte Richtung Ausgang.
„Nein!“ Verwundert blickte sie zu mir zurück, und ich lächelte beruhigend. „Das ist nicht nötig. Es ist ja nichts gestohlen worden.“
„Wie kannst du das wissen? Deine Sachen sind alle kaputt. Die Versicherung wird nicht zahlen, wenn du es nicht meldest. Mein verstorbener Mann war Versicherungsvertreter, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe immer die Büroarbeit für ihn erledigt. Versicherungen sind da sehr eigen. Das war vor dreißig Jahren so, und das hat sich bis heute nicht geändert. Hör auf eine alte Frau!“
Ich winkte ab. „Ja, ich glaube dir das doch. Aber dieser Aufwand ... Dann rennen hier die Polizisten durch und stellen Fragen und schmieren alles mit ihrem Pulver voll wegen der Fingerabdrücke. Und wofür? Sie fassen die Täter doch ohnehin nicht.“
Im schlechtesten Fall sperrte Moore mich gleich weg.
„Hm ...“ Sie überlegte. „Da hast du recht. Im Fernsehen reden sie ja dauernd davon, dass die Aufklärungsrate so niedrig ist.“ Sie nickte. „Schlimm, was die Gangster sich alles so trauen.“
„Ja. Früher war das sicher alles besser“, versuchte ich es mit der Floskel, die alte Leutchen immer so gerne verwendeten.
Alma lachte nur. Es klang wie eine rostige Türangel. „Wo hast du denn diesen Blödsinn her? Es war anders, aber besser auch nicht. Ich sag dir was: Ich koche uns nachher was Schönes, und du kommst zu mir und dann trinken wir ein Gläschen Wein – oder einen Sherry. Wie wäre das?“ Sie schmunzelte, und ihre kleinen wachen Augen verschwanden fast in ihren ganzen Runzeln.
Ich lächelte. „Sehr gern. Ich nehme aber lieber den Wein.“
Sie nickte fröhlich. „Was immer du willst.“ Damit ging sie zu ihrem Kater und hob das riesige Tier hoch. Er mauzte protestierend, aber gegen ihren beherzten Griff, mit dem sie ihn sich unter den Arm klemmte, hatte er keine Wahl.
Ich brachte die beiden zur Tür und sah ihnen nach, bis Alma und Luigi ihre Eingangstür geschlossen hatten. Ich wollte meine ebenfalls schließen, als ich zufällig auf das Schloss achtete. Keine Einbruchspuren, kein Kratzer – gar nichts. Ein Profi. Oder jemand mit einem Schlüssel?
Ich angelte den Ersatzschlüssel aus der Hosentasche und drehte ihn nachdenklich.
Jeder hatte ja seinen Hausschlüssel dabei. Normalerweise.
Meiner war jedoch nicht bei den Sachen gewesen, die man bei mir gefunden hatte. Es wäre interessant zu wissen, wer meinen Schlüssel an sich genommen hatte.
KAPITEL 3
Ich war vor einigen Wochen in diese Wohnung gezogen – und ich hatte noch so gut wie gar nichts ausgepackt. Nun hatten das andere übernommen, und ich war gezwungen, zumindest alles wieder in die Kartons zu sortieren. Eine Weile wanderte ich einfach nur durch das Chaos und drückte mir die obligatorische Tüte Tiefkühlerbsen gegen die Schläfe, damit sie nicht anschwoll. Mein Schädel brummte, und ich hegte die Hoffnung, hier irgendwo Schmerztabletten zu finden. Wer eine Waffe unter seiner Badewanne versteckt, der hat auch Schmerztabletten im Haus. Hoffentlich ...
Alles plätscherte durch meinen malträtierten Schädel, und während ich anfing, meine Sachen aufzuräumen und wieder in die Kisten zu packen, kehrte ein Großteil meiner Erinnerung zurück. Es war ganz einfach, ein bisschen so, als würde ich ein Bild betrachten, und je näher ich herantrat, je mehr ich von den Gegenständen in die Hand nahm, um sie wieder wegzuräumen, desto mehr Details konnte ich erkennen.
Ich war zweiunddreißig – seit drei Monaten. Statt etwas Anständiges zu lernen, wie meine Eltern es gerne gehabt hätten, ließ ich mich zur Security und Personenschützerin ausbilden. Eine ganze Weile arbeitete ich in einer Sicherheitsfirma, sammelte Erfahrungen in allen nur denkbaren Bereichen, von Alarmanlagen bis zum Kaufhausdetektiv, und machte mich schließlich selbstständig. Es lief – nicht gut, aber es lief.
Der erste Impuls von Kunden war nämlich der Wunsch nach einem männlichen Schutz – das Klischee eines muskelbepackten Hünen mit großkalibriger Waffe, dunklem Anzug und Sonnenbrille. Aber es sprach sich schnell herum, dass eine Frau sehr viel unauffälliger und weniger bedrohlich für das Umfeld war, was durchaus von Vorteil sein konnte. Und wie viel Kraft war nötig, um den Abzug einer Waffe durchzuziehen?
Ich verschaffte mir einen Ruf und bekam meine Aufträge. Es waren einträgliche Jobs für gutes Geld. Ich war ausgebildet im Nahkampf, konnte mit diversen Schusswaffen umgehen und fuhr jedes Fahrzeug, das man mir hinstellte.
Ich fand einen Karton mit der Aufschrift Büro und öffnete ihn. Es waren Ordner darin, aber keine sensiblen Kundendaten. Die hatte ich vor Wochen in ein Schließfach gegeben, bis ich mich entschieden hätte, wie es weitergehen würde. Das hier war nur allgemeiner Kram.
Ich nahm mir einen Ordner heraus, der nicht beschriftet war. Es war der einzige, der ein Geheimnis um seinen Inhalt machte.
Eine Weile stand ich da und hielt ihn unschlüssig in der Hand. Konnte ich mir das ansehen? Es würden nur Zeitungsartikel darin sein, aber ein ängstliches Kribbeln in meinem Magen warnte mich. Ich zögerte und packte den Ordner letztendlich wieder zurück in den Karton. Dann warf ich die Tüte mit den inzwischen matschigen Erbsen in den Müll und ging ins Bad. Die Pistole legte ich in Reichweite auf das Waschbecken, suchte ein Handtuch und zog mich aus, um zu duschen. Ein Pflaster klebte noch in meiner Armbeuge. Ich riss es ab und warf es weg – vermutlich von der Infusion. Die Stelle war ein wenig blutunterlaufen. Gedankenverloren rieb ich darüber, und plötzlich erinnerte ich mich an andere Einstiche, mehr als nur einen. Unwillig schüttelte ich die Erinnerung ab.
Das heiße Wasser war angenehm, und ich blieb ewig so stehen und schloss die Augen. Es war ein wenig unheimlich, dass mir binnen Sekunden fast mein komplettes Leben wieder eingefallen war, genau so, wie es der Arzt gesagt hatte. Natürlich war ich froh darüber, dass er recht behalten hatte, dennoch war es eine Erfahrung, die ich nicht noch einmal haben musste.
Mir fehlten außerdem immer noch einige Bausteine. Alles, was in den Tagen unmittelbar vor meinem ... Unfall lag. Also, die eigentliche Frage, wer mir das angetan hatte, war noch nicht beantwortet – und die nach dem Warum ...
Ich stellte das Wasser ab und verließ die Dusche. Abwesend stand ich auf den Fliesen und sah zu, wie das Wasser über meine Haut lief und sich zu einer Pfütze um meine Füße sammelte. Es tropfte aus meinen kurzen Haaren, und ich genoss den Moment der Kühle auf der Haut. Bedächtig trat ich zu dem großen Badezimmerspiegel, in dem ich mich fast komplett sehen konnte. Ich musterte das Spiegelbild. Die Frau, die da stand, war groß, schlank und gut trainiert. Ein ernstes, fast schon verschlossenes Gesicht blickte mir entgegen. Sie war nicht unattraktiv, wenn sie nicht gerade von durch Drogen ausgelösten Angstzuständen terrorisiert wurde.
Sie trug Narben, die sich hell abhoben und von allem Möglichen stammten. Eine Messerwunde am Arm, Risswunden am Oberschenkel aufgrund eines Autounfalls und an der Schulter in Höhe des Schlüsselbeins Narbengewebe durch eine Schusswunde.
Ich hob die Hand und tastete mit den Fingerspitzen darüber. Sie war noch nicht alt und stammte von meinem letzten Auftrag bei der Familie Magnusson. Eine Mutter und ihre Tochter. Personenschutz. Ein normaler Auftrag, wie alle anderen auch. Die Mutter, Vera Magnusson war wohlhabend und leitete einen großen Konzern, den sie von ihrem Vater geerbt hatte. Aber um den Konzern zu erhalten, mussten sie sich verkleinern, und es standen Entlassungen an. Es hatte Drohbriefe gegeben, die sich nicht nur gegen sie und den Vorstand richteten, sondern auch gegen die Familien und somit gegen ihre Tochter Sara – ein kleines Mädchen, im Alter von sieben Jahren.
Vera Magnusson engagierte eine große Sicherheitsfirma. Diese sollte die Alarmanlage sowie das Überwachungssystem ihres nicht unbescheidenen Anwesens perfektionieren und die Vorstandsmitglieder schützen, wenn diese davon Gebrauch machen wollten. Für ihren persönlichen Schutz jedoch beauftragte sie mich. Sie wollte keine Männer in ihrem näheren Umfeld, und erst recht nicht in der Nähe ihrer Tochter. So gab es ein kleines Kompetenzgerangel zwischen der Sicherheitsfirma und mir, aber am Ende akzeptierten sie, dass ich da war. Die Kundin hatte das Sagen und das letzte Wort. Klar wäre es einfacher für einen Rundumschutz gewesen, wenn Vera Magnusson die große Firma genommen hätte. Bei so vielen Mitarbeitern konnten sie die Schichten wechseln, was bei mir nicht möglich war. Also zog ich in Vera Magnussons Haus – einen anderen Weg gab es nicht –, bis die brisante Phase in der Firmenpolitik vorbei war.
Aber der ganze Auftrag lief von Anfang an schlecht. Die Drohungen waren massiv, und nach Wochen passierte das, was niemals hätte geschehen dürfen. An das Anwesen kam niemand heran, aber Vera Magnusson ging zur Arbeit, sie hatte Vorstandssitzungen. Ebenso musste ihre Tochter zur Schule. Sie hatten schließlich ein Leben, das sie weiterleben mussten – trotz allem oder genau deswegen. Vera war da ein wenig eigen. Sie wollte sich nicht unterkriegen lassen. Sie war eine sehr stolze und eigensinnige Frau und weigerte sich, sich von solchen Drohungen beeindrucken zu lassen. Es ging ihr um ihre Tochter, alles andere war unwichtig.
Der Schuss aus der Menge galt auch gar nicht Sara. Davon war ich immer noch überzeugt. Es war ein verrückter, verwirrter und frustrierter Mitarbeiter, der einfach aufs Geratewohl versuchte, mit Gewalt etwas durchzusetzen. Es war schlichtweg Pech, dass Vera ihre Tochter an diesem Tag dabeihatte, als sich der Vorstand in der Firma treffen wollte. Sara hatte eine Erkältung, konnte am Schulausflug nicht teilnehmen, und so traf Vera die wahrscheinlich schlechteste Entscheidung und nahm sie mit zu sich in die Firma, wie sie es schon oft getan hatte. Früher.
Ich wollte es ihr ausreden, denn die Situation war eine andere als vor Monaten, aber sie wollte nicht hören. Ich wäre doch da und zwei oder drei Leute der anderen Sicherheitsfirma, war ihre Erklärung. Es war auch alles friedlich, bis wir am Nachmittag das Gebäude wieder verließen.
Demonstranten standen vor dem Eingang, Mitarbeiter der Firma, die verzweifelt versuchten, ihre Existenz zu retten.
Verzweiflung war immer gefährlich, denn die Menschen glaubten ab einem gewissen Punkt, dass sie nichts mehr zu verlieren hatten. Wie falsch dieser Gedanke war, erkannten sie meistens erst, wenn alles zu spät war.
Auch Reporter waren anwesend, und jemand hatte die Polizei geholt. Wut schwappte uns entgegen, gebrüllte Parolen, die ich kaum verstand, und dann warfen sie die ersten Sachen. Die Polizei fischte einzelne Demonstranten aus der Menge. Ich wollte nur Sara aus dem Gebäude bekommen und zum Wagen auf dem Parkplatz schaffen. Innerlich verfluchte ich Vera für ihren Starrsinn. Sie blieb zurück, ein Journalist wollte einen Kommentar, und statt ihn stehen zu lassen, redete sie mit ihm. Ich passte nur eine Sekunde nicht auf – eine verfluchte Sekunde, weil ich überlegte, dass ich ohne Vera nicht zum Auto konnte, wenn sie zurückblieb. Und dann zerriss ein Schuss die Luft.
Die Leute schrien und duckten sich.
Ein Mann stand in der panischen Menge und zielte mit einer Pistole auf Vera. Er war übergewichtig und ungepflegt, kein Attentäter, wie man ihn sich vorstellt, sondern ein Mann, der seine plötzliche Freizeit zu Hause auf dem Sofa verbringt, zu viel Bier trinkt und mit seinem Schicksal hadert, weil er nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll und folglich eine fatale Idee entwickelt.
Sara stand ihm einfach nur im Schussfeld. Wie in Zeitlupe stolperte die Kleine, und eine rote Blume aus Blut breitete sich auf ihrem weißen Shirt aus.
Fassungslos sah ich zu dem Mann. Er hatte einen so irren Ausdruck, dass ich nicht glaubte, dass er irgendetwas von dem mitbekam, was er anrichtete. Er zielte ein weiteres Mal, legte den Finger um den Abzug und schoss. Ich stieß das Mädchen ganz zu Boden und drehte mich dabei genau in die Schussbahn ...
Ein Klingeln riss mich aus den Gedanken. Erschrocken zuckte ich zusammen und ergriff die Waffe. Es klingelte erneut und noch einmal, dann sprang die mechanische Stimme des Anrufbeantworters an.
Nackt tappte ich aus dem Bad und folgte der Stimme, bis ich im Wohnzimmer beim Fernseher das Telefon fand. Nach dem Ton erklang eine Frauenstimme. „Hallo, hier ist Dr. Lawson vom staatlichen Museum. Ich hinterlasse Ihnen meine Nummer und würde mich freuen, wenn Sie zurückrufen. Ich würde gern etwas mit Ihnen besprechen. Persönlich. Vielen Dank.“ Es folgte eine Festnetznummer, die sie herunterrasselte.
Ich überlegte, aber der Name erschien mir fremd. Vielleicht falsch verbunden?
Der AB zeigte mir noch weitere Anrufe, und ich drückte die Abspieltaste. Fünf Nachrichten. Vier davon waren nur langes Rauschen und das Klicken, als jemand wieder auflegte. Die letzte war von dieser Dr. Lawson. Die vier Anrufe, bei denen niemand etwas gesagt hatte, zeigten eine Telefonnummer an. Sollte es also ein Perverser gewesen sein, dann kein sehr schlauer, wenn er seine Rufnummer nicht unterdrückte.
Ich wollte wieder ins Bad und mir etwas zum Anziehen suchen, als es erneut klingelte. Es war die Nummer des perversen Lauschers. Entschlossen nahm ich ab. „Ja!“
„Sasha Barnett?“ Eine Männerstimme. Er konnte also auch reden.
„Bin dran.“
„Haben Sie über den Auftrag nachgedacht?“
Ich überlegte schnell. Wir kannten uns demnach, aber ich konnte mit der Stimme nichts anfangen. Er sprach sehr akzentuiert, kein Dialekt – es war keiner von Hanks Aufträgen, das war mir sofort klar.
„Ja, habe ich“, versuchte ich es einfach mal aufs Geratewohl.
„Sie machen den Job?“
Verdammt, entweder suchte ich jetzt eine entlaufene Katze, oder ich stimmte zu, für den größten Drogendealer der Stadt zu arbeiten. Aber mein Instinkt sagte mir, dass das hier wichtig war – er brüllte es mir quasi ins Hirn.
„Ja.“ Meine Stimme hörte sich etwas belegt an, und ich schluckte.
„Sehr schön. Dann wären nur noch die Details zu besprechen.“
„Unbedingt“, stimmte ich zu. „Wann sollen wir uns treffen?“
„Heute Abend. Ich will das so schnell wie möglich erledigt wissen.“
„Sicher.“
„Ist alles in Ordnung?“
Leider nein. Ich wälzte den Klang seiner Worte in meinem Kopf hin und her, aber ich hatte nicht den Funken einer Idee. Aber sollte ich ihm das sagen? Ach, Entschuldigung, ich hatte einen kleinen Unfall und mir ist gerade nicht gegenwärtig, wer Sie eigentlich sind? Eher nicht.
„Es geht um meine Bezahlung“, versuchte ich es vage, denn am Ende ging es doch immer ums Geld.
Schweigen.
Ich kaute auf meiner Unterlippe herum. War das ein Fehler gewesen? Vielleicht hatten wir schon alles vereinbart?
Aber ich hatte diesen ominösen Auftrag ja noch nicht angenommen, daher konnte nichts abgesprochen sein.
„Ich bin bereit das Doppelte zu zahlen“, erklang es an meinem Ohr. „Im Voraus.“
Das Doppelte wovon?
Ich schwieg, und er setzte hinzu: „Geld spielt keine Rolle, das sagte ich schon. Wenn Sie erfolgreich sind und das Stück wiederbeschaffen, reden wir über einen sechsstelligen Betrag für Sie.“
Sechsstellig!
Ich schloss den Mund. Ich hätte die Nullen gern auf einen Zettel gemalt, um sicher zu sein, aber im Augenblick umgaben mich nur Kartons mit DVDs, einer Heimkinoanlage und einer riesigen CD-Sammlung. Hörte ich mir die auch an? Kaum vorstellbar. So viel Zeit hatte ja niemand.
„Okay“, war alles, was mir dazu einfiel.
„Ich werde wieder einen Wagen schicken, der Sie abholt. Gegen zehn. Dann bekommen Sie alle Informationen.“
„Ja, ist gut.“
„Ach, und Frau Barnett?“
„Ja?“
„Ich hoffe, es geht Ihnen wieder besser?“
Angespannt umklammerte ich das Telefon und meinte so ruhig ich konnte: „Es geht, ja.“
„Ich versichere Ihnen, dass es nicht in unserem Interesse liegt, Ihnen zu schaden.“ Damit legte er auf.
KAPITEL 4
„D