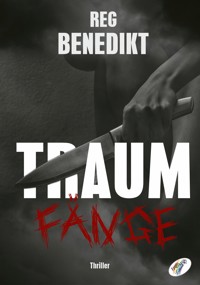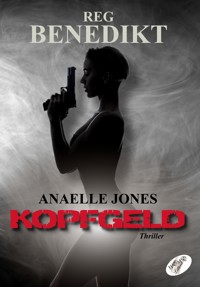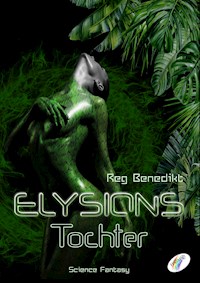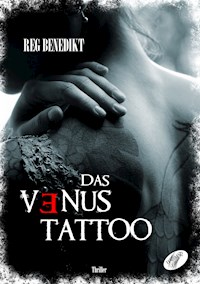
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am Ende der Unsterblichkeit … wartet der Tod! Sashas Job als Detektivin scheint nur noch aus dem Beschatten untreuer Ehepartner zu bestehen – und dabei hat sie mit Beziehungsdramen selbst genug um die Ohren, denn Jo hat sich völlig unerwartet von ihr getrennt. Da kommt ihr der Auftrag, den Tod einer jungen Tätowiererin aufzuklären, gerade recht. Während die Polizei von Selbstmord ausgeht, ist Ella, die Freundin der Verstorbenen, von einem Gewaltverbrechen überzeugt. Ein von der Toten hinterlassener Brief ist der Anfang einer Reihe rätselhafter Hinweise zu einem dunklen Geheimnis – und jemand scheint bereit zu sein, seine Opfer dafür qualvoll sterben zu lassen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BENEDIKT
Inhaltsverzeichnis
Das Venus-Tattoo
Das Venus-Tattoo
Impressum
Widmung
Über die Autorin
Das Venus-Tattoo
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Programm
Die Träne der Aphrodite
Jägerin der Schatten
Herbstsplitter
Lesbe auf Butterfahrt
Enge Bande
Das Leuchten des Almfeuers
Reg Benedikt
Thriller
© Reg Benedikt, Das Venus-Tattoo
© HOMO Littera Romy Leyendecker e. U.,
Am Rinnergrund 14, 8101 Gratkorn,
www.HOMOLittera.com
E-Mail: [email protected]
Grafik und Gestaltung: Rofl Schek
Cover: © caracterdesign, istock by GettyImages
Das Model auf dem Coverfoto steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des E-Books. Der Inhalt des E-Books sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Models aus.
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Handlung, Charaktere und Orte sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Die geschilderten Handlungen dieses E-Books sind fiktiv! Im realen Leben gilt verantwortungsbewusster Umgang miteinander und Safer Sex!
ISBN Print: 978-3-903238-70-1
ISBN PDF: 978-3-903238-71-8
ISBN EPUB: 978-3-903238-72-5
ISBN PRC: 978-3-903238-73-2
Und noch ein Buch ohne Monster ...
Für meine Frau, die Trolle nicht mag und Sasha liebt – und weil du immer und überall Kerzen anzündest und so nicht nur meine Welt besser machst.
Über die Autorin
Reg Benedikt, geboren 1973, ist eine deutsche Schriftstellerin, die mit ihrer Frau in der Nähe von Berlin lebt. Das Schreiben begleitet sie seit Jahren und ist ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens.
Neben spannenden Abenteuern verbirgt sich in ihren Büchern auch jedes Mal eine Liebesgeschichte, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt, denn sie ist sorgfältig in düsteren Intrigen und mystischen Geheimnissen verpackt – und es gibt immer ein bisschen Drama. Mit Humor und Leidenschaft lässt sie ihre Protagonistinnen am Ende siegen – vermutlich ...
Veröffentlichungen bei HOMO Littera:
Jägerin der Schatten, Die Magische Grenze (2019)
Die Träne der Aphrodite (2020)
1. Kapitel
Amanda war keine gute Ehefrau.
Das zumindest behauptete ihr Ehemann. Sie wäre in letzter Zeit unaufmerksam, hatte er gesagt – was vermutlich bedeutete, dass er sich vernachlässigt fühlte. Ob es nur um das Abendessen ging, das sie ihm nicht mehr kochte, oder die – hm ... ehelichen Pflichten, die nicht zu seiner Zufriedenheit erfüllt wurden, blieb offen. Ich hatte nicht gefragt. Bratkartoffeln oder Beischlaf waren die Hauptgründe, die den Ehepartner misstrauisch machten, sobald eines davon nicht mehr ausreichend zur Verfügung stand. Die Bratkartoffeln nur im übertragenen Sinn, denn wer wollte schon jeden Abend Bratkartoffeln? Beim Sex sah das vermutlich anders aus. Aber das war nur eine Theorie und kam sicher auch auf die Dauer der Beziehung an.
In Amandas Ehe fehlte eine der beiden Komponenten. Darum saß ich im Auftrag ihres Ehemannes in meinem schwarzen Mittelklassewagen, den ich unauffällig in einer Seitenstraße geparkt hatte, und von wo es mir möglich war, zwar nicht die Eingangstür, aber durch eine praktische Lücke in der Hecke den großen Garten, das Wohnzimmer im Erdgeschoss und sogar das Schlafzimmer im ersten Stock zu sehen. Moderne Häuser konnten wunderbar sein. Viele Fenster, viel Glas – null Privatsphäre. Ein Traum für jeden Privatdetektiv und Voyeur – das kam in etwa aufs Gleiche raus. Nur Ersterer erhielt noch Geld für die Vorstellung, obwohl ich ehrlich gesagt auf die meisten Shows gut hätte verzichten können.
Und hier bahnte sich die nächste an, ob ich wollte oder nicht. Amanda hatte die dunkle Gestalt vor fünf Minuten ins Haus gelassen – und es war nicht ihr Ehemann, davon konnte ich ausgehen.
Ich gähnte herzhaft und fragte mich, warum ich mir das antat. Ich hockte vor Amandas Haus in einem lauschigen Vorort der Stadt und fror mir wortwörtlich den Arsch ab. Es war eine lausige Sommernacht, die ihren Namen nicht verdiente. Da tröstete mich auch der sternenklare Himmel nicht über die einstelligen Temperaturen hinweg. Den Motor konnte ich nicht laufen lassen, denn das war bei einer Observierung ziemlich weit oben auf der Liste von Dingen, die man nicht tat. Ich konnte nur unauffällig in meinem geparkten Auto sitzen und mit klammen Fingern klebrige Gummitiere in mich hineinstopfen. Mehr Abendbrot würde es in den nächsten Stunden nicht geben. Mein Kaffeebecher war so gut wie leer und der kümmerliche Rest zu bitterer Plörre erkaltet.
Ich war schlecht ausgerüstet, zumindest, was mein leibliches Wohl anging. Aber auf dem Beifahrersitz lag eine schicke Spiegelreflexkamera mit einem der teuersten Objektive, die ich jemals besessen hatte. Sie machte wirklich scharfe Aufnahmen, sehr deutlich und detailliert. Wenn ich damit Fotos von den zu beschattenden Ehepartnern schoss, blieb der Fantasie keinerlei Spielraum – der Hoffnung allerdings auch nicht. Die meisten zerknüllten die Fotos wütend – das waren die Ehemänner – oder tropften sie mit Tränen voll – das waren die Ehefrauen. Beide Geschlechter neigten auch zu einer Vorliebe von Konfetti, in die sie die schicken Hochglanzfotos verwandelten. Schade drum.
Gegen das Licht im Wohnzimmer waren Amanda und ihr Verführer gut zu sehen. Amanda redete mit der Gestalt, die mit dem Rücken zu mir vor den bodentiefen Fenstern stand. Sie nahm die Kapuze des Mantels vom Kopf und ließ sich von Amanda aus dem Kleidungsstück helfen.
Ich fand das ungewöhnlich, denn welcher Typ ließ sich schon aus der Jacke helfen? Aber als der Mantel fort war, kam darunter der wohlgeformte Körper einer Frau in einem hautengen schwarzen Kleid zum Vorschein, für das man nicht viel Stoff verschwendet hatte. Es war am Rücken hochgeschlossen, aber ohne Ärmel, wies jedoch einen Ausschnitt auf, der dafür gemacht war, nicht mehr auf die Augenfarbe zu achten, und reichte in der Länge nur bis zur Mitte ihrer Oberschenkel. Bei der Figur, die die Lady hatte, würde ich auf neunzig-sechzig-neunzig tippen, aber da das ein Klischee ist und ich im Schätzen von so etwas wahnsinnig schlecht bin, konnten es auch alle anderen Maße sein – alle Maße, die zu den Adjektiven sexy und atemberaubend passten. Sie war sehr groß, aber sie trug auch High Heels. Darauf hatte ich bis eben nicht geachtet, weil ich von dieser Entwicklung einigermaßen überrascht worden war.
Sollte ich noch überlegt haben, ob es sich hierbei um eine Vertreterin für Bibeln handeln könnte, zerstreute sich diese Vermutung, als Amanda der großen Frau vertraut über den Nacken strich, diese sich darauf zu ihr drehte und beide in einem langen Kuss versanken.
Weshalb Amanda in ihrer Ehe ein kleines bisschen unaufmerksam war, dürfte wohl keine Frage mehr sein.
Ohne mich von den beiden Protagonistinnen abzuwenden, tastete ich nach der Kamera, hob sie mir vors Gesicht und gönnte mir einen besseren Ausblick auf das Geschehen. Ich zoomte näher heran und schoss das eine oder andere Foto.
Amanda und ihre Besucherin hatten sich lange nicht gesehen – oder aber alles war noch sehr frisch. Die beiden Frauen verschlangen sich geradezu mit Küssen. Amanda wühlte ihre Hände in die Hochsteckfrisur der anderen, und wenig später floss eine Flut aus kastanienbraunem Haar über die Schultern der Fremden. Diese nahm das zum Anlass den Kuss zu unterbrechen – vermutlich benötigten beide ein wenig Sauerstoff – und zog dafür wenig feinfühlig Amandas Bluse aus dem Bund ihrer Jeans. Sie schob den Stoff hinauf und streifte ihn ihr über den Kopf. Der BH folgte, und zwar so schnell, dass ich nicht einmal mitbekam, wie sie den aufgefummelt hatte. Sehr geschickt, die Lady.
Sie widmete sich Amandas Brüsten überaus gefühlvoll mit Händen und Mund. Sie musste sich dafür vorbeugen, weil Amanda doch um einiges kleiner war als sie. Amanda nutzte die Gelegenheit die Frisur der anderen noch ein wenig mehr durcheinanderzubringen, als sie deren Kopf umfasste und sie fester an sich presste. Dank meines schicken Objektivs stand ich quasi neben den Frauen und konnte auch sehen, wie die Besucherin Amandas Brustwarze küsste und dann ihre Schneidezähne darum schloss. Ihre Hände glitten gleichzeitig auf Amandas Rücken, und als ihre Fingernägel sich in deren Haut krallten, biss sie zu. Amanda riss den Mund auf und schrie – vermutlich. Die Show war bedauerlicherweise ohne Ton.
„Autsch ...“, murmelte ich zerstreut, als sich solidarisch mit Amandas auch meine Brustwarzen versteiften. Das hätte ich ja nicht so gern, aber Amanda schien es zu gefallen, denn sie lachte atemlos.
Ich tastete blind nach der Gummitiertüte und angelte mir noch eines der klebrigen Viecher heraus. Während ich auf dem gelierten Zucker kaute, schob Amanda die Frau in Richtung Sofa. Diese gab nach und setzte sich, und Amanda war schneller über ihr, als ich mein Gummitier aufgegessen hatte. Aber sie küsste sie nicht. Ihre Hände fanden die Schenkel ihrer Geliebten und schoben den Stoff ihres wahnsinnig engen, aber sehr flexiblen Kleides hinauf. Dann kniete sie sich zwischen die Beine der Frau und ...
„Ich soll dir Tee bringen.“
Ich fuhr zusammen und herum, und mein Herz blieb beinahe stehen. „Scheiße, Georg! Bist du verrückt?“, fluchte ich und rang nach Luft. Adrenalin schwappte durch meinen Körper und prickelte unter meiner Kopfhaut. Mir war danach, den Mann zu schlagen, der sich mit der ihm eigenen Gelassenheit auf den Beifahrersitz gleiten ließ. Ich konnte gerade noch die Tüte mit den Gummitieren retten, ehe er sich daraufsetzte.
Er sah mich reglos an und hielt mir einen Thermobecher Tee unter die Nase. Es roch nach Pfefferminze.
Ich nahm ihm den Becher aus der Hand und knallte ihn lieblos auf das Armaturenbrett. „Was machst du hier, verdammt noch mal? Außer mich zu Tode zu erschrecken.“
Er schaute von mir zu dem Tee und wieder zu mir. Ja, schon klar.
„Charlee schickt dich mit Tee?“
„Natürlich. Du kennst sie. Ich hatte an die Scheibe geklopft.“ Er blickte über meine Schulter zum Haus. Da ich mich ihm zuwandte, wusste ich nicht, was die beiden Frauen in diesem Moment ... ähm, trieben. Aber da Georg sich zu der aussagekräftigen Reaktion einer gehobenen Augenbraue hinreißen ließ, nahm ich an, sie waren schon einen Schritt weiter als eben. „Aber du hast mich wohl nicht gehört“, bemerkte er, und ich hätte schwören können, dass da ein Hauch von Spott in seiner Stimme gelegen hatte.
Er trug einen Anzug, wie immer. Ich hatte ihn noch nie ohne erlebt. Er war auch immer glatt rasiert, mit einem leichten Aftershave, das einen nicht gleich ins Koma beförderte, und er hatte eine gepflegte Kurzhaarfrisur. Unauffällig und professionell. Ich kannte Georg nicht anders. Seit er für mich arbeitete, sah er so aus, wie er jetzt hier saß. Ich nahm an, in seinem Kleiderschrank waren ein Dutzend gleich aussehende dunkle Anzüge. Es musste so sein.
Er war bei mir nicht fest angestellt, aber wenn ich ihn brauchte, dann stand er zur Verfügung. Ein unauffälliger und sehr fähiger Mitarbeiter meiner Detektei. Geübt im Umgang mit allerhand Waffen und Nahkampftechniken, geduldig und wortkarg. Der perfekte Mann.
„Welche von denen ist die Ehefrau?“
Ich drehte mich nicht zum Haus um. Es war mir unangenehm, dass Georg mich erwischt hatte – obwohl ich ja nur meinen Job erledigte, erinnerte ich mich unwillig. Es war eigentlich egal, mit wem Amanda rumvögelte, so lange es nicht ihr Ehemann war – und das war er eindeutig nicht.
„Die kleine Dunkelhaarige.“
Ausdruckslos sah er dem Geschehen im Haus eine Weile zu.
„Danke für den Tee“, versuchte ich ihn unauffällig wieder loszuwerden.
„Bitte“, sagte er, starrte aber weiter zum Haus und das ohne jede Regung in seinem Gesicht. Genauso gut hätte er der Davidsfigur beim Einstauben im Museum zusehen können. Ein seltsamer Mann. Obwohl wir schon seit etwa einem Jahr zusammenarbeiteten, kannte ich ihn so gut wie nicht. Es hatte nie ein persönliches Gespräch gegeben. Ich wusste nicht, welche Hobbys er hatte oder ob er überhaupt welche hatte. Vielleicht sammelte er Briefmarken oder Schrumpfköpfe – beides wäre nicht ausgeschlossen. Er trank lieber Tee statt Kaffee. Das war alles, was ich von Georg wusste. Er war zuverlässig, und ich vertraute ihm und das, obwohl ich nichts von ihm wusste. Ich hinterfragte das nicht. Manche Dinge musste man einfach hinnehmen.
„Und ich soll dich an deinen Termin morgen erinnern.“ Sein Blick fand mich wieder.
Ah ja, der Termin.
Wie ich dieses Wort hasste. Einen Termin machte man mit Geschäftspartnern oder seinem Zahnarzt. Aber nicht mit der Frau, die man liebt. Leider ändern sich die Begrifflichkeiten, wenn sich die Beziehung darauf beschränkt, nur noch befreundet zu sein. Es war eine stillschweigende Übereinkunft. Natürlich wollte ich Jo als Freundin, denn sonst hätte ich gar keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt, und das hätte mir das Herz gebrochen. Also noch mehr. Es war schon zerfleddert, durchbohrt und lag am Boden. Aber wenn ich sie sehen konnte, dann schlug es wenigstens noch – ein bisschen.
Allerdings funktionierte das mit der Freundschaft nicht besonders gut, was daran liegen konnte, dass Jo von dieser stillschweigenden Übereinkunft, die ich mit mir getroffen hatte, nichts wusste.
Verdammt, ich versank schon wieder in einer zähen Suppe aus Selbstmitleid. Ich räusperte mich und quetschte hervor: „Ich werde es nicht vergessen.“
Georg musterte mich, und ich hätte schwören können, er war kurz davor zu fragen, wie es mir gehe oder ob alles in Ordnung sei. Er tat es nicht, und ich war froh. Vielleicht hatte ich mich auch getäuscht. Es war immerhin Georg. Gefühle gehörten nicht in sein Repertoire, und Empathie war auch so eine Schublade, die für ihn verschlossen blieb.
„Dann noch – viel Erfolg“, verabschiedete er sich, und ich war nicht sicher, ob ich mir das kurze Zögern eingebildet hatte. Er stieg aus dem Wagen und verschwand in der Dunkelheit. Wenig später hörte ich ihn wegfahren.
Ich griff nach dem Thermobehälter, drehte den Deckel ab und trank einen Schluck. Brühend heiß füllte die Flüssigkeit meinen Mund, und ich spuckte sie hastig zurück in den Becher. „Mist!“, lispelte ich wütend. Ich hasste den Tee, der mir die Zunge verbrannt hatte, ich hasste die Welt, die scheinbar nur existierte, um mir immer aufs Neue einen Fußtritt zu verpassen, und ich hasste Georg, der mich mit seiner dämlichen Erinnerung an morgen aus meiner Ruhe gerissen hatte.
Ich wandte mich wieder dem Haus zu und hob die Kamera vors Gesicht. Amanda und ihre Besucherin waren inzwischen im Schlafzimmer ein Stockwerk höher angekommen. Es war dunkel bis auf einige romantische Kerzen. Schlechte Lichtverhältnisse. Ich hasste Kerzen. Allerdings war ohnehin nicht mehr viel zu sehen, außer dem Bettlaken unter dem sie herumspielten. Ab und zu tauchte ein Bein auf oder ein Kopf, und es war jede Menge Bewegung unter dem dünnen Stoff.
Ich hatte meine Fotos. Eigentlich könnte ich den Abend beenden und nach Hause fahren, um die restliche Nacht noch ein wenig zu schlafen. Es wäre gut, wenn ich den morgigen Termin ausgeruht angehen würde. Dennoch blieb ich sitzen. Nachdenklich blätterte ich durch die Aufnahmen auf der Kamera, die ich eben geschossen hatte. Es waren gute Bilder, zerstörerische Bilder, die dieser Ehe ein Ende setzen würden. Vielleicht kam Amanda das entgegen – vielleicht auch nicht. Sich in ihrem Zuhause mit dieser Frau zu treffen, war riskant genug, sodass man annehmen konnte, ihr lag nicht mehr viel an einer Fortsetzung der Beziehung mit ihrem Mann.
Ich fuhr mit dem Daumen über die kleinen Tasten neben dem Display und drückte eine davon. Alle Bilder löschen, stand dort. Ich wählte Ja. Langsam legte ich die Kamera wieder beiseite, rutschte ein wenig tiefer im Sitz, verschränkte die Arme vor der Brust und machte es mir so gemütlich wie möglich.
Irgendwann schreckte ich aus einem leichten Dämmerschlaf auf. Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass zwei Stunden vergangen waren. Mit einem leisen Stöhnen kämpfte ich mich in eine aufrechte Position. Mein Rücken meldete sich protestierend, und meine Muskeln waren steif von der Kälte. Ich wurde zu alt für das alles hier – Leuten nachstellen, pikante Fotos schießen, um Leben zu vernichten. Daraus bestand das Geschäft zum größten Teil. Es war ziemlich unbefriedigend. Jedenfalls dann, wenn man am falschen Ende der Kamera war, dachte ich und grinste spöttisch.
Im Schlafzimmer von Amandas Haus waren die Kerzen aus. Es lag dunkel da. Aber ich sah durch das ebenfalls dunkle Wohnzimmer Licht aus dem Flur und die Schatten von zwei Personen. Ich öffnete das Fenster und lauschte mit angehaltenem Atem in die kalte Nacht hinaus. Eine Eingangstür ging auf und wieder zu, und wenig später hörte ich das leise Klacken von Pfennigabsätzen.
Ich stieg aus, sortierte meine Kleidung und streckte mich, um nicht wie eine steife Holzpuppe zu taumeln. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ausschaute. Vermutlich wie eine verfrorene Detektivin, die die halbe Nacht im Auto damit verbracht hatte, andere beim Vögeln zu beobachten. Besagte Detektivin fühlte sich müde und frustriert. Wenn ich also auch nur halbwegs so aussah, wie ich mich fühlte, dann würde Amanda mich schon aus Mitleid nicht abweisen.
Ich raffte mich auf und ging um das Grundstück herum zum Hauseingang. Es war knapp vor Mitternacht. Ich würde mich nicht reinlassen, wenn ich Amanda wäre. Ich klingelte trotzdem und hörte im Inneren einen dezenten Gong.
Nach einer Weile erklangen Schritte, und ohne sich auch nur durch den Spion abzusichern oder nach einem Passwort zu fragen, öffnete Amanda die Tür. Ihr breites Lächeln traf mich, erstarrte zur Grimasse und wich einem Ausdruck von misstrauischem Ärger gemischt mit Angst. Es war offensichtlich, dass sie jemand anderen erwartet hatte. Kurz zuckte ihr Blick an mir vorbei den Weg hinunter, ehe er wieder zu mir fand.
„Sie ist weg“, sagte ich, um ihr wenigstens diese Sorge zu nehmen.
„Wer sind Sie?“, fragte sie angespannt. Sie trug einen Morgenmantel, was nicht unüblich war, wenn man mitten in der Nacht rausgeklingelt wurde. Ihre Haare hatte sie gerichtet. Nichts deutete darauf hin, dass sie eine aufregende erste Nachthälfte erlebt hatte.
„Mein Name ist Sasha Barnett. Ich bin Privatdetektivin.“
„Und?“ Amanda war sichtlich irritiert. Ich schrieb ihre langsame Reaktion den Hormonen zu, die sicher noch ihren Verstand überschwemmten und verhinderten, dass sie logisch dachte.
„Ihr Mann hat mich engagiert.“
„Wofür? Ist das ein Scherz?“
Verdammt, musste der Sex gut gewesen sein!
„Nein“, erklärte ich geduldig und probierte mich an einem Lächeln. „Er macht sich Sorgen.“
„Weshalb?“
„Wegen Ihrer Ehe.“
Ihr Mund formte ein stummes Oh, und ihre Augen weiteten sich, als sie endlich begriff. Aber kurz darauf runzelte sie die Stirn. „Ist es üblich, dass Sie die, ähm ... andere Partei aufsuchen?“
Ah, jetzt begann sie mitzudenken. Sehr schön. „Nein, es gehört nicht zur normalen Vorgehensweise. In der Regel wird der andere mit den Tatsachen durch den Scheidungsanwalt konfrontiert.“
Ihre Augen verengten sich lauernd. „Und warum sind Sie dann hier?“
Auch eine gute Frage. Die hatte ich mir selbst bisher gar nicht gestellt. „Ich ...“ Ja, was?
Sie wartete, ob ich noch mehr schlaue Sachen sagen würde, aber als ich nur ratlos schwieg, straffte sie sich und öffnete die Tür ein Stück weiter. „Kommen Sie rein.“
Ich gehorchte und merkte, wie mir die Situation entglitt. Wenn ich doch bloß zuerst denken würde, ehe ich solche dummen Sachen tat wie das hier.
Amanda trat an mir vorbei ins Wohnzimmer und machte Licht. Sie bot mir allerdings keinen Platz an, aber das war okay. „Mein Mann hat Sie also beauftragt, rauszufinden, ob ich ihn betrüge?“
„Ja.“
„Mit einem anderen Mann?“
„Ich vermute, dass er davon ausgeht.“
„Sie wissen, dass es anders ist?“ Sie ließ mich nicht aus den Augen. Das war keine Ehefrau, die ich in flagranti ertappt hatte. Zumindest benahm sie sich nicht so, auch wenn es natürlich so war. Es war nicht der Hauch eines schlechten Gewissens zu entdecken, von Reue gab es keine Spur in weitem Umkreis. Ich hatte sie für eine gelangweilte Ehegattin gehalten, die sich die Zeit vertrieb, so lange, wie es gut ging. Stattdessen stand hier eine Frau, die ihre Ziele verfolgte. Interessant.
Ich nickte und unterdrückte ein vielsagendes Grinsen. Es wäre wohl nicht angebracht.
Amanda musterte mich, und in ihren Augen lag ein amüsiertes Funkeln. „Haben Sie Fotos gemacht?“
„So ist der Job“, rechtfertigte ich mich unwillig, „aber ich habe sie gelöscht.“
„Schade.“ Und jetzt lag das Lächeln auch um ihre Lippen. Es war selbstbewusst und unmissverständlich.
Ich glaube nicht, dass ich sie mit offenem Mund anstarrte, so viel Selbstbeherrschung hatte ich noch, aber mein Erstaunen war nicht zu übersehen.
„Also, Sasha. Warum sind Sie hier?“
„Sie sollten wissen, dass Ihr Mann Sie verdächtigt, ihn zu betrügen.“
„Wollen Sie mich erpressen?“, fragte sie aufmerksam.
Ich erschrak. Daran hatte ich nicht mal gedacht. „Nein!“
„Was dann?“
Es tat mir bereits leid, dass ich hier war. Ich hatte nicht überlegt und mich in eine sehr peinliche Situation gebracht. Aber ich konnte auch nicht einfach wieder gehen. Oder?
„Nichts.“ Ach verdammt! „Ich hatte einen beschissenen Tag. Eigentlich war es ein beschissenes Jahr“, redete ich drauflos. „Ich beschatte Menschen, die andere Menschen betrügen, und mache davon Bilder. Damit zahle ich meine Miete, aber eigentlich ist es ... traurig.“ Ich unterbrach mich und machte eine entschuldigende Handbewegung. „Sie haben mich überrascht. Das passiert nicht oft, und mein Gefühl hat mir geraten, ich sollte Sie warnen.“
„Ihr Gefühl. Soso ...“
„Ich dachte, Sie sollten das alles wissen und selbst entscheiden.“
„Was werden Sie meinem Mann erzählen?“
„Nichts. Dass ich in der Zeit, die er mich engagiert hat, nichts rausfinden konnte, um seinen Verdacht zu bestätigen.“ Ich hatte keine Vorstellung, was in Amanda vorging, ob sie mir glaubte oder mich für völlig durchgeknallt hielt.
Eine Autotür ging draußen, und aus Amandas nachdenklichem Blick wurde Schrecken – und noch ehe sie etwas sagen konnte, war mir klar, dass ich mich selbst in Schwierigkeiten gebracht hatte.
„Mein Mann!“
Genau. Perfekt! Ich wich vom Durchgang des Flurs in die Schatten des Wohnzimmers zurück. Ich wusste ja, wie wundervoll man dieses Haus einsehen konnte.
„Sie sollten gehen. Können Sie klettern?“
„Wie bitte?“
„Der Zaun. Sie werden darüber müssen. Oder wollen Sie, dass mein Mann Sie für diejenige welche hält? Ihr Ruf wäre ruiniert, selbst wenn dieser Gedanke noch so abwegig ist.“ Sie nahm mich am Arm und zog mich zur Terrassentür. „Eine Detektivin, die ihren Mandanten betrügt. Das können Sie nicht erklären.“
Nein, mir würde dazu nichts Plausibles einfallen. So oder so hätte ich meinen Mandanten hintergangen, ob ich nun die Fotos löschte und log oder er vermutete, ich hätte was mit seiner Frau.
Aber ich war sehr erstaunt, wie durchdacht Amanda war. Vermutlich hatte sie sich schon einige Male überlegt, wie es wohl wäre, wenn ihr Mann irgendwann überraschend nach Hause käme. Schön, dass ich jetzt Teil dieser Überlegungen sein durfte – und das nur, weil ich nie vorher nachdachte, sondern gefühlsbetont in solche Sachen hineinstolperte.
Amanda öffnete die große Glastür und fragte: „Sind Sie gut?“ Ich verstand nicht, was sie meinte, und auf mein irritiertes Stirnrunzeln ergänzte sie schnell: „In Ihrem Job. Sind Sie gut?“
Da ich im Begriff war, durch eine Terrassentür zu flüchten wie eine erwischte Liebhaberin, fehlten mir etwas die Argumente.
Amanda war mein Zögern Antwort genug. Sie lächelte verhalten. „Aber Sie sind ... unkonventionell.“
Das hatte sie nett gesagt.
Sie ließ mich an der offenen Tür stehen und eilte schnell zu einer Schublade im Wohnzimmerschrank. Dann kam sie zurück und drückte mir eine Visitenkarte in die Hand. „Das hier könnte ein Auftrag für Sie werden. Kein Ehebruch. Ich denke, Sie sind genau die Richtige für den Job. Gehen Sie da morgen Abend zu selben Zeit hin.“
„So spät?“, bemerkte ich verwundert. Es ging auf Mitternacht zu.
„Ja. Es wird sich lohnen. Sie täten mir einen persönlichen Gefallen, weil sie jemandem helfen, der mir viel bedeutet. Es wäre etwas anderes als nackten Hintern beim Sex zuzusehen.“
Bevor ich noch irgendetwas einwenden konnte, schob sie mich auf die Terrasse hinaus. „Jetzt gehen Sie schnell.“
Ihr Wunsch war mir Befehl. Ich trat in die Dunkelheit der kalten Nacht, als ich von der Eingangstür her den Schlüssel im Schloss hörte.
„Passen Sie auf die Sprenger auf“, flüsterte sie noch, und dann schloss sie die Tür.
Welche Sprenger? Ich schlich geduckt hinter die Sträucher, die um die Terrasse angeordnet waren, und sprintete über die weite Rasenfläche. Ein Zischen ließ mich erschrocken innehalten, zeitgleich traf mich ein eiskalter Wasserstrahl von der Seite. Mir blieb die Luft weg, und ich unterdrückte einen Aufschrei, als ich auch schon stolperte und der Länge nach über das Gras schlitterte.
Mit einem Fluch kam ich wieder auf die Füße und rannte weiter, wich einem anderen Wasserstrahl geschickt aus, um präzise in den nächsten hineinzurennen. Aber es war eigentlich schon egal, denn nasser konnte ich kaum noch werden. Scheiße, war das kalt!
Ich erreichte die Hecke, quetschte mich durch die Sträucher und hangelte mich den Zaun hoch. Oben angekommen, sprang ich hinunter, geriet aus dem Gleichgewicht, weil der Abstand höher war als gedacht, und wäre fast wieder hingeknallt. Zügig ging ich zu meinem Wagen, stieg ein und bezwang nur mit Mühe den Impuls, die Autotür zuzuknallen. Stattdessen biss ich die Zähne zusammen und schloss sie leise und behutsam.
Ganz langsam atmete ich ein und wieder aus. Wasser tropfte aus meinen Haaren, rann mir in den Nacken und den Rücken hinunter und sickerte unangenehm kalt durch den Stoff meiner Kleidung auf die Haut.
Ich öffnete meine Faust, die ich um die Visitenkarte gekrallt hatte. Das Papier war ziemlich dick, wirkte teuer und sollte offensichtlich Eindruck hinterlassen. Allerdings erfüllte es diesen Zweck nicht mehr, denn es war aufgeweicht, und ich hatte die edle Karte nachhaltig zerknautscht. In schwarzer Schrift stand eine Adresse darauf – und ein Name: Ella.
2. Kapitel
Wir starrten uns an. Er grinste eindeutig gehässig und machte sich lustig über mich, weil ich wie er an diesem Ort gefangen war. Ich wich ihm aus und überließ ihm den Sieg, als ich das kleine Schild an der Glasvitrine suchte: eine japanische Holzmaske aus dem 17. Jahrhundert.
„So viel besser bist du auch nicht dran“, murmelte ich ihm zu, aber es interessierte ihn nicht. Ich schlenderte weiter und warf einen flüchtigen Blick in einen der großen Spiegel, die in der Halle an den Wänden hingen und den riesigen Eingangsbereich des Museums optisch um einiges vergrößerten.
Eine vollschlanke Frau blickte mir in einem wirklich schlecht sitzenden Abendkleid entgegen, das leider ohne Ärmel war und daher ihre beeindruckenden Oberarme betonte, die sich weiß und fleischig von dem Schwarz des Kleides abhoben. Unmerklich verzog ich das Gesicht. Ich trat einen Schritt beiseite, bis ich mich an der raumgreifenden Dame vorbei im Spiegel sehen konnte, die wie ein Schlachtschiff weitersegelte und einem der Kellner ein Glas Sekt abnahm.
Ich fand, das war eine großartige Idee, und gönnte mir selbst auch ein Gläschen zur Beruhigung der Nerven, ehe ich mich wieder meinem Abbild zuwandte. Ich stand so weit weg, dass die große Frau mir gegenüber auch jemand anders hätte sein können. Okay, ich trug kein Abendkleid, ganz sicher nicht. Ich hatte mich zu elegantem Schwarz entschlossen, allerdings in Form einer eng anliegenden Jeans, eines schwarzen Hemdes und eines schicken Blazers. Den Ausschnitt hatte ich ein wenig großzügiger aufgeknöpft, zu mehr ließ ich mich nicht hinreißen. Wäre ich dichter an den Spiegel herangetreten, dann hätte man die Augenringe der Blondine mit den kurzen Haaren auch erkennen können. Da konnte ich mich noch so bemühen, mir meine Haarsträhnen über die Augen zu zupfen – der Anblick blieb eher bemitleidenswert.
Die Gäste waren alle sehr unterschiedlich gekleidet. Vermutlich hatte kaum jemand so richtig gewusst, was bei einer Museumseinweihung, also eigentlich der Neueröffnung einer Halle für das frühe Mittelalter, als angemessene Kleidung galt. Im Kettenhemd war zwar niemand hier, aber sonst war alles vertreten. Die Herren hatten es leicht mit ihren Anzügen. Lediglich die Krawattenfarbe ließ Urteile über Geschmack und Beziehungsstatus zu: farblich abgestimmt und elegant – verheiratet oder schwul. Ein Griff zur senfgelben Krawatte mit floralem Silberdruck – Single mit einem Hang zu Tapetenmuster, und niemand wies ihn darauf hin.
Die Damen wiederum zeigten viel oder wenig Haut an diversen Stellen, wo das bei Kleidern oder raffinierten Blusen möglich war, glänzten und glitzerten in allen Farben des Regenbogens und hatten derartig viel Schminke aufgelegt, dass man meinen mochte, das hier war ein Catwalk und keine Museumsausstellung.
Ich nahm einen großen Schluck von meinem Sekt, befürchtete aber schon jetzt, dass ich etwas Stärkeres bräuchte, um das hier zu überstehen, oder man mir die ganze Flasche reichen müsste. Aber das war wohl unüblich. Ich blickte mich noch ein wenig um und schlenderte wie alle anderen Gäste durch die Halle. Gediegene Musik plätscherte durch die Lautsprecheranlage. Es klang ein bisschen wie die Top Hits der Aufzugsmusik. Die Gespräche der vielen Menschen mischten sich damit und bildeten ein anstrengendes akustisches Chaos, obwohl niemand sich traute, laut zu reden.
Man hatte mit etlichen Scheinwerfern und bunten Lampen eine mystische Atmosphäre geschaffen, die die ohnehin schon imponierende Halle des alten Gebäudes noch ehrwürdiger erscheinen ließ. Einzelne Exponate in den Glasvitrinen wurden mit Spots gesondert hervorgehoben oder abwechselnd in Licht getaucht. Es ging wohl eher um Effekte als um die Ausstellungsstücke an sich.
Die Mittelalterhalle konnte man bereits einsehen, aber sie war noch durch ein unüberwindbares Absperrbändchen geschlossen, dessen ernste Aufgabe niemand infrage stellte. Die Ausstellungsräume dahinter schimmerten in bläulichem Licht, das auf den weißen Decken der liebevoll eingewickelten Stehtische fluoreszierte. Das lange Buffet lockte mit allerhand Speisen, und mir drängte sich der Verdacht auf, dass die meisten Anwesenden eher wegen der Häppchen hier waren als wegen der rostigen Schwerter und angeknacksten Tongefäße.
Eine Frau ging durch die noch abgesperrte Halle und kontrollierte vermutlich ein letztes Mal, ob alles seine Ordnung hatte.
Ja, das passte zu ihr. Sie trug ein einfaches, aber sehr hübsches schwarzes Cocktailkleid, das ihre Arme frei ließ und nur hier und da ein wenig Spitze aufwies. Es zeigte viel Haut und betonte ihre schlanke Figur ausnehmend vorteilhaft. In den hochhackigen Schuhen hatte sie ungeheuer lange Beine. Die dunklen Haare hatte sie in eine ordentliche Hochsteckfrisur genötigt, was ihr ein etwas strenges Aussehen verlieh. Ich mochte ihre Haare lieber offen, am besten über ihren nackten Rücken fließend, wenn ich es mir aussuchen dürfte – was nicht der Fall war.
Ich beobachtete sie und nippte an meinem Sekt.
Ich war hier, weil ich eine Einladung erhalten hatte. Als Jos Lebenspartnerin hatte das Museum mich, mit Büttenpapier und goldener Schrift, zu der Veranstaltung hinzugebeten. Allerdings schon vor über einem halben Jahr. Da waren wir noch ein Paar gewesen. Das stellte sich jetzt ein wenig anders dar. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre ich nicht hier, aber es entsprach Jos Wunsch. Es ging um ihr Prestige. Niemand wusste, dass wir getrennt waren. Vielleicht würde es ein schlechtes Bild auf Jo werfen. Eine Charakterschwäche, die sie sich nicht erlauben wollte oder die keiner wissen durfte. Ein Fleck auf ihrer weißen Weste. Die ordentliche stets durchgeplante Dr. Josephine Lawson hatte ein Problem, das sie nicht lösen konnte, und das war, wie es der Zufall wollte, ich. Mein Abstieg von der festen Beziehung zur unwürdigen Ex war rasant gewesen. So richtig begriff ich es immer noch nicht. Ich fand, zwischen uns war alles in Ordnung, bis Jo begann, zu überlegen, ob wir nicht zusammenziehen sollten. Eine gemeinsame Wohnung, kein Freiraum mehr, stattdessen ein geteiltes Leben. Irgendwie war ich wohl nicht enthusiastisch genug. Sie überrannte mich mit ihrer Idee, und als ich ihr nicht jubelnd um den Hals fiel, stellte sie plötzlich die gesamte Beziehung infrage. Ich fand mich in nächtlichen Diskussionen wieder, denen ich nichts hinzuzufügen hatte, außer einem Gefühl, das mir davon abriet, mein Leben komplett aufzugeben. Zumindest erschien mir der Gedanke an eine gemeinsame Wohnung mit gemeinsamem Geschirr und einem geteilten Kleiderschrank so. Ich liebte Jo, ich genoss ihre Gegenwart – jede Minute davon –, aber bis jetzt konnte ich jederzeit in mein Leben zurückgehen, wenn ich das wollte oder ich zu mir finden musste.
Wie soll man so was in Grundsatzdiskussionen einbringen? Ich liebe dich, aber ich liebe meine Freiheit mehr? Das kommt nicht besonders gut an – wie ich jetzt wusste. Hätte mir mal jemand eher sagen sollen, dass Ehrlichkeit an dieser Stelle unangebracht ist. Aber sollte ich lügen und mich verbiegen? Nein. Ich kam interessanterweise gar nicht auf die Idee.
Und darum hatte Jo sich von mir getrennt. Einfach so. Ich sah es kommen wie einen Zug, der in einem Tunnel auf einen zurast und man nicht wegkam. Sie war in all ihren Entscheidungen so resolut, ganz anders, als man das sonst von Frauen kennt, mich eingeschlossen. Entscheidungsfindung war nicht meine Stärke. Jo hingegen wusste, was sie wollte und vor allem, was sie nicht wollte, und das war ich, wenn ich nicht zu hundert Prozent zu ihr stand. Es ging auch gar nicht mehr um die Wohnung, sondern um die Frage, wie sehr ich sie liebte.
Wie sehr liebte man jemanden, wenn man nicht bereit war, sein Leben mit diesem Menschen zu teilen? Sie setzte mir die Pistole auf die Brust – im übertragenen Sinn, und ich folgte meinem Bauchgefühl mit allen Konsequenzen.
Dass ich jetzt hier mit meinem fast leeren Glas Sekt stand, wich etwas vom Weg ab, denn wir hatten kaum Kontakt, außer einem Telefonat, in dem sie mich gebeten hatte, heute hierherzukommen. Ansonsten hüllten wir uns in eisiges Schweigen, und keine war bereit, nachzugeben.
Warum sollte ich? Ich hatte nichts falsch gemacht.
Nur war es so, dass ich Jo über alle Wut, verletzte Eitelkeit und zähem Selbstmitleid, in dem ich mich wegen dieser Ungerechtigkeit gegen mich gerne suhlte, noch immer liebte. Vielleicht hatte ich die Hoffnung, dass wir reden könnten. Vielleicht würde Jo sich entschuldigen und ihren Fehler einsehen.
Ich lächelte bitter, denn eher fror wahrscheinlich die Hölle zu. Ich tauschte mein leeres Glas gegen ein volles und nahm noch einen großen Schluck. Da der Alkohol nur in Spurenelementen vorhanden war, half er mir nicht, meine Nervosität zu vertreiben.
Ein helles Klingen lenkte mich ab, und ich wandte mich wieder der Haupthalle zu, als ein schlanker Mann in den Sechzigern wiederholt mit einem Schlüssel gegen sein Sektglas schlug, bis auch der Letzte kapiert hatte, dass wir jetzt zum offiziellen Teil übergingen. Er stand seitlich zu dem Absperrband und wartete, bis ihm alle ihre Aufmerksamkeit schenkten.
„Meine werten Damen und Herren“, hob er mit kräftiger Stimme an und lächelte der Wand aus Zuhörern entgegen. „Ich freue mich außerordentlich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und uns auf eine Reise in die Vergangenheit begleiten. Aber keine Sorge – das Buffet ist frisch.“
Die Leute lachten höflich, und ich verzog pflichtbewusst die Lippen.
„Mein Name ist Professor Walter Haverkamp, und das hier“, er breitete die Arme aus und schaffte es dabei, den Sekt nicht zu verschütten, „sind meine überaus fähigen Kolleginnen Dr. Josephine Lawson und Dr. Davina Jensen.“
Es musste abgesprochen sein, dass die beiden Frauen aus dem Hintergrund nach vorne traten, als ihr Stichwort fiel.
Jo lächelte unverbindlich. Sie mochte solche Auftritte nicht. Sie liebte Kunst und Geschichte und all diese antiken Tonscherben und was die Leute vor fünfhundert Jahren noch so weggeworfen hatten. Stunden und Tage verbrachte sie im Keller des Museums und puzzelte an diesen Kleinigkeiten herum, bis jedes Teil sich fügte und ein Ganzes bildete. Dem gab sie sich mit einer Geduld hin, die einen Gletscher zur Verzweiflung trieb. Aber Auftritte vor geneigtem Publikum, dem sie ihre Arbeit präsentieren sollte, auch wenn sie dadurch die ihr zustehende Anerkennung bekam und das eine oder andere Spendengeld für das Museum sammeln konnte, verabscheute sie zutiefst. Sie war immer nervös bei diesen Ereignissen, auch wenn man ihr das nicht ansah. Ich wusste es, weil sie es mir mal erzählt hatte. Trotzdem begegnete sie diesem Teil ihres Berufs, ohne zu zaudern, stellte sich ihren Ängsten, wie sie es immer tat – aufrecht und mit einem Lächeln, hinter das niemand blicken konnte.
Die andere Frau, Dr. Jensen war vielleicht Ende dreißig. Sie war schlank, gekleidet in einen schwarzen, fließenden Jumpsuit mit tiefem V-Ausschnitt, der ihre Arme frei ließ. Die Hosenbeine waren weit geschnitten. Sie trug nur einen Armreif um das Handgelenk, ansonsten keinerlei Schmuck. Eine Gemeinsamkeit mit Jo. Ihre dunklen Haare waren halblang, und der Pony fiel ihr lässig über die Augen. Sie war ohne Frage eine Erscheinung. Da denkt man, im Museum verkriechen sich nur die Mauerblümchen, und dann rahmen diese zwei Frauen einen älteren Herrn ein. Ich würde mal sagen, der Professor hatte den Jackpot gezogen. Vermutlich war ihm das gar nicht bewusst.
„Diese beiden Damen sind nicht nur eine große Hilfe“, fuhr der Professor in seiner Rede fort, „denn ohne sie hätte das Museum diese Ausstellung niemals zusammenstellen können, sondern sehen auch noch ganz reizend aus und schmücken einen alten Mann wie mich.“
Wieder lachten alle, und ich korrigierte meine Meinung. Selbst ein ältlicher Professor erkannte Schönheit – auch wenn sie in Fleisch und Blut daherkam und nicht in Form einer verstaubten Antiquität. Was wohl seine Gattin für eine Einstellung dazu hatte?
Ich betrachtete seine Hände. Kein Ring, auch kein Abdruck. Also war er ein Mann, der vermutlich mit seiner Arbeit verheiratet war.
„Aber ich will Sie nicht unnötig lange auf die Folter spannen und eröffne hiermit die Ausstellung. Sprechen Sie mich ruhig an, wenn Sie Fragen zu einzelnen Exponaten haben.“ Er machte eine Handbewegung in Richtung Absperrung. Ein Wachmann des Museums entfernte das Bändchen, und die Leute tröpfelten gemächlich in die Halle dahinter, um sich unauffällig an das Buffet anzupirschen.
Ich atmete tief durch und folgte der Herde zum Trog. Ich tauschte allerdings nur mein leeres Glas gegen ein volles. An Essen konnte ich nicht mal denken, denn dann drehte sich mir der Magen um. Ich hatte seit Wochen nicht mit Jo geredet und fühlte mich wie vor einer Prüfung, bei der nicht weniger auf dem Spiel stand als mein Leben. Ich begab mich mit Freuden in handgreifliche Auseinandersetzungen mit unwilligen Kaufhausdieben oder nutzte die durchschlagenden Argumente meiner Glock, um Informationen von maulfaulen Informanten zu bekommen, aber hier und jetzt bekam ich weiche Knie, weil ich mit einer Frau reden sollte, mit der ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit das Bett geteilt hatte. Sie sollte mir vertraut sein. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, sie nicht mehr zu kennen. Es war verwirrend und beängstigend, und ich bekam Fluchttendenzen. Ich musste mir das hier nicht antun. Wirklich nicht.
„Es soll recht lecker sein.“
Mein Herz setzte kurz aus und raste dann weiter. Bemüht ruhig drehte ich mich um, und da stand sie. Jo lächelte nicht, sondern sah mich mit einem Blick an, der nicht dazu beitrug, meine Nervosität zu besänftigen. Kühl wäre eine Untertreibung gewesen. Aber wollte sie nicht, dass ich herkomme?
Ich war gegen all meine inneren Stimmen da, die mich für naiv hielten, dass ich ihrer Bitte Folge leistete. Die mich seit Stunden warnten, dass mir das hier wehtun könnte und mich weit zurückwerfen würde in meinem Versuch, die Trennung zu bewältigen.
Ach, eigentlich hatte ich damit noch gar nicht angefangen.
„Der Professor ist ein Glückspilz“, bemerkte ich und war froh, dass meine Stimme fest und sicher klang.
Fragend hob sie die Brauen. Es war klar, dass sie mich nicht verstand. Jo war eine schöne Frau, aber sie legte darauf keinen Wert und beachtete die Tatsache auch nicht. Meine Anspielung war für sie also aus einer völlig anderen Welt.
Ich tat das mit einem Schulterzucken ab und versuchte mich auf neutrales Gebiet zu begeben. „Die Ausstellung ist ... gut geworden.“
„Gut?“ Sofort stürzte sie sich auf mein Zögern.
Hätte ich mir mal vorher ein paar schlaue Worte zurechtgelegt. Ich konnte mit den Exponaten nichts anfangen – mit dem ganzen Museum nicht. Und gut war offenbar keine Umschreibung, die eine Kunsthistorikerin hören wollte, wenn man über eines ihrer größten Projekte sprach, das sie in den letzten Monaten auf die Beine gestellt hatte.
„Ja, ähm ... interessant“, rettete ich mich und ahnte, dass ich es nur schlimmer machte.
Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, und falls das möglich war, verschloss sie sich noch mehr vor mir. Das klappte alles wirklich fabelhaft.
Ihr Blick zuckte kurz zu meinem schon wieder fast leeren Sektglas. „Hast du dir schon etwas angesehen?“
Ja, also ... „Nein, wollte ich aber eben tun.“ Ich blieb freundlich und bemüht.
Bemüht – auch so ein Wort. Es passte in diesem Moment aber ganz wundervoll. Es war so mühsam. Jo kam mir kein Stück entgegen, und sie wollte auch nicht. Das hier war kein Versuch, sich anzunähern, das hier war nur eine Darstellung für andere.
„Ich habe gelesen, die Ausstellung rankt sich hauptsächlich um ein spezielles Exponat“, hangelte ich mich weiter. Das sollte doch reichen, mein Interesse zu beweisen. Ich hatte eine halbe Stunde, bevor ich hierhergefahren war, noch schnell im Internet recherchiert.
Jo stutzte überrascht, und ich hasste mich selbst. Aber sie nickte und ging mit mir zu einer Glasvitrine in der Mitte der Halle, die mit einem eigenen Spot schön ausgeleuchtet war. Wir gesellten uns zwischen die anderen Besucher, die die Vitrine umkreisten.
„Das hier sind Teile eines Manuskripts. Kennst du das Voynich-Manuskript?“
Ich unterdrückte ein Seufzen und schüttelte artig den Kopf. Natürlich nicht. Woher auch? Ich nahm nicht an, dass es dieses Manuskript auf die aktuellen Bestsellerlisten geschafft hatte.
„Ein sehr geheimnisvolles Manuskript, das etwa 500 Jahre alt ist. Das Besondere daran ist, dass es in einer Schrift geschrieben ist, deren Sprache niemand kennt und die bis heute nicht entschlüsselt worden ist.“ Jo trat näher an die Vitrine heran und betrachtete nachdenklich deren Inhalt.
Es war Papier im weitesten Sinne. Drei Pergamentseiten, die ihre besten Zeiten schon hinter sich hatten. Sie waren in einer kleinen schnörkligen Handschrift beschrieben. Ich erkannte nicht mal einzelne Buchstaben, geschweige denn Wörter oder den Inhalt des Textes.
„Wir stehen erst am Anfang unserer Forschung, aber es scheint so, als wenn dieser Text ähnlich aufgebaut ist.“
„Dann ist es ein Teil dieses, ähm ... anderen Manuskripts?“
„Voynich“, ergänzte sie meine Lücke.
Ja, genau.
„Nein. Bisher haben wir keinen Zusammenhang festgestellt. Die Handschrift ist auch eine andere.“
Also könnte das hier alles sein, von einem antiken Kochrezept bis hin zu einer Beschwörungsformel für Satan selbst.
„Wo findet man so was?“ Mehr wissbegierige Fragen fielen mir nicht ein.
„Manchmal muss man einfach Glück haben“, antwortete jemand an Jos Stelle, und als ich mich umsah, kam der Professor mit einem Lächeln zu uns. Ihm folgte Dr. Jensen.
„Sie sind Jos Lebensgefährtin?“, erkundigte er sich.
Mein Lächeln gefror ein wenig, aber außer Jo würde das wohl niemand merken. Ich nickte und hielt seiner kurzen Musterung stand. „Sasha Barnett“, stellte ich mich selbst vor.
„Also, Sasha. Ich darf Sie doch so nennen?“
„Sicher.“
Er strahlte. „Dieser Fund war reiner Zufall. Wir haben einen Hinweis bekommen, von einem Antiquariat. Eine Villa wurde aufgelöst, und zwischen all den Stücken fanden sich diese Seiten. Es war Glück, dass man uns informierte, weil der Antiquar so eine Ahnung hatte, dass das hier etwas für das Museum sein könnte. Gegen eine kleine Summe Finderlohn hat er uns das Exponat überstellt.“
„Haben Sie schon eine Idee, welchen Inhalt es hat?“, fragte ein Herr aus dem Besucherkreis. Der Professor zog die Leute an. Seine Gegenwart wirkte wie ein Magnet.
Mir war es recht, dann konnten andere die schlauen Fragen stellen, und ich war nicht mehr im Fokus.
„Eine gute Frage“, lobte der Professor. Aus der Nähe betrachtet war ich nicht mehr so sicher, ob er schon sechzig war. Seine Haut war noch überraschend glatt. Aber er kam bestimmt nicht viel an die Sonne. Möglich, dass er jünger war. Andererseits waren seine Hände älter, sein Haar ergraut, aber dicht. Und seine Augen ... Ich musterte ihn unauffällig. Seine Augen waren stechend. Ein eisiges Grau, das jetzt, als er von dem Ausstellungsstück erzählte, begeistert leuchtete.
„Sehen Sie die Zeichnung?“
Alle drängten sich um die Vitrine. Ich hatte bei meiner ersten Betrachtung bereits dieses seltsame Kunstwerk, hm ... bewundert und musste mich deshalb nicht durch die Besucher drängeln. Die besagte Zeichnung war recht grob und wirklich klein, und für mich war es, als hätte ein Dreijähriger versucht, einen Becher zu malen.
„Diese Zeichnung stellt eine Schale dar.“
Natürlich. Wenn man seine Fantasie anstrengte, vielleicht.
„Wir wissen auch, welche Schale dargestellt wird. Das Symbol eines Pentagramms, das aufgemalt wurde, lässt den eindeutigen Schluss zu, dass es sich hierbei um einen Gral handeln muss.“
Ein Raunen ging durch die Umstehenden. Ich war bestrebt, mir meine Ratlosigkeit nicht anmerken zu lassen, aber es beachtete mich ohnehin niemand. Selbst Jo hing an den Lippen des Professors. Alle lauschten dem Mann mit einer Faszination, als würde er den Sinn des Lebens verkünden. Himmel, es handelte sich um Fragmente eines wirklich sehr alten Manuskripts und eine Schale, die vermutlich längst zerstört war.
„Meinen Sie den Heiligen Gral, Professor?“, hauchte eine Frau fassungslos, und ich erkannte die dicke Dame von vorhin, die sich so unschön vor mich ins Spiegelbild gedrängelt hatte.
Der Professor lachte amüsiert. „Das wäre nichts weniger als ein Wunder, meine Liebe. Zumal es sich vermutlich nur um einen Mythos handelt.“ Er zwinkerte ihr zu, und die Frau lächelte entzückt.
Wie machte er das? War er der Superstar der Museumsliebhaber? Hoffentlich warf niemand seinen Schlüpfer nach ihm.
„Nein, nicht der Heilige Gral vom guten Artus“, sprach der Professor weiter. „So weit wollen wir doch nicht gehen. Dieser hier dürfte mit dem Blut Jesu nichts zu tun bekommen haben. Gral ist weitläufig auch die Bezeichnung für ein Gefäß. Der Einfachheit halber nennen wir ihn so. Und weil dieses hier derartige Symbole aufweist, eben wie das Pentagramm, wird es sich um ein Opfergefäß handeln.“
„Aber das Pentagramm ist ein Zeichen des Bösen“, wandte jemand von weiter hinten ein.
Ich entdeckte einen älteren Herrn mit Brille. Das Gestell war ihm auf die Nase gerutscht, und er blickte über die Gläser hinweg zu dem Professor. Seine ergrauten Haare waren ein wenig zerzaust, und sein Anzug entsprach der Mode von vor dreißig Jahren. An seinem Kragen hob sich ein kleines Kreuz ab. Eine Art Anstecknadel. Es sah irgendwie religiös aus, auch wenn ich mich damit nicht gut auskannte. So was gab es manchmal bei Sektenmitgliedern – oder Freaks. Aus dem Alter schien er mir allerdings raus zu sein. Wie ein Sympathisant irgendeiner Sekte wirkte er aber auch nicht.
„Denken Sie, es handelt sich um Satanismus?“, fügte der Herr hinzu, und damit verdammte er sich selbst in die Kategorie „wunderlicher Freak“.
„Das kann man schwer herleiten. Hierzu müssen wir noch weiter forschen und den Text entschlüsseln. Aber falls es so wäre, dann wäre dieser Gral das Gegenteil zu dem Heiligen Gral, von dem die Legenden berichten. Seine Existenz fiele in die Zeit der Inquisition. Eine ketzerische Sensation, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben.“
„Oder es ist einfach nur eine Obstschale“, murmelte ich undeutlich und ausschließlich für mich selbst.
„Es dürfte mehr als das sein“, sagte eine Frau neben mir.
Mir war nicht bewusst gewesen, dass jemand so nah bei mir stand, dass er meine abfällige Bemerkung hatte hören können. Als ich aufsah, entdeckte ich Dr. Jensen, die mich intensiv musterte. Es tat mir leid. Ich hatte ihre Arbeit mit meinen unüberlegten Worten beleidigt.
„Nur ein ... Scherz“, erklärte ich halbherzig und bemerkte, dass Jo sich uns zuwandte. Ein blöder Zeitpunkt.
„Ein nicht besonders gelungener“, entgegnete Dr. Jensen ernst.
Mann, die war ja unversöhnlich. Sofort fühlte ich mich angegriffen, beherrschte mich aber. Meine Worte waren dumm gewesen, sie hatte recht, und ich sollte einfach die Klappe halten, wenn ich nichts Intelligentes beizutragen hatte. Ich nickte und versuchte, alles mit einer entschuldigenden Handbewegung fortzuwischen.
„Sie beleidigen damit das, wofür wir wirklich lange gearbeitet haben“, setzte sie nach.
Lieber Himmel, was war denn mit der los?
„Nicht nur mich, auch Josephine.“
Ich hob die Brauen. Genug war genug. Ich hatte mich entschuldigt – mehr oder weniger. Das sollte doch reichen. Und wieso Josephine? Jo hasste es, wenn man sie so nannte.
„Um was geht es denn?“, erkundigte sich Jo.
Dr. Jensen deutete auf mich und sagte: „Ich denke, deine ... Freundin, hält das hier alles für einen Witz. Kann das sein?“ Das Zögern war kaum zu hören, aber da.
Irgendwie wurde ich in die Defensive gedrängt, und das gefiel mir nicht. Ich kannte die Frau gar nicht, und sie ging auf mich los, als würde sie darauf schon ewig warten.
Zumindest waren die anderen Besucher noch immer mit den Papierrückständen beschäftigt, und der Professor erging sich in Reden über die Forschungsarbeit und fesselte seine Fans mit aufregenden Details über Radiokarbondatierungen. Wir waren ins Abseits geraten, und mich überkam das ungute Gefühl, dass es keine Zeugen geben würde, wenn die unleidliche Dr. Jensen mir an die Kehle springen würde. Von Jo erhoffte ich mir keine Rettung, ehrlich gesagt.
„Ich habe nur einen Scherz gemacht“, rechtfertigte ich mich und war darüber selbst erstaunt. Hatte ich das nötig? Offensichtlich, denn ich ergänzte verdrossen: „Es war eigentlich auch nicht für fremde Ohren bestimmt.“
„Und doch spiegelt es Ihre Gedanken wider.“ Dr. Jensen fixierte mich wie eine Schlange das Kaninchen. „Wir erforschen die Geschichte der Menschheit. Wir finden raus, wer wir sind und woher wir kommen. Soweit ich weiß, schnüffeln Sie lediglich im Leben anderer Leute herum. Ich denke daher nicht, dass Sie in der Position sind, sich über unsere Arbeit lustig zu machen. Josephine ist eine wunderbare Frau, die auf ihrem Gebiet Großartiges geleistet hat. Das Team hat wertvolle Arbeit vollbracht.“ Dr. Jensen legte Jo die Hand auf die nackte Schulter und ließ sie dort. Nicht oberflächlich mit den Fingerspitzen, sondern mit der ganzen Handfläche, und ich konnte sehen, dass sie Jos Schulter drückte. Tröstend? Beipflichtend? Schwesterlich verbunden?
Vertraut, auf jeden Fall.
Mir wurde heiß, und etwas zerrte und wühlte in meinem Bauch. Selbst die Beleidigung dieser Frau ging darin unter. Die beiden hatten was miteinander!
Wie lange arbeiteten sie schon zusammen? Jo hatte das erste Mal vor knapp einem halben Jahr von dem Projekt berichtet – beim Abendessen, wenn ich mich richtig erinnerte. Sie erzählte von einem absolut einmaligen Fund und der Idee, diese Ausstellung aufzubauen. Irgendwann kurz danach brachte sie das Thema mit der gemeinsamen Wohnung auf, und noch einen verwirrenden Hauch später waren wir getrennt.
Alles fügte sich zusammen. Ich löste meinen Blick von der Hand der Frau, die Jos Schulter festhielt, und sah Jo in die Augen. Reglos hielt sie mir stand. Eine Sekunde. Zwei. Dann wandte sie sich ab.
So war das also ...
Mechanisch hob ich mein Glas und trank den letzten Schluck. Meine Gedanken waren erstarrt.
„Ich glaube, sie hat es nicht so gemeint“, sagte Jo ruhig.
Ihre nachsichtigen Worte in der dritten Person, obwohl ich vor ihr stand, rammten mir ein Messer ins Herz – es musste antik sein, denn es war rostig und schartig und riss alles kaputt.
„Das weißt du besser“, gab Dr. Jensen zu und lenkte endlich ein.
Inzwischen war das völlig unwichtig. Ich wusste nicht, was ich fühlen sollte, ahnte allerdings, dass da noch einiges auf mich einstürzen würde, sobald ich kapierte, was das alles bedeutete.
Ich zwang mich zu einem Lächeln – es fühlte sich nach halbseitiger Gesichtslähmung an, aber das war mir egal. Demonstrativ hob ich mein leeres Glas. „Sie entschuldigen mich.“ Ohne eine Reaktion abzuwarten, entfernte ich mich – Abgang verschmähte Geliebte im ersten Akt des Dramas.
Scheiße, scheiße, scheiße! Was war passiert? Wie konnte Jo mir das antun?
Hatte sie nicht immer Angst gehabt, dass ich sie eines Tages für eine andere sitzen lassen würde? Und nun tat sie mir das an? Erstaunlicherweise änderte das alles. Es war nicht mehr nur eine Trennung, weil wir verschiedene Vorstellungen von einer Beziehung hatten. Jetzt war ich verlassen worden wegen einer anderen! Dr. Jensen, eine Frau, die Jo in allem besser verstand als ich. Die wusste, was der Unterschied zwischen einer Amphore und einer Hydria war – nur mal so zum Beispiel. Ich hatte hingegen keine Ahnung.
Ich war sicher, dass sie Jo auch in anderer Hinsicht bestens verstand. Ich schob mich ans Buffet und nahm mir dort noch eines der Sektgläser. Ein Kellner vom Catering war bestrebt, ständig nachzufüllen und den Vorrat nicht versiegen zu lassen. Er hatte gut zu tun.
Als ich mit dem Glas in der Hand dastand, fragte ich mich selbst, warum ich hier noch aushielt. Es war längst Zeit zu gehen.
Ich trank den Sekt in einem Zug aus und reichte dem verdutzten Kellner das Glas zurück. Dann verließ ich das Museum und suchte mein Auto auf dem Parkplatz. Ich wollte gerade einsteigen, als ich schnelle Schritte hinter mir hörte. Für eine Sekunde schloss ich die Augen, ehe ich mich mit dem Mut der Verzweiflung umdrehte und Jo entgegenblickte, die mich in diesem Moment erreichte.
„Was sollte das eben?“ Ihr Gesicht war so ernst, dass einem angst und bange werden konnte. Ihre schönen vollen Lippen waren nur noch ein schmaler Strich.
„Ich verstehe nicht, was du meinst“, wich ich unfreundlich aus.
„Warum hast du dich über unsere Arbeit lustig gemacht?“
Unsere? Das durfte doch alles nicht wahr sein! Ich hob übertrieben ratlos die Hände. „Es war ein Scherz