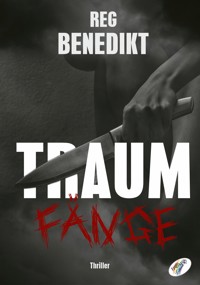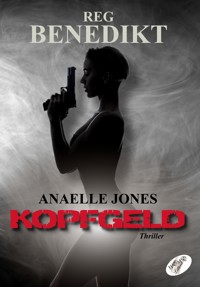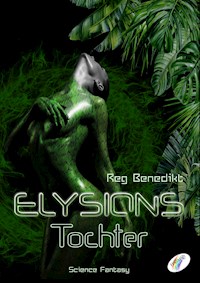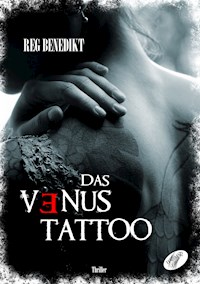6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Magische Grenze
- Sprache: Deutsch
Riven wird als Baby von einem abtrünnigen Magier mit dämonischer Dunkelheit gezeichnet. So wächst sie als Außenseiterin in einer Welt voller blutiger Konflikte um das allmächtige Schicksalstor auf. Einzig ein verschollener Schlüssel kann den Krieg beenden, und nur Riven weiß, wo dieser zu finden ist. Als ihr Weg sie über die Magische Grenze in die Schattenwelt führt, stößt sie auf die knallharte Ermittlerin Mack, und unerwartet ist sie die Verdächtige in einem grausamen Mordfall. Doch Mack scheint auch die einzige Chance zu sein, ihr Volk zu retten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Wächterin der Dunkelheit
Wächterin der Dunkelheit
Impressum
Widmung
Über die Autorin
Wächterin der Dunkelheit
Das Verlorene Volk schuf das Tor jenseits der Realität
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Aus unserem Programm
Jägerin der Schatten: Die Magische Grenze
Die Träne der Aphrodite
Das Venus-Tattoo
Lesbe auf Butterfahrt
Reg Benedikt
Fantasy
© Reg Benedikt, Wächterin der Dunkelheit: Die Magische Grenze
© HOMO Littera Romy Leyendecker e. U.,
Am Rinnergrund 14, 8101 Gratkorn,
www.HOMOLittera.com
E-Mail: [email protected]
Grafik und Gestaltung: Rofl Schek
Cover: © akvafoto2012 by AdobeStock.com
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Handlung, Charaktere und Orte sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Originalausgabe: September 2021
ISBN Print: 978-3-903238-78-7
ISBN PDF: 978-3-903238-79-4
ISBN EPUB: 978-3-903238-80-0
ISBN PRC: 978-3-903238-81-7
In liebevoller Erinnerung an meine Mutter, die mir mit sanfter Beharrlichkeit die Welt der Bücher überhaupt erst eröffnete und immer sämtliche Science-Fiction- und Fantasy-Filme mit mir im Kino gesehen hat.
Über die Autorin
Reg Benedikt, geboren 1973, ist eine deutsche Schriftstellerin und lebt in der Nähe von Berlin. Das Schreiben ist ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens.
Neben spannenden Abenteuern verbirgt sich in ihren Büchern jedes Mal eine Liebesgeschichte, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt, denn sie ist sorgfältig in düstere Intrigen und mystische Geheimnisse verpackt – und es gibt immer ein bisschen Drama. Mit Humor und Leidenschaft lässt sie ihre Protagonistinnen am Ende siegen – vermutlich ...
Veröffentlichungen bei HOMO Littera:
Die Magische Grenze: Jägerin der Schatten, Fantasy, April 2019
Die Träne der Aphrodite, Thriller, Februar 2020
Das Venus-Tattoo, Thriller, Dezember 2020
Das Verlorene Volk schuf das Tor jenseits der Realität, doch niemand weiß, wer es in die Wirklichkeit brachte. Es versperrt den Zugang zur ewigen Dunkelheit, die zwischen den Welten existiert. Man gab ihm viele Namen, die durch die Geschichte getragen wurden, und doch bezeichnen alle nur die Schrecken, die es verbirgt.
Prolog
Wenn Magie sich sammelt, dann kann sie sichtbare Wolken bilden, so wie jene, die sich im Thronsaal zusammenballte und dunkel und bedrohlich bis hinauf zur Decke wuchs. Blitze zuckten in ihr, erhellten sie wie ein Gewitter, und die Luft knisterte. Wind wirbelte Staub durcheinander, der schon seit Generationen unbehelligt unter Schränken und hinter Wandteppichen geschlummert hatte. Die lange Ahnenreihe der Tanesh’ wurde durchgeschüttelt, als die Magie an den Gobelins mit ihren Abbildern zerrte.
„Du hast gesagt, er wäre ein Scharlatan, Owen“, zischte Ad Tanesh, Herrscher über die Suaver, seinen Berater an. Neben ihm stand Pehma, die Meisterin. Ihr undurchdringlicher Blick war fast noch schlimmer als die Wut des Herrschers. Sie war eine mächtige Frau, auch wenn sie immer den Anschein erweckte, als wüsste sie das nicht. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte, Ad Tanesh hätte sie niemals kritisiert.
Owen leckte sich nervös die Lippen. „Davon bin ich ausgegangen.“
„Sieht mir aber echt aus“, knurrte der große, breitschultrige Mann. Er mochte diesen übernatürlichen Irrsinn nicht. Er machte ihm Angst – auch wenn er dieses Wort nie verwendet hätte. Vielleicht bereitete es ihm eher Sorge, wenn er etwas gegenüberstand, das so wenig greifbar war und doch eine derartige Macht hatte. Heutzutage kam man leider an Magie kaum noch vorbei. Es wurden keine anständigen Kriege mehr geführt wie früher, wo Männer einzig mit Schwertern aufeinander losgegangen waren und das Geschick der Feldherren über Sieg oder Niederlage entschieden hatte. Magier trieben stattdessen ihr Unwesen, wurden bezahlt, um ihre Kräfte gegen den Feind einzusetzen.
Mit Sorge betrachtete er also den alten Mann, der unter der riesigen magischen Wolke stand und fremde Worte in einem betäubenden Singsang murmelte. Seine Finger waren gichtgekrümmt. Er sah aus, als wäre er schon sehr alt – vermutlich war er noch älter. Sein schütteres Haar sträubte sich über seinen Ohren, und unter der knisternden Spannung wehte sein Umhang. Wenn dieser Mann ein Scharlatan war, wie Owen behauptete, dann ein verdammt guter.
„Ich dachte, es kann nicht schaden.“
„Da bin ich mir gerade nicht so sicher“, zweifelte Ad Tanesh.
„Was passiert hier?“, wollte Pehma wissen, und ihre Worte waren wie klares Wasser in dem tosenden Sturm.
Obwohl sie nicht laut sprach, hörte Owen sie sehr deutlich. Er selbst musste die Stimme heben, um sich über das magische Spektakel hinweg verständlich zu machen. „Er sagt, sein Name ist Dihoz, und er will den Schlüssel für das Schicksalstor finden.“
„Das will er?“, entfuhr es Pehma, und ihre Überraschung war echt.
„Das Drachenauge? Es wurde noch nie gesehen. Von niemandem.“ Ad Tanesh umfasste unruhig den Knauf des riesigen Breitschwertes an seiner Hüfte und blickte misstrauisch zu dem Magier, der mit seinen knotigen Fingern komplizierte Muster in die Luft malte. „Ich war nicht mal sicher, ob es existiert.“
„Er behauptet, dass er es hat.“
Es hatte schon viele gegeben, die versucht hatten, das Schicksalstor zu öffnen, und doch war es keinem gelungen. Es blieb geschlossen – seit Ewigkeiten. Einzig das Drachenauge war in der Lage es zu überwinden – so hieß es. Die Legenden berichteten, dass man mit dem Schlüssel das Tor beherrsche und somit alles, was es verbarg. Hier allerdings wurden die Geschichten ungenau, denn niemand konnte sagen, was sich hinter dem Tor befand. Nur, dass es unbeschreibliche Macht für den strahlenden Helden beinhalte, da waren sich alle einig.
„Es gibt nur einen kleinen Haken.“
Der Kopf des Herrschers fuhr herum, und er fixierte seinen Berater mit verengten Augen. Er wusste doch, dass es so einfach nicht sein konnte. „Was für einen Haken?“
Owen lachte unsicher, was in dem tosenden Lärm fast unterging. „Das ist eine seltsame Sache. Dieser Dihoz ... Er verlangt einen etwas ungewöhnlichen Preis.“
„Welchen Preis?“ Ad Tanesh baute sich bedrohlich vor Owen auf, der daraufhin noch ein wenig kleiner wurde. Aber Owen war sich sicher, dass er an alles gedacht hatte. Es konnte funktionieren. Diesen Magier hatte ihm der Himmel geschickt – und wenn nicht der Himmel, dann irgendwer anders.
Er schaute an den breiten Schultern seines Herrn vorbei zu der unheilschwangeren Wolke, die Blitze in alle Richtungen verteilte. Sollte das hier funktionieren, war er ein Held. Lieder würden für ihn geschrieben, und niemand würde ihn mehr als Lakaien bezeichnen. Er blickte wieder zu seinem Herrn. „Das ist so“, begann er behutsam, als es einen lauten Knall gab.
Pehma und die beide Männer sahen zu Dihoz. Die gigantische Wolke ballte sich zusammen. Der alte Magier streckte die Hand aus, und gleich einem Strudel wurde die Wolke in seine Handfläche gesaugt, materialisierte sich und verschwand – und mit ihr der Wind und die Blitze und das statische Knistern. Es war plötzlich so still, als wäre man taub geworden.
„Es ist vollbracht“, erklärte Dihoz mit überraschend kraftvoller Stimme.
„Der Stein“, wisperte Owen und trat zusammen mit Ad Tanesh die wenigen Stufen in den Saal hinunter. In der Handfläche des Greises glänzte es, und als er näher kam, wurde er gewahr, wovon bisher nur Legenden berichtet hatten – ein grünes Juwel, gehalten von einer Klaue aus Gold. Das Drachenauge ...
„Er hat es“, raunte Ad Tanesh neben ihm fassungslos und wollte nach dem Stein greifen, doch der Magier zog ihn fort.
„Das Kind“, forderte Dihoz auf.
„Kind?“
„Natürlich“, beeilte sich Owen dazwischenzugehen. „Es ist ein wahrlich großer Moment.“ Er wandte sich zu seinem Herrn. „Stell dir vor, was du mit dem Schlüssel bewirken kannst, Herr.“
Ad Tanesh nickte. Er konnte es sich vorstellen, sehr gut sogar. Er würde die Todbringer zurückschlagen und diese elenden Kreaturen in ihre Höhlen treiben, aus denen sie unermüdlich gekrochen kamen.
„Dafür musst du einen Preis zahlen.“
„Herr“, mahnte Pehma aus dem Hintergrund, aber die Vorstellung dessen, was das Drachenauge bewirken konnte, war überwältigend.
„Egal, was es ist“, stimmte Ad Tanesh überzeugt zu.
„Ich wusste, dass du das sagst“, rief Owen erleichtert und eilte zu einer Tür am Ende des Saals. Gleich darauf kehrte er mit einem Bündel im Arm zurück. Es war in goldbestickte Decken gewickelt.
Ad Tanesh erstarrte und machte den Mund auf, um zu protestieren, aber dann fing er Owens Blick auf. Er war schon so lange sein Berater. Er hatte seinem Vater gedient und jetzt ihm – er war ihm immer treu ergeben gewesen. Owen ermahnte ihn stumm, ihm zu vertrauen – und doch ... es war seine Tochter, die er in den Armen hielt. Unentschlossen ballte Ad Tanesh die Hände zu Fäusten. Er wollte vertrauen. Niemals würde Owen etwas tun, das ihm oder seiner Familie Schaden zufügte. Niemals! Owen wusste, dass er tot war, wenn er einen Fehler beging.
„Das Kind.“ Owen zeigte es dem Magier.
Ein Lächeln breitete sich auf Dihoz’ Gesicht aus, das direkt aus der Finsternis zu kommen schien, als er das Baby betrachtete.
„Du wolltest es sehen. Das hast du“, sagte Owen wachsam.
„Nimm es weg!“, befahl Pehma alarmiert.
Aber es war zu spät. Der Magier machte eine Handbewegung und beschwor ein Wort, das so fremd war, dass es die Ohren kaum erfassen wollten. Er berührte blitzschnell die Stirn des Babys mit einem knotigen Finger und ritzte mit einem langen gelben Fingernagel die Haut zwischen den Augen ein. Es begann zu schreien.
Owen zog das Bündel weg. „Der Stein! Schnell!“
Ad Tanesh packte das Handgelenk des alten Mannes, das dünn wie ein Ast war, und wollte ihm das Drachenauge entwinden. Doch als Dihoz lachend die Faust öffnete, verschwand das Juwel in grünem Rauch – war nie da gewesen.
„Betrüger!“, fluchte Ad Tanesh.
„Du Narr! Du hast dein eigen Fleisch und Blut verraten!“ Der Magier lachte abermals, und das Geräusch sträubte einem die Nackenhaare. „Sie gehört jetzt der Dunkelheit!“
„Wer bist du?“ Drohend ging Ad Tanesh auf den Alten zu, während hinter ihm seine Tochter schrie.
Dihoz stellte sich dem viel größeren Mann entgegen. „Glaubst du wirklich, Herrscher der Suaver, dass deinem Volk das Tor gehört? Ihr seid unwürdig! Es gehört keinem Sterblichen.“ Der Körper des Alten bebte vor Empörung, und Speichel flog von seinen Lippen, so aufgebracht war er.
Angewidert wich Ad Tanesh zurück. Er verstand kein Wort von dem, was dieser verrückte Alte faselte. Er war erbärmlich, und Ad Tanesh griff ihn nur deshalb nicht an, weil er unbewaffnet war. „Sondern wem? Dir etwa? Einem Greis?“
Dihoz lachte erneut – leise erst und überrascht, als könnte er die Unwissenheit seines Gegenübers nicht fassen. Dann wurde sein Lachen lauter und bekam etwas Irres. „Ja!“, stieß er hervor und wurde sofort wieder ernst. Es war unheimlich. „Ich diene der Dunkelheit, und nicht mehr lange, und sie wird mir gehorchen. Ihre Macht wird euch vernichten.“ Hinter ihm begann die Luft zu kochen, anders konnte man es nicht beschreiben. In Wellen waberte sie wie im Sommer, wenn die Hitze den Horizont verbrannte. Der Thronsaal verschwamm hinter dieser unnatürlichen Wand. Es wurde dunkel, als würde alles Licht der Sonne verschluckt werden, und eine riesige mannsgroße Klaue fuhr mittig aus dem Nichts wie durch eine Fläche aus Wasser oder einen Spiegel. Eine zweite folgte und öffnete die Welt selbst. Mit Kräften, die über jedes Verstehen hinausgingen, rissen sie die Luft zu nebliger Finsternis auf. Sehnige Arme zwängten sich hindurch, und ein ebensolcher Körper folgte in die Gegenwart. Er war riesig. Bleiche glitschige Haut spannte sich über Knochen, übersät mit offenen Wunden, aus denen blutiger Eiter floss. Es glich einer Geburt, wie er sich dort aus dem Nichts hindurchwand, sich auf einen Rand stützte, den es nicht geben sollte. Blinde Augenhöhlen suchten ziellos. Ein Mund öffnete sich zu einem Schrei, als er in den Thronsaal hineingriff. Er verfehlte Ad Tanesh, der sich zur Seite duckte.
In Panik wollte Owen zurückweichen, fiel jedoch über seine eigenen Füße. Dass er dabei das Kind nicht fallen ließ, war reiner Zufall. Eilig legte er das schreiende Baby auf den Fußboden und stolperte beiseite.
Es war Ad Tanesh, der sein Schwert zog und mit einem wütenden Schrei nach dem Magier schlug. Sein Leben bestand aus Kampf und Tod, und egal, was um ihn passierte, so erkannte er doch den Feind, den es zu besiegen galt. Zielsicher sirrte die schwere Klinge durch die Luft und durchtrennte Dihoz’ Kehle mit einem Hieb. Der Greis taumelte von der Wucht nach hinten, die Augen weit aufgerissen.
Sofort sprang Pehma vor und riss das Kind von der Kreatur fort. Sie wich der Klaue geschickt aus, und statt des Babys erwischte die Kreatur den Körper des Magiers und zerrte ihn mit sich. Die Öffnung schloss sich, und es blieb nichts zurück als Stille.
Atemlos starrten sie die leere Luft an. Ad Tanesh wandte sich an Owen und hob das blutige Schwert. „Was hast du getan?“
„Ich wollte nur das Beste für unser Volk“, beschwor Owen. „Ich kann es erklären.“
„Sie ist es nicht“, sagte Pehma.
Der Herrscher trat zu ihr. „Was?“
„Glaubst du wirklich, ich würde deine Tochter einem Verrückten überlassen?“, redete Owen schnell. „Niemals würde ich das!“
Pehma beachtete sein Gestammel nicht, sondern strich die Tücher beiseite, die das kleine Gesicht umgaben. Das Weinen war leiser geworden. Sie wischte das Blut fort, das aus dem Riss an der Stirn sickerte. Dann hielt sie dem Herrscher das Kind hin und wiederholte: „Sie ist es nicht.“
„Natürlich nicht!“, bestätigte Owen.
„Du hast ihn betrogen?“, fragte Ad Tanesh verwirrt.
„So wie er uns. Er versprach uns die Möglichkeit, das Schicksalstor zu öffnen. Aber sein Preis, deine Tochter sehen zu dürfen, erschien mir – seltsam. Und Babys sind doch alle gleich.“
„Wessen Kind ist das?“, wollte Ad Tanesh wissen.
„Eine Waise. Niemand wird sie vermissen.“
„Ihre Augen“, wisperte Pehma erschrocken.
Die Männer beugten sich über das Kind und beobachteten bestürzt, wie sich die violette Iris, die alle Suaver haben, verfärbte. Wie Tinte floss die Nacht in sie hinein. Für einen Moment waren es Augen aus einer anderen Welt, so schwarz wie der Nachthimmel und so tief wie das finsterste Meer, das versucht, einen in die Kälte hinabzuziehen. Gleichzeitig wich alle Farbe aus dem dunklen Babyflaum, der den kleinen Kopf bedeckte, und wurde silbrig grau wie Mondlicht.
„Sie ist verflucht“, hauchte Owen voller Entsetzen.
Ad Tanesh lief ein eisiger Schauer über den Rücken. Die Worte des Alten gingen ihm nicht aus dem Kopf, ebenso der Anblick der Kreatur, die sich aus dem Nichts hervorgewunden hatte. „Das Tor darf nie geöffnet werden“, murmelte er.
„Aber seine Macht ...“, begann Owen fast schon verzweifelt.
„Wird uns vernichten“, unterbrach Ad Tanesh entschlossener. „Du hast es doch erlebt.“
„Ein Trick ...“
„Nein!“, sagte Ad Tanesh scharf und fügte leiser hinzu: „Niemand kann ... das kontrollieren, und wer weiß, was sich noch alles dahinter verbirgt. Es würde uns zerstören.“ Er schaute Pehma an und rang eine Sekunde mit sich. Als er schließlich wieder sprach, war seine Stimme fast lautlos. „Töte es.“
„Töten die Suaver jetzt schon Kinder?“, fragte Pehma ruhig, als hätte sie genau gewusst, was in ihm vorging.
„Sie ist ein Dämon.“
„Sie ist unschuldig!“
„Jetzt nicht mehr. Wir wissen nicht, was er mit ihr gemacht hat. Sie ist gefährlich.“ Die breiten Schultern des Mannes sanken herab, als würde ihn alle Kraft verlassen. Aber sein Befehl war eindeutig und duldete keinen Widerspruch. „Töte es! Ich werde es nicht noch einmal wiederholen.“
Pehma hielt seinem Blick stand, dann senkte sie gehorsam den Kopf und trat mit dem Kind an ihnen vorbei.
Die Männer sahen ihr nach. Keiner von ihnen wollte in ihrer Haut stecken.
***
Mit untergeschlagenen Beinen saß er auf der Anhöhe, nicht weit entfernt von dem trostlosen Tal, aus dem sich das Tor erhob. Seine Ausmaße waren gigantisch, und er musste zugeben, dass er beeindruckt war. Selbst das Mondlicht wagte es nicht, das schwarze Gestein zu berühren, aus dem es gefertigt war. Es floss einfach darum.
Helle Lichtpunkte von Fackeln näherten sich über das sandige Ödland. Es waren sieben Gestalten, kräftige Krieger, mehr als zwei Meter groß, und doch nahmen sie sich wie Ameisen gegen die riesigen Torflügel aus, die dort ohne ersichtlichen Zweck in den sternenklaren Himmel ragten. Sie hatten drei Gefangene bei sich, die sie zwischen sich an Ketten mitzerrten.
Leise drangen die Geräusche der seltsamen Prozession zu ihm herauf. Er hörte das Klappern von Eisen, das von den Waffen der Krieger herrührte, das hellere Klingen der Ketten und die schwachen Laute der drei Gefangenen. Sie waren schon mehr tot als lebendig, und vermutlich würde die Opferung für sie eine Erlösung sein.
Als die Prozession auf dem Podest vor dem Tor ankam, bildeten die Krieger einen Kreis und stellten die Gefangenen in ihre Mitte. Sie stimmten einen seltsamen unmenschlich tiefen Singsang an, der nur aus einem Wort bestand. Dabei zwangen sie die erbärmlichen Gestalten auf die Knie, und als einer ihrer Aufpasser von hinten an sie herantrat und ihnen nacheinander die Kehlen durchschnitt, war das so unspektakulär wie das Schälen eines Apfels.
Er hatte sich mehr versprochen und war ein wenig enttäuscht. Es war nichts anderes, als dummes Vieh zur Schlachtbank zu treiben. Das sollte alles sein?
Die Krieger ließen die Leichen auf dem Podest liegen, und die Lichtpunkte der Fackeln verschwanden wieder in der Nacht.
Er erhob sich steif und wollte sich abwenden, als er neue Laute hörte. Es war zu dunkel, um viel erkennen zu können, aber es klang, als würde sich etwas über die Kadaver der Gefangenen hermachen. Ein feuchtes Schmatzen von Fleisch, das aufgerissen wurde, und dumpfes Brechen von Knochen. Aber das war es nicht, was ihm einen Schauer über den Rücken jagte, sondern das Gefühl, dass die Finsternis sich verdichtete, und der Eindruck, als würde sich etwas Zugang zur Welt verschaffen, das hier nicht sein sollte.
„Also stimmt es“, hauchte er ehrfürchtig.
Hast du gezweifelt?
Es war ein Wispern in seinem Geist und fühlte sich in etwa so an, als würden lange Krallen über seine Gedanken kratzen – wie über eine Tafel. Es war unangenehm, aber er hielt es aus. Als er die Augen schloss, konnte er ihn sehen, am Rand seiner Wahrnehmung. Es war nicht viel von ihm übrig, nur ein Schemen, der versuchte, eine Form zu bilden – ein siechender Körper, der aus Tod bestand. Aber sein Innerstes war erfüllt mit Hass, der weit über alle Welten hinausreichte, und darin lag seine eigentliche Macht. Er war der eine, der in der Dunkelheit zwischen den Welten gefangen war. Er kannte ihn aus der Vergangenheit, aber die Zeit hatte es nicht gut mit ihm gemeint. Er war nur ein Schatten seiner selbst. Fast musste er über das Wortspiel lächeln, aber er verkniff es sich. Es stand ihm nicht zu. Der Dämon hatte seine Kraft eingebüßt. Das mochte auch der Grund sein, warum er so lange nichts von ihm gespürt hatte – und warum er noch am Leben war.
„Sind die Opfer für dich?“
Es ist schwaches Fleisch – unwürdige Leben. Es ist zu wenig, um der Dunkelheit zu entkommen. Es gab eine kurze Pause, in der die Unendlichkeit sanft weiterzog. Ich weiß, wer du bist. Deine Macht ist so groß wie von allen deiner Art – und doch werde ich dich vernichten, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr habt mich dazu gemacht.
„Andere waren es, nicht ich.“
Du stirbst dennoch.
Eines Tages vermutlich ... „Was haben sie gerufen?“
Nascahl.
Er überlegte. Ein Name für den Dämon. Es würde ihn stärken, ebenso wie die Opfer, die sie für ihn darbrachten.
Ich kenne dich. Du streifst durch die Dunkelheit.
Er zögerte. „Das tue ich.“
Warum?
„Die wahre Stärke liegt dort verborgen.“
Bei mir ist sie nicht. Das klang etwas zynisch, falls das möglich war.
„Ich habe versucht, die Dunkelheit über die Magische Grenze zu holen, aber es misslang.“
Schweigen war die Antwort, ein Tasten durch seinen Geist, das ihm unnatürliche Kälte in die Glieder trieb.
Ich spüre einen Teil der Dunkelheit jenseits der Weltengrenze.
War das möglich? Es war Jahre her ... Nein, er wüsste davon. Aber vielleicht gab es einen anderen Weg. „Das dort unten sind nur Tiere. Was wäre, wenn man sie anleitet? Wenn die Zahl der Opfer wächst und du deine alte Stärke wiedererlangst?“
Die Schatten in seinem Geist verdichteten sich, und es formte sich ein Körper, wie er fremdartiger nicht sein konnte, nur verborgen von den zerfledderten Fetzen eines Umhangs, ehe erneut die Stimme durch seine Gedanken kratzte: Sprich, Dihoz!
1
Einatmen ...
Die Leute hielten mich für verrückt.
Ausatmen ...
Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sogar recht damit haben.
Einatmen ...
Ich bin mir selbst nicht ganz sicher. Vieles von dem, was ich sehe und höre, existiert für die anderen nicht.
Ausatmen ...
Und doch bin ich überzeugt, dass ich es mir nicht einbilde. Ich habe aufgegeben, es erklären zu wollen, was einen noch verrückteren Eindruck macht. Es ist nicht gut, anders zu sein. Das zumindest hatte ich sehr schnell gelernt.
Einatmen ... und ... ausatmen ... In immer steter Abfolge. Die Gedanken darauf konzentrieren, den nächsten Atemzug zu tun. Nichts anderes war bei der Meditation wichtig, nur der Augenblick, in dem ich mich befand.
Der eisige Wind der Hochebene, der sich in meiner Haut festbiss, war weit weg. Er spielte mit meinem Haar, und ich bekam den Eindruck, dass er mich verspotten wollte. Die Sonne schob sich über die Berge hinauf, und ihre ersten Strahlen berührten mein Gesicht. Durch die geschlossenen Lider floss ihr Gold in mich.
Einatmen ...
Es war wirklich kalt.
Ausat...
Verdammt! Ich schlug die Augen auf und blinzelte in das Licht der Morgensonne. Wie zähes Feuer strömte es über die schroffen Berghänge, auf denen das ganze Jahr über Schneefelder zu finden waren, und erreichte das Tal, das sich tief unter mir ausbreitete. Es berührte Baumwipfel und vertrieb die Nacht aus jedem Winkel, egal, wie sehr sie sich auch festklammerte.
Abwesend betrachtete ich die Landschaft, die sich hinter den Mauern der Festung erstreckte. Hier, vom höchsten Punkt des Wehrs, konnte man bis zum Horizont sehen, über das Dorf hinweg, das sich an den Fuß der Festung duckte bis zu den Wiesen, Feldern und Wäldern dahinter, ehe die Berge im Süden das Land der Suaver abgrenzte. Sie waren zu weit entfernt, als dass ich sie hätte erkennen können. Die Luft war so früh am Morgen noch neblig, und alles, was am Horizont lag, wurde von sanftem Dunst verborgen, den die Sonne in einigen Stunden vertreiben würde. Vor den Bergen weiter im Westen lag die Blutwüste im Niemandsland. Der Schemen des Schicksalstors ragte aus dem Tal hervor und war selbst über diese Distanz auszumachen, jedoch blieb es im Nebel undeutlich, und das nachtschwarze Gestein erschien nur grau. Seine riesigen Torflügel strebten schier gen Himmel, und obwohl es Kilometer entfernt war, war sein Anblick überwältigend.
Normalerweise war das Wehr ein ruhiger Ort, den selten jemand aufsuchte. Schon gar nicht um diese Zeit. So weit oben erreichte einen der Tumult der erwachenden Festung nicht. Alles blieb zurück, nur der Wind jammerte leise um einen herum, und ab und an schrie eine Dohle, die den Tag begrüßte.
Man hielt mich außerdem für leicht beschränkt. Gesagt hatte es niemand, aber ich wusste es. So wie die drei Rekruten, die sich im Windschatten der Mauer ausruhten, die zum Wehr führte. Vor einer ganzen Weile waren sie heraufgekommen, um zu rauchen. Vermutlich hatten sie noch Dienst, was erklärte, warum sie sich bemühten, heimlich zu sein. Sie waren nur wenige Meter entfernt, und doch schienen sie anzunehmen, dass ich sie nicht hörte.
Ich konzentrierte mich weiter auf meinen Atem, so wie Pehma es mich gelehrt hatte. Das war der Kern der Meditation. Sich auf sich selbst besinnen – im Hier und Jetzt und im eigenen Körper.
„... tut sie da?“
„Keine Ahnung. Schlafen?“
„Im Sitzen?“
„Woher soll ich das wissen? Sie ist verrückt, das weiß jeder.“
„Verrückt?“ Das war der Neue. Ich kannte ihn noch nicht. Er war sicher ein geschickter Kämpfer, sonst wäre er nicht bei der Wache.
Ich spürte ihre Blicke auf mir, ignorierte sie aber so gut ich konnte.
„Hast du bisher nichts davon gehört? Sie ist von Dämonen besessen, heißt es.“
So hätte ich es nicht ausgedrückt. Pehma nannte es Visionen. Vielleicht waren es welche, vielleicht auch nicht.
„Und sie hört Stimmen und führt Selbstgespräche.“
Das war nicht richtig. Das machte ich schon lange nicht mehr. Zumindest nicht, wenn andere Leute anwesend waren.
„Warum tut sie das – was immer sie da tut?“
„Bestimmt ist sie selbst ein Dämon“, raunte der Dritte so leise, dass ich ihn gut verstehen konnte. Unbehagliches Schweigen breitete sich aus.
„Ich sage, sie ist einfach nur verrückt.“ Das war der Wortführer. Seine Stimme klang polternd, und die Worte waren ein wenig schleppend. Er kam aus dem Norden. Sicher aus einem winzigen Dorf, wo nichts ihn erwartete außer Feldarbeit. Nun hatte er seine Chance ergriffen und war ein Soldat der Wache des Herrschers. Seine Eltern waren zweifellos stolz – er war es auf jeden Fall, so wie er sich vor den beiden anderen aufplusterte.
Wie gesagt, ein ruhiger Ort. Meistens jedenfalls. Ich atmete einmal tief durch und erhob mich. Sofort riss der Wind an meiner Kleidung und machte mir deutlich, dass er noch immer etwas von dem vergangenen Winter in sich trug. Er war schneidend, obwohl Hemd und Hose aus dicht gewebtem Stoff waren.
Ehe ich mich umwandte, um zu gehen, schaute ich zu den Männern hinüber, die bei der Mauer saßen. Sie waren groß und muskulös und in ihren dunklen Uniformen sehr beeindruckend mit all dem Leder, den Nieten und den Schwertern. Es war amüsant, wie sie erschrocken zurückstarrten, als hätten sie nicht damit gerechnet, dass ich Ohren hatte und sie hören konnte – egal, wie verrückt ich vielleicht sein mochte. Zumindest der Neue schien angemessen verlegen zu sein und senkte den Blick.
Ich drehte mich um und lief auf der anderen Seite das Wehr entlang und hinunter ins Innere der Festung.
Die Eisfeste war schon viele Jahrhunderte alt. Ursprünglich hatte man sie aus den Felsen der Berge geschlagen, und an zwei Seiten waren die Hänge so steil, dass niemand hinauf oder hinunterkam, ohne zu Tode zu stürzen. Im Laufe der Zeit war sie beständig weitergewachsen. Jeder Herrscher der Suaver hatte daran gebaut. Die Mauern waren breiter geworden, die Wehrtürme höher. Sie war ein Labyrinth, und man konnte tagelang hindurchwandern und immer wieder Orte finden, an denen man noch nie gewesen war. Das Dorf lag im Inneren der letzten Schutzmauer.
Mein Weg führte mich hinunter, aber ich mied die belebten Hauptstrecken der Eisfeste. Um diese Zeit war mir dort zu viel Betrieb. Waren wurden geliefert, und die Leute gingen ihrer Beschäftigung nach. Die Mauern boten hunderten Suavern eine Heimat, um zu leben und zu arbeiten. Viele wurden hier geboren und starben auch hier, ohne je weiter wegkommen zu sein als zum Dorf, wenn Markt war.
Ich nahm den längeren Weg, über steinerne Wendeltreppen, durch von Sonnenmoosen nur mäßig beleuchtete Flure, von denen Türen in weitere Bereiche führten. An den Wänden hingen Bilder von sicherlich berühmten Suavern, deren Namen niemand mehr kannte und die stetig weiter weggehängt worden waren, bis sie in den abgelegenen Gängen ihr Dasein fristeten und streng auf mich herabstarrten. Ab und an fanden sich ein paar zerkratzte Schilde aus legendären Schlachten gegen die Todbringer, an die sich auch keiner mehr erinnerte. Es gab so viele Gefechte und Tote, dass niemand sich damit aufhielt, besondere Kämpfe hervorzuheben.
Ich ging eine Treppe hinunter, bog nach rechts und blieb ruckartig stehen, sonst wäre ich gegen den Brustharnisch eines Mannes gelaufen, der mir plötzlich im Weg stand. Ich schaute hinauf in sein Gesicht, und mein Magen krampfte sich zusammen. Hinter ihm wartete ein Rekrut. Es waren zwei der Soldaten von oben. Sie waren mir gefolgt.
Ein Lächeln lag um seine Lippen. Es war vielversprechend böse.
Schnell musterte ich sie. Der Neue, ein dünner Kerl mit Ansätzen von Flaum um sein Kinn, der mal ein Bart werden sollte, schien sich nicht wohlzufühlen – und wenn er sich schon nicht wohlfühlte, dann durfte ich davon ausgehen, dass mir einiges bevorstand.
Der Wortführer stand lässig vor mir, starrte mich provozierend von oben bis unten an und wieder zurück. Ich schwieg. Falls sie erwarteten, dass ich anfing, täuschten sie sich.
Der Durchgang, in dem wir standen, war nicht sehr breit und weit abgelegen. Der einzige Ausweg war die Treppe zurück und hinauf ...
Ich spürte, wie sich jemand in meinem Rücken aufbaute. Da war er ja, der dritte Kerl. Somit war auch dieser Weg versperrt.
„Du bist Pehmas Schülerin“, begann der Wortführer gedehnt. „Wie kommt es, dass sie dich unterrichtet?“
Ich schwieg weiter.
„Redest du nicht mit uns?“
Ich versuchte, die beiden vor mir im Blick zu behalten und gleichzeitig zu ahnen, was der Mann hinter mir vorhatte. Mein Herzschlag beschleunigte sich, ganz so, wie er es nicht tun sollte. Pehma hatte mir beigebracht, ruhig zu bleiben. Es war wichtig, die Situation zu beherrschen und nicht von ihr beherrscht zu werden.
Schwierig, wenn einen drei Soldaten umringten, die sich offensichtlich langweilten.
„Ist sie stumm?“, wollte der Neue wissen.
„Blödsinn!“ Der Wortführer lächelte wieder dieses unangenehme Lächeln und fixierte mich. „Sie will nur nicht.“
Vielleicht waren seine Eltern auch ganz froh, dass er jetzt hier war und nicht mehr zu Hause, überlegte ich.
„Sieht nicht aus wie ein Dämon“, bemerkte der Mann hinter mir, und ich hörte sein Grinsen. Dann berührte er mich an der Hüfte, und in einem Reflex schlug ich seine Hand fort und wich zur Wand aus.
Jetzt gab es keinen Weg mehr. Die Steinwand drückte sich in meinen Rücken, und die drei Männer bauten sich vor mir auf.
„Holla!“, rief der Kerl mit einem Lachen und rieb sich übertrieben seine Hand, die ich getroffen hatte. „Bist du sicher, dass sie ein Dämon ist, Cil?“, fragte er den Wortführer höhnisch. „Sie ist doch recht hübsch.“ Er hob die Hand zu meinem Gesicht. Ich nahm den Kopf beiseite, und er fasste ins Leere, aber er lachte abermals nur.
„Keine Ahnung“, sagte Cil lauernd. „Vielleicht sollte sie sich mal ein wenig ausziehen, damit wir mehr sehen können.“
Die beiden rückten näher. Mit zwei Fingern zog der eine den Ausschnitt meines lockeren Hemdes am Kragen weiter auf und schielte unter den Stoff. „Wirklich ansprechend.“
„Komm her, Kleiner“, befahl Cil nach hinten, womit der Neue gemeint war. Er trat unsicher vor.
„Halt sie fest!“
„Ich glaube nicht ...“
„Das ist ein Befehl! Du willst doch dazugehören, oder nicht? Also solltest du gehorchen. Wenn sie sich wehrt, hilfst du mit dem Messer nach. Sie bleibt dann schon ruhig, wenn sie weiß, was gut für sie ist.“
So war das also ... „Würde ich mir überlegen“, sagte ich langsam, und umgehend hatte ich von allen dreien die ungeteilte Aufmerksamkeit. Überrascht zuerst, doch dann warfen sich Cil und sein Kumpel einen kurzen Blick zu und grinsten.
Cil zog ein Messer aus seinem Gürtel. Ein langes Messer – natürlich. Er gab es dem Neuen, der unschlüssig damit vor mir stand, ehe Cil sich an mich wandte und entschlossen meinen Arm nahm. Seine Hand war riesig, mit Schwielen vom Schwertkampf bedeckt und stark. Ein Breitschwert wog etliches. Es über Stunden in einem Kampf zu führen, erforderte sehr viel Kraft. Wie ein Schraubstock legten seine Finger sich um mein Handgelenk. Mit einem Ruck zog er mich zu sich.
„Wollen doch mal rausfinden, ob du wirklich so besessen bist. Vielleicht mag ich das ja“, betonte er selbstgefällig. Seine Augen hatten sich dunkel gefärbt, und seine Wangen waren gerötet.
Mit einer geschickten Drehung befreite ich meinen Arm, und er grunzte überrascht. Sein Schlag kam jedoch zu plötzlich, als dass ich ausweichen konnte, und Cil traf mich seitlich am Kopf. Ich stolperte gegen die Wand, und meine Ohren klingelten. „Scheiße ...“, stieß ich hervor und tastete benommen nach meiner Wange.
„Das hast du nun davon.“ Seine Stimme war ein wütendes Zischen. Wieder griff er nach mir. „Wir treiben dir die Dämonen schon aus.“
Dann ging alles sehr schnell. Ich wich zur Seite, bevor er mich erwischte, und schlug seinem Kumpel den Handballen in den Bauch. Es war keine reine Muskelkraft, sondern gesammelte Energie aus dem ganzen Körper heraus, so wie Pehma es lehrte. Eine alte Technik, mit der man jeden noch so überlegenen Gegner ausschalten konnte. Funktionierte wirklich gut.
Der Mann klappte vornüber, und ich riss gleichzeitig mein Knie hoch. Es landete in seinem Gesicht, das auf dem Weg nach unten war, und der ein oder andere Zahn gab vermutlich nach. Im selben Moment nahm ich die Hand von Cil, die mich greifen wollte, zog ihn an mich und traf mit der Faust seinen ungeschützten Hals. Während er fiel, drehte ich mich schnell zu dem Neuen, der vor Schreck sein Messer vergessen hatte. Ich schlug es ihm aus der Hand und fing seinen entsetzten Blick auf, als ich ihm gezielt zwischen die Beine trat. Keuchend brach er in die Knie, als das Messer gerade erst scheppernd auf dem Boden landete.
Das Klingeln in meinen Ohren ließ nach, und das Stöhnen und Jammern drang zu mir durch. Die drei Männer lagen um mich herum und wanden sich auf die eine oder andere Art auf dem Boden. Ich kniete mich neben Cil, umfasste sein stoppliges Kinn und drehte seinen Kopf so zu mir, dass er mich ansehen musste. Seine Augen waren ein wenig trüb, was vielleicht daran lag, dass er kaum Luft bekam. „Fass mich nie wieder an! Sonst werde ich und alle Dämonen der Finsternis dich nachts in deinen schlimmsten Albträumen aufsuchen, und du wirst dir wünschen, niemals geboren worden zu sein.“
Ich wartete sein mattes Nicken ab, erkannte die irrationale Angst in seinen Augen und erhob mich. Rasch schaute ich mich um. Nun ja, die Situation hatte ich im Griff behalten, wenn auch etwas anders ausgelegt, als es Pehma unterrichtete. Sie brachte mir bei, zu kämpfen und wie ich mich selbst und meine Gefühle kontrollierte. Fraglos war das Letztere das Schwierigere. Diverse Arten zu beherrschen, jemandem das Genick zu brechen, war wirklich ein Kinderspiel – im Vergleich dazu, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass man über die Zerbrechlichkeit eines Genicks nachdenken musste.
Vielleicht erfuhr sie nie etwas hiervon ...
„Was geht hier vor?“, polterte eine tiefe Stimme, und der Hauptmann der Wache stapfte wütend auf mich zu.
Oder aber ich hatte echt ein Problem.
***
„Das ist die Wahrheit? Sie hat euch angegriffen?“, fragte der Hauptmann nun zum zweiten Mal. Er schien Schwierigkeiten mit der Glaubwürdigkeit der Geschichte zu haben, die ihm die drei berichtet hatten.
Ich war selbst fasziniert von dem Märchen, das die Männer sich ausgedacht hatten. Ein Dämon habe sie angegriffen – das war ich. Völlig unvorbereitet, hätte ich sie erwischt und niedergeschlagen. Sie hätten sich nur freundlich erkundigt, ob sie mir helfen könnten, weil man sich in den entfernten Teilen der Feste leicht verliefe – und dann das! Völlig von Sinnen wäre ich gewesen.
„Hm ...“, brummte der Hauptmann. Er war ein gestandener Mann mit grauen Schläfen, die Haut wettergegerbt mit tiefen Falten. Wir befanden uns in seinem Dienstzimmer. Keiner durfte sich setzen, was den dreien einige Mühe bereitete. Der Kumpel von Cil versuchte immer noch die Blutung seiner Unterlippe zu stoppen, und der Neue stand leicht vorgebeugt da und war bleich wie ein Laken.
Der Hauptmann betrachtete mich, aber er sprach mich nicht an. Ihm war nicht wohl. Ich wusste, dass er Pehma gerufen hatte und auch, dass er hoffte, sie möge bald hier sein. Er wandte sich dem Neuen zu – das schwächste Glied der Gruppe. „Hat es sich so zugetragen, Soldat?“
Der Neue schielte rasch zu mir und dann wieder zum Fußboden. Schließlich nickte er.
Ich hatte nichts anderes erwartet.
Die Tür öffnete sich, und Pehma trat ein. Schnell erfasste sie die Situation. „Was ist passiert?“, erkundigte sie sich mit ruhiger Gelassenheit. Neben dem Hauptmann wirkte sie geradezu zerbrechlich. Sie war schlank und verlor sich fast in den weiten Leinensachen, die sie stets trug. Ihre Gesichtszüge waren markant ausgeprägt und ihre Haare kurz geschnitten. Weibliche Attribute waren ihr unwichtig. Sie war Pehma. Die Meisterin. Früher hatte sie selbst die Kinder der Eisfeste unterrichtet, inzwischen machten dies andere Lehrer und sie blieb im Hintergrund. Ihr Unterricht beschränkte sich nicht auf Allgemeinwissen wie Lesen und Schreiben, sondern umfasste zusätzlich verschiedene Kampfstile. Diese lagen jenseits dessen, was die Rekruten beim Drill übten, und waren so fremd, dass nicht viele sie erlernen wollten, weil sie gar nicht erkannten, was ihnen geboten wurde. In den seltensten Fällen spielten Schwerter eine Rolle. Auch das passte nicht zur Auffassung von Soldaten.
So lange ich denken konnte, war ich Pehmas Schülerin. Ich fragte mich nicht, ob ich jemals etwas anderes sein konnte, denn niemals würde ich ihre Perfektion in Selbstbeherrschung erreichen – sonst wäre ich nicht hier im Dienstzimmer des Hauptmannes, um Rede und Antwort zu stehen.
„Ein, äh ... Zwischenfall, wie es scheint. Meine Männer berichteten, sie hätte sie angegriffen.“
„Und?“ Pehma schaute mich an. „Hat sie es getan?“
Schweigend senkte ich den Blick. Der Fußboden war interessant – rissig und rau, Jahrhunderte alt.
„Sie redet nicht“, seufzte der Hauptmann.
Genau genommen hatte er mich noch gar nicht gefragt. Allerdings hätte ich tatsächlich nichts erklärt. Drei gegen einen. Das war nicht gut. Er würde mir nicht glauben.
Pehma trat zu mir. Ihre Stiefel tauchten vor mir auf. Sie berührte meine Wange, und ich biss die Zähne zusammen, als mich der Schmerz durchzuckte. Ich spürte deutlich die Schwellung von Cils Schlag.
„Ich kümmere mich darum.“ Pehma schob mich an der Schulter zu Tür.
„Was?“ Das war Cil. Seine Stimme klang seltsam kratzig. „Sie darf einfach so gehen? Sie hat die Soldaten des Herrschers angegriffen! Sie ... sie ist ein Dämon, das weiß jeder!“
„Halt die Klappe!“
Ich war überrascht. Der Neue funkelte Cil wütend an, der nun vor Fassungslosigkeit die Sprache verlor. Aber er war nicht dumm und presste die Lippen zusammen. Stumm nahm er Haltung an und starrte auf die Wand gegenüber. Der Neue schaute wieder zu mir, ehe er sich abwandte. Er wirkte schuldbewusst.
Konnte ich mir auch nichts von kaufen.
Energisch schob Pehma mich hinaus. Ich folgte ihr durch die Gänge, tiefer hinunter in die Feste.
„Willst du mir erzählen, was passiert ist?“
Es war mir unangenehm, und ich wollte diesen Vorfall lieber vergessen, als darüber zu reden, wie die Männer mich angesehen hatten.
„Also nicht“, interpretierte sie mein Schweigen. „Wie gerätst du nur immer in diese Schwierigkeiten?“
Eine rhetorische Frage. In der Regel fanden mich die Schwierigkeiten einfach.
„Warum hast du mit Gewalt geantwortet?“
„Weil sie mit Gewalt gefragt haben“, sagte ich so beherrscht ich konnte.
„Aber das ist nicht in jedem Fall die beste Lösung.“
„Es war die einzige.“
„Es gibt immer mehr als einen Ausweg. Das weißt du. Ich bin bestrebt, dir genau das beizubringen.“
Ja, mein Leben lang bereits. Meine Eltern waren tot. Das hatte man mir gesagt. Ich war im Dorf bei einer Amme aufgewachsen, die sich um Waisenkinder kümmert, und war dort eine von vielen gewesen. Ich erinnere mich kaum an diese Zeit – außer, dass man nie allein war. Aber bald schon hatte Pehma mich zu sich geholt, als es die ersten, hm ... Vorfälle gab. Auch daran entsann ich mich nur verschwommen. Einzelne Szenen, Kinder, die um mich standen und mich kniffen und boxten und Dinge riefen. Prügeleien, weil sie mich beleidigten und ärgerten, bis ich zuschlug und meist unterlag. Es waren so viele. Sie nannten mich verrückt.
Aber selbst wenn es mehr als einen Ausweg gab, wie Pehma lehrte – manchmal war er einfach verstellt von Männern mit Schwertern. Ich rechtfertigte mich nicht. Wer sich rechtfertigte, der hatte verloren.
Wir erreichten den Küchentrakt. Das Klappern von Geschirr drang zu uns und Stimmen. Es roch nach frischem Brot. Mein Magen knurrte. Eigentlich war ich hierher unterwegs gewesen, um mir etwas zu essen zu organisieren, ehe ich so unschön aufgehalten worden war. Wir stiegen die letzten drei Stufen hinunter und durchquerten die riesige Küche. Es war sehr warm, die Feuer im Herd und im Kamin brannten. Die Küchenmädchen eilten geschäftig herum, ein paar Arbeiter saßen an einem großen Tisch und aßen ihr Frühstück. Es wurde gescherzt und gelacht. Jeder nickte Pehma freundlich zu, und ich folgte ihr wie ein Schatten. Als wir an einer der Arbeitsplatten vorbeikamen, auf dem ein Teller mit Brötchen stand, nahm ich mir schnell eins und ließ es in einer meiner Taschen verschwinden.
Es war nicht verboten. Ich durfte mir jederzeit alles nehmen, was ich benötigte. Ich war Pehmas Schülerin, und als solche hatte ich meine Ruhe und viele Befugnisse. Aber ich wollte auch nicht fragen – oder bitten. Ihre Blicke waren dann immer so – vorsichtig oder mitleidig. Im schlimmsten Fall übertrieben freundlich, als wollten sie mich nicht reizen.
Zügig schritt Pehma vor mir aus der Küche hinaus. Als wir weiter durch die Gänge liefen, blieb ich hinter ihr und biss schnell von dem Brötchen ab. Hastig kaute ich und schlang das Stück hinunter.
„Wohin gehen wir?“, erkundigte ich mich.
„Ad Tanesh will mich sprechen.“
Ich erstickte fast an einem Krümel. „Der Herrscher?“, krächzte ich.
Pehma sah zu mir zurück und kurz auf das Brötchen in meiner Hand, dann hob sie fragend die Brauen. Ungeduldig verzog ich das Gesicht und ließ den angebissenen Rest wieder in meiner Tasche verschwinden. Hunger war primitiv. Es war ein niederer Instinkt, dem man sich nicht unterwerfen sollte – und so weiter ...
Ohne eine nähere Erklärung setzte sie ihren Weg fort. Pehma war immer so geheimnisvoll. Nichts von dem, was sie sagte, war klar und deutlich. Alles hatte mehrere Bedeutungen oder verbarg sich hinter Worten oder Schweigen.
„Was will er?“
„Er wird es mir mitteilen.“
Davon war auszugehen. „Dann warte ich oben?“
„Nein, du bleibst bei mir.“
Meine Schritte wurden ein wenig langsamer. Rasch schaute ich an mir hinunter. Schwarze Kleidung, eine praktische Hose aus festem Stoff mit Gürtel, weiche Stiefel aus Leder und ein weites Hemd. Meine üblichen Sachen – eher ungeeignet für eine Audienz beim Herrscher Ad Tanesh. Allerdings würde er mich vermutlich kaum bemerken. Es waren immer sehr viele Leute um ihn herum: Berater, Wachen und Bedienstete. Besucher und Gäste.
Er war ein Mann, der im Zentrum stand. Im Zentrum des Reiches der Suaver – und in seinem Leben. Alles andere um ihn herum war nicht wichtig. Dafür hatte er seine Berater. Wenn es etwas gab, das seiner Aufmerksamkeit bedurfte, dann wurde er direkt darauf hingewiesen. Er war gerecht und streng, aber mit Kleinigkeiten gab er sich nicht ab.
Ich strich mir eine Haarsträhne hinter das Ohr zurück, die mir sofort wieder ins Gesicht fiel, als ich mich noch immer kritisch musterte.
„Es ist unwichtig.“
Ich hob den Kopf.
Pehma war ebenfalls langsamer geworden und beobachtete mich. „Es wird ihn nicht interessieren, wie du aussiehst.“
Das war auch nicht anzunehmen. Es war mir ehrlich gesagt egal, was Ad Tanesh über mich dachte. Es ging ja gar nicht um ihn.
Ich nickte nur, und als wir weitergingen, strich ich mein Hemd glatt und befreite mich von den Brötchenkrümeln. Ein Kribbeln breitete sich in meinem Bauch aus, und meine Handflächen wurden ein wenig feucht. Ich atmete tief durch. Beherrsche die Situation und die Emotionen. Halte deinen Geist frei.
Die Nervosität blieb, aber ich war ziemlich sicher, dass man es mir nicht ansah.
Wir erreichten den Thronsaal. Er war gemacht, um zu beeindrucken. Ein riesiger steinerner Saal mit Verzierungen aus Holz an den Wänden und Säulen. Eine hölzerne Galerie lief oben einmal herum – erreichbar über weite Treppen an den jeweiligen Enden. Wandteppiche und Bilder hingen, wo immer Platz dafür war. Im Kamin brannte ein Feuer und mühte sich, die Kälte aus dem Fels zu vertreiben. Der Thronsaal gehörte zum ältesten Teil der Feste. Die Herrscher der Suaver hatten schon immer Wert daraufgelegt, ihre Macht hervorzuheben.
Ein langer Tisch stand in der Mitte, auf dem Karten und Papiere ein unübersichtliches Chaos bildeten. Ein Tablett mit Essensresten versteckte sich dazwischen. Neben Ad Tanesh war eine Offizierin anwesend. Sie machte einen mitgenommenen Eindruck, ihre Lederrüstung war dreckig, und ihre Kleidung mit Schweiß und Blut befleckt. Ich kannte sie. Jeder kannte die Offiziere, die die Soldaten des Herrschers befehligten und gemeinsam mit ihnen das Land beschützten. Sie waren Helden.
Ad Tanesh selbst machte einen nicht weniger müden Eindruck. Er war ein großer muskulöser Mann in der Mitte seiner Jahre. Aber sein Haar war zerzaust, und er hatte Ringe unter den Augen. Seine Bewegungen waren langsam und sein sonst so strenges Gesicht besorgt.
Als Pehma und ich eintraten, kam Owen auf uns zu. Der Berater des Herrschers war ein altersloser Mann, sehr schlank mit feingliedrigen Händen, die noch nie mit harter Arbeit in Berührung gekommen waren. Er hielt sich so aufrecht, als hätte er einen Besen verschluckt. Owen legte Wert auf Etikette, und sein leicht arroganter Blick schien immer etwas auszusetzen zu haben. Wenn er durch die Feste patrouillierte, dann nicht, ohne ständig ein Dienstmädchen zu scheuchen, hier und da etwas in Ordnung zu bringen. Es war, als würde die Eisfeste ihm gehören.
Owen nickte Pehma zu und hieß uns, mit einer Handbewegung näher zu treten. Als ich Pehma folgen wollte, stoppte er mich mit einer winzigen Geste. „Du wartest, Schülerin.“
Pehma schaute zu mir zurück und nickte kaum merklich. Also blieb ich im Hintergrund stehen. Owen wirkte zufrieden, und ich konnte eben noch ein Augenrollen unterdrücken. Mit auf dem Rücken verschränkten Händen schlenderte ich langsam ein Stück über weichen Teppich näher zum Kamin. Dabei sah ich mich schnell im Saal um. Sie war nicht hier. Die Spannung fiel von mir ab und doch traf mich ein kleiner Stich der Enttäuschung.
Ich spürte, dass Owen mich beobachtete. Einerseits folgte er dem Gespräch, andererseits bemühte er sich, mich nicht aus den Augen zu lassen. Es passte ihm nicht, dass ich anwesend war, aber er konnte nichts dagegen tun, wenn Pehma mich mitbrachte.
Beim Feuer blieb ich stehen und genoss die Wärme. Die Wände der Feste waren so dick, dass es zu jeder Jahreszeit kalt im Inneren war. Selbst im Hochsommer wurde es nach einer Weile ungemütlich.
„Es gab einen Vorfall an der Grenze zum Tor“, berichtete die Offizierin, was an sich nichts Ungewöhnliches war. Das Land der Todbringer grenzte an das der Suaver. Das führte seit Anbeginn zu Konflikten. Die Todbringer waren ein Volk, neben dem man nicht friedlich leben konnte. Es gab keine Zeit, in der es nicht zu Auseinandersetzungen gekommen war. Nicht eines der alten Lieder berichtete von einem gewaltlosen Beisammensein, aber wirklich ausnahmslos alle von den Schlachten der Helden, den Siegen über die Todbringer, von Tod und Verlust und der Hoffnung, dass es eines Tages vorbei sein würde. Es herrschte ein schwärender Krieg, der an den Grenzen geführt wurde und in dessen Mittelpunkt das Schicksalstor stand. Früher waren die Kämpfe blutiger gewesen. Die Herrscher der Suaver hatten mit all ihrem Ehrgeiz und jedem verfügbaren Schwert versucht, die Todbringer aus den Bergen zu vertreiben. Die Verluste an Leben waren auf beiden Seiten erheblich, und der Erfolg blieb aus. Irgendwann zogen sich die Suaver zurück, und seither gehörte das Tor und die Blutwüste, in der es stand, zu keinem Volk. Die Todbringer verehrten es allerdings auf ihre Art. Sie opferten ihm Leben und richteten arglose Lebewesen in grausamen Ritualen hin. Über zwei Jahrzehnte lang nahmen ihre Angriffe an der Grenze stetig zu. Seit Ad Tanesh verkündet hatte, dass es sein Bestreben sei, das Tor geschlossen zu halten, schien es, als wollten die Todbringer es mit ihren Opfern überreden, sich ihnen zu öffnen.
Das tat es natürlich nicht. Dennoch verschwanden Suaver, und die Gerüchte mehrten sich, dass sie von den Todbringern geopfert wurden und das, obwohl ihre Leichen nie auftauchten. Sie hatten auch einen Namen gefunden – Nascahl. Niemandem war klar, wen sie damit anbeteten. Die Suaver zogen sich zurück, fort von der düsteren Gegenwart des Tors, dessen Schatten viel weiter reichte, als er eigentlich dürfte.
„Sie haben die Soldaten an der Grenze angegriffen – ohne Vorwarnung. Es gab viele Tote ...“ Die Stimme der Frau war belegt. Eine Offizierin, die schon einiges gesehen hatte – die ihr Leben dem Kampf verschrieb und doch bedrückt wirkte. Etwas musste diesmal anders gewesen sein.
Pehma schwieg, und als niemand etwas sagte, fragte sie schließlich an Ad Tanesh gewandt: „Warum wolltest du mich sprechen, Herr?“
„Sie haben eine neue Waffe. Eine – magische Waffe.“ Das Zögern war kaum zu hören.
„Magisch?“
„Sie tötet mit einer unsichtbaren Kraft.“
Pehma schaute ihn an, dann auf die Karten. Ihre Stirn runzelte sich nachdenklich. „Und was kann ich da tun?“
„Wir hoffen, dass du weißt, was das für eine Waffe sein könnte.“
„Ich bin keine Magierin“, gab sie zu bedenken.
„Und doch vertraue ich darauf, dass du eine Antwort haben wirst.“ Seine Worte klangen nicht, als gäbe es eine Wahl. „Wir brechen sofort auf.“
Pehma starrte ihn an, hielt seinem Blick stand, als wäre er nicht der mächtigste Mann des Reiches – und dann nickte sie kaum merklich. Wäre es nicht unmöglich, hätte ich schwören können, dass Ad Tanesh erleichtert aufatmete.
„Pehma!“
Alle wandten sich um. Eine junge Frau hatte den Saal durch eine Seitentür betreten und kam auf den Tisch zu. Sie trug ebenfalls eine Uniform mit hohen Stiefeln und eine aus gehärtetem Leder gefertigte Rüstung um den Schwertarm bis hinauf zur Schulter. An einem breiten Gürtel hing ihr Schwert. Alles war neu und repräsentativ. Ihr langes Haar war zu einem Zopf geflochten, doch einzelne Strähnen hatten sich daraus gelöst. Im Gehen streifte sie die Handschuhe ab, und als sie Pehma erreichte, blieb sie stehen und verneigte sich höflich.
Es war kaum zu erkennen und nur, weil ich ganz genau darauf achtete, konnte ich es sehen – das unmerkliche Lächeln, das Pehmas Mundwinkel hob, als sie die Frau anschaute: Linnea, die Tochter des Herrschers, Hoffnung aller Suaver, war sie doch die Zukunft. Das Schicksal hatte Ad Tanesh seine Frau genommen, und nun war seine Tochter alles, was ihm geblieben war. Sie wuchs mit dem Wissen auf, eines Tages das Land zu regieren. Die Suaver verehrten sie, sie nannten sie Tochter der Sonne. Ihre Mutter war berühmt für ihre Schönheit gewesen, und für Linnea galt das ebenfalls. Sie hatte langes dunkles Haar, das ein schön geschnittenes Gesicht mit ernsten Augen umschloss, aber wenn sie lächelte, dann schmolz das ewige Eis von den Berghängen. Ad Tanesh hatte ihr gestattet, sich von Pehma im Kampf ausbilden zu lassen. Eine unkompliziertere Alternative, als sie mit den Soldaten zum Drill antreten zu lassen, was der Tochter des Herrschers nicht würdig gewesen wäre.
Linnea trug ein Schwert, und es hieß, sie konnte damit umgehen. Sie war Soldatin, soweit Ad Tanesh es zuließ. Ihr Leben war viel zu kostbar, als dass sie mehr unternehmen durfte, als gut bewacht einige Patrouillen zu reiten. Dennoch war sie ihrem Volk damit verbunden. Mehr zumindest, als wenn sie Wandteppiche stickend in der Feste die Zeit totschlagen würde – und so viele Wandteppiche, wie es hier gab, hatten etliche Generationen von Frauen ihr Leben damit verschwendet.
Langsam holte ich Luft. Ich hatte das Atmen vergessen, als Linnea unerwartet aufgetaucht war. Unauffällig betrachtete ich sie. Selten war ich ihr so nah wie jetzt. Die Zeit, als sie Unterricht bei Pehma genommen hatte, war schon lange vorbei. Einzelunterricht, natürlich, und es war immer eine Leibwache dabei gewesen. Pehma hatte diese Kontrolle missfallen, aber Ad Tanesh hatte darauf bestanden, und am Ende hatte sie sich gefügt.
In diesen Wochen und Monaten hatte Linnea regelmäßig bei uns trainiert, und ich hatte mich auf jeden dieser Tage gefreut. Ich glaube nicht, dass sie mich jemals zur Kenntnis genommen hatte. Ich war nur die, die den beiden etwas zu trinken brachte, wenn sie in der Sommerhitze in einem der Höfe ihre endlosen Schwertübungen abhielten. Und doch bedankte sie sich immer mit einem Lächeln, das mir die Knie weich werden ließ und mich nachts in meine Träume begleitete.
Zumeist verbarg ich mich irgendwo im Schatten und schaute ihnen zu. Stunden – und ich wurde es nicht müde. Aber irgendwann war der Unterricht vorbei. Pehma eröffnete ihr, sie könne ihr nicht mehr beibringen, wenn sie nicht mehr lernen wolle als den Kampf. Linnea war damit zufrieden, und so erschien sie nicht wieder.
Ich litt. Es war dumm und unlogisch, aber ich litt einsame Qualen, weil ich nicht mehr jeden Tag bei ihr sein konnte. Sie wusste nicht mal, wer ich war, und doch war mir das gleich. Es genügte mir, sie still zu verehren. Hätte sie mich angesprochen, wäre ich vermutlich an einem Herzstillstand gestorben. Aber sie nur noch von Weitem sehen zu dürfen, wenn es der grausame Zufall wollte, war auch niederschmetternd.
Ich konnte mit niemandem darüber reden. Es gab nur Pehma, und Gefühle waren ein Gebiet, mit dem ich ihr nicht zu kommen brauchte. Alles in ihrer Ausbildung drehte sich darum, seine Emotionen zu beherrschen und sich nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Wacklige Knie wegen eines Lächelns und unruhige Gedanken vor dem Einschlafen an eine Frau, die ungeschickterweise die Tochter des Herrschers war, fielen eindeutig in diesen Tabubereich. Es wurde besser, aber dennoch hoffte ich jeden Tag, sie zu treffen. Vielleicht würde sie irgendwann meinen Namen kennen. Vielleicht ...
Eher öffnete sich vermutlich das Schicksalstor.
„Was machst du hier?“, fragte Linnea, und ihre Stimme floss wie Samt durch den Raum.
„Das tut nichts zur Sache“, mischte sich Ad Tanesh ein, ehe Pehma Luft holen konnte.
Verwundert blickte die Meisterin ihn an. Er wirkte nervös.
Seine Tochter musterte ihn, und ihr Lächeln war fort. „Es geht um den letzten Überfall“, sagte sie, und auf sein missbilligendes Stirnrunzeln hin, zuckte sie ungehalten mit den Schultern. „Ich habe Ohren, Vater. Jeder redet davon.“
„Oh, nun ja ...“
„Ich komme mit euch.“
„Auf keinen Fall!“ Es war wohl genau das, was er befürchtet hatte. Abwehrend verschränkte er die Arme vor der Brust und übte sich in einem strengen Gesichtsausdruck, der unbeeindruckt von Linnea abprallte.
„Ich muss das sehen. Ich muss den Leuten dort helfen.“
„Nein!“
„Es ist mein Volk!“
„Noch bin ich der Herrscher der Suaver. Ich lasse nicht zu ...“
„Nimm sie mit“, unterbrach ihn Pehma, ohne die Stimme zu heben.
Ärgerlich funkelte er sie an. „Du weißt nicht, was du redest, Frau. Es ist viel zu gefährlich.“
Pehma nickte zustimmend. „Und doch hat sie recht. Es ist ihr Volk. Es wird helfen, wenn sie Anteil nimmt.“
„Der Anblick der Toten ...“
„Wird sie stärken“, fiel sie ihm erneut ins Wort. „Sie ist kein Kind mehr.“
Er rang mit sich. Er konnte es nicht verbergen, und als er schließlich abgehackt nickte, war es vermutlich das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte.
Warum Pehma eine solche Macht hatte, war mir völlig unklar, und doch war es so.
Pehma verneigte sich, als wäre es seine Entscheidung gewesen, und er verzog unwillig das Gesicht, schwieg aber. Sie wandte sich um, und ohne einen Blick ging sie an mir vorbei.
Ich schloss mich ihr an. Ein unsichtbarer Schatten.
2
Die Sonne hatte etwas Stechendes, wie sie durch ihre geschlossenen Augenlider drang bis direkt in ihr Hirn. Mit einem leisen Stöhnen versuchte sie, die Bettdecke über ihr Gesicht zu ziehen, aber der Stoff wollte nicht nachgeben. Was war passiert?
Sie hatten gestern gefeiert – spontan nach Dienstschluss. Henrys Beförderung. Es hatte diverse Lokalrunden gegeben, und dann war da diese Frau. Eine Bekannte von Henry, Streifenpolizistin, soweit sie sich erinnerte. Ihr Lächeln hatte sie verfolgt. Immer wenn sie hochgesehen hatte, war es da gewesen. Ein hübsches Gesicht, ein toller Körper in dieser Uniform.
Verdammt, war das hell!
Sie drehte den Kopf zur Seite und blinzelte mit einem Auge. Eine Blümchendecke, kleine Rosen, fremdes Muster. Kannte sie nicht. Sie schaute ein wenig höher. Ein Bild hing an der Wand, seltsame Kreise und Farben. Modern. Nicht ihr Geschmack.
Eine Ahnung beschlich sie, und mit ihr das ungute Gefühl, dass dieser Morgen kompliziert werden könnte – und sie hasste es kompliziert.
Neben ihr bewegte sich jemand. Sie schielte hinüber und entdeckte den Grund, warum die Bettdecke nicht nachgegeben hatte. Ein nackter Körper lag bäuchlings quer über den Blümchen. Sie nahm sich die Zeit und betrachtete die Frau. Wirklich hübsch, auch ohne Uniform. Zumindest ließ ihr Geschmack sie nicht im Stich, egal, wie betrunken sie war.
Ihr Blick verharrte in Höhe der weichen Brust, die seitlich von der sich bauschenden Decke nur halb verborgen wurde, und wanderte weiter, um bei dem wirklich ansprechenden Hintern zu verweilen. Sie erinnerte sich an diese Hüften. Sehr beweglich und – hungrig. Trotz der Kopfschmerzen verzog sie die Lippen zu einem Lächeln.
Wie war noch ihr Name?
Irgendwas mit N? Nadja?
Angestrengt runzelte sie die Stirn, aber es fiel ihr nichts ein. Mist!
Es wurde Zeit zu verschwinden.
Vorsichtig schob sie sich unter der Decke hervor und setzte sich auf. Der Schmerz in ihrem Kopf schwoll unangenehm an. Sie rieb sich mit beiden Händen die Schläfen und wartete, bis ihr Kreislauf akzeptierte, dass sie beschlossen hatte, aufrecht zu gehen. Möglichst leise begann sie ihre Kleidung einzusammeln. Es galt nur, die richtige Unterwäsche zu erwischen und die Socken ... Vielleicht im Wohnzimmer? Sie erinnerte sich verschwommen, dass sie schon im Flur begonnen hatten, aneinander rumzuspielen und den Stoff als lästiges Hindernis loszuwerden.
Barfuß tappte sie hinüber und hob alles auf, was ihr bekannt vorkam. Sie war immerhin schon bei der Jeans angekommen und streifte sich gerade ihr T-Shirt über, als sie das dumpfe Gefühl hatte, beobachtet zu werden.
Langsam strich sie den Stoff hinunter und drehte sich um. Die Frau stand an den Türrahmen gelehnt da, die Arme vor der Brust verschränkt. Ihr dunkles Haar war ein wenig durcheinander. Es schien sie nicht zu belasten, dass sie nackt war. Mit hochgezogenen Brauen musterte sie sie, und ein vielsagendes Lächeln kräuselte ihre Mundwinkel. Sie durchschaute sie bis auf den Grund der Seele. Wie sie so was hasste!
„Du gehst, Mack?“
Ah, sie wusste also ihren Namen. Na, das war jetzt weniger gut. Wie hieß sie nur? War es was mit R? Rona? Verdammt noch mal!
„Muss zum Dienst“, brummte Mack undeutlich und hob eine Socke auf. Wo war die zweite?
„Ja, ist klar.“ Der Spott war nicht zu überhören. „Noch einen Kaffee?“
„Glaub nicht.“ Suchend drehte sie sich um, aber das verflixte Ding war nirgends zu finden. Dann ging sie eben ohne. Hauptsache, sie kam hier weg, bevor es richtig unangenehm wurde.
„Suchst du die?“ Die Frau stand hinter ihr, und die Socke baumelte an ihrem Zeigefinger.
Verräter!
Schnell trat Mack zu ihr und wollte ihr das untreue Ding abnehmen, doch sie ließ nicht los. Verwundert schaute sie auf, und für einen Moment hielt sie dem Blick stand – ein fragender Blick, der nach Antworten suchte, der wissen wollte, ob das jetzt alles war oder noch mehr kam. Ob sie Möbel zusammen kaufen und eine Katze haben würden.
Resolut zupfte Mack ihr die Socke aus der Hand und wandte sich ab. Auf dem Weg zum Flur zog sie sich fertig an und schlüpfte in ihre Schuhe. Sie griff sich die Jacke, die auf dem Boden lag, und hatte die Klinke der Wohnungstür schon in der Hand, als sich ihre Erziehung meldete.
Zögernd drehte Mack sich um. Die Frau war ihr langsamer gefolgt. Noch immer hatte sie sich nicht bedeckt. Interessant. Es gab nicht viele Frauen, die derartig selbstsicher mit ihrer Nacktheit umgingen. Die meisten, die sie getroffen hatte, wickelten sich recht schnell in diverse Stoffbahnen, um sich zu schützen. Sie erinnerte sich, dass sie sich auch im Bett sehr selbstbewusst gegeben hatte.
Hm ... Mack versuchte ein Lächeln. „Tut mir leid.“
„Das muss es nicht. Es war ... nett.“
Nett? Nett! Sofort meldete sich ihr Ehrgeiz. Nett war die kleine Schwester von ... Eben noch rechtzeitig entdeckte sie das amüsierte Glänzen in den Augen ihres Gegenübers.
Ah, eine Herausforderung. Jetzt musste sie grinsen. Sie war gut, verdammt gut. Wenn sie nur ihren Namen wüsste. Sandra ...? Nein.
Plötzlich trat die Frau mit einem Schritt zu ihr, und ehe Mack sie abwehren konnte, was sie möglicherweise auch getan hätte, fand sie sie zu einem Kuss. Ihre Hand legte sich in ihren Nacken, damit sie nicht ausweichen konnte, und strich ihr dann sanft über den abrasierten Kopf – rasiert, bis auf die wenigen millimeterkurzen dunklen Stoppeln.
„Fühlt sich immer noch weich an“, raunte die Frau fasziniert an Macks Lippen. „Ich will dich nicht heiraten. Aber wenn du magst, dann ruf doch mal an, und wir könnten das hier wiederholen.“
„Ja, vielleicht ...“ Jetzt wusste sie es! „Janett.“
Sie schmunzelte verhalten und küsste sie noch einmal. „Es würde mich freuen.“