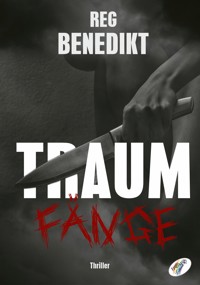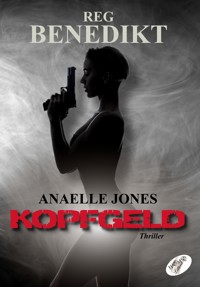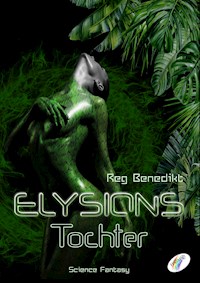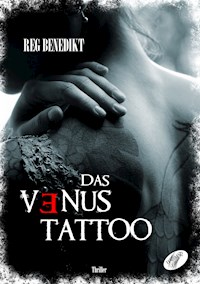5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Jägerin der Schatten
- Sprache: Deutsch
Als Sina auf die geheimnisvolle Eve trifft, ahnt sie nicht, in welcher Gefahr sie sich bald befinden wird. Denn Eve ist eine Jägerin, dazu auserwählt, all jene Geschöpfe in eine Parallelwelt zu schicken, die es sonst nur in Legenden und Märchen gibt. Eine Flut von Ereignissen wird in Gang gesetzt, die Sinas alltägliches Leben und alles, woran sie bisher geglaubt hat, auf den Kopf stellt. Als sie schließlich mit einer mächtigen Magierin verwechselt wird und ein uralter Dämon sie töten will, ist Eve die Einzige, die sie noch retten kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
REG BENEDIKT
Inhaltsverzeichnis
Jägerin der Schatten
Jägerin der Schatten: Die Magische Grenze
Impressum
Die Autorin
Jägerin der Schatten: Die Magische Grenze
Nur wenige kennen die Grenze zwischen den Welten ...
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Programm
Herbstsplitter
Lesbe auf Butterfahrt
Enge Bande
Das Leuchten des Almfeuers
Lesbian Summer Dreams
REG BENEDIKT
Fantasy
© Reg Benedikt, Jägerin der Schatten: Die Magische Grenze
© HOMO Littera Romy Leyendecker e. U.,
Am Rinnergrund 14, 8101 Gratkorn,
www.HOMOLittera.com
Email: [email protected]
Grafik und Gestaltung: Rofl Schek
Cover: © D-Keine – istock by GettyImages
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Handlung, Charaktere und Orte sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Die geschilderten Handlungen dieses E-Books sind fiktiv! Im realen Leben gilt verantwortungsbewusster Umgang miteinander und Safer Sex!
Originalausgabe: März 2019
ISBN PDF: 978-3-903238-35-0
ISBN EPUB: 978-3-903238-36-7
ISBN PRC: 978-3-903238-37-4
ISBN Print: 978-3-903238-34-3
Über die Autorin
Reg Benedikt, geboren 1973, ist eine deutsche Schriftstellerin, die mit Vorliebe Protagonistinnen erschafft, die nicht allzu zimperlich sein dürfen. Inspiriert wird sie von Actionfilmen, Fantasy-Epen und Science-Fiction-Schlachten. Auf dem Weg zur Arbeit führt sie oftmals Gedankendiskussionen mit ihren Heldinnen. Dabei ist die entscheidende Frage nicht, ob sich ihre Charaktere verlieben, sondern vielmehr wie und wann.
Reg Benedikt lebt mit ihrer Frau und diversen Fellnasen in der Nähe von Berlin.
Nur wenige kennen die Grenze zwischen den Welten und wissen, wie sie überwunden werden kann.
Und doch ist es möglich. Seit Anbeginn der Zeit.
Für jene, die zuhören, berichten die Legenden davon. Legenden von Einhörnern, von Elfen und Zwergen, von Trollen und Drachen, Hexen und Magiern.
Die Menschen haben diese Legenden aus der Vergangenheit weitererzählt. Ihren Kindern und Kindeskindern – und dabei wurden die Geschichten zu Märchen, und niemand erinnert sich mehr daran, ob sie wahr sind oder nicht.
Prolog
Sie stritten.
Schon wieder stritten sie. Sie konnte sie nicht verstehen und wollte es auch gar nicht.
Der Regen fiel in Strömen vom bleigrauen Himmel, klatschte prasselnd auf das Autodach. Die Scheibenwischer schafften es kaum, das Wasser von der Frontscheibe fernzuhalten. Die Stimmen redeten aufeinander ein und störten ihren Schlaf hinten auf dem Rücksitz. Der Regen war zu laut für die Worte, aber doch nicht laut genug für die Wut dahinter. Unwillig seufzte sie, wollte an dem Traum festhalten, den sie träumte, aber er wich zurück, zusammen mit dem Schlaf – wie ein scheues Tier, das auswich, wenn sie danach griff, immer weiter fort, je mehr sie sich anstrengte. Wie grelles Licht schnitten die Stimmen in ihre sanfte Welt, wurden lauter und schärfer.
Es war immer dasselbe – und immer ging es um nichts. Sie wollte es nicht hören und nicht hier sein.
Schlaftrunken setzte sie sich auf, leise, damit sie nicht merkten, dass sie wach war, und weiter ihre Illusion lebten, dass sie nicht mitbekam, wie sehr sie sich hassten. Ihre Eltern dachten noch immer, dass sie nichts hörte, nichts sah und im Glauben an ihre heile Welt lebte, obwohl sie nun schon siebzehn war. Sie hatte längst selbst erkannt, dass die Welt nicht aus Regenbögen und Einhörnern bestand.
Starr blickte sie durch die regennasse Scheibe des Wagens, hörte das Brummen des Motors, ein wenig zu hoch, zu viele Umdrehungen – zu schnell. Die Dämmerung und der Regen ertränkten die Welt. Wasser spritzte im Licht der Scheinwerfer von der Straße hoch. Die Sicht war miserabel, und dennoch rasten sie durch die Nacht.
Sie waren wütend. Stritten weiter. Wurden immer lauter in ihrer Rage, ohne noch länger Rücksicht zu nehmen, weil sie sie vergaßen.
So, wie sie sie immer vergaßen.
Sie wollte fort. So weit weg, wie es möglich war. Für eine Sekunde löste sich ihr Blick von der Straße. Sie sah hinunter und bemerkte, dass sie ihre Hände zu Fäusten geballte hatte. Es tat weh. Sie hob den Kopf – und erblickte gerade noch die Bremslichter des Lkw vor ihnen.
Vorne schrien beide auf. Er trat die Bremse durch. Der Wagen schleuderte auf der Fahrbahn, schlidderte durch Wasser und drehte sich um sich selbst. Die Welt verschwamm. Irgendwie schaffte sie es, nach rechts zu sehen, und das Heck des Lkw sprang auf sie zu. Sie hörte sich schreien, dann traf ein ungeheurer Schlag die Seite des Wagens. Blech zerriss mit einem ohrenbetäubenden Kreischen. Sie wurde herumgeworfen, schlug mit dem Kopf gegen etwas Hartes, und alles wurde schwarz um sie.
Ewigkeiten ...
Atemlos verharrte sie in der Dunkelheit.
Absolute Stille um sie.
Dann drangen gedämpfte Laute zu ihr. Sirenen heulten. Stimmen. Sie konnte nichts sehen. Aber sie konnte fühlen. Sie schmeckte Blut, das sich in ihrem Mund sammelte und sie ersticken wollte. Ihre gesamte rechte Seite war taub, und sie ahnte, dass das nicht gut war. Dann war da eine seltsame Wärme. Zuerst spürte sie es kaum, war sich nicht sicher. Aber die Wärme steigerte sich, wurde unangenehm heiß, nahm ihr zusätzlich die Luft zum Atmen. Schließlich wurde die Hitze unerträglich, brannte in ihrem Hals, versengte ihre Haut. Sie wollte den Kopf drehen, konnte sich aber nicht bewegen. Sie versuchte es mit den Armen und Beinen. Nichts. Sie spürte, dass ihr Körper reagierte, aber er stieß überall auf Widerstand. Ein eisenharter Griff umspannte sie.
Die Hitze steigerte sich.
Sie hörte Schreie und brauchte einige wenige rasende Herzschläge, um zu erkennen, dass sie es war, die da schrie. Sie erkannte ihre eigene Stimme nicht. Es klang schrecklich – wie die Schreie eines Tieres. Aber sie konnte nicht aufhören. Die Schmerzen trieben sie in den Wahnsinn, und die Angst zu ersticken, schlug über ihr zusammen. In Panik zerrte sie an ihren Fesseln und wehrte sich mit aller Kraft. Sie ignorierte die Qualen, die sich zu tobendem Feuer steigerten. Haut riss, etwas schnitt tief in ihr Fleisch, an tausend Stellen. Es war ihr egal. Sie war wie ein Tier! Ein Tier in der Falle, das um sein Leben kämpfte. Aber sie kam nicht frei. Rauch ließ sie würgen, sie erstickte, bekam keine Luft mehr. Sie schrie wieder, zornig, wütend – und in Todesangst ...
1
Die Nacht war nass und kalt. Vor einer Stunde hatte der Regen aufgehört. Pfützen hatten sich überall gesammelt, und der Asphalt glänzte tiefschwarz. Niemand, der nicht wirklich musste, ging vor die Tür – um diese Zeit schon gar nicht. Hier, in der verlassensten Ecke der Stadt, am Rande des Industriegebietes, gab es keine Menschenseele.
In der Stille klangen die Schritte unter mir daher umso lauter, hallten von den Mauern der Gebäude wider, als eine Gestalt durch die Straßen rannte. Immer wieder schaute sie sich um, ehe sie weitereilte. Hätte sie nach oben geblickt, hätte sie mich vermutlich gesehen. Lange schon war ich nicht mehr hinter ihr, sondern lauerte über ihr.
Ich bin die Jägerin. Der Grund, vor dem die Gestalt dort unten floh.
Aufmerksam verfolgte ich jeden Schritt. Fast unsichtbar verschmolz ich mit den Schatten. Meine Lederjacke hatte mich leidlich vor dem Regen geschützt, aber ansonsten war ich angemessen nass – wie alles, was sich länger als fünf Minuten draußen in der Nacht aufgehalten hatte. Es gab schönere Orte, als diesen hier, und mir lag viel daran, die Jagd zu beenden. Es war zu riskant, noch länger zu warten.
Die Gestalt unter mir tauchte in eine schmale Gasse zwischen zwei Häusern ein. Ich sank in die Hocke, auf ein Knie abgestützt, und blickte die senkrechte Wand hinunter, an Häuserwänden und Lagerhallen entlang. Ein Industriegebiet. Wenn es Wachleute gab, so scheuten sie das Wetter und saßen irgendwo im Warmen, Trockenen und sahen Spätfilme oder waren längst auf ihrem Bürostuhl eingeschlafen. Ich griff nach einer der eisernen Leitersprossen, die sich nach unten in der Dunkelheit verloren, stieß mich ab und kletterte die Stufen hinab. Das letzte Stück sprang ich hinunter und landete lautlos auf dem Asphalt. Kurz hielt ich inne und lauschte. Dann lief ich los.
Die Gasse führte zur nördlichen Grenze des Industriegebietes und endete an einer Zufahrt. Ich blieb stehen und wich in die Schatten der Häuser zurück. Kameras waren auf die Zufahrt gerichtet.
Hier konnte mein Weg nicht weitergehen, das würde mein Opfer nicht riskieren. Aber wo war es hin?
Ärgerlich presste ich die Lippen aufeinander. Ich drehte mich um und ging ein Stück zurück bis zu einer Ecke, dort folgte ich einer weiteren Seitengasse. Rechts und links ragten die Betonwände der Fabrikhallen in den düsteren Himmel hinauf. Vor mir war ein Tor. Pechschwarz gähnte es in die Nacht. Ich griff nach dem langen Messer, das mit einer Lederscheide an meinem Gürtel im Rücken unter der Jacke befestigt war, und zog es lautlos, bevor ich einen vorsichtigen Blick ins Innere warf.
Ich konnte gerade noch den Kopf einziehen, als eine Eisenstange ein Stück Beton aus dem Torrahmen sprengte, wo eben noch mein Gesicht gewesen war. Hastig wich ich zur Seite aus, duckte mich und stürmte in die Halle. Eine schemenhafte Gestalt bewegte sich so schnell in dem Zwielicht, dass sie nicht mehr blieb als ein Schatten.
Ich rannte hinterher, sprang und warf mich auf sie, brachte mein Opfer zu Fall.
Vom Schwung mitgerissen, schlidderten wir über den Hallenboden. Doch ehe ich wieder aufspringen konnte, erwischte mich ein Tritt und ich flog zur Seite. Schmerz raubte mir die Luft, das Messer glitt mir aus den Fingern. Ich rollte mich ab und kam auf die Füße.
Schnelle Schritte verklangen.
Dann Stille.
Ich war wieder allein.
Mit einem lautlosen Fluch sah ich mich um, fand das Messer und schob es zurück in die Scheide. Ich verließ die Halle, und nach kurzem Überlegen suchte ich mir den Weg zum Parkplatz. Er war von einem Drahtzaun umgeben. Hier war auch die Stirnseite der Fabrikhalle – und ein weiterer Ausgang. Kameras gab es nicht, dafür war der Zaun oben mit Stacheldraht bewährt und etwa drei Meter hoch – zu auffällig, um dort hinüberzuklettern. Es sei denn ... Suchend wanderte mein Blick an dem Zaun entlang, bis ich an einer Stelle eine Öffnung entdeckte, wo der Draht zurückgebogen war.
Mühsam zwängte ich mich durch die schmale Lücke und lief auf der anderen Seite einen Hang hinauf. Oben angekommen, befand ich mich auf einer größeren Straße des Vorortes, der sich an das riesige Industriegebiet anschloss. Auch hier war alles menschenleer.
Mein Opfer würde versuchen, so viel Abstand wie möglich zwischen uns zu bringen. Zu Fuß war das schwierig. Was also würde es tun?
Weit entfernt strahlte ein Schild freundlich in die trübe Nacht. Die U-Bahn. Das war die denkbar schlechteste Wendung dieser Jagd, aber die einzig logische.
Im Laufschritt rannte ich auf die Treppe zu, die unter die Erde führte, und folgte den Stufen nach unten. Die U-Bahnstrecke endete hier – auf dem Bahnhof war niemand zu sehen. Die Beleuchtung war alles andere als hell, nur jede zweite Lampe funktionierte überhaupt, und davon flackerten einige unentschlossen und warfen ihr zuckendes Licht über den Bahnsteig.
Langsam ging ich weiter, jeden Muskel angespannt. Vor mir bewegte sich etwas, und in einem Reflex zuckte meine Hand zum Griff des Messers. Ehe ich es zog, erkannte ich, dass es eine Passantin war, die auf die letzte U-Bahn in dieser Nacht wartete. Misstrauisch sah sie zu mir. Das war verständlich. Es war nicht erstrebenswert, lange hier unten allein zu bleiben, wenn man nicht sehr abenteuerlustig war.
Als ich vorbeiging, spürte ich ihre Blicke noch immer auf mir.
Leise und dumpf trug der Tunnel das Geräusch eines Zuges heran. Das Rauschen und Rattern wurde immer lauter, dann traf ein Luftzug den Bahnsteig und wirbelte Staub und Papier auf, als die U-Bahn einfuhr.
Die Wagen waren verlassen. Der Einzige, der mitfuhr, war der Zugführer, verborgen hinter getönten Scheiben.
Nur aus den Augenwinkeln sah ich eine schnelle Bewegung, als die Gestalt in die Bahn sprang. Ich lief los und hechtete ebenfalls in den Wagen. Im letzten Moment wich ich einem Schlag aus, der schon wieder auf meinen Kopf gerichtet war, duckte mich weg und glitt in den Gang des Waggons zurück. Ehe ich mein Gleichgewicht wieder hatte, traf mich ein Hieb und stieß mich gegen die Haltestangen. Mein Rücken prallte gegen Metall, ich stolperte und konnte mich gerade noch mit einer Hand festhalten und wieder hochziehen. Ein wirklich gut gezielter Tritt verfehlte mein Gesicht deswegen nur um Zentimeter. Ich nutzte den Schwung und trat dem Angreifer gegen das Standbein, sodass dieser schwer auf den Boden knallte. Sofort setzte ich nach, wälzte den Körper unter mir herum und stemmte ihm ein Knie auf die Brust. Die Gestalt wehrte sich mit allen Kräften, kam aber aus meinem Griff nicht heraus.
Allerdings war es nur eine Frage der Zeit, bis es ihr gelingen musste, denn sie war stark. Zornig fauchte sie mich an und entblößte spitze Reißzähne. Purpurfarbene Augen in einem blassen Gesicht verengten sich zu Schlitzen und starrten mich mordlüstern an. Ich zog mein Messer und setzte es an die Kehle des Wesens, das die Gegenwehr widerwillig aufgab und den Kopf beiseitedrehte, um der Klinge an seinem Hals zu entkommen.
Mit der freien Hand packte ich das Amulett, das das Wesen um den Hals trug, und sagte leise: „Es ist Zeit.“
„Messer fallen lassen!“, rief eine Stimme energisch.
Überrascht sah ich auf und in die Mündung einer Pistole. Die Frau vom Bahnsteig stand über uns. Sie wirkte keineswegs mehr ängstlich. Genau genommen schien sie sogar sehr entschlossen, und die Waffe in ihrer Hand zitterte nicht.
Von der Pistole blickte ich in ihr Gesicht. „Das hier geht dich nichts an.“
„Jetzt schon! Lass das Messer fallen, und gib sie frei!“
Es war mir nicht möglich, die Frau einzuschätzen, aber wenn jemand um diese Zeit hier unterwegs war, eine halb automatische Waffe mit sich führte und damit auf einen zielte, war es klüger, erst zu denken und dann zu handeln.
Gemächlich hob ich die Hände, ohne das Messer loszulassen, hielt es nur noch mit Daumen und Zeigefinger und stand auf. Die Pistole folgte jeder meiner Bewegungen. Ich sah, wie das Wesen nicht weniger erstaunt als ich die Situation erfasste. Binnen einer Sekunde war es auf den Beinen.
Die Frau hatte damit ganz offensichtlich nicht gerechnet.
Ich schon, aber in diesem Moment konnte ich es nicht verhindern, wenn ich nicht Gefahr laufen wollte, erschossen zu werden.
Ehe die Frau ihre Überraschung überwinden konnte, sprang das Wesen sie an, schlug ihren Arm mit der Waffe beiseite und stieß sie zwischen die Sitzreihen.
Gerade als sich die Türen schlossen, flüchtete die Gestalt wieder hinaus. Ich wollte hinterher, aber es war zu spät. Die Türen verriegelten sich, und ich konnte nur noch in das grinsende Gesicht mit den spitzen Zähnen sehen. Sie hob die Hand und winkte, als die Bahn anfuhr.
Wütend presste ich die Lippen zusammen und schob das Messer zurück in die Scheide.
Es würde also weitergehen.
„Verdammt ...“, stöhnte die Frau und rappelte sich vom Boden hoch. Sie hielt sich den Kopf. Offenbar war sie recht unsanft irgendwo angeeckt.
Ich konnte nicht sagen, dass es mir sehr leidtat. Erbarmungslos blieb ich stehen und sah zu, wie sie sich hochkämpfte, dann endlich leicht schwankend stand und sich an einem der Griffe aufrecht hielt. Ihre Pistole hatte sie fallen gelassen, zumindest waren ihre Hände leer. Wo die Waffe lag und wie erreichbar sie war, konnte ich nicht ausmachen – ein Umstand, der mich wachsam werden ließ.
Die Frau brauchte eine Weile, um zu erfassen, dass sie mit mir alleine war und durch den Sturz ihre Waffe verloren hatte. Eine lange Weile. Hätte ich es darauf angelegt, wäre sie nicht mehr in der Lage gewesen, irgendetwas zu unternehmen. Ihr Blick huschte bemüht unauffällig über den Fußboden auf der Suche nach der Pistole, aber scheinbar konnte sie sie auch nicht sehen, ohne sich auffällig zu benehmen. Sie war zu lesen wie ein Buch. Wäre die Nacht nicht so frustrierend gewesen, hätte es mich amüsiert.
Mit kaum unterdrückter Angst sah sie mich an, als ihr die Lage bewusst wurde, in der sie sich befand. Finster starrte ich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Ich hielt mühelos das Gleichgewicht, als die Bahn ruckelnd in den nächsten Bahnsteig einfuhr, während die Frau sich krampfhaft an ihren Griff klammerte und vermutlich gerade im Kopf die Möglichkeiten ihres baldigen Todes durchging. Da hätte es viele Varianten gegeben, aber ich war sicher, ihre Fantasie war grenzenlos, angestachelt von ihrer Angst.
Als die Bahn immer langsamer wurde, nahm ich die Arme runter und trat mit einem Schritt auf sie zu, sodass ich mein Gesicht ganz dicht vor ihrem hatte. Ich hielt ihren Blick fest und sah, wie sich ihre Pupillen weiteten. Ihr stockte der Atem. Einen winzigen Moment zögerte ich. Da war etwas ... ihre Augen kamen mir bekannt vor, aber ich konnte es nicht einordnen. Ein leichter Kopfschmerz lenkte mich ab, und ich verdrängte den Gedanken.
„Misch dich nie wieder in meine Angelegenheiten ein!“, flüsterte ich ihr zu. „Beim nächsten Mal hast du vielleicht nicht so viel Glück.“
Die Bahn hielt an. Ich drehte mich um und stieg aus.
***
„Mann, siehst du schlecht aus!“, begrüßte mich Geva, als ich die Bar betrat. Sie stand hinter dem Tresen und schenkte gerade eine Bestellung Bier aus.
Geva war eine große dunkelhäutige Frau mit schwarzem, sehr kurzem Haar, in das an der Seite ein kompliziertes Muster einrasiert war. Sie war ohne Frage eine Erscheinung – lange schlanke Gliedmaßen und ein fein geschnittenes Gesicht. Sie wirkte immer etwas distanziert und vorsichtig. Ich verglich sie gerne mit einer schwarzen Raubkatze, denn ihre Bewegungen und ihr ganzes Auftreten waren geschmeidig und leise, hatten etwas Kühles und Abwartendes.
„Danke, sehr nett“, brummte ich unwillig und zog mich auf einen der Barhocker.
Obwohl es spät in der Nacht war, war die Bar noch gut besucht – aber es war auch Samstagabend. Wäre es anders gewesen, dann hätte Geva dichtmachen können, allerdings betrieb sie die Bar nicht wegen des Geldes, sondern zu Studienzwecken. Das menschliche Gebaren im Allgemeinen und deren Schrullen im Besonderen – ein unendliches Feld.
Die Bar war ein kleines Szenelokal in einer angesagten Gegend. Ich war oft hier, was aber mehr an Geva lag als an der Bar. Mir gefiel das Publikum hier nicht besonders.
Musik spielte im Hintergrund. Die Bässe wummerten unterschwellig durch den Raum und mischten sich mit den Gesprächen der Gäste. Es war eine bunte Mischung wie jeden Abend. Jeder war willkommen, von Studenten bis hin zu aufgestylten Pärchen, die vor dem nächsten Event noch etwas trinken wollten, um die Zeit zu verkürzen.
Der Stammtisch im hinteren Bereich war voll besetzt, denn es war das monatliche Treffen der Motorradfrauen. Immer wieder kam von dort lautes Gelächter und Zwischenrufe. Vor dem Lokal parkten ihre schweren Maschinen, sie waren nicht zu übersehen.
Ich kannte sie – ein Zeichen, dass ich zu oft hier war. Sie waren okay, wenn sie ankamen, und etwas anstrengend, wenn sie getrunken hatten. Vor allem aber waren sie sehr von sich und ihren Flirtqualitäten überzeugt.
Einige trübe Gestalten hockten an der Bar, möglichst dicht am begehrten Alkohol. Es waren fast alles Stammgäste, Künstler oder Lebenskünstler. Das kam beides in etwa auf dasselbe raus. Beide Spezies hatten wenig Geld und investierten dieses in Alkohol, um ihr Dasein als verkannte Genies besser zu ertragen.
Ich kannte sie so gut, wie man einen Menschen kennen konnte, der regelmäßig hier saß und sich betrank. Manchmal redeten sie, und was sie zu sagen hatten, steckte voller Depressionen und verpasster Gelegenheiten.
Trash, die gute Seele, die Geva als Hilfe angestellt hatte, kam mit der nächsten Bestellung für den Stammtisch zu uns. Sie war kaum Mitte zwanzig, ein flippiges kleines Girlie mit strubbeliger Frisur, das immer aussah, als wäre es gerade erst aufgestanden. Es war allerdings zu erahnen, dass sie für diesen Eindruck lange Zeit vor dem Spiegel verbrachte. Sie warf mir einen Blick zu, ehe sie ein halbes Dutzend Bierflaschen auf ein Tablett stellte. „Was ist passiert? Du siehst echt scheiße aus.“
Ein lautloses Seufzen stahl sich über meine Lippen. „Nichts. Was soll passiert sein?“, gab ich unfreundlich zurück.
Trash – die eigentlich Natascha hieß, ihr Leben lang mit Tasha abgekürzt worden war und sich nun Trash nannte, weil es cool war und beim Erobern von potenziellen Bettgefährten immer gut ankam, da man gleich ein Gesprächsthema hatte – runzelte die Stirn, musterte mich noch einmal kurz und machte sich dann mit einem Schulterzucken auf den Weg zurück zum Stammtisch, wo sie mit großem Hallo begrüßt wurde. Oder das Bier, wie man es nimmt.
„Hey, Eve! Alles klar?“, begrüßten mich einige Frauen lautstark quer durch den Raum, als sie mich entdeckten. Einige Gäste schauten verdrießlich aufgrund der Störung.
„Sicher“, antwortete ich. Die Stimmung war schon recht feucht-fröhlich und locker. Ein bisschen zu locker.
„Eve! Wenn du dich einsam fühlst, dann komm doch nachher bei mir vorbei, Schatz!“, rief eine der Frauen und lachte laut. Sie umklammerte ihre Bierflasche wie einen Rettungsring.
Ich kannte sie vom Sehen. Es war wohl auch nicht ihr erstes Bier. Keine Ahnung, wie lange sie gebraucht hatte, sich den Mut für diesen Spruch anzutrinken.
Ich begegnete den frivolen Blicken und verzog dann die Lippen zu einem kalten Lächeln. „Ich überleg es mir, wenn ich jemals so einsam sein sollte!“, entgegnete ich mit einer Stimme, die keinen Zweifel daran ließ, dass ich niemals so einsam sein würde.
Die Frau lachte und prostete mir zu. Eine Freundin neben ihr schlug ihr feixend auf den Rücken.
Ich nickte ihnen zu und wandte mich wieder um. Mein Lächeln erlosch im selben Moment. Geva grinste mich an.
„Was?“, fragte ich bissig.
„Immerhin eine Option“, spottete sie freundlich.
„Ja, klar. Eher friert die Hölle zu!“
Geva lachte nur. Dann sah sie mich aufmerksam an. „Hattest du Erfolg?“
Ich schüttelte den Kopf, und Geva runzelte die Stirn. Ehe sie fragen konnte, sagte ich: „Es gab ein Problem. Ich musste die Jagd abbrechen.“
Wieder musste ich an die Augen der fremden Frau denken. Irgendetwas stießen sie in meinem Kopf an – und dann war da wieder dieser leichte Kopfschmerz.
Ich rieb über meine Schläfe. Es war eine lange Nacht gewesen.
„Alles in Ordnung?“
„Ich weiß nicht ...“ Ich blickte Geva an, aber aus irgendeinem Grund zögerte ich, ihr von der seltsamen Begegnung zu erzählen.
Geva war meine beste Freundin, genau genommen, war sie alles, was ich hatte. Wir kannten uns schon viele Jahre, und doch hielt mich etwas zurück.
Mein Schweigen war ihr Antwort genug. „Was ist passiert?“
„Eine Fremde war da.“
„Ja, und?“
„Sie war bewaffnet. Hat mit einer Pistole auf uns gezielt.“ Ich zuckte mit den Schultern. „Sie kam mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wo ich sie einsortieren soll.“
Geva hob die Brauen. „Bekannt? Wie meinst du das?“
Tja, wie meinte ich das? Ich wusste es selbst nicht.
Meine Kopfschmerzen wurden schlimmer. Unwillig rieb ich mir über die Augen und stieg von dem Hocker.
„Ich bin müde“, beendete ich die Fragerei. „Hast du hinten trockene Sachen für mich?“
Geva nickte. „Du weißt ja, wo alles ist.“
Sie wirkte nachdenklich, als ich sie hinter der Bar stehen ließ.
Vor den Toiletten zweigte noch eine Tür ab mit der Aufschrift Büro. Dort gab es einen Schreibtisch mit Bürostuhl, eine große Ledercouch und ein Regal mit allerhand Papierkram und Ordnern. Dann noch einen Schrank, in dem immer Kleidung zum Wechseln hing.
Ich legte das Messer auf den Schreibtisch und tauschte meine nassen Sachen gegen eine saubere Jeans und ein weites Hemd, das eher Geva gepasst hätte, die ein wenig größer war als ich. Ich blieb barfuß und ließ mich auf die Couch fallen. Mit einem Seufzen schloss ich die Augen.
Als ich sie wieder aufschlug, war es dunkel um mich herum. Eine absolute Dunkelheit, die mich verwirrte. Normalerweise leuchtete immer irgendwo etwas, ein elektrisches Gerät im Stand-by, die Straßenbeleuchtung vor dem Fenster. Irgendwas.
Wie viel Zeit war vergangen? War ich eingeschlafen?
Ich blinzelte, aber die totale Schwärze blieb und war so dicht, dass ich das Gefühl hatte, sie würde in mich kriechen, durch meine Nase und meinen Mund, und drohte mich zu ersticken. Ich atmete schwerer und versuchte, mich selbst zu beruhigen.
Ich wollte mich aufsetzen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Meine Arme waren wie gelähmt. Da war kein Widerstand, dennoch konnte ich meine Hände nicht fühlen. Als wären sie nicht da.
Panik kroch in mir hoch und legte sich wie ein eisernes Band um meine Brust, schnürte mir die Luft ab. Mein Herz schlug hart gegen die Rippen. Dann fühlte ich die Wärme auf meiner Haut, auf meinem Gesicht.
Ich erstarrte.
Ein Wimmern erklang. Es dauerte, bis ich merkte, dass das Geräusch aus meiner Kehle kam.
Die Wärme steigerte sich, wurde zu Hitze, und das Wissen um das, was kommen würde, erstickte meine Laute. Ich wollte mich wehren und weglaufen, aber noch immer hatte ich keine Kontrolle über meinen Körper.
Die Hitze brannte auf meiner Haut. Plötzlich hörte ich Glas splittern, und mit berstendem Lärm riss Metall. Feuer brannte auf mir, etwas Scharfes, Gezacktes riss mein Gesicht auf. Eine Welle aus Schmerz schlug über mir zusammen. Ich schrie auf und fuhr hoch.
Licht blendete mich. Die Hitze verschwand schlagartig, keuchend rang ich nach Luft. Ich lag noch immer auf der Couch. Es schien nicht viel Zeit vergangen zu sein. Ich zitterte am ganzen Körper. Mein Kopf dröhnte vor Schmerzen, als würde jemand in mir mit einem Presslufthammer Tango tanzen. Mühsam erhob ich mich, ging in das angrenzende kleine Bad, das nur durch das Büro zu erreichen war, und zog das Hemd aus. Ich drehte am Waschbecken das kalte Wasser auf und hielt minutenlang meinen Kopf darunter.
Erst als der Schmerz nachließ, griff ich mir ein Handtuch und trocknete mich ab. Bedächtig senkte ich die Hände und blickte lange in den Spiegel, etwas, was ich nicht oft tat.
Es war einmal mein Gesicht gewesen, jetzt gehörte es einer Fremden. Beinahe hätte man dieses Gesicht als gut aussehend beschreiben können. Beinahe ...
Ich drehte den Kopf nach links. Narben schnitten sich durch die Haut, reichten von der Schläfe bis hinunter zum Kinn und zerstörten, was einmal ich gewesen war. Die Male setzten sich über meinen Körper fort, über die Schulter und einen Teil des Rückens und weiter unten über den Oberschenkel. Narben wechselten sich mit Haut ab, verspotteten mich mit ihrem Kontrast zu gesunder Haut.
Meine Augen fanden im Spiegel die Tätowierung der wütenden Schlange, die sich über meinen Rücken wand, meinen Nacken umschlang und mit glühenden Augen von meiner Schulter hinauf zu meinem Gesicht im Spiegel starrte. Sie kauerte dort, bereit zum Sprung, bereit, die Dämonen zu vertreiben, die mich quälen wollten. Bereit zu kämpfen ...
So wie ich gekämpft hatte, um bis hierherzukommen, und nicht dem leisen Flüstern zu folgen, das mich hinunter in den Abgrund ziehen wollte – dem nachzugeben manchmal nur zu einfach wäre.
Abwesend strich ich mit dem Daumen der rechten Hand über die schwache Narbe an meinem linken Handgelenk.
Das Verrückte war, für viele Frauen, zum Beispiel auch für etliche der Motorradfrauen am Stammtisch der Bar, entsprach ich irgendwie dem Bild der einsamen Kämpferin. Was auch immer. Ich hatte es noch nicht herausgefunden. Aber ich wusste, dass sie mich ansahen und träumten. Dass sie sich Mut antranken und mit flapsigen Anmachsprüchen meine Aufmerksamkeit suchten.
Aber wofür? Ich war kein Traum. Ich war Realität.
Eine seltsame Realität.
Sie hatten ja keine Ahnung.
Ich war eine Jägerin. Man hatte mich dazu gemacht. Ich war gestorben und hatte die Grenze überschritten. Etwas, was nur wenigen Menschen widerfuhr – und nur wenige kehrten zurück.
Ich war eine davon.
Ein kaum hörbares Rascheln ließ mich erstarren, und die seltsamen Gedanken verflogen sofort. Das Geräusch kam aus dem Büro. Ohne zu zögern, wich ich hinter die Tür zurück und spähte in den Raum nebenan. Es war nichts zu sehen, aber ich konnte auch nicht alles überblicken. Mein Messer lag auf dem Schreibtisch, ich hätte durch das ganze Büro gemusst, um es zu erreichen.
Es war nichts mehr zu hören.
Hatte ich mich geirrt? Ich war mir nicht sicher – und sich nicht sicher sein, konnte schnell in einer Katastrophe enden.
Oder sah und hörte ich schon Gespenster? Vielleicht hatte der Traum mich zu sehr mitgenommen. Ich hatte ihn lange nicht mehr geträumt und hätte auch gern darauf verzichtet.
Ich machte einen Satz in das Büro an den Schreibtisch, duckte mich weg und griff mir das Messer.
Nichts passierte.
Natürlich nicht. Das war ja albern. Ich atmete auf und drehte mich um.
Ein unglaublich harter Schlag traf seitlich meinen Kopf. Licht explodierte hinter meinen Augen, der Boden sprang auf mich zu. Ich wollte mich abfangen, war aber nicht schnell genug und knallte auf die Dielen. Benommen versuchte ich mich hochzustemmen, da traf mich etwas in die Seite. Haltlos fiel ich zurück und krümmte mich vor Schmerz zusammen. Aus den Augenwinkeln sah ich verschwommen ein Paar Stiefel vor mir. Einer davon holte aus, um mich noch mal zu treten. Ich sah ihn auf mich zufliegen und spannte mich in Erwartung des Schmerzes. Der Tritt presste mir die Luft aus dem Körper, und ich stöhnte unterdrückt auf. Gleichzeitig griff ich zu und hielt den Stiefel samt darin steckendem Bein fest. Mit aller Kraft verdrehte ich das Bein und hörte einen erschrockenen Schrei, als ich meinen Gegner aus dem Gleichgewicht hebelte und zu Fall brachte. Polternd krachte ein Körper neben mir auf den Boden. Ich stürzte mich auf den Angreifer und rammte ihm den Ellenbogen auf Höhe der Nieren in den Rücken. Mit einem dumpfen Keuchen brach er zusammen, und ich drehte ihn gewaltsam herum.
Fassungslos ließ ich meinen Gegner wieder los und rutschte auf dem Boden in sichere Entfernung. Ich blickte mich um und griff mir mein Messer, das auf dem Boden gelandet war, aber ich hob es nicht auf. Verwirrt blieb ich, wo ich war, und starrte mein Gegenüber an.
Sie war etwas größer als ich, sehr schlank, mit langen Gliedmaßen, obwohl man das unter der lockeren Kleidung, die viel verbarg, nicht gut erkennen konnte. Die Haut war sehr hell und ihr Gesicht schmal und absolut perfekt geschnitten. Sie war schön – aber das waren sie alle. Volle Lippen und purpurfarbene Augen, die nicht von dieser Welt waren. Dass die Ohren spitz zuliefen, konnte man wegen der langen, schwarzen Haare nicht sehen. Männer und Frauen waren kaum zu unterscheiden, aber es fiel mir nicht schwer, sie als Frau zu erkennen – dazu war ich schon zu lange hinter ihr her.
„Was willst du hier?“, flüsterte ich erschüttert.
Der Schmerz von den Schlägen rollte noch dumpf durch meinen Körper. Etwas Warmes sickerte mir über die Schläfe. Ich blutete aus einer Platzwunde, vom Schlag oder vom Sturz danach.
Hier lief alles falsch.
Misstrauisch sah die Elbin mich an. Dass ich noch lebte, obwohl sie es geschafft hatte, mich zu überraschen, war mehr als nur seltsam. Elben sind übermenschlich stark, auch wenn man es ihren schlanken Körpern nicht ansieht. Sie hätte mich mit dem ersten Schlag bereits töten können.
Nachlässig wischte ich mir das Blut von der Wange. Nun ja, viel gefehlt hat ja nicht. Es kam nicht oft vor, dass mir die Geschöpfe hinterherrannten. Die Elbin hätte schon weit weg sein können, nicht in Sicherheit, denn ich würde nie aufhören, sie zu jagen, und das wusste sie, aber sie hätte einen guten Vorsprung gehabt.
Und nun war sie hier.
„Warum?“ Ich merkte erst, dass ich laut gesprochen hatte, als ich meine eigene Stimme hörte.
„Ich muss mit dir reden“, sagte sie vorsichtig. „Es ist wichtig.“
Ihre Augen fanden die meinen, und ein Kribbeln lief mir über den Rücken, so intensiv war ihr Blick. Ja, es musste wichtig sein, sonst wäre sie dieses Risiko niemals eingegangen.
„Du hättest anklopfen können, statt mir den Schädel einzuschlagen.“
„Du hättest mir nicht zugehört“, stellte sie fest, und ich gab ihr im Stillen recht.
Ihr Blick wich ab und wanderte über meinen Körper. Ich gab der Versuchung nicht nach, ihren Augen zu folgen. Ich wusste auch so, was sie sah. Es war mir egal, dass ich halb nackt war, mein Körper war mir noch nie wichtig gewesen. Ich hatte gelernt, ihm keine Bedeutung beizumessen. Den Narben nicht, und all dem nicht, für das sie standen und wie sie mein Leben verändert hatten. Ich hatte irgendwann aufgehört, meinen Körper zu hassen. Das war alles. Er war mein Werkzeug, und er musste funktionieren. Weiter nichts.
Kaum merklich verzogen sich die Lippen der Elbin zu einem Lächeln. „Ich habe schon viel von dir gehört“, bemerkte sie, und ihre Stimme klang ein wenig anzüglich.
Oder bildete ich mir das ein?
Als ich nicht antwortete, vertiefte sich ihr Lächeln. „Die Geschichten, die man sich im Alten Reich über dich erzählt, werden dir nicht gerecht, Jägerin. Du bist eine starke Frau und ein würdiger Gegner.“
„Was willst du?“
Sie nickte und wurde ernst. Ruhig stand sie auf und ließ mich dabei nicht aus den Augen. Ich tat es ihr gleich und kam auf die Füße. Die Welt schwankte etwas, aber ich ließ es mir nicht anmerken. Den Schmerz blendete ich aus.
Wir standen voreinander, jede bereit zu kämpfen. Die Situation war angespannt, und ich war mir nicht sicher, wie sie enden würde.
„Es passieren Dinge auf der anderen Seite, von denen du wissen musst.“ Sie suchte in meinem Gesicht nach etwas.
Verstehen?
Ich reagierte nicht, blieb ausdruckslos. Wollte ich wissen, was sie mir zu sagen hatte?
Es ging mich nichts an. Es war nicht meine Welt.
„Es kommen Wesen hierher, die ebenfalls auf der Jagd sind. So wie du.“ Es lag keinerlei Vorwurf in ihrer Stimme. „Sie suchen die Magierin. In deiner Welt, Jägerin.“
Ihren Worten zu folgen, war nicht schwer, aber ich verstand sie nicht.
„Hier?“ Mein Kopf hörte nicht auf zu schmerzen. Das Denken fiel mir immer schwerer, und ich fragte mich, warum ich ihr noch zuhörte.
Sie nickte. „Man hat mich geschickt, um dich zu warnen. Sie ist in großer Gefahr. Ihre Macht ist wertvoll. Sie darf nicht sterben. Aber wenn sie hier ist, dann ist sie schutzlos.“
Ihre Worte dröhnten in meinem Kopf. Der Schlag muss doch stärker gewesen sein, als ich gedacht hatte.
„Und warum ist sie dann hier?“, brachte ich mühsam hervor.
„Sie sucht nach einem Weg. Einen Weg zu überleben.“
Der Schmerz schwoll an. „Dann sollte sie nicht hierherkommen, wenn es so gefährlich ist“, murmelte ich mühsam.
Was war nur los? Ich merkte, wie eine unheilvolle Schwärze in meinem Kopf lauerte und begann, sich auszubreiten.
Ich kam nicht dagegen an. Meine Beine gaben plötzlich nach. Ich erwartete den Aufprall, aber da fingen mich starke Arme auf, und das Gesicht der Elbin war direkt über mir. Ein kurzer Adrenalinstoß brachte mich dazu, mich zu wehren, und ich versuchte, mich aus ihrem Griff zu befreien, aber sie ließ mich nicht los, und die Dunkelheit griff mit langen Fingern nach meinem Bewusstsein.
„Hilf ihr“, hörte ich sie ganz dicht bei mir flüstern. Kühle Finger strichen über meine Stirn. Mühsam zwang ich meine Augen auf und sah in ihr Gesicht. „Du bist eine Jägerin. Finde die Magierin und beschütze sie, sonst ist sie verloren.“
„Das kann ich nicht“, stieß ich hervor.
„Doch. Nur du und keine andere. Das Schicksal will es so. Der erste Schritt ist bereits getan. Es gibt kein Zurück mehr.“
2
Was für eine Nacht.
Zuerst wartete sie eine halbe Stunde vergeblich auf ihre Verabredung in einem wirklich schicken Italienischen Restaurant, was an sich schon den Abend ruiniert hatte – nicht das Restaurant, sondern die leidige Tatsache, dass sie im wahrsten Sinne wie bestellt und nicht abgeholt herumgesessen hatte, den mitleidigen Blicken der Kellner ausgesetzt. Und schließlich wurde sie auf dem Weg durch die halbe Stadt vom Regen überrascht, der sie völlig durchweichte, weil sie ihren Schirm vergessen hatte, und dann – das!
Sina war sich noch immer nicht sicher, ob sie nicht alles nur geträumt hatte. Allerdings brauchte sie sich nur zaghaft zu bewegen, und ein stechender Schmerz im Nacken und in Höhe der Rippen erinnerte sie daran, dass man von Träumen in der Regel nicht solche Blessuren zurückbehielt.
Alles war so unglaublich schnell gegangen. Im Nachhinein verfluchte sie sich immer noch für ihre naive Dummheit, sich in eine Straßenschlägerei, oder was immer das gewesen war, eingemischt zu haben.
Was hatte sie bezwecken wollen? Wollte sie die zwei Freaks der Polizei übergeben? Sicher hätten die beiden gerne gewartet, bis sich die Herrschaften der nächsten Polizeidienststelle herbequemt hätten. Bestimmt wären sie auch so liebenswürdig gewesen, sie auf das Revier zu begleiten, wenn es gar nicht anders gegangen wäre.
So ein Wahnsinn! Sie konnte froh sein, dass die Frau sie nicht abgestochen hatte mit ihrem riesigen Messer – und die andere sie nur geschubst und nicht gleich niedergeschlagen hatte, obwohl ihr das schon reichte.
Mit gerunzelter Stirn massierte Sina sich behutsam den Nacken. Womöglich hätte sie ihr die Nase oder den Kiefer gebrochen – oder gleich das Genick, wenn sie schon dabei war.
Ihre Pistole hatte sie unter den U-Bahnsitzen wiedergefunden. Erstaunlich, wie nutzlos so eine Waffe war, wenn man nicht bereit war, sie einzusetzen. Dabei handelte es sich nur um eine Schreckschusspistole, und dennoch hatte sie nicht abgedrückt.
Jetzt saß sie hier im Krankenhaus in ihrem Büro, in ihrem Luxusledersessel, nach hinten weggekippt, die Füße auf dem Schreibtisch und wartete, dass das Schmerzmittel anfing zu wirken, das Maren, ihre Freundin und Nachtschwester vom Dienst, ihr netterweise gegeben hatte. Natürlich hatte sie gefragt, was passiert war. Also hatte sie ihr von dem Überfall erzählt. Marens Reaktion war ihren Gedanken nicht unähnlich.
„In so was mischt man sich nicht ein“, hatte sie aufgebracht gesagt. „Du hättest einfach die Polizei rufen sollen. Hast du eine Vorstellung, was hätte passieren können?“
Eine rhetorische Frage, auf die Sina nicht antwortete. Bisher war sie noch nicht bei der Polizei gewesen. Ihr Weg hatte sie direkt ins Krankenhaus geführt, wo sie in der Verwaltung arbeitete. Gebrochen hatte sie sich nichts, darauf war sie selbst gekommen, aber es war hilfreich, etwas gegen die Schmerzen zu nehmen, ehe sie nach Hause fuhr. Und das Krankenhaus lag auf dem Weg ...
Vielleicht, aber nur ganz vielleicht wollte sie auch nicht alleine zu Hause sein. Das gestand sie sich nicht gerne ein, aber es lauerte eine leise Angst in ihr. Möglicherweise stand sie auch unter Schock, aber damit würde sie alleine klarkommen. Wenn sie etwas in diese Richtung andeutete, würde Maren sie umkreisen wie eine besorgte Henne, und dafür hatte sie gerade keinen Nerv.
Ihre Bürotür stand einen Spalt offen. Maren hatte darauf bestanden, damit sie sie rufen hören konnte, falls ihr doch noch schlecht wurde oder Ähnliches. Ob sie sie allerdings gehört hätte, war fraglich.
Es war einiges los. Am Wochenende, speziell Samstagnacht, gab es meistens mehr zu tun in der Notaufnahme. Die Schwestern eilten hin und her, das Telefon klingelte fast pausenlos, und Leute kamen und gingen.
Es war gut, dass sie das nichts anging. Zum einen hatte sie Urlaub, zum anderen war sie nicht mehr für die Notaufnahme zuständig. Diese Zeiten hatte sie hinter sich. Eigentlich wäre sie Ärztin, aber ihr Weg hatte sie in eine gänzlich andere Richtung geführt, und nun war sie in der Verwaltung des Krankenhauses tätig und unterstützte das Management. Patienten sah sie nur noch im Vorbeigehen.
Sina war sich nicht sicher, ob ihr dieser Weg gefiel und wo er sie hinführte. Aber es war ein Job, von dem sie gut leben konnte, wenn er sie auch nicht erfüllte oder befriedigte. Sie vermied es allerdings auch, allzu viel darüber nachzudenken.
„Sina!“
Das klang mehr als ungeduldig.
Sina hob den Kopf und blickte zur Tür. Maren stand dort und hatte sie offenbar schon einmal angesprochen. Sie wirkte gestresst.
„Ja! Ich sitze doch hier.“
„Aber du antwortest nicht.“
„Wie war die Frage noch mal?“
Ein ungeduldiges Rollen mit den Augen Richtung Decke folgte. „Ich habe gefragt, ob es dir besser geht.“
„Wenn du nicht so rumbrüllst, geht es eigentlich.“
Maren schnaubte und verschwand wieder.
Es war ein furchtbarer Tag gewesen, der noch furchtbarer geendet hatte. Ihr ganzes Leben lag in Trümmern.
Mit einem leisen Stöhnen legte sie den Unterarm über die Augen und rutschte in dem Sessel ein Stück tiefer. So gesehen, passte der Zustand zum Gesamtbild.
Es war nur eine Affäre gewesen. Sie hatte es gewusst.
Ja, doch. Natürlich. Aber ... Aber – verdammt, musste dieses verfluchte Miststück mit einer anderen ins Bett, ehe das mit ihr zu beenden?
Sie war so dämlich, so selten dämlich!
Sie hatte Kirsten vor zwei Monaten kennengelernt. Genau genommen hatte Kirsten sie abgeschleppt. Ein treffenderes Wort gab es im Nachhinein nicht. Kirsten hatte sich einfach in diesem niedlichen kleinen Café – in das sie niemals wieder und auf keinen Fall mehr gehen würde – zu ihr an den Tisch gesetzt. Begeistert war sie nicht gewesen, und sie hatte sich auch kühl und abweisend gezeigt, aber das hatte Kirsten nicht wirklich interessiert.
Wie alles passiert war, konnte sie nicht genau sagen. Irgendwann hatte sie gemerkt, dass sie fast gegen ihren Willen ein Gespräch mit Kirsten führte. Kirsten lud sie auf einen Kaffee ein und später am Nachmittag auf einen Wein – und sie ließ es sich gefallen. Das war fast noch unglaublicher als der Rest. Es war lange her, dass man sie so umworben hatte, sie eingeladen und mit feinsinnigen Komplimenten bedacht hatte.
Hatte sie wirklich so schöne Haut und leuchtende Augen?
In diesem Café hatte sie es geglaubt.
Kirsten war groß und schlank. Ihr Haar hing ihr in lässigen Strähnen in die Augen. Immer wieder strich sie es sich mit einer Hand zurück, eine Geste, die sie faszinierte. Es wirkte entspannt und souverän. Überhaupt strahlte sie eine Selbstsicherheit aus, die sie gefangen nahm und um die sie sie beneidete. Da war kein Zweifel erkennbar. Ihr Lächeln galt nur ihr. Und wie sie ihr in die Augen sah! Nicht flüchtig oder achtlos, sondern sehr intensiv. Fast war es schon unverschämt aufdringlich.
Aber nur fast. Es machte deutlich, wie interessiert Kirsten war, die sich nach einer ganzen Weile, in der sie sie eigentlich loswerden wollte, es aber aus irgendeinem Grund doch nicht tat, vorstellte und ihr mit einem schiefen Lächeln die Hand über den Tisch entgegenstreckte. Es war diese letzte Gelegenheit, wo sie noch einmal hätte entscheiden können ...
Und sie entschied sich und legte ihre Hand in die von Kirsten. Über sich selbst erstaunt, nahm sie noch zur Kenntnis, was sie tat, da schlossen sich schon warme kräftige Finger um ihre Hand und Kirstens Blick senkte sich in ihre Augen ...
Im Grunde genommen war es von Anfang an nichts weiter als eine Affäre gewesen. Hatte sie etwas anderes vermutet, dann zeugte das nur von ihrer Naivität.
„Du dummes Ding!“, brummte Sina.
Sie hatten eine aufregende Zeit gehabt. Schon am ersten Abend waren sie im Bett gelandet, und diese Kirsten war ... ziemlich unglaublich gewesen, ein wenig fordernd. Bisweilen hatte sie sich etwas überrumpelt gefühlt, um nicht zu sagen willenlos, aber das musste ja nicht schlecht sein.
Sina kniff die Augen fest zusammen, bis sie Sterne sah.
Hätte sie ihren Verstand beisammengehalten und sich nicht wie ein dummer Teenager in dieses Abenteuer gestürzt, dann wäre ihr aufgefallen, wie Kirsten wirklich war. Wie oberflächlich sie eigentlich war und das nur hinter ihrer Selbstsicherheit verbarg.
Oh ja, Kirsten wusste, was sie wollte. Sehr genau sogar. Es wäre nur gut gewesen, wenn sie das auch erkannt hätte – rechtzeitig, und nicht erst, als es schon zu spät war.
Dabei war es ganz einfach. Kirsten wollte sie, wollte mit ihr ins Bett – und zwar genau so lange, bis die nächste kam. Und das war relativ bald.
Die zeitliche Abfolge war ihr nicht bekannt, was auch besser war. Vorgestern jedenfalls hatte sie Kirsten mit dieser anderen getroffen, Händchen haltend auf der Straße – durch einen Zufall. Kirsten hatte sie gar nicht gleich gesehen, so sehr war sie vertieft in die Gegenwart der anderen gewesen.
Sie selbst war fassungslos stehen geblieben. Sie konnte nicht glauben, was sie da sah, während die Bedeutung nur allmählich durch ihren Kopf sickerte. Es war wohl nicht allein die Tatsache, dass Kirsten eine andere hatte, viel schlimmer war, dass sie geglaubt hatte, sie würde ihr etwas über Sex hinaus bedeuten. Dass dem offensichtlich nicht so war, versetzte ihr einen Schlag. Es war dumm, Kirsten so viel von sich zu geben ...
Ach, verdammt! Dass sie vertraut hatte, wo Misstrauen weit besser gewesen wäre ...
Verfluchter Sex! Nichts als Ärger, wenn der Verstand versagte.
Die beiden waren auf sie zugekommen, und Kirsten hatte den Kopf gehoben. Einen Moment hatte sie gedacht, sie würde sie nicht erkennen, doch dann war Kirsten überrascht stehen geblieben. Sie ließ die Hand der Fremden nicht mal los.
Es gab nicht viel zu sagen. Keine von ihnen versuchte es. Es war zu demütigend. Sie hatte Kirsten geglaubt, all ihre Komplimente, dabei wollte sie sie nur ins Bett kriegen – und das war ihr ja auch gelungen.
Und würde ihr mit der Nächsten und Übernächsten gelingen.
Sie war am Ende nur eine in einer langen Reihe.
Sina stieß den Atem aus. Wortlos hatte sie sich umgedreht und war, bemüht nicht zu rennen, den Weg zurückgegangen.
Sie war nicht unglücklich – dieses Gefühl kannte sie nur zu gut. Sie war verletzt und wütend. Ihr Stolz war verletzt, und sie war wütend auf sich und ihre Blödheit und auf Kirsten mit ihrer Arroganz. Waren denn alle so? Gab es keine, die mehr als nur eine Affäre oder bestenfalls eine Beziehung wollte, die eine Halbwertzeit von nur wenigen Monaten hatte und dieses Wort kaum verdiente?
Gestern hatte Kirsten wider Erwarten angerufen. Sina war davon ausgegangen, mit ihr niemals wieder etwas zu tun zu haben. Und nun das!
„Es ist nicht so, wie du denkst“, hatte Kirsten ohne Einleitung begonnen. Es war ein Satz, der bereits Filmgeschichte geschrieben hatte. Ein Satz, der sie fast auflachen ließ, so klischeebehaftet war er.
Und so überflüssig.
„Wie ich denke?“, hatte sie gesagt. Ihre Stimme war gefasst gewesen und ein wenig kühl. Innerlich hatte sie gebrodelt und alle Kraft gebraucht, ruhig zu bleiben. Sie wollte Kirsten nicht die Genugtuung verschaffen, zur hysterischen Zicke zu werden, die vor Eifersucht nur noch rotsah. Sie war sechsunddreißig Jahre alt und eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand. Mehr als das! Manchmal versank sie bis über die Ohren in diesem beschissenen Zustand, den man Leben nannte. Seit zwei Jahren bemühte sie sich, sich aufrecht stehend durch dieses Drama zu kämpfen. Sie konnte Stolpersteine, wie Kirsten einer war, nicht gebrauchen, dazu fehlte ihr die Kraft. Denn es riss Wunden auf, die tief gingen und die heilen sollten – und sie hatte keinesfalls die Absicht, sich noch mehr zu erniedrigen, als sie es ohnehin schon getan hatte.
„Ich denke, du warst mit dieser Frau im Bett. Und ich denke weiter, dass du nicht die Absicht gehabt hast, mich darüber in nächster Zeit in Kenntnis zu setzen. Das denke ich“, stellt sie unberührt fest. „Was davon ist deiner Meinung nach anders?“
Kirsten war sprachlos. Offenbar hatte sie mit einer anderen Reaktion gerechnet. „Ich liebe diese Frau nicht“, begann sie schließlich.
Sie lachte auf. „Das glaub ich dir sogar. Ich denke nicht, dass du außer dir selbst jemals jemanden lieben kannst.“
„Mach doch nicht so einen Aufstand.“ Das klang ärgerlich, was ziemlich erstaunlich war. „Was ist denn schon dabei? Ja, gut, ich hatte Sex mit der Frau. Aber du bedeutest mir etwas. Das ist doch viel wichtiger!“
Glaubte sie an das, was sie sagte?
Fast hatte es den Anschein. Oder belog sie sich nur einfach selbst? Sina war sich nicht sicher.
Irgendwie, sie wusste selbst nicht wie, überredete Kirsten sie zu einem Treffen, um zu reden.
Dieses Treffen wäre heute gewesen – ein letzter Fehler, Kirsten noch eine Chance einzuräumen, etwas zu erklären, was offensichtlich war. Aber dazu war es gar nicht gekommen. Kirsten hatte sie versetzt.
Seither verfluchte sie sich selbst für ihre Dummheit, haderte sogar mit ihrem Schicksal und verdrängte mühsam und zumeist erfolglos die Bilder der Vergangenheit.
Kirsten war nur eine Erfahrung und ein riesiger Fehler ...
Aber es gab auch eine andere – eine, die ihr gezeigt hatte, was Liebe eigentlich ist, und was Schmerz bedeutet. Zwei Dinge, auf die sie gut und gern verzichtet hätte.
Sie hatte gedacht, Frauen würden anders miteinander umgehen. Nicht, dass sie viel Ahnung auf diesem Gebiet hatte, und ihre romantischen sehnsüchtigen Vorstellungen waren ja auch zu nichts zu gebrauchen. Aber es hatte bisher nur einen Menschen gegeben, der ihr Leben so komplett umgekrempelt hatte, dass nichts mehr an seinem Platz geblieben war.
Das hatte auch ihr Mann nicht geschafft, der nun die kurze, aber sehr entscheidende Vorsilbe „Ex“ trug und die Hälfte ihres Geschirrs und gut zwei Drittel ihrer Tupperware hatte. Sie hatte bis zur Trennung nicht einmal gewusst, dass er sich für Plastikschüsseln begeistern konnte, vermutete aber, dass es nur ums Prinzip gegangen war. Er hatte nie ihr Herz erobert. Liebe war ein Wort gewesen, das etwas umschrieb, das nur in der Fantasie von sehr romantischen Menschen existierte. Es wurde gern und oft benutzt, ohne dass jemand sagen konnte, was es eigentlich war.
Liebe ... Dieses Gefühl bedeutete doch nur, dass man sich zum Trottel machte und am Ende mit Schmerzen zurückblieb. Man war wieder allein. Schlimmer noch – man war einsamer als vorher ...
Vor ihrem Büro kam Tumult auf. Schnelle Schritte eilten über den Flur und jemand rief etwas.
Sicher ein Notfall. Sie war froh um die Ablenkung und beschloss, sich nicht länger hier im Halbdunkel ihren Gedanken hinzugeben. Sie trat hinaus und sah, wie eine der Schwestern in ein Behandlungszimmer rannte.
Langsam schlenderte sie hinterher. Es ging sie ja eigentlich nichts an, sie war sich auch nicht sicher, ob ein Notfall jetzt das Richtige für sie war. Man wusste ja nie, wie schlimm es stand, und sie fühlte sich gerade nicht besonders belastbar.
Sie entdeckte Maren an der Anmeldung. „Was ist los?“