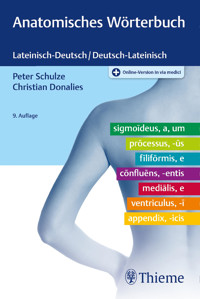
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vom Oculus ins Cerebrum: Fachbegriffe schnell finden und abspeichern
Gerade in der Anatomie ist es besonders wichtig, Fachbegriffe zu beherrschen.
Aber ganz ehrlich: Wer kann sich die alle merken?
Hier gilt: Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und hier steht es:
Im lateinisch-deutschen Teil des Wörterbuchs findest du ca. 4200 anatomische Termini mit den deutschen Übersetzungen. Damit du die Bedeutung besser nachvollziehen kannst, wird auch der Wortstamm erklärt. Auf abgeleitete und häufig verwendete deutsche Begriffe wird außerdem hingewiesen. So prägst du dir die Fachausdrücke leichter ein!
Hintergründe erkennen und Fachsprache verstehen
Der deutsch-lateinische Teil umfasst ca. 2000 deutsche Bezeichnungen mit ihren fachterminologischen Entsprechungen. Hier liegt der Fokus auf den Begriffen, die in der medizinischen Fachsprache häufig verwendet werden.
Ein handlicher Helfer für alle, die mit anatomischen Termini umgehen wollen oder müssen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Anatomisches Wörterbuch
Lateinisch – Deutsch, Deutsch – Lateinisch
Peter Schulze †, Christian Donalies
9., unveränderte Auflage
Vorwort zur 8. Auflage
Diese Auflage beginnt mit der traurigen Nachricht, dass Herr Dr. Peter Schulze (geb. 10.4.1939) am 10.9.2004 an einer heimtückischen Krankheit verstorben ist.
Er war der Hauptautor dieses Wörterbuchs und blieb es auch bis zur 6. Auflage.
Ich denke mit Dankbarkeit an unsere Studienzeit Anfang der 60er-Jahre in Leipzig zurück, in der wir gemeinsam die Erstfassung dieses anatomischen Nachschlagewerkes in recht mühsamer Kleinarbeit schufen. Als Grundlage dienten sowohl die Baseler Nomina Anatomica wie auch die Jenaer und die Pariser Nomina Anatomica. Die erste Auflage erschien dann, nach einigen weiteren Mühen, 1969 als „Kleines erläuterndes Wörterbuch der Anatomie“ im VEB Georg Thieme Verlag Leipzig, wo dann auch vier weitere Auflagen bis 1987 folgten.
Die 6. Auflage – nunmehr im Georg Thieme Verlag Stuttgart • New York – machte deutliche Veränderungen und Erweiterungen nötig. Diese erfolgten v. a. durch die Ergänzung um 350 Stichwörter und die Aufnahme eines deutsch-lateinischen Teils. Zu diesem schrieb 1993 P. Schulze, dass hier „die gebräuchlichen und gängigen deutschen anatomischen Bezeichnungen erfasst (wurden), soweit sie in der medizinischen Fachsprache verwendet werden und in Lehrbüchern vorkommen. Es wurde nicht versucht, alle lateinischen bzw. latinisierten Nomina anatomica ins Deutsche zu übertragen. Die lateinischen Substantive und zusammengesetzten Fachbegriffe sind mit dem ausgeschrieben Genitiv und, soweit dies sinnvoll und wichtig erschien, mit dem Nominativ und Genitiv Plural angeführt worden. Dies wird denjenigen Benutzern, deren Lateinkenntnisse noch gering sind, das Eindringen in die Nomenklatur erleichtern…“ Man findet sehr viele Vokabeln schon in der Antike – jedoch ohne dass sie eine anatomische Bedeutung besaßen. Dies wird in dem Wörterbuch ergänzt, indem die Abkürzung anat. (anatomisch) eingefügt wurde.
Die 7. Auflage konnte unverändert bleiben. Für die 8. Auflage wurden allerdings wieder viele Erweiterungen bzw. Veränderungen nötig. Neben der verstärkten Berücksichtigung der Terminologia Anatomica des FCAT (Federative Committee on Anatomical Terminology) wurden viele Ableitungen aufgenommen, die im sonstigen üblichen Sprachgebrauch häufig vorkommen. Diese dürften nicht nur das Wörterbuch interessanter machen, sondern auch das Ableiten und Behalten und damit das Lernen erleichtern.
Ich bedanke mich bei Frau Gabriele Schulze, die ihr freundliches Einverständnis gab, dass das Werk ihres verstorbenen Mannes durch mich weitergeführt wird. Dank gebührt auch meiner Tochter Frau Gabriele Donalies, die mir in liebevoller und sorgfältiger Weise schreibtechnisch zur Seite stand. Desgleichen bedanke ich mich bei Frau Marianne Mauch und Herrn Gerd Rodriguez vom Georg Thieme Verlag, die mir mancherlei Hilfe gewährten.
Natürlich bedanke ich mich desgleichen bei allen, die in dieses Buch seit fast 40 Jahren häufig reingeschaut haben und bei den vielen, die in der Zwischenzeit dazu gekommen sind.
Für Anregungen und Kritiken an diesem Büchlein wäre auch ich allen sehr verbunden!
Wittstock, im Juni 2008
Christian Donalies
Vorwort zur 6. Auflage
Dieses Wörterbuch ist aus dem „Kleinen erläuternden Wörterbuch der Anatomie“ hervorgegangen, das von 1969 bis 1987 im Georg Thieme Verlag Leipzig in fünf Auflagen erschienen ist. Es wird hier in erweiterter und überarbeiteter Form unter dem Titel „Anatomisches Wörterbuch – Lateinisch-Deutsch, Deutsch-Lateinisch“ vorgelegt. Der lateinisch-deutsche Teil ist durch einen deutsch-lateinischen Teil ergänzt worden, der, wie zu hoffen ist, die Brauchbarkeit des Buches erhöhen wird. Für die Ausarbeitung des deutsch-lateinischen Teiles wurden auch meine „Anatomischen Bezeichnungen – Deutsch-Lateinisch, Lateinisch-Deutsch“ herangezogen, die 1981 in zweiter Auflage im Georg Thieme Verlag Leipzig erschienen waren.
Im neu hinzugekommenen deutsch-lateinischen Teil sind die gebräuchlichen und gängigen deutschen anatomischen Bezeichnungen erfaßt, soweit sie in der medizinischen Fachsprache verwendet werden und in Lehrbüchern vorkommen. Es wurde nicht versucht, alle lateinischen bzw. latinisierten Nomina anatomica ins Deutsche zu übertragen. Die lateinischen Substantive und zusammengesetzten Fachbegriffe sind mit dem ausgeschriebenen Genitiv und, soweit dies sinnvoll und wichtig erschien, mit dem Nominativ und Genitiv Plural angeführt worden. Dies wird denjenigen Benutzern, deren Lateinkenntnisse noch gering sind, das Eindringen in die Nomenklatur erleichtern und das Buch für den Unterricht in Terminologiekursen brauchbarer machen.
Der lateinisch-deutsche Teil ist überarbeitet und um etwa 350 Stichwörter ergänzt worden. Die nomenklatorischen Neuerungen des 12. Internationalen Anatomenkongresses in London wurden weitgehend berücksichtigt. Da ein Wörterbuch niemals fertig ist, ergeht an alle Benutzer die Bitte, Anregungen und Kritiken dem Verlag zuzuleiten. Sie werden sorgfältige Berücksichtigung finden.
Riesa, im Juni 1993
Peter Schulze
Verzeichnis der Abkürzungen
A. Arteria (Arterie, Schlagader)
Aa. Arteriae (Arterien, Schlagadern)
Adj. Adjektiv
anat. anatomisch, im anatomischen Sprachgebrauch
arab. arabisch
Art. Articulatio (Gelenk)
Artt. Articulationes (Gelenke)
BNA Baseler Nomina Anatomica (1895)
Dem. Deminutiv, Verkleinerungsform
eigtl. eigentlich
embryol. embryologisch
engl. englisch
erg. ergänze
f. femininum (genus), weiblich
FCAT Federative Committee on Anatomical Terminology
GFWB Großes Fremdwörterbuch
grch. griechisch
hebr. hebräisch
hist. histologisch
indekl. indeklinabel, nicht deklinierbar
ital. italienisch
JNA Jenaer Nomina Anatomica (1935)
JS Jacobitz-Seiler
lat. lateinisch
latinis. latinisiert
Lw. Lehnwort
Lig. Ligamentum (Band)
Ligg. Ligamenta (Bänder)
Ln. Lymphonodus (der Lymphknoten)
Lnn. Lymphonodi (die Lymphknoten)
M. Musculus (Muskel)
Mm. Musculi (Muskeln)
m. masculinum (genus), männlich
N. Nervus (Nerv)
nlat. neulateinisch
Nn. Nervi (Nerven)
Nom. anat. Nomen anatomicum, anatomische Bezeichnung
od. oder
Part. Partizip
PI. Plural
PNA Pariser Nomina Anatomica (1955)
P. P. A. Partizip Präsens Aktiv
P. P. P. Partizip Präsens Passiv
Proc. Processus (Fortsatz)
Procc. Processus (Fortsätze)
R. Ramus (Ast)
Rr. Rami (Äste)
Sg. Singular
span. spanisch
splat. spätlateinisch
Subst. Substantiv
substantiv. substantiviert
t.t. Terminus technicus, Fachausdruck
urspr. ursprünglich
V. Vena (Vene)
Vv. Venae (Venen)
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort zur 8. Auflage
Vorwort zur 6. Auflage
Hinweise für den Benutzer
1. Lateinisch-deutscher Teil
2. Deutsch-lateinischer Teil
Verzeichnis der Abkürzungen
Teil I Latein-Deutsch
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
21 U
22 V
23 X
24 Z
Teil II Deutsch-Latein
25 A
26 B
27 C
28 D
29 E
30 F
31 G
32 H
33 I
34 J
35 K
36 L
37 M
38 N
39 O
40 P
41 Q
42 R
43 S
44 T
45 U
46 V
47 W
48 Y
49 Z
50 Literatur
Anschriften
Impressum/Access Code
Teil I Latein-Deutsch
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
21 U
22 V
23 X
24 Z
1 A
Peter Schulze, Christian Donalies
a-: (in Zusammensetzungen) für: un-, -los, -losigkeit; vom grch. Alpha privativum. Vor h oder Vokal tritt ein grch. ny=n ein: anōnymus
abdōmen, -minisn.: anat. Bauch; sonst auch Schmerbauch, Wanst
abdōminālis, e (abdōmen): anat. Bauch-, zum Bauch gehörend
abdūcēns, -entis: wegführend, wegziehend; P. P. A. von abdūcere: wegführen, wegziehen; in N. abdūcens (VI. Hirnnerv). Der N. abdūcens innerviert den M. rēctus lāteralis. Dieser Muskel abduziert den Bulbus oculi nach temporal; daher die Bezeichnung als abdūcēns (nach Voss-Herrlinger)
abductio, -onisf.: das Abziehen, das Abführen
abductor, -ōrism.: anat. Abzieher, Abführer; „Abduktor“ M. abductor Abziehmuskel, Muskel mit abziehender Wirkung; abdūcere: abführen, wegführen, abziehen
aberrāns, -antis: abirrend; P. P. A. von aberrāre: abirren; errāre: „irren“. Abgel.: erratischer Block (abgeirrter Steinblock in der Eiszeit)
aberrātiō, -ōnisf.: Abirrung, Abweichung, Aberration (im Hinblick auf Lage oder Entwicklung gesagt)
abnormālis, e: von der Norm abweichend; wohl zu abnōrmis, e: von der Regel abgehend
abnormālitās, -ātisf.: Abweichung von der Regel, Regelwidrigkeit; vielleicht zu abnormālis gebildet; belegt ist nur abnormitās, -ātis f.: die Abweichung von der Regel
absorbēns, -entis: aufsaugend; P. P. A. von: hinunterschlürfen, verschlucken, einschlürfen, aufsaugen. Abgel.: absorbieren
absorptiō, -ōnisf.: Verschlingen, Aufsaugen
abundantia, -aef.: Überfluss, Übermaß, Fülle. Abgel.: Abundanz (Überfluss)
acardiacus, a, um: embryol. ohne Herzanlage; aus ↑ a- und cardiacus, a, um: Herz-, zum Herzen gehörig; grch. kardiakos
accelerāns, -antis: beschleunigend; P. P. A. von accelerāre: beschleunigen; celer, celeris, celere: schnell. Abgel.: Akzeleration (Beschleunigung z. B. im Wachstum während der Pubertät)
accessor, -ōrism.: anat. Hinzukommender; accedere: hinzukommen
accessōrius, a, um (accessor): hinzukommend, das Hinzukommen betreffend; u. a. in N. accessōrius (XI. Hirnnerv): „Der N. accessōrius kam durch Thomas Willis 1664 zu den damals bekannten 10 Hirnnerven ,hinzu‘“ (Triepel-Herrlinger). Abgel.: frz. Accessoires
accidentālis, e: embryol. zufällig; zu accidentia, -ae f.: Zufall. Abgel.: Akzidentialien (Nebenpunkte), akzidentell (unwesentlich), Akzidenz (kleine Drucksache)
accumulātus, a, um: aufgehäuft; P. P. A. zu accumulāre: aufhäufen; vgl. cumulus, -ī m. -Haufen. Abgel.: Akkumulation, Akkumulator, Kumuluswolken
acervulus, -īm. (acervus): anat. Hirnsand; eigtl. Häufchen
acervus, īm.: Haufe, Menge. Abgel.: Koazervat (Zusammengehäuftes)
acētābulāris, e (acētābulum): anat. zur Hüftgelenkspfanne gehörend, Hüftgelenkspfannen-
acētābulum, -īn. (acētum): Hüftgelenkspfanne; eigtl. Essigschale, Schüssel
acētum, -īn.: „Essig“, Azetat (Salz der Essigsäure)
acidophilus, a, um: hist. durch saure Farbstoffe anfärbbar; aus acidus, a, um: sauer und grch. philos m.: Freund
acinōsus, a, um (acinus): anat. beerenförmig, traubenförmig, azinös; antik: weinbeerartig
acinus, -īm.: anat. Drüsenendstück, Endstück seröser Drüsen; eigtl. kleine Beere, Weinbeere
acr(o)-: anat. (in Zusammensetzungen) für: Außen-, Spitz-, Hoch-, grch. akros: oberster, höchster. Abgel.: Akren (Enden der Gliedmaßen), Akribie (äußerste Genauigkeit), Akromegalie (Größenwachstum der Akren)
acrōmiālis, e (acrōmion): Schulterhöhen-, zur Schulterhöhe gehörend, akromial
acrōmion, -īīn. anat. Schulterhöhe; grch. akrōmion n.: Schulterspitze, Schulterhöhe, zu akros: oberster, äußerster und ōmos m.: Schulter
acrosōma, -atisn.: hist. Spitzenkörper, Überzug bzw. Schicht am vorderen Teil des Spermienkopfes; aus ↑ acro- und grch. sōma, sōmatos n.: Körper
acrosōmālis, e (acrosōma): Spitzenkörper-, zum Spitzenkörper gehörend; die Schicht am vorderen Teil des Spermienkopfes betreffend
acrosōmāticus, a, um (acrosōma) ↑ acrosōmālis
acusticus, a, um: anat. das Hören betreffend, Hör-; grch. akustikos; akūein: hören
ad-: Vorsilbe mit der Grundbedeutung „zu, nach, an“
adamantinus, a, um: stählern, stahlhart; grch. adamantinos; adamas, -antos m.: Stahl
additionālis, e: zusätzlich; wohl zu additiō, -ōnis f.: das Hinzufügen Vgl. auch engl, additional zusätzlich
adductio, -onis f.: das Herbeiziehen, das Anziehen
adductor, -ōrism.: Heranführer, Heranzieher; in M. adductor: heranziehender Muskel; sonst: „Zuführer“; addūcere: heranführen, heranziehen
adductōrius, a, um (adductor): anat. 1. heranführend, dem Heranführen dienend, 2. zum Heranführer gehörend
adeno-: anat. (in Zusammensetzungen) für Drüsen-; grch. adēn, adenos m.,f.: Drüse
adenomerus, -īm.: anat. teilungsfähiger Anteil der Drüse, Adenomer; aus ↑ adeno- und grch. Meros n.: Teil
adenohypophysis, -is oder -eōsf.: anat. drüsiger Vorderlappen der Hirnanhangsdrüse; aus ↑ adeno- und hypophysis, -is oder -eōs f.: Hirnanhangsdrüse, Hypophyse
adenoīdeus, a, um: anat. drüsenähnlich, adenoid; zu grch. adenoeidēs: drüsenartig, drüsenähnlich; grch. aden, adenos m.,f.: Drüse
adeps, adipism.,f.: Fett
adhaerēns, -entis: festhängend, anklebend; P. P. A. von adhaerēre: festhängen
adhaesio, -ōnis/.: auch
adhēsio, -ōnisf.. anat. Bezeichnung für das physiologische Aneinanderhaften beider Sehhügel, Adhaesio interhalamica: „inkonstante Verwachsung zwischen rechtem und linkem Thalamus“ (Feneis); antik: das Anhängen, die Anschließung; adhaerēre: festhängen, ankleben
adhērēns, -entis: ↑ adhaerēns
adhesiō ↑ adhaesio
adipōsus, a, um (adeps): anat. 1. fettreich, 2. aus Fett bestehend. Abgel.: Adipositas (Fettsucht)
aditus, -ūsm.: Zugang, Eingang; adīre: herangehen
adminiculum, -īn.: Stütze; in: Adminiculum līneae albae (dreieckiger) Verstärkungszug der Līnea alba oberhalb der Symphyse
adolfactōrius, a, um: anat. zum Riechlappen gehörig; aus ↑ ad- und olfactōrius, a, um: das Riechen betreffend, Riech-
adumbilīcālis, e (ad- + umbilīcālis): anat. am Nabel befindlich, neben dem Nabel befindlich
advehēns, -entis: zuführend; P. P. A. von advehere: herbeiführen, zuführen, herbringen
adventīcius, a, um auch
adventītius, a, um: äußerer, von außen kommend, hinzukommend; advenīre: herzukommen, hinzukommen, adventus, us m.: Ankunft
adventītia, -aef.: anat. äußere bindegewebige Hülle von Gefäßen und Hohlorganen. Adventītia ist eine Kurzform, die für Tunica adventītia steht
adventītiālis, e (adventītia): anat. zur Adventitia gehörend, die Adventitia betreffend, Adventitia-; in Cellula adventītiālis: Adventitiazelle
adventītius, a, um: auch
adventīcius, a, um: äußerer, von außen kommend, hinzukommend; advenīre: herzukommen, hinzukommen
aequātor, -ōrism., auch: ēquātor, -ōrism: Gleicher, bezeichnet anat. den größten Umfang eines kugelähnlichen Gebildes, bezogen auf die frontale Ebene
afferēns, -entis: herbeitragend, zuführend; P. P. A. von afferre: herbeitragen, herbeibringen; ferre: tragen. Abgel.: Afferenz (Begriff der Neurophysiologie, der die Richtung der Informationsübertragung beschreibt)
affixio, -ōnisf.: das Anhaften, das Anfügen, Befestigung; affīgere: anheften. Abgel.: Affix (Prä- oder Suffix, Vor- oder Nachsilbe), affizieren (reizen, krankhaft verändern)
affīxīvus, a, um: anat. die Anheftung betreffend, Anheftungs-, die Befestigung betreffend, Befestigungs-
affīxus, a, um: angeheftet; P. P. P. von affigere: anheften
aganglionicus, a, um: anat. ohne Nervenknoten, nicht mit Nervenknoten versehen, aganglionär; aus ↑ a- und ganglion, -iī n.: Nervenknoten
agger, aggerism.: Damm; in Agger nāsi: Schleimhautwulst der Nase
aggregātiō, -ōnisf.: Zusammenballung, Aggregation; eigtl. das Zusammenhäufen, Aufhäufen; in Aggregātiō erythrocytica: die Geldrollenform der roten Blutkörperchen (nach Faller). Abgel.: Aggregatzustand
aggregātus, a, um: anat. zusammengelagert, nahe beieinander liegend; eigtl. zusammengeschart; aggregāre: zusammenscharen
āla, -aef.: Flügel
ālāris, e (āla): anat. Flügel-, zum Flügel gehörend; flügelförmig; antik: Flügel-, zu den Flügeltruppen gehörig
albicāns, -antisf.: weiß (schimmernd); P. P. A. von albicāre: weiß sein, weiß machen
albūgineus, a, um (albūgo): anat. weiß, weißlich
albūgo, -inisf. (albus): das Weiße, weißer Fleck
albus, a, um: weiß. Abgel.: Album (ursprüngl. weiße Holztafel), Albino, Albumine
alimentārius, a, um: Nahrungs-, zur Nahrung gehörig; zu alimentum, -ī n., meist PI. alimenta, -ōrum n.: Nahrung, alere: ernähren
allantoicus, a, um (allantois): anat. Urharnsack-, zum Urharnsack gehörend
allantois, -idisf.: anat. Urharnsack; grch. allantoeidēs: wurstförmig, wurstähnlich; zu grch. allās, allāntos m.: Wurst. Abgel.: Allantiasis ( Wurstvergiftung, Botulismus)
allosōma, -atisn.: anat. Geschlechtschromosom; aus grch. allos: anderer und grch. sōma, -atos n.: Körper
allosōmālis, e (allosōma): anat. Geschlechtschromosomen-, die Geschlechtschromosomen betreffend
alveolāris, e (alveolus): anat. 1. zum Lungenbläschen gehörig, Lungenbläschen-, 2. zum Zahnfach gehörig, Zahnfach-
alveolus, -īm. (Dem. von alveus): anat. 1. Lungenbläschen, 2. Zahnfach; sonst: kleine Mulde, Wanne, Vertiefung; in Alveoli dentālēs: Zahnfächer, Alveoli pulmōnis: Lungenbläschen
alveus, -īm.: längliche Vertiefung, Wanne, Mulde
ambiēns, -entis: herumgehend, umgebend; P. P. A. zu ambīre: herumgehen, herumlaufen, etwas umgeben
ambiguus, a, um: sich nach zwei Seiten hin neigend; unsicher, zweifelhaft; in Nucleus ambiguus. Abgel.: ambivalent
ameloblasticus, a, um (ameloblastus): die Schmelzbildung betreffend, Schmelzbildungs-
ameloblastus, -i m.: hist. den Zahnschmelz bildende Zelle, (Zahn)-schmelzbildner, Ameloblast; vermutlich aus enamelum, -ī n.: Schmelz und grch. blastos m.: l. Keim, Trieb, Schößling, 2. das Sprossen
amiculum, -īn.: Mantel, Überwurf; amicīre: überwerfen, umhüllen
amitōsis, -is oder -eōsf.: direkte Kernteilung, ohne „Fadenbildung“ einhergehende Kernteilung; aus ↑ a- und grch. mitos m.: Faden
amnioblastus, -īm.: Schafhautbildungszelle, Amnionbildungszelle; aus grch. amnion n.: Schafhaut, Häutchen um die Leibesfrucht und ↑ -blastus
amniogenicus, a, um (amnio- + -genicus): Schafhautbildungs-, die Bildung der Schafhaut betreffend, amniogen
amnion, -iīn.: embryol. Schafhaut, (Frucht) wasserhaut, innere Eihaut, die das Fruchtwasser umgibt und dem Keimling am nächsten ist; grch. amnion n.: Schafhaut, Häutchen um die Leibesfrucht
amnioticus, a, um (amnion): Schafhaut-, Eihaut-, die Schafhaut betreffend, amniotisch
amorphus, a, um: gestaltlos, formlos, „amorph“; grch. amorphos: 1. ungestaltet, missgestaltet, hässlich, 2. gestaltlos, formlos, „amorph“, grch. morphē f.: Gestalt
amphiarthrōsis, -is oder -eōsf.: anat. Wackelgelenk, mit straffen Bändern versehenes Gelenk von geringer Beweglichkeit, Amphiarthrose; aus grch. amphi: rings, umher, auf beiden Seiten und grch. arthrōsis f.: Gelenk, Vergliederung
amphora, -aef.: Gefäß, Krug, „Amphore“; von grch. amphoreus m.: Gefäß mit zwei Henkeln
ampulla, aef.: (Dem. von amphora): „Ampulle“ , anat. Bezeichnung für eine kolbenförmige Verdickung, Erweiterung oder Ausbuchtung eines Hohlorgans; eigtl. kolbenförmiges Gefäß, kleine Flasche. Abgel.: „Ampel“ , „Pulle“
ampullāris, e (ampulla): anat. flaschenförmig, kolbenförmig; zur Ampulle gehörig
amputātiō, -ōnisf.: das Abschneiden; amputāre: abschneiden, wegschneiden
amyelinātus, a, um: anat. marklos; zu ↑ a- und myelīnum, -ī n.: Myelin (dies, von grch. myelos m.: Mark; in Neurofibra amyelināta: marklose Nervenfaser
amygdala, -aef.: Mandel; grch. amygdalē f. Abgel.: Amygdalin (blausäurehaltiger Geschmackstoff in bitteren Mandeln)
amygdaloīdes, Gen. -is: anat. mandelähnlich; grch. amygdaloeidēs; amygdalē f.: Mandel
amygdaloīdeus, a, um (amygdaloīdes): anat. 1. mandelähnlich, 2. zu etwas Mandelähnlichem gehörend; in Corpus amygdaloīdeum
ānālis, e (ānus): anat. zum After gehörig, After
anaphasis, -is oder -eōsf.: eine Phase der Kernteilung. Es erfolgt die Trennung der Chromosomen in die Tochterchromosomen; diese wandern zu den Polen der Spindelfigur und es kommt zur Bildung der Doppelsterne; neugebildet aus grch. ana: nach oben hin, über… hin und phasis f.: Erscheinung; Anaphase, phainesthai: sich zeigen, erscheinen.
anastomōsis, -is oder -eōsf.: anat. Verbindung von Blutgefäßen (bzw. Lymphgefäßen oder Nerven) untereinander; im Latein der Antike in der Bedeutung „Öffnung“ belegt; grch. anastomōsis f.: Eröffnung, Mündung; „Anastomose“, grch. anastomoein: mit einer Mündung versehen, öffnen
anastomōticus, a, um (anastomōsis): anat. zur Anastomose gehörend, anastomosierend, verbindend; im antiken Latein: Öffnung verschaffend; grch. anastomōtikos: dem Öffnen dienend, öffnend
anatomia, -aef.: „Anatomie“ ; grch. anatomē f.: das Aufschneiden oder Zergliedern eines Körpers; anatemnein: zerschneiden; neben anatomia im Lateinischen auch die Form
anatomē, -ēsf.
anatomicus, a, um: das Zergliedern betreffend, die Lehre vom Körperbau betreffend; grch. anatomikos; anatomē f.: das Aufschneiden oder Zergliedern eines Körpers, Anatomie; in Collum anatomicum humeri: anatomischer Hals des Oberarmknochens
ancōnaeus, a, um: anat. zum Ellenbogen gehörig, Ellenbogen-; zu grch. ankōn, ankōnos m.: Ellenbogen. Abgel: Ancona (italienische Stadt, die an der Küste den Grundriss eines Ellenbogens hat)
ancōnēus, a, um (ancōnaeus) ancōnaeus
ancora, -aef.: „Anker“ ; vgl. grch. ankyra f.
ancorālis, e (ancora): Anker-, zum Anker gehörend
aneuploideus, a, um: embryol. nicht mit dem normalen Chromosomensatz versehen; ↑ an- und euploideus, a, um: Chromosomensatz aufweisend
angio-: anat. (in Zusammensetzungen) für Gefäß-, Blutgefäß-; grch. angeion n.: Gefäß. Abgel.: Angiografie, Angiologie, Angiom
angioarchitectonicē, -ēsf.: anat. Aufbau und räumliche Verteilung der Blutgefäße in der Großhirnrinde Angioarchitektonik; aus ↑ angio- und architectonicē, -ēs f: Baukunst, Architektur; grch. architektonikē f., zu ergänzen ist technē f. oder epistēmē f.
angioblasticus, a, um: anat. zur Gefäßbildung gehörig, die Gefäßbildung betreffend, Gefäßbildungs-, angioblastisch; aus ↑ angio- und grch. blastikos: keimend, das Keimen befördernd; vgl. angioblastus
angioblastus, -īm.: (angio- + blastus): jugendliche Zelle, die die Fähigkeit zur Bildung von Kapillaren besitzt (nach WdM), Angioblast
angulāris, e (angulus): winkelig, eckig, „angular“
angulus, -īm.: Winkel, Ecke. Abgel.: Triangel, Triangulation (Landmessung mit der Hilfe von Dreiecken)
angustia, -aef. (angustus): Enge; anat. in 1. (nicht offiziell) zur Bezeichnung der Speisenröhrenengen: Angustia cricoīdea: Ringknorpelenge, Angustia aortica: Aortenenge und Angustia diaphragmatica: Zwerchfellenge, 2. (nicht offiziell) Angustia pelvis: Beckenenge
angustus, a, um: eng. Verwandt: Angst
ano-: anat. (in Zusammensetzungen) für Anus: After
ānococcygēus, a, um (ano- + coccygēus): anat. zum After und zum Steißbein gehörend; vom After zum Steißbein verlaufend
ānococcygicus, a, um (ano- + cocoygicus) ↑ ānococcygēus
ānogenitālis, e (āno- + genitālis): anat. den After und die Geschlechtsorgane betreffend, zum After und zu den Geschlechtsorganen gehörend
anōnymus, a, um: namenlos, unbenannt; grch. anōnymos; grch. onoma, -atos n.: Name; in A. anōnyma und Vv. anōnymae
ānsa, -aef.: anat. Schlinge, Schleife; antik: 1. Griff, Henkel, Handhabe 2. Anhalt, Anhaltspunkt
ānsātus, a, um (ānsa): anat. mit einer Schlinge versehen, antik: mit einem Griff oder Henkel versehen
ānser, ānserism.: Gans
ānserlnus, a, um (ānser): Gänse-, zu den Gänsen gehörig, gänsefußförmig
ante-: Vorsilbe mit der Grundbedeutung „vor, Vorder-“
antebrachiālis, e (antebrachium): anat. den Unterarm betreffend, Unterarm-
antebrachium, -iīn. (ante- + brachium): anat. Vorderarm, Unterarm; auch antibrachium, -iī n. (BNA)
anterior, ius: vorderer, vorn gelegen
antero-: anat. (in Zusammensetzungen) vorn befindlich; entspricht dem Adjektiv anterior
anterolaterālis, e (antero- + laterālis): anat. vorn-seitlich gelegen; Vorderseiten-
anteromediālis, e (antero- + mediālis): anat. vorn und nach der Mitte zu gelegen, vorn und in der Mitte befindlich, vorn- mitten-
anterosuperior (antero- + superior): anat. vorn und oben gelegen, vorn-oben-
anthelix, -icisf.: Gegenwindung, anat. innere, d. h. näher dem Meātus acusticus externus zu gelegene Windung der Ohrmuschel, parallel zur Helix verlaufend; grch. anthelix, -ikos f: „innere Ohrleiste“ (Jacobitz-Seiler)
ant(i)-: Vorsilbe mit der Grundbedeutung gegen (über); grch. anti-
antimesomētriālis, e (anti- + mesomētrium): anat. gegenüber dem Gebärmuttergekröse befindlich; mesometriälis neugebildet zu mesomētrium, -iī n.: Gebärmuttergekröse, zur Gebärmutter ziehende Bauchfellduplikatur
antitragicus, a, um (antitragus): anat. zum Antitragus gehörend, zum Gegenbock gehörend
antitragohelicīnus, a, um (antitragus + helicīnus): anat. zum Antitragus und zur Helix gehörend; in Fissūra antitragohelicīna
antitragus, -īm.: anat. „Gegenbock, Gegenecke“ (de Terra), ein Ohrmuschelhöcker, der dem Tragus gegenüber liegt; grch. antitragos m.
antrum, -īn.: Höhle, Höhlung, grch. antron n.
ānulāris, e (ānulus): Ring-, zum Ring gehörig
ānulātus, a, um (ānulus): mit einem Ring versehen, beringt
ānuli-, anulo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Anulus: Ring
ānulifōrmis, e (anuli- + fōrma): anat. ringförmig
anulo- ↑ anulī-
ānulospīrālis, e (anulo- + spīrālis): anat. ringförmig gewunden
ānulus, -īm. (Dem. von ānus): Ring
ānus, -ī,m.: anat. After, urspr. Ring
aorta, -aef.: anat. Hauptschlagader; grch. aortē f.
aortico-: anat. (in Zusammensetzungen) für Aorta: Hauptschlagader
aorticopulmōnālis, e (aortico- + pulmōnālis): zur Hauptschlagader und zur Lunge gehörig, die Hauptschlagader und die Lunge betreffend, aortikopulmonal
aorticorēnālis, e (aortico + rēnālis): zur Hauptschlagader und zur Niere gehörend, die Hauptschlagader und die Niere betreffend, aortikorenal
aorticus, a, um (aorta): anat. Hauptschlagader-, zur Hauptschlagader gehörig
apertūra, aef.: anat. Öffnung; sonst auch: das Öffnen; aperīre: öffnen. Abgel.: Apertur (Öffnungsverhältnis der Blende eines Objektivs)
apertus, a, um: offen, aperīre: öffnen
apex, apicism.: Spitze; anat. insbesondere i. S. v. 1. Knochenspitze, spitz auslaufendes Ende eines Knochens, 2. (spitzes) Ende eines Organs. Abgel.: Apex (1. Zielpunkt der Bewegung eines Gestirns, 2. Zeichen für die Länge eines Vokals, Zeichen für die Betonung einer Silbe)
apicālis, e (apex): anat. Spitzen-, zur Spitze gehörend
apico-: anat. (in Zusammensetzungen) für Spitzen-; apex, apicis, m.: Spitze
apicoposterior (apico- + posterior): anat. die Spitze und den hinteren Abschnitt betreffend, den hinteren (dorsalen) Anteil der Spitze betreffend
apolāris, e (polus): keinen Pol besitzend, ohne Pol; aus ↑ a- und grch. polos m., latinis. polus, -ī m.: Drehpunkt, Pol, „polar-“
apocrīnus, a, um: anat. die Absonderung betreffend, ; „apokrin“ ; zu grch. apokrinein: absondern; grch. apokrisis f.: Absonderung
aponeurōsis, -is oder -eōs, f.: anat. flächenhafte Sehne, Sehnenhaut, „flach ausgebreitete Sehne“ (Wolff). „Aponeurose“ ; grch. aponeurōsis f.: Stelle, an der der Muskel in eine Sehne übergeht; aponeuroesthai: sehnig werden; grch. neuron n.: Sehne. Nerv
aponeurōticus, a, um (aponeurōsis): anat. einer flächenhaften Sehne ähnlich; zu einer flächenhaften Sehne gehörig; aponeurotisch;
apophysis, -is oder -eōs,f.: anat. (nach Voss-Herrlinger) durch Muskelzug bedingte Aus- oder Anwüchse des Knochens (Prōcessus, Spīna, Crista, Tūber, Tūberculum, Tūberōsitās); als Ansatzstelle für Muskeln dienender Knochenfortsatz, Apophyse; grch. apophysis, -is oder -eōs. f.: Auswuchs, Nebenschoß; auch: Knochenfortsatz. an dem eine Sehne ansetzt
apparātus, -ūsm.: anat. Vorrichtung; antik: 1. Herstellung, Beschaffung, 2. Zurüstungen, Rüstzeug, Gerätschaften, 3. reiche Ausstattung, Pracht, Gepränge
appendicula, -aef. (Dem. von appendix): kleines Anhängsel
appendiculāris, e (appendicula): anat. (Wurm)fortsatz-, zum Wurmfortsatz gehörend
appendix, -icisf.: Anhängsel; u. a. in Appendix vermifōrmis: Wurmfortsatz; appendēre: daran hängen. Abgel.: Appendizitis, Appendektomie
approximālis, e: anat. das Herankommen betreffend, Näherungs-; approximāre herankommen, sich nähern
aqua, -aef.: Wasser. Abgel.: Aquarium, Aquarell, Aquavit („Wasser des Lebens)
aquaeductus, -ūsm. (aqua + ductus): anat. mit Flüssigkeit gefüllter Kanal; antik: Wasserleitung
aqueus, a, um (aqua): anat. wäßrig, wasserähnlich; in Humor aqueus: Kammerwasser; antik: aus Wasser bestehend
aqueductus, -ūsm. ↑ aquaeductus
aquōsus, a, um (aqua): anat. wäßrig, wasserähnlich; antik: voll Wasser, wasserreich
arachnoīdālis, e (arachnoīdes): anat. Spinnwebenhaut-, zur Spinnwebenhaut (Arachnoīdea) gehörend
arachnoīdea, -aef.: anat. Spinnwebenhaut; Substantiv. Fem. Sg. vom Adj. arachnoīdeus. Zu ergänzen ist Membrana oder Tunica
arachnoīdeālis, e ↑ arachnoīdālis
arachnoīdes, -is: anat. spinngewebsähnlich; grch. arachnoeidēs; arachnē f.: 1. Spinne, 2. Spinngewebe. Abgel.: Arachnoiden (Spinnentiere), Arachnologie (Spinnenkunde)
arachnoīdes, -isf.: anat. (veraltet) Spinnwebenhaut; Substantiv. Fem. Sg. vom Adj. arachnoīdes. Zu ergänzen ist wohl Membrāna oder Tunica
arachnoīdeus, a, um↑arachnoīdālis
arbor, arborisf.: Baum; u. a. in Arbor vitae (cerebelli): Lebensbaum, Name für die Zeichnung des Kleinhirns auf dem Medianschnitt. Abgel.: Arboretum (Baumgarten)
archenteron, -īn.: embryol. Urdarm; aus grch. archē f.: Anfang und enteron n.: Darm. Abgel.: Arzt
arcuālis, e (arcus): anat. Bogen-, den Bogen betreffend
arcuātus, a, um (arcus): 1. bogenförmig gekrümmt, 2. mit einem Bogen versehen
arcus, -ūsm.: Bogen. Abgel.: Arkaden (Bogengang), Arcus (Kreisbogen eines Winkels)
ārea, aef.: Fläche, Platz. Abgel.: Areal, Hektar
arēna, -aef.: Sand, „Arena“ : urspr. mit Sand bestreuter Kampfplatz
arēnāceus, a, um (arena): sandig, sandartig
āreola, -aef. (Dem. von ārea): kleiner Hof, kleiner Platz, mlat. Beet; in Areola mammae: Warzenhof
āreolāris, e (āreola): anat. Warzenhof, zum Warzenhof (= Areola mammae) gehörend
argentaffinocytus, -īm.: hist. mit Silberpräparaten anfärbbare und darstellbare Zelle; argentum, -ī n.: Silber. Abgel.: Argentinien („Silberland“), affinis, e: benachbart, verwandt und ↑ -cytus
argyrophilocytus, -ī m.: anat. mit Silberpräparaten anfärbbare und darstellbare Zelle; grch. argyros m.: Silber, philos m. Freund und ↑ -cytus
arrector, ōrism.: anat. Aufrichter; arrigere: aufrichten; in Mm. arrectōrēs pilōrum
arteficiālis, e: embryol. künstlich; antik nur artificiālis, e: kunstmäßig, kunstgerecht; artificium, -iī n.: Kunst, Handwerk, Gewerbe, ars, artis f.: Kunst, Wissenschaft; Handwerk; facere: tun, machen
artēria, -aef.: anat. Schlagader, Arterie; auch Luftröhre in der Verbindung Artēria aspera: „rauhe Arterie“; grch. artēria f., Hauptbedeutungen: 1. Luftröhre (auch grch. tracheia artēria f.: „rauhe Arterie“, ↑ trachēa), 2. Schlagader (auch grch. leia artēria f.: „glatte Arterie“. Man ging im Altertum davon aus, dass die Schlagader mit Luft gefüllt war.
artēriālis, e (artēria): Schlagader-, zur Schlagader gehörig, zur Arterie gehörig, Arterien-
artērio-: anat. (in Zusammensetzungen) für Artēria, Schlagader, Arterie
artēriola, -aef. (Dem. von artēria): anat. kleine Schlagader, kleine Arterie
artēriolāris, e (artēriola): kleine Schlagadern betreffend, Arteriolen-
artēriōsus, a, um (arteria): anat. 1. reich an Schlagadern, reich an Arterien, arterienreich, 2. zur Schlagader gehörig, zur Arterie gehörig, Schlagader-, Arterien-
artēriovēnōsus, a, um (arterio- + vēnōsus): anat. zur Schlagader und zur Vene gehörig, Schlagader und Vene verbindend, arteriovenös; in Anastomōsis artēriovenōsa
arthrologia, -aef.: Gelenklehre, Arthrologie; aus grch. arthron n: Gelenk und grch. logos m: Wort, Rede, Lehre
articulāris, e (articulus): Gelenk-, zum Gelenk gehörend, artikular
articulātiō, -ōnisf.: anat. Gelenk; sonst 1. Knotenkrankheit (an Weinstöcken), 2. gegliederter Vortrag; articulāre: gliedern
articulus, -īm.: (Dem. von artus): (kleines) Gelenk
artus, -ūsm.: Gefüge, Gelenk
ary-: anat. (in Zusammensetzungen) für die Cartilāginēs arytaenoideae: Gießbeckenknorpel
aryepiglōtticus, a, um (ary- + epiglōtticus): anat. vom Gießbeckenknorpel zum Kehldeckel verlaufend, zum Gießbeckenknorpel und zum Kehldeckel gehörend, aryepiglottisch
arytaenoīdēs, -is: anat. gießbeckenähnlich, einem Schöpfgefäß ähnlich; grch. arytainoeidēs; arytaina f.: Gießbecken, Schöpfgefäß, Schöpfkelle
arytaenoīdeus, a, um (arytaenoīdēs): anat. 1. gießbeckenähnlich, 2. zu etwas Gießbeckenähnlichem gehörend; in Cartilāgo arytaenoīdea (BNA): Gießbeckenknorpel
arytenoīdeus, a, um ↑ arytaenoīdeus
ascendēns, -entis: aufsteigend; P. P. A. von ascendere: aufsteigen
asexuālis, e: embryol. ungeschlechtlich; aus ↑ a- und sexuālis, e: zum Geschlecht gehörig, Geschlechts-; sexus, -ūs m.: Geschlecht
asper, era, erum: rauh; in Līnea aspera femoris
associātiō, -ōnisf.: anat. Verbindung; nlat, zu associāre: verbinden, vereinigen; vgl. engl./frz. association: Vereinigung, Verbindung, Verband, Verein, ital.: associazione f.: Verein, Gemeinschaft, span.: asociación f.
astēr, asterism.: Stern, grch. aster, -eros m.: Stern, Gestirn. Abgel.: Astronomie, Astrologie
astro-: anat. (in Zusammensetzungen) für: Stern-; grch. astron n.: Stern, Gestirn; vgl. astēr
astrocytus, -īm. (astro- + cytus): hist. sternförmige Gliazelle
asymmetricus, a, um: ungleichmäßig, nicht ebenmäßig, unsymmetrisch; neugebildet zu grch. asymmetros: ohne Ebenmaß, ohne Proportion; grch. asymmetria f.: Mangel an Proportion
atelīōticus, a, um: embryol. nicht gänzlich entwickelt, unentwickelt, unreif; aus ↑ a- und grch. teleiōtikos: vollendend, beendigend; teleiōsis f.: das Vollenden, die Reife
atlanticus, a, um (atlas): anat. zum Atlas gehörend, Atlas-, den ersten Halswirbel betreffend. – Im antiken Latein gab es das Adjektiv atlanticus, a, um: zum Atlasgebirge gehörend
atlanto-: anat. (in Zusammensetzungen) für Atlas: erster Halswirbel
atlantoaxiālis, e (atlanto + axiālis): anat. zum ersten und zum zweiten Halswirbel gehörend, den ersten und den zweiten Halswirbel betreffend
atlantodentālis, e (atlanto + dentālis): anat. zum ersten Halswirbel und zum Dens axis gehörend, den ersten Halswirbel und den Dēns axis betreffend
atlantoepistrophicus, a, um: anat. zum ersten und zum zweiten Halswirbel gehörend, den ersten und den zweiten Halswirbel betreffend; aus atlanto- und „epistrophicus, a, um“ zu epistropheus, -eī oder -ēos, m. (BNA, JNA): zweiter Halswirbel
atlantooccipitālis, e (atlanto- + occipitālis): anat. vom ersten Halswirbel zum Hinterhaupt verlaufend; in Membrana atlantooccipitālis
atlās, atlantism.: anat. der erste Halswirbel; grch. atlas, -antos m.: der Tragende, Träger. Personifiziert Atlas, grch. Sagenfigur, ein Titan, der das Himmelsgewölbe trug; aus Alpha protheticum (bzw. euphonicum) und grch. tlas, Partizip von tlēnai: „tragen“. Abgel.: Atlas (großes Gebirge in Nordafrika), Atlantischer Ozean
atrēticus, a, um: anat. nicht durchbohrt, ohne Öffnung, atretisch; zu grch. atrētos: undurchbohrt. -Abgel.: Atresie (angeborenes Fehlen einer Körperöffnung)
ātrio-: anat. (in Zusammensetzungen) für Atrium (cordis): (Herz)vorhof
ātrioventriculāris, e (atrio- + ventriculāris): anat. zum Vorhof und zur Kammer des Herzens gehörend, atrioventrikulär
ātrium, -iīn.: Vorhof, Vorraum; in Atrium cordis: Herzvorhof. Atrium dextrum: rechter Vorhof, Atrium sinistrum: linker Vorhof. Abgel.: Atrium (größter Saal des Hauses)
audītīvus, a, um: anat. dem Hören dienend, das Hören betreffend; das Hörorgan betreffend; audīre: hören
audītōrius, a, um: anat. das Hören betreffend, Hör-; antik auch: das Zuhören betreffend; zu audītor, -ōris m.: Hörer, Zuhörer; audīre: hören. Abgel.: Audienz
audītus, -ūsm.: Hören, Gehör(sinn); audīre: hören; in Organon audītus (BNA): Hörorgan
augmentālis, e: anat. Zuwachs-, Vermehrungs-, den Zuwachs oder die Vermehrung betreffend; augmentum, -ī n.: Vermehrung, Wachstum, Zunahme. Abgel.: Augment (Zusatz)
aurālis, e (auris): anat. Ohr-, das Ohr betreffend
auricula, -aef. (Dem. von auris): anat. 1. Ohrmuschel, 2. Auricula atriī: Herzohr; sonst kleines Ohr, äußeres Ohr
auriculāris, e (auricula): anat. 1. zur Ohrmuschel gehörig, 2. ohr-(muschel)förmig; eigtl. zu den Ohren gehörig
auriculo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Ohrmuschel-; auricula, -ae f.: Ohrmuschel
auriculotemporālis, e (auriculo- + temporālis): anat. die Ohrmuschel und die Schläfe betreffend, Ohrmuschel- Schläfen-
auris, -isf.: Ohr. Abgel.: Auskultation (Abhören), Aurikel („Öhrchen“, Primelart)
autonomicus, a, um: unabhängig, eigengesetzlich; zu grch. autonomos: nach eigenen Gesetzen lebend, unabhängig; autos: selbst und nomos m.: Gesetz
autophagicus, a, um: anat. selbstverzehrend, selbstverdauend; von grch. autophagos: selbstverzehrend
autosōma, -atisn.: anat. in beiden Geschlechtern übereinstimmendes Chromosom (nach Faller), an der Geschlechtsbestimmung nicht beteiligtes Chromosom (Medizin-Duden), homologes Chromosom, Autosom; aus grch. autos: selbst und sōma, -atos n.: Körper
autosōmālis, e (autosōma): zu einem in beiden Geschlechtern übereinstimmendem Chromosom gehörend, zum Autosom gehörend, das Autosom betreffend
avis, -isf.: Vogel; in Calcar avis: Vogelsporn. Abgel.: Aviatik (Flugtechnik)
axiālis, e (axis): anat. 1. Achsen-, zur Achse gehörend, die Achse betreffend, 2. den zweiten Halswirbel betreffend, zum zweiten Halswirbel gehörend
axilla, -aef. (Dem. von āla): Achsenhöhle
axillaris, e (axilla): anat. Achselhöhlen-, zur Achselhöhle gehörend, die Achselhöhle betreffend, „axillar“
axis, -ism.: anat. 1. der zweite Halswirbel, 2. Achse; sonst nur „Achse“ ; vgl. grch. axōn, -onos m.
axo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Axon: Achsenzylinder (des markhaltigen peripheren Nerven)
axoaxōnālis, e (axo- + axōnālis) hist. „zwischen zwei Achsenzylindern liegend“ (Faller) von Achsenzylinder zu Achsenzylinder verlaufend, zwei Achsenzylinder betreffend
axodendriticus, a, um (axo- + dendriticus): hist. „zwischen einem Achsenzylinder und einem Dendriten liegend“ (Faller), einen Achsenzylinder und einen Dendriten betreffend, Achsenzylinder-Dendrit-
axolemma, -atisn.: hist. Umhüllung, Grenzschicht des Achsenzylinders: aus ↑ axo- und grch. lemma, -atos n.: Rinde, Schale, Haut
axōn, axōnism.: hist. Achsenzylinder des markhaltigen peripheren Nerven; grch. axōn: Achse
axōnālis, e (axōn): Achsenzylinder-, den Achsenzylinder betreffend, zum Achsenzylinder gehörend
axonēma, -atisn.: hist. Achsenfaden: aus ↑ axo- und grch. nēma, -atos n.: Faden
axoplasma, -atisn.: hist. das Plasma des Achsenzylinders, „die Plasmasubstanz des Achsenzylinders“, (Ahrens); aus axo- und plasma, -atis n.: hist. Zellgrundsubstanz (antik: Gebilde, Geschöpf), von grch. plasma, -atos n.: das Gebildete, Geformte
axosōmaticus, a, um: hist. „zwischen einem Achsenzylinder und einem Zellkörper liegend“ , einen Achsenzylinder und einen Zellkörper betreffend. Achsenzylinder-Zellkörper-
axovasculāris, e (axo- + vasculāris): zwischen einem Achsenzylinder und einem Gefäß liegend (Faller), einen Achsenzylinder und ein Gefäß betreffend. Achsenzylinder-Gefäß-
azurophilicus, a, um: hist. „den Azurfarbstoff liebend“ , durch Azurfarbstoff anfärbbar, azurophil; von frz. l‘azur m.: Himmelsbläue, Meeresbläue, Lapislazuli (das Wort ist persischen Ursprungs und über das Arabische ins Französische eingedrungen) und grch. philikos: freundschaftlich, freundlich
azygos, on: anat. nicht gepaart, nicht verbunden (d. h. mit einer Arterie); grch. azygos: nicht zusammengejocht, unverbunden: die Bezeichnung phlebs azygos findet sich schon bei Galen. Die betreffende Vene ist nicht mit einer Arterie „gepaart“ , d. h. verläuft nicht mit einer Arterie zusammen
3 C
Peter Schulze, Christian Donalies
caecālis, e (caecum): anat. Blinddarm-, zum Blinddarm gehörend
caecum, -īn. (caecus): anat. 1. Blinddarm (zu ergänzen ist intestinum) 2. blind endender Hohlraum, in Caecum cūpulāre und Caecum vestibulāre; caecum ist substantiviertes Neutr. vom Adj. caecus
caecus, a, um: blind
caeruleus, a, um: blau, bläulich; in Locus caeruleus
calamus, -īm.: (Schreib)rohr, (Schreib)-feder, in Calamus scriptōrius (JNA): Schreibfeder, unterster Abschnitt der Rautengrube; grch. kalamos m.: Abgel.: Kalmus, Schalmei, nicht verwandt: Kalamität
calcāneāris, e (calcāneus): anat. zum Fersenbein gehörend, das Fersenbein betreffend, Fersenbein-
calcāneo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Fersenbein-
calcāneocuboīdeus, a, um (calcāneo- + cuboīdeus): anat. das Fersenbein und das Würfelbein betreffend, zum Fersenbein und zum Würfelbein gehörend
calcāneofibulāris, e (calcaneo- + fibulāris): anat. das Fersenbein und das Wadenbein betreffend, zum Fersenbein und zum Wadenbein gehörend
calcāneonāviculāris, e





























