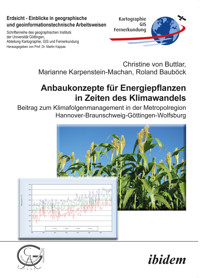
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Erdsicht - Einblicke in geographische und geoinformationstechnische Arbeitsweisen
- Sprache: Deutsch
Trotz vermehrter Anstrengungen in den letzten Jahren, den vom Menschen verursachten Klimaveränderungen zu begegnen, ist davon auszugehen, dass sich ein Klimawandel bereits spürbar vollzieht und sich weiter beschleunigen wird. Der Anstieg der mittleren Jahrestemperatur um 2 bis 3 Grad Celsius bis zum Jahr 2100, veränderte Niederschlagsmengen im Jahresverlauf und die Häufung extremer Witterungsereignisse stellen die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Das vorliegende Buch stellt auf der Basis von regionalen Klimaprognosen, die bis ins Jahr 2100 reichen, neue, an die veränderten Klimabedingungen in Niedersachsen angepasste Anbaukonzepte für Nahrung, Futterbau und Energie vor. Die Autoren zeigen auf, dass sich sowohl die Palette der bisher anbauwürdigen Pflanzenarten verändern wird, als auch die bisherigen regionalen Fruchtfolgen, die Produktionstechnik und die Pflanzenzüchtung sich in ihren Zielsetzungen an die klimatischen Veränderungen anpassen müssen, um die Produktivität der Standorte zu erhalten. Besonders in Zeiten des Klimawandels hat der umweltfreundliche, artenreiche Energiepflanzenanbau seine Berechtigung, da er dazu beiträgt, fossile Energieträger einzusparen und sich im Mix mit Nahrungs- und Futtermittelanbau Synergien mit Umwelt- und Naturschutzzielen ergeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Vorwort des Herausgebers
Die Reihe „Erdsicht – Einblicke in geographische und geoinformationstechnische Arbeitsweisen“ soll Forschungsergebnisse und Arbeiten im Bereich der Erdsystemforschung vorstellen. Die Betrachtung der Erde als System ist als Inhalt heutiger und zukünftigergeowissenschaftlicher Gemeinschaftsforschung dringend gefordert. Die Herausforderungen liegenu.a.in der Erforschung der vielfältigen Interaktionen zwischen den verschiedenen Teilbereichen des Systems Erde. Hierzu zählen Wechselwirkungen zwischen fester Erde und Atmosphäre, zwischen der Landoberfläche und der Hydrosphäre oder zwischen Biosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre.
Der Mensch steht dabei mit seinen zentralen Nutzungsansprüchen (Ernährung – landwirtschaftliche Nutzung – Ressourcennutzung–Energieversorgung) im Mittelpunkt eines vielfach vernetzten Erdsystems. Der Mensch verändert Landschaften und Atmosphäre und greift somit in alle Skalenbereiche des Erdsystems ein. Insofern müssen diese Veränderungen beobachtet und bewertet werden, damit Konzepte für ein nachhaltiges Erdsystemmanagement auf den unterschiedlichen Raum- und Zeitskalen entwickelt werden können.Die neuen Geoinformationstechniken (Geostatistik; Geographische Informationssysteme – GIS; luft- undsatellitengestützte Fernerkundungssysteme – Remote Sensing) helfen dabei,das System Erde zu beobachten und zu begreifen.
Der vorliegende Band mit dem Titel„Anbaukonzepte für Energiepflanzen in Zeiten des Klimawandels“von Christine von Buttlar, Marianne Karpenstein-Machan und Roland Bauböck greift ein aktuelles Problem der Klimafolgenforschung auf und knüpft an den bereits erschienenen ERDSICHT-Band „Bioenergie im Landkreis Göttingen. GIS-gestützte Biomassepotenzialabschätzung anhand ausgewählter Kulturen, Triticale und Mais“ thematisch an.
Die Kernfrage dabei ist, welche konkreten Auswirkungen der Klimawandel auf regionaler Ebene(z.B. Agrarproduktion, Energieversorgung)habenwirdund wiewir uns andie daraus resultierenden Problemeanpassen können?Hierzu sind neue Managementstrategien für unsere Landwirtschaft und Energieerzeugung gefragt. Das vorliegende Buch in der Reihe „ERDSICHT“ fasst die Ergebnisse des interdisziplinären Forschungsprojektes „Regionales Management von Klimafolgen durch nachhaltige standort- und klimaangepasste Anbaukonzepte für Energiepflanzen“ zusammen und liefert wichtige Kernaussagen für zukünftige Entscheidungsträger.
Martin Kappas
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A1B
Klimaszenario (Zeiträume 2021-2050 sowie 2071-2100)
BBCH
Entwicklungsstadien
BFI
Blattflächenindex
BioSTAR
Biomass Simulation Tool for Agricultural Resources
BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung
BTL
Biomass to Liquid
C
Kohlenstoff
CC
Cross Compliance
CCM
Corn Crob Mix
CLM Modellierung
Climate Local Model-Daten
CO2
Kohlenstoffdioxid
dt
Dezitonne
DWD
Deutscher Wetterdienst
ETK
Evapotranspirationskoeffizient
FAO (and Water Division)
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Ff
Fruchtfolge
GIS
Geoinformationssysteme
Gö
Göttingen
GPS
Ganzpflanzensilage
ha
Hektar
HAWK
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hi
Hildesheim
I+K-Plattform
Internetportal Klimafolgenmanagementprojekt
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
IZNE
Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung der Universität Göttingen
K
Kalium
kg
Kilogramm
KUP
Kurzumtriebsplantage
l
Liter
LBEG
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
LBG
Landsberger Gemenge
LG
Leitgebiet
LK
Landkreis
LSKN
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
Mf
Marktfrucht
Mg
Magnesium
mm
Millimeter
N
Stickstoff
Nd.
Niederschlag
nFK
nutzbare Feldkapazität
nFKWe
nutzbare Feldkapazität des effektiven Wurzelraumes
NO2
Stickstoffdioxid
P
Phosphor
pH
pH-Wert, Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung
PK
Phospor-Kali
RA
Winterraps
RME
Rapsmethylester
RO
Roggen
RS-US
Rotschwingel-Untersaat
S
Schwefel
Sommerhj.
Sommerhalbjahr
SWOT-ANALYSE
Stärken- Schwächen-Analyse
t
Tonne
Temp.
Temperatur
TM
Trockenmasse
UE
Celle (Uetze)
US
Untersaat
W
Winter
WG
Wintergerste
WG-US
Weidelgras-Untersaat
Winterhj.
Winterhalbjahr
WI-US
Wicken-Untersaat
WW
Winterweizen
ZR
Zuckerrüben
1Einleitung und Zielstellung
1.1Forschungsverbundprojekt „Klimafolgenmanagement“
Das vorliegende Buch„Regionales Management von Klimafolgen durch nachhaltige standort- und klimaangepasste Anbaukonzepte für Energiepflanzen“wurde imRahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojektes „Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen“erstelltund deckt im Kontext des großen Verbundprojektes den Arbeitsbereich Energiepflanzenanbauab.
Das Forschungsverbundprojektist Bestandteil der Fördermaßnahme „klimazwei – Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimaauswirkungen“ des Rahmenprogramms des BMBF: „Forschung für Nachhaltigkeit“. Das dreijährige Projekt wurde im Juni 2011 beendet.Eswurde das primäre Ziel verfolgt, eine übertragbare Methodik für die Entwicklung von Managementstrategien zur Klimaanpassung zu erarbeitenund in ausgesuchten Teilräumen der Metropolregion umzusetzen. Dabei wurde eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis angestrebt.
Um diese Ziele zu erreichen,wurden die Arbeitsbereiche „Basiswissen“, „Wirkungsbereiche“ sowie „Networking/Bildung“ 7 Teilprojekten zugeordnet. Abbildung 1 zeigt die Struktur des Verbundprojektes.Im Teilprojekt „Energiepflanzen“ (FE2) wirkten die Forschungsinstitutionen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), das Interdisziplinäre Zentrum für Nachhaltige Entwicklung der Universität Göttingen (IZNE), die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) und die Geo-Net Umweltconsulting GmbH zusammen. In diesem Teilprojekt wurden auf der Basis der bereitgestellten Klimaprognosen durch die Meteorologiegruppe (FE1) Strategien für den Energiepflanzenanbau und die -nutzung vor dem Hintergrunddes Klimawandels erarbeitet.
Abbildung1: Struktur des Forschungsverbundprojektes (www. klimafolgenmanagement.de)
1.2Teilprojekt Energiepflanzen
Schwerpunktdes Teilprojektes „FE 2Energiepflanzen“ ist die Entwicklung vonKonzepten zur Sicherung einer nachhaltigen Biomasseproduktion und Bioenergieerzeugung unter veränderten Klimabedingungen.
Die meteorologischen Grundlagenzur prognostizierten Klimaveränderungwurdendurch die UniversitätHannoverim Teilprojekt1in Form von Climate Local Model-Daten(CLM-Daten)weiter bearbeitet und als hoch auflösende regionale Klimadatenmit einerAuflösungvon1x1 km für drei Zeiträume, 1961-1990(Ist-Zustand), 2021-2050 (Ende der ersten Hälfte des Jahrhunderts) und 2071-2100 (Ende der zweiten Hälfte des Jahrhunderts)für die Projektpartnerundfür die darauf aufbauendenweiteren Bearbeitungsschritteim Teilprojekt Energiepflanzen (Abb. 2)bereitgestellt.
Abbildung2:Struktur und Arbeitsbereiche des Teilprojektes Energiepflanzen (www.klimafolgenmanagement.de)
Schwerpunktder Arbeitendes IZNEinnerhalb dieses Projektesist die Bewertung dieser prognostiziertenKlimafolgen für den Anbau von Energiepflanzen innerhalb der Metropolregion.
In einem ersten Schrittwirdeine Bestandsaufnahme zur Erfassung der Anbaubedingungen in der Metropolregion im Hinblick auf die Standorteigenschaften der potenziell zur EnergieerzeugunggeeignetenEnergiepflanzen durchgeführt.
§Es erfolgt eine Auswertung der Klimadatenfür die Vegetationszeiten derwichtigsten Kulturen der Metropolregionentsprechend ihrerunterschiedlichenTemperaturansprüche im Hinblick auf die künftigen Anbaubedingungen.
§Vertiefend werdenfür drei repräsentative Leitgebietein der Metropolregion für standortangepassteEnergiepflanzen Ertragsprognosenfür dreiZeiträume (Ist-Zustand,2021-2050und2075-2100)mit einem Pflanzenwachstumsmodellmodelliert.Anhand derstatistischen Datender Metropolregion erfolgteine ValidierungdeseingesetztenPflanzenwachstumsmodells „BioSTAR“vonBAUBÖCK(2010, 2013).
§Aufbauend auf den Erkenntnissen aus denKlimaprognosen, der Wachstums- und Entwicklungsgeschwindigkeit und der Erträge der Energiepflanzen auf Basis der pflanzenbaulichen Modellierung in den drei Prognosezeiträumenwerdenregional angepasste Fruchtfolgenfür zwei in der Metropolregion typische Standorteigenschaftenentwickelt.DieseFruchtfolgen werden für unterschiedliche „Produktlinien“ zur Erzeugung von Bioenergie ausEnergiepflanzenentwickelt.Berücksichtigt werden Biogas-,Ethanol-, Biodiesel-und BTL-orientierte Fruchtfolgen als reine Energiefruchtfolgen sowie als Mischfruchtfolgen mit Marktfrüchten. Für die thermische Nutzung werden Dauerkulturen vorgeschlagen.
§AbschließendwerdenMaßnahmen zur Kulturartenwahl, Fruchtfolgegestaltung, Düngeplanung, Bodenbearbeitung und Pflanzenzüchtungvorgeschlagen und Empfehlungen ausgesprochen. Es werdensowohldiePerspektivenzur Optimierungals auchdieGrenzen der Anpassungaufgezeigt.
Die wichtigsten Ergebnissesind auchauf derim Rahmen des Forschungsvorhabens entwickelteninternetbasierten Informations- und Kommunikationsplattform (I+K-Plattform: www.klimafolgenmanagement.de) für Gemeinden, Verwaltungen und andereEntscheidungsträgerverfügbar.
2Material und Methoden
2.1Gebietsübersicht und Standortbedingungen der Leitgebiete
Die folgende Abbildung stellt die Lage der Metropolregion Hannover-Brauschweig-Göttingen-Wolfsburgim südöstlichen TeilNiedersachsens sowie die Lage der drei für vertiefende Untersuchungenausgewählten Leitgebiete dar:
Abbildung3:Lage der Metropolregion und der Leitgebiete in Niedersachsen
Derim südlichen Teil der Metropolregion gelegeneLandkreisGöttingenrepräsentiertlandwirtschaftlich ertragreicheBödenmitmittlerennutzbarenFeldkapazitätenvon 183 mmund im Mittel 62 Bodenpunktenbei gleichzeitig mittlerem bis hohem Niederschlagsniveau.Die Gemeinde Krebeck-Wollbrandshausen dient in diesem Leitgebiet als Modellgemeinde für weiterführende Untersuchungenz.B. für die Ertragsmodellierungenvor dem Hintergrund des Klimawandels.
Derim zentralen Bereich der Metropolregion gelegeneLandkreisHildesheimweistmit Göttingen vergleichbare Klimabedingungenabermitgeringerenmittlerennutzbaren Feldkapazitäten von 132 mmund geringerenBodenpunkten(54)auf.Die Gemeinde Alfeld dient im Landkreis Hildesheim als Modellgemeine für weiterführende Untersuchungen.
Im nördlichen Bereich der MetropolregionimLandkreisCelleüberwiegensandige BödenmitnutzbarenFeldkapazitätenvon im Mittel 113mm und 54 Bodenpunktenbei gleichzeitigim Vergleich zu den anderen Leitgebietengeringem Niederschlagsniveau.Hier werden dieinder Metropolregion höchsten Jahresmitteltemperaturengemessen.Das LeitgebietCellestellt schonheute ein klassisches BeregnungsgebietdarundohneZusatzbewässerungwürdendeutlichgeringereErtragsleistungenalsdiein der Statistik des Landes ausgewiesenen Erträgeerreicht.Die Gemeinde Uetze dient im Leitgebiet Celle als Modellgemeinde für weiterführende Untersuchungen z. B. zur Ertragsmodellierung.
2.2CLM Daten und Klimaszenarien
Zur Beschreibung von Auswirkungen des Klimawandels auf die künftigen Anbaubedingungen und Ertragsleistungen sowie Ableitung der Anpassungsstrategien wird auf die Auswertungen des Teilprojektes Klimawandel(FE1)zurückgegriffen.Innerhalb des Verbundprojektes wurde sich geeinigt,bei den Zukunftsszenariendas Szenario A1B desIntergovernmental Panel onClimate Change (IPCC) der Vereinten Nationen zu verwenden.Das A1B Szenario istunter den 40 verschiedenen Szenarien eines, das oft für Klimaprojektionen als Referenz herangezogen wird.Bei diesem Szenario wird das Ziel,die Erderwärmung auf 2°C zu begrenzen zwar verfehlt, eine extreme Klimaveränderung wird aber vermieden(IPCC, 2007).
Das Teilprojekt „Klimawandel“ bearbeitete dieCLM- Klimadaten, die in einer Auflösung von20x20 kmvorlagen und regionalisierte dieseauf eine Auflösungvon1x1 kmmit demLokalmodell FITNAH.Es wurde einVergleich der Klimaszenarien aus den Perioden 1961-1990, 2021-2050 und 2071-2100 durchgeführt(KRAUSEu. GROSS,2011).
Niederschlags- und Temperaturänderungen in diesen Zeiträumen sind Grundlage der in FE 2 durchgeführten Ableitung der Vegetationszeiten sowie der Ertragsmodellierung. Allerdings wurde zur Beschreibung der aktuellen Ausgangssituation auf regionale Mittelwerte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Zeitraum 1961-1990 zurückgegriffen, da die modellierten Klimadaten des Zeitraums 1961-1990(Ist-Zustand)insbesondere beim Niederschlag deutliche Abweichungen von den gemessenen DWD-Daten zeigten.In Anlehnung an die DWD-Daten wurden die modellierten Klimadaten für die Prognosezeiträume 2021-2050 und 2071-2100 für die Niederschläge angepasst.
2.3Beschreibung desKlimasundderphänologischen Phasenunterschiedlicher Kulturenim Ist-Szenario
Als Grundlage einer Szenarien-Entwicklung zur Beschreibung des Klimawandels in der Zukunft erscheint es sinnvoll, zuerst mit einem Rückblick indie Vergangenheit zu beginnen.Wie lässt sich das aktuelle Klima beschreiben?Mit welchenVeränderungenhaben wir schon heute zu tun? Lassen sich in den letzten rund 60 Jahren Trends erkennen? Wie haben sich die Erträge der regionaltypischen Kulturen entwickelt und sindhierebenfalls Trends zu erkennen? Sind Änderungen in der phänologischen Entwicklung dieser Kulturen feststellbar? Und lassen sich Zusammenhänge zum Klima oder anderen Faktoren wie dem Züchtungs- oder technischen Fortschritterkennen?Umdiesen Fragen nachzugehen, wurden zu Beginn des Vorhabens Klimadaten und phänologische Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes fürNiedersachsenaus der Vergangenheit fürdie drei Leitgebiete ausgewertet.
Klimadaten:Die Klimadaten Niederschlagssumme und Tagesdurchschnittstemperatur liegen für den Zeitraum von 1951 bis 2007 als Tageswerte vor und wurden vom DWD an jeweils einer Messstelle je Landkreis erhoben. Diese Daten wurden durch accessbasierte Auswertungen zu Monats- bzw. Halbjahres- und Jahreswerten und zu phänophasenbezogenen Summen- bzw. Mittelwerten verrechnet. Es erfolgten ebenfalls Analysen, in denen die Jahreswerte über zwei Zeitintervalle (1961-1990; 1991-2007) gemittelt wurden. Diese Vorgehensweise trägt der Kenntnis Rechnung, dass eine Beschleunigung des Klimawandels ab den 90igerJahren erfolgte (Chmielewski,2007a). Die Analysen wurden für die Leitregionen und für Niedersachsen durchgeführt.
Phänologische Daten:Phänologische Datenwerden ebenfalls vom DWD an Leitstandorten jährlich erfasst. Hier wurde jeweils auf eine das Leitgebiet am besten repräsentierende Messstelle zurückgegriffen.Es wurdendie TerminefürAussaat, Feldaufgang, Blüte, Gelbreife, Ernteerfasst, wobei nicht immerfürallePflanzenarten Datenzuallen Jahren bzw. anallenStationen vorlagen. So konntenfür die Kultur Mais aufgrund mangelnder Datengrundlage keine Aussagen getroffen werden.
Ertragsdaten:Die Ertragsdaten werden vomLandesamt für Statistik Niedersachsen (LSKN) auf Gemeindeebene vorgehalten und wurden für diese Auswertung für den Zeitraum 1949 – 2007 sowie für den kürzeren Zeitraum 1978 bis 2008 verwendet.Ab1978wurden u.a.die Erhebungsräumevom LSKNneu definiert, so dass hier eigene Anpassungen zur Erstellung vergleichbarer Datenreihen erforderlich waren.
2.4Ertragsdaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen
RegionaleErtragsdatenund Flächennutzungsdatenwerden von Landesamt für Statistik Niedersachsen auf Gemeindeebene vorgehaltenundalle3 -5 Jahre fortgeschrieben.DieseDaten wurden für die gesamte Metropolregion auf Landkreisebene und zur Beschreibung der aktuellen Situation bisheute ausgewertet. Neben derDarstellung von Ertragsentwicklungen wurden Veränderungen der Fruchtartenverhältnisse betrachtet. Ferner gehen die mittleren Erträge der Leitgebiete als Grundlage zur Beschreibung des Ist- Zustandes und alsReferenzfür diemodellierten Erträge der Klimaszenarien aus den Perioden 1961-1990, 2021-2050 und 2071-2100in die Ergebnisdarstellung ein (Kap.4.2).
2.5Ertragsmodellierung mit BioSTAR
Für die Modellierung der Biomasseerträge in den drei Leitgebieten wurde das Biomasseertragsmodell BioSTAR (Biomass Simulation Tool for Agricultural Resources) (Bauböck, 2010) verwendet.
Bei dem Modell BioSTAR handelt es sich um ein kohlenstoffbasiertes Pflanzenmodell (Azam-Ali, S.N. et al., 1994), mit dem anhand von Eingangsklimadaten (Niederschlagshöhe, Temperatur, Globalstrahlung, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit) sowie dem verfügbaren Bodenwasser (Feldkapazität)und Veränderung des Blattflächenindexes in der Vegetationszeit der Kulturender Ertragszuwachs im Verlauf der Vegetationsperiode simuliert wird(s.Abbildung4).
§Die Kohlenstoffaufnahme wird anhand von kulturspezifischen Lichtsättigungskurven sowie den gemittelten, täglichen Quantenflussdichten dargestellt.
§Die Bruttofotosyntheserate sowie die Dissimilation (Veratmung) werden über die Tagesmitteltemperatur erhöht oder erniedrigt und ergeben zusammen die Nettoprimärproduktion.
§Für die Simulation des Wasserhaushaltes im SPAC (soil plant atmosphere continuum) werden die täglichen Transpirations- und Evaporationsraten gesondert berechnet.
§Für den Anteil der Bodenevaporation wird die über den Strahlungsansatz berechnete Verdunstungsmenge nach Turc (DVWK, 1996) mit einem vom Bodenbedeckungsgrad (Blattflächenindex) abhängigen Faktor multipliziert (Merthaet al., 2006).
§Die tägliche Transpirationsrate ist im Modell an die Brutto-Kohlenstoffassimilation gekoppelt und wird für die Simulation von Trockenstress über den Stomatawiderstand zusätzlich reguliert.
§Für die Darstellung der Pflanzenentwicklung wird im Modell ein temperaturabhängiger, täglicher Entwicklungsstand berechnet. Die Skala dieser Entwicklung ist dimensionslos und stellt die Pflanzenentwicklung im Gleitkommabereich von 0 (Bestellung), über 1 (Blüte) bis 2,1 (Vollreife) dar (Penning de VrieS, F.T.W.et al., 1989).
§Der Blattflächenindex (BFI) wird im Verlauf der Pflanzenentwicklung anhand einer vom Entwicklungsstand abhängigen Kurve simuliert. Diese Kurve hat im Modell nur dann einen optimalen Verlauf, wenn kein Trockenstress auf den modellierten Bestand einwirkt. Trockenstress reduziert im Modell die Nettoassimilationsrate, die Transpiration sowie die Entwicklung des BFI.
Das Modell ist im Vergleich zu komplexeren Pflanzenmodellen (CERES, DSSAT, EPIC) einfach aufgebaut, es benötigt allerdings auch nurzehnpflanzenspezifische Eingangsparameter. Trotz des einfachen Modellaufbaus werden alle wesentlichen, den Entwicklungsverlauf und die Biomassebildung von Agrarpflanzen beeinflussenden Faktoren hinreichend genau erfasst, umklima- undbodenabhängige Ertragssimulationen durchzuführen. Je nach Kultur und Bodenart liegt der Fehler des Modells bei etwa +/- 15% der real gemessenen Biomasseerträge(Bauböck, 2013).
Abbildung4:Flussdiagrammmit Eingangsparametern, die in das BiomasseertragsmodellBioSTAReinfließen
3Bestandsaufnahme
3.1Vom Klimawandel betroffeneProduktionsfaktoren des Pflanzenbaus
Die vier entscheidenden Größen des Klimawandels sind der erwartete Anstieg der Jahresdurchschnittstemperaturmit trockenerenundlängeren Sommern, die Veränderung derNiederschlagsverteilunghin zu feuchteren,milderenWintern bei nahezu gleichbleibendem Jahresniederschlag,ein Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre und die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen(Groß2007).Modellrechnungendes Teilprojektes „Klimawandel“zur Frage, mit welchen Extremereignissenin der Metropolregionin der Zukunft zu rechnen ist, ergebenkeinen Trend zu mehr Extremniederschlagsereignissen, wohl aber zu stärkeren Jahresvariabilitäten.AuchHitzeperioden (Temperaturen > 30°C)werden laut dieser Prognosen zunehmen (Groß et al., 2012).
Prinzipiell gilt, dass sich Pflanzen im Wachstum auf langsame Änderungen besser einstellen und diese ausgleichen könnenals auf Extremsituationen. Das Gleiche lässt sich für die ackerbaulichen Anpassungsmöglichkeiten, sei es im produktionstechnischen oder auch im züchterischen Bereich, feststellen.
Die folgende Übersicht stellt die vom Klimawandel betroffenen Aspekte des Pflanzenbaus nachHOFFMANN-BAHNSEN(2011) in der Übersicht dar.
Tabelle1:Vom Klimawandel betroffene Produktionsfaktoren des Pflanzenbaus
Treibende Faktoren im Klimawandel:
Betroffene Produktionsfaktoren des Pflanzenbaus:
Anstieg der Temperatur
Ertragsstabilität und -qualität
Veränderung der Niederschläge
Standorteignung
Anstieg der CO2Konzentration
Fruchtfolgegestaltung
Verstärkte Klimavariabilität
Wasserverbrauch- und Verfügbarkeit
Humus- undNährstoffhaushalt
Schädlinge, Krankheiten, Unkräuter
Biodiversität
Quelle:nachHoffmann-Bahnsen,www.umwelt.sachsen.de/lfulg/download/140108_Hoffmann_Bahnsen.pdf 6/2011
Deutlich wird, dass das ganze Anbaugefüge vom Klimawandel betroffen ist. Unter geänderten Standortbedingungen reagieren Kulturen mit verändertem Wasser- und Nährstoffbedarf, sindeinem sich ändernden Krankheitsdruck und Unkrautdruck ausgesetzt und reagieren mit geänderten Ertragsquantitäten und -qualitäten.HOFFMANN- BAHNSEN(2011)unterscheidet hier weiter zwischen definierenden Faktoren wie dem Klima, limitierenden Faktoren wie der Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffensowie reduzierenden Faktoren, nämlich dem Unkraut-undSchädlingsdruck sowieevtl. veränderter Schadelementverfügbarkeit.
Tabelle2:Ertragsbestimmende Faktoren von Kulturpflanzen
Definierende Faktoren:
CO2
Strahlung
Temperatur
Kultureigenschaften
Limitierende Faktoren:
Wasser
Stickstoff
Phosphor
Reduzierende Faktoren:
Schädlinge
Krankheiten
Unkräuter
Schadstoffe (Ozon…)
Quelle:nachHoffmann-Bahnsen,www.umwelt.sachsen.de/lfulg/download/140108_Hoffmann_Bahnsen.pdf6/2011
Dem Klima als definierendem Faktor kommt damit die entscheidende Rolle für die Entwicklung von standortangepassten Anbaukonzepten heute und perspektivisch unter den sich ändernden Voraussetzungen im Klimawandel zu.
Die Folgen des Klimawandels auf dieStandorteignung der Kulturarten, die Ertragsleistung und die Fruchtfolgegestaltung werden inden folgenden KapitelnimAllgemeinenund mit Regionalbezug untersucht.
Die Auswirkungen des Klimawandels auf diePflanzengesundheit wurdenanhandaktueller Publikationen recherchiert.Tabelle3stellt eineLiteraturübersichtdermöglicher Folgen des Klimawandelsaufdie Pflanzengesundheit dar(u.a.JUROZECKet al. (2009),Seidel(2010),Chmielewski(2007b),GEROWITTu.STRUCK2008,KLINGENHAGEN(2010),MEINDLSCHMIDTu.Schröder(2009),METZet al. (2004)).
Tabelle3:Folgen des Klimawandels für die Pflanzengesundheit
Hohe Temperaturen + unausgeglichene Wasserversorgung:
§Generell Beeinträchtigung d. Pflanzengesundheit
§Wirkung von Pflanzenschutzmitteln wird witterungsbedingt unsicherer
§Eingeschränkte Wirkung von Bodenherbiziden bei fehlender Feuchte
§Durch erhöhte UV Strahlung evtl. veränderte Wirkdauer von Pflanzenschutzmitteln
Starkregenereignisse / Überflutungen:
§Begünstigung von Wurzelfäulen
Hohe Temperatur und hohe Niederschläge/Feuchte:
§Zunahme von Rostkrankheiten, Netzfleckenkrankheit,Cercospora
§Zunahmevon Mehltau, Halmbruch, Septoria
§Förderung von Schnecken, Milben, Bakterien, Insekten wie Kartoffelkäfer und Blattläuse
Trockenperioden:
§Förderung bestimmterSchaderreger wie Spinnmilben
§Zunahme wärmeliebender Unkräuter (z.B. Hirsen, Franzosenkraut, Gänsefuß)
§Zunahme trockenheitsresistenter Unkräuter (z.B. Distel mit unterirdischen Speicherorganen)
§Zunahme von Herbstkeimern aufgrund milder Winter (z. B. Acker-Fuchsschwanz, Klettenlabkraut)
§Mögliche Einwanderung schwer bekämpfbarer Arten (z. B. Ambrosia)
§Förderung von Krankheiten
Milde Winter:
§Förderung der Überwinterungvon Schaderregern
§Einwanderung bisher nicht heimischer Erreger wie z.B. Maiswurzelbohrer
Auch im Klimawandel wird es unterschiedliche klimatische Ausprägungen mit jeweils verschiedenen Folgen für die Pflanzengesundheit geben. Problematisch für die Pflanzengesundheit und die Konkurrenzkraft der Kulturen erscheinen die in Folge höherer Wintertemperaturen besseren Überwinterungsmöglichkeiten von Schaderregern und im Herbst auflaufende Unkräuter und die Verbreitung neuer, wärmeliebender Unkräuter. Gehen warme Temperaturen mit Niederschlägen einher, so vermehren sich Blattkrankheiten wie Rost und Mehltau sowie Spinnen, Milben und Bakterien. Treffen hohe Temperaturen auf Trockenheit, kann dagegen eine bessere Pflanzengesundheit, aber höherer Schädlingsbefall erwartet werden. Die Veränderung des Klimas geht tendenziell mit einer zunehmenden Unsicherheit bei der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln und Bodenherbiziden einher.
3.2Keimtemperaturen, Wasserbedarf und kritische Entwicklungsstadien landwirtschaftlicher Kulturen
Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden die relevanten Kulturen anhand einer Literaturrecherche hinsichtlich ihrer pflanzenphysiologischen Eigenschaften und insbesondere des Wasserbedarfs charakterisiert. Die folgende Tabelle stellt eine Übersicht des Wasserbedarfs und der klimatisch sensiblen Phasen der wichtigsten Kulturen nachFAO and Water Division(1996)sowieEHLERS (1996)undGEISSLER(1988)zusammen.Am niedrigen Transpirationskoeffizientenwird derVorteil derC4-Kulturen Mais und Sorghum hinsichtlich des niedrigen Wasserbedarfs je produzierter Einheit Trockenmasse deutlich. Auch die Zuckerrübe hat eine hohe Wassereffizienz. Unter den Getreidearten hat der RoggendengeringstenTranspirationskoeffizienten. EinenhöherenWasserbedarf haben die Kulturen Raps, Kartoffeln, Sonnenblumen und Gräser. Auch Soja hat einen hohenspezifischenWasserbedarf, ist aber gut an warme Klimataangepasst.Der Wasserbedarf je Flächeneinheit wird von der Ertragsleistung der Kulturen mitbestimmt.So kann eine Kultur wie der Mais trotz eines geringenTranspirationskoeffizienten aufgrund seiner hohen Ertragsleistung einen hohen Wasserbedarf jeHektar haben und damit auch ggf. Zusatzwasserbedarf zur Entfaltung seiner Ertragsleistung. Die Angaben zum Beregnungsbedarf sind als grobe Orientierungswerte zu verstehen und könnenin Einzeljahren abweichen.





























