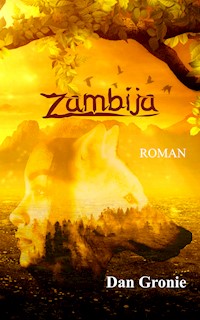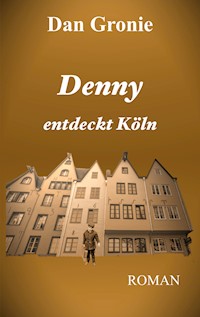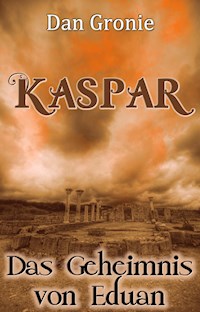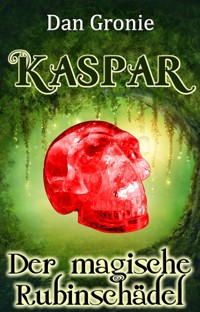Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nachdem Bill Clayton alias Andor das Weltentor auf der Erde vernichtet hat, ist er auf dem Planeten Pelos gestrandet. Bill ist im Besitz eines Supervirus, mit dem alle Energieversorgungsanlagen der Palets abgeschaltet werden können. Der Kopfgeldjäger Horyet wechselt die Seiten und soll Bill bei seiner Mission unterstützen, diesen Supervirus in die feindliche Hauptbasis einzuschleusen. Kann Bill ihm wirklich vertrauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dan Gronie
Andor - Gestrandet auf Pelos
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Erweitertes Impressum
Bücher von Dan Gronie
Widmung
Prolog
Mein lieber Scholli!
Achtung, ein Mulk!
Vor verschlossener Tür
Besser ein dickes Ende als ein schwerer Anfang
Bis auf die Knochen
Eine Bombe für den Feind
Von Höhlen habe ich die Schnauze voll
Ran an den Feind!
Tausend Tode sterben
Aus der Ferne heimgekehrt
Kommunikationsgenie
Das Lallen geht mir auf die Nüsse
Friedliche Ruhe ist besser als Ruhe in Frieden!
Zum Abschied lächeln oder weinen?
Freund oder Feind
Narren zum Altar karren
Personen-, Orts-, und Sachverzeichnis
Danksagung
Impressum neobooks
Erweitertes Impressum
Alle Rechte liegen beim Autor. Die Verbreitung dieser E-Book-Ausgabe in jeglicher Form und Technik, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.
Titel: Andor - Gestrandet auf Pelos
Copyright © 2021 by Dan Gronie
Umschlaggestaltung: Dan Gronie,
Umschlagabbildungen: © Olivia Grand,
Bild von Felix Mittermeier auf Pixabay,
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay,
Bild von Peter Fischer auf Pixabay
E-Book-Ausgabe: neobooks, München
Vollständige E-Book-Ausgabe April 2021 entspricht der im BoD - Books on Demand Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage April 2021
ISBN: 978-3-7531-8546-0
Bücher von Dan Gronie
ANDOR
Band 1: Rätsel der Vergangenheit
Band 2: Reise durch das Weltentor
Band 3: Gestrandet auf Pelos
Weitere Bücher von Dan Gronie
Band 1: Kaspar - Die Reise nach Feuerland
Band 2: Kaspar - Der magische Rubinschädel
Band 3: Kaspar - Das Geheimnis von Eduan
Estalor - Rückkehr der Höllenschlange
Denny entdeckt Köln
Widmung
Für meine Frau Ursula.
Du bringst die Sterne zum Leuchten.
Prolog
Es war ein kalter Tag. In der Nacht hatte Frost geherrscht, und am frühen Morgen lag Reif auf den Wiesen und Feldern. Trotzdem schlich Horyet aus dem Haus seiner Eltern. Er war ein Kind auf der Suche nach Abenteuern und liebte den düsteren Sumpf.
Bis hierher und bloß nicht weiter, sagte seine Mutter stets zu ihm, denn jenseits dieses ein Meter hohen Metallzaunes begann eine andere Welt, eine unheimliche Welt, eine Welt voller Gefahren und voller Geheimnisse, und genau das war es, was Horyets Neugierig geweckt hatte – die Geheimnisse des Sumpfes. Er hatte schon einmal die Warnungen seiner Mutter missachtet, hatte sich bei Nacht aus dem Haus geschlichen, und war jenseits dieses Zaunes allein unterwegs gewesen.
In dieser Jahreszeit wirkte der Sumpf meistens düster und grau. Unheimliche Nebelschwaden zogen dann oft über ihn hinweg, doch das alles würde Horyet nicht abhalten, noch einmal über den verbotenen Zaun zu steigen, um diese mystische Welt zu erkunden.
Die vergangene Nacht war eine ganz besondere Nacht gewesen, denn es hatte Vollmond geherrscht. Horyet hatte in dieser Nacht genau beobachtet, wie der Vollmond bleich wie ein runder Ausschnitt mitten in der Schwärze gestanden hatte. Es war ein fahler, unwirklicher Lichtschein gewesen, den der Mond seinem Heimatplaneten entgegenschickt hatte. Sein Vater hatte ihn bei solch einer Vollmondnacht schon einmal mitgenommen und war mit ihm zum verbotenen Zaun gegangen. Seine Mutter hatte nichts davon gewusst. Er und sein Vater hatten den Sumpf beobachtet und gesehen, wie sich der fahle Mondschein auf der dunklen Fläche des Sumpfes widergespiegelt hatte. Das Mondlicht hatte den zahlreichen Sumpfgräsern und Sumpfgewächsen einen leichenhaften Anstrich gegeben. Der unheimliche Lichtschein des Mondes hatte sich dabei auf der Wasseroberfläche des Sumpfes widergespiegelt, und Horyet hatte dabei das Gefühl gehabt, als müssten sich jeden Augenblick die Toten aus diesem Sumpf erheben.
Bis hierher und nicht weiter!
Ja, das hatte auch sein Vater in dieser Nacht zu ihm gesagt. Horyet hatte seinen Vater gefragt, warum niemand den Sumpf betreten durfte. Jeder wusste angeblich Bescheid, dass etwas Schlimmes folgen würde, wenn jemand diese Regel brechen sollte. Doch die Erklärung seines Vaters hatte Horyet keinesfalls zufrieden gestellt. In dieser Nacht hatte er sich fest vorgenommen, eines Tages diese Regel zu brechen, um das Geheimnis zu lüften.
Sein Vater hatte ihm oft erzählt, dass nach einer Vollmondnacht manchmal geheimnisvolle Irrlichter über die schwarze Wasserfläche des Sumpfes tanzen würden.
Genau aus diesem Grund war Horyet auch an diesem Morgen ganz früh aufgebrochen. Es war noch dämmrig, aber er hatte ja eine Lampe dabei. Horyet begab sich also auf die Suche nach diesen mysteriösen Lichtern.
Heute war der ersehnte Tag für Horyet gekommen, an dem er dem Geheimnis auf den Grund gehen wollte. Er stand vor dem Metallzaun und starrte hinüber, dann brach er wieder die Regel und kletterte über den Zaun. Er knipste die Lampe an und hielt inne. Dieses Mal ging er nach rechts entlang des Zaunes.
Seine Herz raste vor Aufregung als er einen ihm unbekannten schmalen Pfad entdeckte. Er warf einen Blick zurück zum Zaun, dann wandte er sich wieder dem Pfad zu und folgte ihm.
Nach einer Weile blieb er kurz stehen. Es war widerlich. Je weiter er sich vom Zaun entfernte, desto stärker roch es nach Verwesung. Sollte er auf die Warnungen seines Vaters hören und umkehren?
Nein. Trotz aller Warnungen folgte er dem Pfad. Der Untergrund wurde weicher und federte stark. Horyet blieb wieder stehen. Er blickte nach rechts, dort wuchs das Gras ziemlich hoch. Zu seiner linken Seite standen karge Bäume in einer schmutzigen Wasserlandschaft.
Was wäre, wenn der Untergrund unter seinen Füßen plötzlich nachgeben würde? Der Sumpf würde ihn wie ein gieriges Monster verschlingen, und es würde später an dieser Stelle noch intensiver nach Verwesung riechen. Horyet schüttelte sich bei diesem Gedanken.
Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen und folgte dem Pfad. Einen Rückzug hatte er sich aus dem Kopf geschlagen.
Nach einer Weile wurde der Untergrund unter seinen Füßen wieder etwas härter und der Boden federte nicht mehr so stark.
Was würden seine Eltern sagen, wenn sie wüssten, dass er sich hier im Sumpf herumtrieb? Es war ja auch zum Verzweifeln, alle schienen etwas über diesen Sumpf zu wissen, aber es gab niemanden, seine Eltern inbegriffen, der ihm etwas genaues über den Sumpf erzählten wollte.
Was war das da vorne? Ein breiter Lichtpunkt kreiste links von ihm über dem Sumpf. Kurz darauf kam ein zweiter Lichtpunkt hinzu. Doch so plötzlich wie sie erschienen waren, verschwanden sie auch wieder.
Horyet wandte sich um. Der Zaun lag mittlerweile weit zurück. Egal. Er konnte sich hier auf diesem Pfad ja nicht verlaufen. Horyet ging also weiter und entdeckte ein Leuchten in den hohen Gräsern rechts von ihm. Es sah so aus, als ob dort jemand mit einer Fackel herumlaufen würde. Hoffentlich war es nicht sein Vater, der auf der Suche nach ihm war.
Der Untergrund wurde wieder weicher, und an manchen Stellen war er glatt und schlammig.
Platsch!
Horyet stand knöcheltief in einer Pfütze. Schnell trat er zurück. Sein Herz raste vor Schreck, um ein Haar hätte ihn der mörderische Sumpf mit Haut und Haaren verschlungen.
Horyet musste seine Mission wohl doch abbrechen. Es war zu gefährlich dem Pfad weiter zu folgen.
Ob es noch andere Pfade durch diesen Sumpf gab oder irgendwer aus seinem Dorf diese Pfade kannte?
Horyet erschrak. Ganz plötzlich hatte er Angst, er könnte sterben. Im dichten Schilf rechts von ihm hatte sich etwas bewegt. Da, schon wieder. Er duckte sich rasch und beobachtete die Stelle. Das Schilf bewegte sich schon wieder und etwas stieß hindurch.
Horyet zuckte zusammen und staunte.
Ein Boot?
Horyet richtete sich wieder auf.
Aus dem hohen Schilf ragte ein kleines Holzboot. Niemand war zu sehen. Der Pfad führte in einem Bogen in die Richtung des Bootes, also verwarf Horyet den Gedanken an die Rückkehr. Er trat in die Pfütze und folgte wieder dem Pfad. Nach ein paar Metern war der Pfad wieder etwas fester geworden. Jedoch sank Horyet an manchen Stellen knöcheltief ein.
Horyet blieb stehen.
Tja, das Boot lag in greifbarer Nähe, doch weder ein Steg noch ein Pfad führten zu ihm hin. Sollte er den Pfad verlassen und durch das Wasser waten? Er betrachtete die Wasseroberfläche. Wie tief mag das Wasser sein? Natürlich hatte er keine Angst zu ertrinken, weil er ja schwimmen konnte, doch er hatte große Angst in irgendeinem Morast stecken zu bleiben und dann vom Sumpf verschlungen zu werden.
Ob es im Wasser auch gefährliche Tiere gab?
Nicht nur dieser mörderische Sumpf sondern auch ein fleischfressender Fisch könnte ihm das Leben nehmen. Horyet musste vorsichtig sein, denn er wollte schließlich seinen nächsten Geburtstag noch mit seiner Familie zusammen feiern.
Horyet stand da wie ein steinernes Monument. Dann fasste er einen Entschluss und trat ins Wasser, dem Boot entgegen. Er versank bis zu den Waden. Vorsichtig näherte er sich dem Boot.
Fast hätte er aufgeschrien, als er beim nächsten Schritt bis zum Bauch im Wasser stand. Das Boot war nur noch vier Schritte entfernt. Sollte er es riskieren?
Er ging weiter.
Schritt für Schritt.
Er blieb stehen.
Ein Schritt trennte ihn noch von seinem Ziel.
Was wollte er eigentlich mit dem Boot anfangen? Plötzlich blubberte das Wasser hinter ihm und er bekam einen höllischen Schrecken. Horyet trat einen Schritt vor und kletterte blitzschnell ins Boot.
Er wandte sich rasch der Wasseroberfläche zu. Doch das Blubbern war verschwunden. Er war fest davon überzeugt, dass er fast einem Raubfisch zum Opfer gefallen wäre.
Ein altes Holzpaddel lag im Boot. Horyet nahm es und paddelte langsam durch das hohe Schilf. Für einen Moment war er wie erstarrt. Wohin wollte er eigentlich mit diesem Boot? Er warf einen Blick zurück zum Pfad. Die Gefahr war groß, dass er im hohen Schilf die Orientierung verlieren und den Pfad nicht mehr wiederfinden würde.
Plötzlich tauchte irgendwo vor ihm ein Leuchten auf. Horyet wandte sich aufmerksam dem Licht zu, paddelte vorsichtig und entfernte sich weiter vom Pfad.
Das Schilf wurde lichter, und mit einem Mal tat sich ein morastiges Gewässer vor ihm auf. Er sah einzelne Büsche und Pflanzen und ein paar Bäume. Auf dem dunklen Wasser trieben Blätter und Seerosen. Ein leichter Wind glitt wie ein Atem über den See hinweg. Horyet paddelte, während er die Gegend aufmerksam im Auge behielt. Es war noch ein ganz schönes Stück bis zur Mitte des Sees, aber Horyet hatte auf einmal das Gefühl, dass er unbedingt dorthin musste.
Der See wurde unruhig, und Horyet ließ das Boot treiben. Es schaukelte auf den kleinen Wellen. Als sich Horyet den Kahn näher betrachtete, fiel ihm auf, dass sein Holz im Laufe der Zeit etwas weich geworden war, und auch die Sitzbank in der Mitte, worauf er saß, war ein wenig angefault. Hoffentlich hielt der Kahn durch und versank nicht mitten auf dem See. Horyet konnte zwar sehr gut schwimmen, aber den Raubfischen im See würde er wohl nicht entkommen können.
Horyet begann wieder zu paddeln. Der Kahn hier hatte schon so viele Jahre gehalten, warum sollte er ausgerechnet jetzt untergehen?
Verdammt noch mal! Je näher er zur Mitte des Sees kam, umso schlammiger wurde die Wasseroberfläche. Horyet befürchtete mit einem Mal mit dem Boot im Schlick stecken zu bleiben, deswegen hörte er auf zu paddeln und entschloss sich zur Rückkehr.
Was erhoffte er sich in der Mitte des Sees zu finden? Weit und breit war nichts Außergewöhnliches zu sehen. Horyet stutzte, als plötzlich unzählige Lichter über die schwarze Wasseroberfläche in der Mitte des Sees tanzten. Er hatte die Irrlichter gefunden und paddelte wieder weiter. Je näher er sich der Mitte des Sees näherte, desto größer wurde die Spannung. Horyet atmete schnell vor Anspannung, als er das Paddel mit gleichen, rhythmischen Bewegungen ins Wasser tauchte. Er paddelte auf der linken Seite, dann wechselte er zur rechten Seite, damit das kleine Boot die Richtung beibehielt.
Die Irrlichter bewegten sich immer noch auf dem See hin und her wie kleine Flammen. Horyet erinnerte sich an die Worte seines Großvaters: »Hüte dich vor den Lichtern im Sumpf! Es sind die Geister der Toten, die einen in die Irre führen wollen.« Doch daran wollte Horyet nicht glauben. Es gab keine Geister in seiner Welt. Tot ist tot, daran glaubte er.
Auf dem See funkte und sprühte es plötzlich wie ein Feuerregen, und mit einem Mal waren die Irrlichter verschwunden. Horyet fluchte laut und ließ einen Schrei ab. So nah am Ziel scheiterte er.
Es wurde heller, die Nebelschwaden verzogen sich, und der Tag brach langsam an. Die Chance, dass er die Irrlichter heute noch einmal zu Gesicht bekommen würde, war vertan. Es war nun an der Zeit nach Hause zurückzukehren, bevor seine Eltern ihn vermissen würden. Trotzdem war der Ausflug ein kleiner Erfolg für ihn gewesen, denn so nah an den Irrlichtern war bestimmt noch niemand aus seinem Dorf gekommen. Er spürte die pure Lebensenergie in sich und nahm sich fest vor, beim nächsten Vollmond wieder auf die Suche nach den Irrlichtern zu gehen.
Horyet paddelte im Halbkreis und wendete das Boot. Er erschrak. In welcher Richtung war der Pfad? Für einen Augenblick war er völlig orientierungslos, doch dann lächelte er zufrieden, als er den markanten Baum sah, der wie ein zweiarmiges Monster alle anderen Bäume überragte. Genau in dieser Richtung lag der Pfad. Horyet paddelte nun etwas schneller. Er schaukelte mit dem alten Kahn zielstrebig dem hohen Schilf entgegen.
Horyet hörte auf zu paddeln und wandte sich der Mitte des Sees zu. Eine innere Stimme warnte ihn vor irgendeiner Gefahr.
Es war still, beinahe schon beängstigend.
Der kleine See wirkte wie ein dunkler Spiegel, auf dessen Oberfläche sich immer wieder kleine Wellen bildeten, und plötzlich bewegte sich das kleine Boot, ohne dass er etwas dazu getan hätte. Es schaukelte so heftig, dass sich Horyet an der Sitzbank festhalten musste. Er fühlte einen eisigen Schauer über seinen Rücken laufen, und einen Moment später vernahm er ein Brodeln. Es kam von der Mitte des Sees.
Wasser schäumte um das Boot herum auf, und es bildete sich eine schaumige Fläche. Horyet hielt sich immer noch fest. Das Wasser gurgelte und brodelte und brachte den alten Kahn gefährlich ins Wanken. Es spielte mit ihm, und Horyet konnte nichts anderes tun, als abwarten.
Horyet musste wieder an die mahnenden Worte seines Großvater denken. Vielleicht gab es ja doch Geister und er hatte sie aus irgendeinem Grund verärgert. Aber er hatte doch nichts Schlimmes getan. Oder hatte er etwa die Ruhe der Toten gestört? Und nun waren die Geister gekommen, um ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
Nun trat unter dem Kiel ein Strudel auf, der das alte Boot wie einen Kreisel drehte. Horyet glaubte, dass der See zu einem schrecklichen Monster geworden war, das ihn nun verschlingen wollte. Horyet wollte um Hilfe schreien, aber er ließ es sein. Wer sollte ihn hier schon hören? Seine Eltern waren zu weit entfernt. Dass sich ein Dorfbewohner hierher verirrt haben sollte, erschien Horyet unwahrscheinlich.
Plötzlich war der ganze Spuk vorbei.
Das Wasser hatte sich beruhigt und war wieder spiegelglatt. Nichts schien sich verändert zu haben.
Oder doch?
In der Tiefe des Sees schimmerte es grünlich. Was hielt sich dort versteckt? Lauerte da unten in der Tiefe ein Stück Hölle? Vorsichtig nahm Horyet das Ruder zur Hand und paddelte dem hohen Schilf entgegen. Horyet wollte hier schleunigst verschwinden, denn in der Tiefe hielt sich etwas Unheimliches versteckt, dass viel größer als ein Raubfisch war. Horyet war fest überzeugt, dass es kein Geist war, sondern womöglich ein blutrünstiges Sumpfmonster, das ihn jagen und dessen gefräßiger Schlund ihn dann verschlingen würde. Horyet wollte nicht als Mahlzeit enden.
Er näherte sich dem schützenden Schilf, in dem er verschwinden konnte. Das Ziel war nicht mehr weit entfernt. Horyet atmete auf, als das hohe Schilf ihn schützend aufnahm. Er paddelte durch das hohe Schilf in Richtung Pfad. Das Schilf wurde lichter, der Pfad kam in Sichtweite, und plötzlich hielt er inne, als er glaubte, jemanden auf dem Pfad gesehen zu haben.
War sein Vater doch auf der Suche nach ihm?
Horyet tauchte das Paddel ins Wasser und stieß auf Grund. Hier konnte er stehen. Sollte er aussteigen und zu Fuß durch das Wasser bis zum Pfad gehen? Als er an das Sumpfmonster dachte, paddelte er langsam weiter.
Krach!
Der alte Kahn lief auf Grund. Bis zum Pfad waren es nur ein paar Schritte, und das Wasser war nicht mehr tief. Bis hierher würde das Sumpfmonster nicht kommen.
Horyet stieg aus dem Boot. Das Wasser reichte ihm bis zu den Waden. Er lief und erreichte den Pfad.
Er atmete aus. Sein Herz raste.
Er war erleichtert dem Sumpfmonster entkommen zu sein. Er wandte sich dem Rückweg zu und lief los.
Blitzartig blieb er stehen und erschrak fast zu Tode.
Da stand es vor ihm.
Das Sumpfmonster.
Na ja, ein Monster? Es ging aufrecht und trug einen schwarzen Kampfanzug. So eine Kreatur hatte Horyet noch nicht gesehen. Sie war mit Sicherheit nicht von seinem Planeten. Die Kreatur hatte eine hellgrüne, schuppige Haut, und aus ihrem kahlköpfigen Gesicht stachen grüne Augen mit einer schwarzen Pupille hervor. Ihre rechte, schuppenbedeckte Hand, mit den dünnen, langen Fingern, griff an den Gürtel, und dann hielt sie einen kleinen, metallischen Stab in der Hand. Die Kreatur aktivierte ihn. Es war ein Lichtschwert.
Horyet wandte sich um und wollte fliehen, doch das Monster war schneller und packte ihn mit der linken Hand am Kragen. Horyet schrie um Hilfe. Dann trat er nach dem Monster und traf es in den Bauch.
Es zischte ihn in einer Sprach an, die er nicht verstand. Horyet hing wie ein Fisch an der Angel. Dann fiel Horyets Blick auf das Lichtschwert, und er ahnte Schlimmes. Horyet wollte noch nicht sterben, aber er konnte seinem Schicksal nicht mehr entfliehen.
Das Monster zischte ihn wieder an und warf ihn im hohen Bogen in den Sumpf.
Platsch!
Horyet wusste nicht warum, aber das Monster ließ ihn am Leben und verschwand.
Triefnass lief Horyet nach Hause und stellte sich schon mal auf eine Predigt von seinen Eltern ein, doch als er ankam, stand das Haus in Flammen. Seine Eltern und Großeltern waren tot.
Horyet lief weinend ins Dorf. Als er dort ankam, erfasste ihn das Grauen. Auch dort hatte niemand überlebt. Horyet machte sich große Vorwürfe, weil er den verbotenen Sumpf betreten hatte, und glaubte lange Zeit, dass er die Schuld für diese grausamen Morde trug. Er nahm an, dass er das Sumpfmonster verärgert hatte und daraufhin das Unheil geschehen war.
Horyet beendete die Gedanken an die Ereignisse aus seiner Kindheit und sah sich um. Er saß in einer Hochsicherheitszelle. Der leitende Agent Roland Landau vom MAD hatte veranlasst, dass Horyet dort eingesperrt wurde. Im Schein der Lampen glänzte der Stacheldrahtzaun, auf der hohen Mauer, wie ein dichtes Spinnennetz. Er sollte für einen Menschen unüberwindbar sein, doch Horyet lächelte in sich hinein, als er durch das vergitterte Zellenfenster nach draußen blickte. Horyet kam von dem Planeten Mesetanien und war ein Formwandler. Er konnte die Gestalt von verschiedenen Lebewesen annehmen, doch er hatte sich entschlossen, das menschliche Aussehen zu behalten.
Pah, diese Mauer mit dem dämlichen Drahtzaun würde ihn sicherlich nicht aufhalten. Was ihn hier festhielt, waren die beiden schwerbewaffneten Wachen vor seiner Zellentür. Der Agent Landau hatte die Bewachung angeordnet und Horyet damit gedroht, dass diese Wachen ihn mit allen Mitteln an einer Flucht hindern würden.
Horyet wandte sich aufmerksam der Tür zu und überlegte, wie er die Wachen ausschalten sollte und welchen Fluchtweg er dann nehmen konnte. Die Tür sah zwar stabil aus, jedoch konnte er versuchen, sie aus der Verankerung zu reißen. Horyet stellte sich die verdutzten Gesichter der Wachen vor, wenn er die Tür in der Hand halten und in die Zelle schmeißen würde. Die Schrecksekunde der Wachen würde er zu seinem Vorteil nutzen. Er malte sich aus, wie er der linken Wache einen Faustschlag verpassen, dann der rechten Wache mit einem Ruck das Genick brechen, und dann blitzschnell auch der linken Wache durch einen gezielten Schlag das Leben nehmen würde. Horyet nickte zufrieden. Könnte funktionieren. Als er sich jedoch die Tür und die Verankerung und das Material genauer ansah, stellte er fest, dass sein Vorhaben aussichtslos war. Er war zwar stärker als ein Mensch, aber das übertraf bei weitem auch seine Kräfte.
Also musst er sich einen anderen Plan zurechtlegen.
Horyet schaute wieder aus dem Zellenfenster. Er musste oft an die Vergangenheit denken und an die Palets und daran, was sie ihm und seinen Leuten alles angetan hatten. Er hatte sich den Palets angeschlossen, in der Hoffnung ganz nach oben zu kommen. Dann sollte seine Rache die Anführer vernichten. Dass er sich als Kopfgeldjäger anheuern ließ, um Andor auszuschalten, war nur ein Mittel zum Zweck für seine Sache. Aber die Dinge hatten sich geändert. Horyet war sich nicht mehr ganz sicher, ob er richtig gehandelt hatte. Er dachte, wie schon so oft, an seine Kindheit und daran, wie er zum ersten Mal einem Palet begegnet war.
Horyet wurde durch ein klirrendes Geräusch aus den Gedanken gerissen. Abendessen? Er stand in der Zelle und brüllte vor Wut. Heute wusste er, dass ihn keine Schuld traf. Denn das Massaker in seinem Dorf hatten die Palets zu verantworten. Sie kamen ursprünglich vom Planeten Norog und hatten einen Außenposten auf seinem Planeten errichtet. Wer ihnen im Wege stand wurde einfach eliminiert.
Horyet brüllte abermals vor Wut.
Die Türklappe ging auf, und eine Wache schob ein Essenstablett hindurch. Horyet nahm das Tablett entgegen und griff mit der linken Hand die Gabel. Dann ließ er das Tablett fallen und stach mit der Gabel auf seinen rechten Unterarm ein, um die Pulsader zu erwischen. Er hoffte, dass die Wachen nichts von seinen außergewöhnlichen Selbstheilungskräften wussten und ihn am Selbstmord hindern wollten. So wie es aussah, lief alles nach Horyets Plan, als die Tür aufging und die beiden Wachen eintraten. Die eine Wache hatte zur Vorsicht das Gewehr auf Horyet gerichtet, während die andere Wache entsetzt auf die Gabel starrte und Horyet befahl, sie fallen zu lassen.
Horyet fackelte nicht lange. Blitzschnell sprang er der Wache, die ihn angesprochen hatte, entgegen und schlug ihr die Faust ins Gesicht. Sie ging sofort bewusstlos zu Boden. Noch bevor die andere Wache reagieren konnte, hatte Horyet auch sie bewusstlos geschlagen.
Schnell wandte sich Horyet der ersten Wache zu und schleifte sie aus dem Sichtfeld der Überwachungskameras. Der Mann hatte etwa die gleiche Kleidergröße wie er. Horyet zog rasch seine Gefängniskleidung aus und streifte die Kleidung der Wache über. Dann schnappte er sich den Pistolenhalfter samt Pistole und zog ihn an. In der Zelle flackerte ein helles Licht auf, und Horyet hatte die Gestalt der Wache angenommen. Letztendlich nahm er die Schnellfeuerwaffe an sich und verließ die Zelle.
Der Alarm war losgegangen. Alles wurde abgeriegelt. Da Horyet nun das Aussehen der Wache und einen gültigen Ausweis hatte, konnte er unbemerkt das Gefängnis durch den Vordereingang verlassen.
Horyet musste schnell handeln, denn es würde nicht lange dauern, bis man die bewusstlosen Wachen finden würde.
Er hatte es also geschafft.
Er war frei.
Endlich.
Horyet ging über den Parkplatz und sah sich aufmerksam um, während er die Fernbedienung eines Autoschlüssels betätigte.
Bieep!
Ein schwarzer BMW reagierte. Horyet stieg ein, startete den Wagen und fuhr los.
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.
ALBERT EINSTEIN
Mein lieber Scholli!
Wir waren durch das Basrato vermutlich nach Pelos gekommen und hatten unsere Mission erfüllt. Das feindliche Basrato war in einem riesigen Feuerball zerstört worden, während einige Gebäude in Flammen aufgegangen waren. Jedoch war somit der Rückweg zur Erde für uns nicht mehr möglich. Berger lenkte den Wagen sicher über die Piste, die zunehmend unebener wurde. Wir fuhren durch eine öde Landschaft und entfernten uns rasch von der feindlichen Basis.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel tauchte ein feindlicher Raumgleiter über uns auf, aktivierte seine Waffen und feuerte. Wir hatten dabei das Glück, schon auf eine Nebenpiste abgefahren zu sein. Die großen Felsen links und rechts von der Piste schützten uns vor den Energiestrahlen.
»Scheiße«, fluchte Berger lauthals und gab Gas.
Jennifer, die auf dem Beifahrersitz saß, sagte panisch: »Mist! Was machen wir jetzt?«
Ohne Vorwarnung schlug ein Energiestrahl direkt vor unserem Wagen in den Boden ein. Dreck und kleine Steine flogen gegen die Windschutzscheibe. Berger bremste kurz ab und gab sofort wieder Gas. Dann sahen wir den silbernen Raumgleiter über uns hinwegfliegen.
»Das geht nicht lange gut«, bemerkte Berger und wandte sich mir kurz zu.
»Ja«, nickte ich.
Ich saß auf dem Rücksitz hinter Jennifer und hielt meine Laptoptasche, die auf dem Sitz neben mir lag, krampfhaft mit der linken Hand fest. Ich überlegte, was außer dem Laptop noch in der Tasche war. Das Delektron war durch die Zerstörung des Basratos unwiederbringlich verloren. Ich hatte also noch mein Lichtschwert, die silbrige Kugel und das goldene Medaillon.
Dann kam der silberne Raumgleiter zurück. Die Felsen links und rechts von uns wuchsen zu kleinen Bergen an. Wir fuhren durch eine enge Schlucht. Dort konnte der Raumgleiter uns nicht folgen. Dennoch blieb der Besatzung die Möglichkeit auf uns zu schießen.
»Wo ist er?«, fragte Jennifer hastig.
Die Antwort kam prompt, als Energiestrahlen rechts von uns in die Felsen einschlugen. Kleine und große Felsbrocken brachen ab und donnerten herunter. Wir hatten Glück gehabt, denn nur kleine Steine trafen unser Wagendach.
»Schwein gehabt«, japste Jennifer.
»Entweder haben wir einen Schutzengel«, sagte Berger, »oder der Pilot ist ein miserabler Schütze.«
»Viel Zeit bleibt uns nicht, bis er zurückkommt«, sagte Jennifer ängstlich und ergänzte hastig: »Er wird nicht ewig vorbeischießen.«
Was konnten wir tun? Der Raumgleiter war auf jeden Fall schneller als unser Wagen.
»Da vorne«, sagte Jennifer schnell und deutete nach rechts.
Gott steh uns bei! Eine noch viel schmalere Piste zweigte ab. Berger überlegte kurz und folgte ihr.
»Oha«, brach es aus mir heraus. »Das ... das wird Zentimeterarbeit.«
Die Piste war sehr schmal, und die Felswände sehr hoch. Berger verlangsamte das Tempo. Ob das eine gute Idee war, hier abzubiegen, bezweifelte ich stark. Für mich sah der Weg aus, wie eine Sackgasse. Kein Entkommen. Eine tödliche Falle. Ich malte mir aus, dass wir plötzlich vor einer Felswand oder einem Abgrund zum Stehen kommen könnten. Wenn dann auch noch der Raumgleiter auftauchen würde, hätten wir ein Problem.
Los, Bill Clayton, streng deinen Grips an!, sagte ich mir im Stillen vor.
Berger schrappte mit dem Wagen an der linken Felswand vorbei. »Mist«, fluchte er laut. »Braucht 'ne neue Lackierung.« Er grinste breit.
Ich sah, wie Jennifer ein erschrockenes Gesicht machte.
»Ist ja nichts ...«, wandte ich mich ihr zu und brach ab, als über uns ein Poltern zu hören war.
»Au Backe!«, zischte Berger laut. Er blickte in den Rückspiegel und gab Gas.
Nun schrappte er auch mit der rechten Wagenseite am Felsen entlang. Aber das schien ihm egal zu sein, denn hinter uns stürzte tonnenweise Gestein herab.
Jennifer schrie kurz auf, dann hörte ich das Zerbersten der Heckscheibe und bemerkte, wie der Wagen noch schneller wurde.
In diesem Moment war ich mir noch nicht sicher, wie wir sterben würden. Entweder würden wir von den herabstürzenden Steinen erschlagen, oder Berger würde den Wagen gegen die Felswand fahren, wo er dann zerschmettern würde.
Ich hielt den Atem an und betete. Mein Leben war mir in diesem Moment egal, aber das Leben meiner Freunde wollte ich mit dem Gebet retten.
Berger bremste den Wagen ab. Wir wandten uns um und sahen, dass der Weg hinter uns verschüttet war.
»Verdammt, zurück können wir jetzt nicht mehr«, fluchte Berger und setzte die Fahrt langsam fort.
Nach kurzer Zeit wurde die Piste noch schmaler.
»Noch ein paar Zentimeter weniger und wir bleiben mit dem Wagen stecken«, stellte Berger fest, und seine Stimme klang bedrückt.
Berger fuhr sehr vorsichtig, und mit einem Mal jubelte er. Na ja, warum sollten wir nicht auch mal ein wenig Glück haben? Die Piste wurde wieder breiter, und Augenblicke später konnte Berger wieder Gas geben.
Ob das aber etwas nützen würde, um unsere Feinde abzuhängen, war ich mir nicht sicher. Außerdem glaubte ich fest daran, dass am Ende dieser Piste, falls sie aus dieser schmalen Schlucht herausführte, unsere Feinde uns schon erwarten würden.
Der Raumgleiter düste wieder über uns hinweg, jedoch feuerte er dieses Mal nicht auf uns.
Warum schießt er nicht? Der Pilot hat doch freies ... , überlegte ich, und Bergers Vollbremsung riss mich aus meinen Gedanken heraus.
»Was ist los?«, fragte ich erschrocken.
»Die Schlucht hört da vorne auf, und die Piste führt auf freies Gelände«, antwortete Berger.
Heikle Situation. Berger könnte Vollgas geben und hoffen, dass er mit dem Wagen irgendwo Deckung finden würde. Riskante Sache. Ein gezielter Schuss von dem Raumgleiter. Aus und vorbei.
Berger fuhr langsam, bis zum Ausgang der Schlucht. Das Gelände dahinter war flach und größtenteils mit hohen Gräsern bewachsen. Vereinzelt waren karge Bäume zu sehen. Weiter links von uns gab es einen kleinen See und weiter rechts davon einen grünen Laubwald. Dorthin führte auch die Piste, die sehr eben aussah, also könnte Berger Gas geben. Aber konnte er den Raumgleiter abschütteln?
»Ob er fort ist?«, fragte Jennifer.
Berger schüttelte den Kopf.
»Ob wir es bis zum Wald schaffen?«, fragte ich.
»Wir können es versuchen«, sagte Berger.
»Okay«, hauchte Jennifer.
»Dann mal los«, sagte ich.
Berger fuhr an, dann gab er Gas. Der Wagen hatte einen kraftvollen Motor und beschleunigte schnell. Berger lenkte den Wagen sicher über die Piste.
»Wir schaffen es«, sagte Jennifer erleichtert, und in diesem Augenblick hörten wir ein Zischen über uns. Der Raumgleiter war wieder da, drehte eine Runde und kam direkt auf uns zu. Das würde kein gutes Ende für uns nehmen. Die beiden Energiestrahlen schlugen links vom Wagen ein. Das trockene Gras fing sofort Feuer. Der Wagen brach aus und kam von der Piste ab.
»Mist«, fluchte Berger und lenkte den Wagen auf die Piste zurück. Dann gab er sofort wieder Gas.
»Wo ist er?«, wollte Berger wissen.
»Er ist hinter uns«, antwortete Jennifer nervös.
»Wie weit?«, fragte Berger kurz.
»Nicht weit genug«, sagte ich. »Wir haben ein paar Sekunden.«
»Das reicht nicht«, sagte Berger.
Der Wagen raste über die Piste und hinterließ eine Staubwolke. Die Landschaft hinter uns hatte sich in ein Meer aus Flammen und Rauch verwandelt. Die ersten vertrockneten Bäume fingen schnell Feuer.
Berger legte eine Vollbremsung hin. Ich schlug mit dem Kopf gegen das Seitenfenster, weil ich mich nach rechts gewandt hatte, um herauszuschauen.
»Das gibt eine Beule«, fluchte ich und fasste mir an die Stirn.
Der Energiestrahl schlug vor uns in die Piste ein, und Sekunden später brannte das Gras neben der Piste lichterloh. Berger beschleunigte den Wagen wieder und fuhr durch das entstandene Schlagloch. Jennifer schrie dabei kurz auf, und wir wurden durchgerüttelt. Die Piste führte nun schnurstracks auf den rettenden Wald zu.
»Er kommt zurück«, stieß Jennifer hervor.
Nur keine Panik. Ruhe bewahren, war mein Motto. Wir hatten schon schlimmere Situationen überstanden. Hoffentlich behielt auch Berger weiterhin die Ruhe. Er lenkte den Wagen immer noch sicher über die Piste. Der Raumgleiter kam, jedoch sah es so aus, als würde er uns nicht mehr erreichen, bevor wir im Wald verschwinden würden.
»Ja«, jubelte ich kurz.
Berger legte wieder eine Vollbremsung hin und kam am Waldrand zum Stehen.
»Was ist nun schon wieder?«, fragte ich hektisch.
»Raus aus dem Wagen«, schrie Berger uns an.
Ohne weitere Fragen zu stellen, stiegen wir rasch aus, und da sah ich auch schon die Bescherung. Die Piste hörte am Waldrand auf.
Der Raumgleiter kam rasant näher und schoss Energiestrahlen ab. Wir flohen ein Stück und warfen uns ins hohe Gras. In einem Feuerball explodierte der Wagen.
Wir blieben im hohen Gras in Deckung, während der Raumgleiter über uns kreiste.
»Wir brauchen einen neuen fahrbaren Untersatz«, sagte Berger und lächelte gequält.
»Ob wir es bis zum Wald schaffen?«, fragte Jennifer.
»Ist ja nicht mehr weit«, sagte ich. »Wir bleiben in Deckung und kriechen bis dahin«, schlug ich vor.
»Okay«, stimmte Berger mir zu, »aber die da oben haben bestimmt Geräte, mit denen sie uns aufspüren können«, ergänzte er.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Wir krochen langsam auf den Wald zu. Es war nicht mehr weit, vielleicht noch zwanzig Meter, aber die hatten es in sich. Berger und Jennifer waren vor mir. Ich folgte ihnen und befürchtete, dass wir durch den Wald davonjagen mussten wie Hasen auf der Flucht vor einem Jäger. Wir robbten weiter über den Boden durch das hohe Gras, das uns Deckung vor unserem Feind gab. Es sah so aus, als ob wir es schaffen würden, doch plötzlich fehlte die Deckung. Die letzten Meter bis zum Wald war das Gelände kahl.
»Los«, sagte ich, als ich sah, dass der Raumgleiter über uns nach rechts abgedreht hatte.
Wir sprangen auf die Beine und liefen das letzte Stück bis zum Wald.
»Schneller! Beeilt euch!«, schrie ich, als ich sah, dass der Raumgleiter zurückkam.
Wir schafften es tatsächlich. Ein Grund zum Jubeln blieb uns aber nicht, denn hinter uns schlugen schon die ersten Energiestrahlen ein, die den Wald sofort in Brand setzten.
»Auch das noch«, fluchte Berger, als hinter uns die Feuerhölle losbrach.
»Lauft!«, schrie ich.
Berger und Jennifer zögerten keinen Augenblick. Ich folgte ihnen. Bei unserer Flucht hatten wir einen sanften Wind im Rücken. Scheiße, das Feuer verfolgte uns und fraß sich wie ein hungriges Tier durch den Wald. Ich sprang über einen am Boden liegenden Baumstamm, gleichzeitig schlug mir ein Ast ins Gesicht.
Etwas weiter rechts und links von uns schlugen wieder Energiestrahlen in den Wald ein und setzten auch diesen Abschnitt sofort in Brand. Wir liefen so schnell wir konnten um unser Leben.
Ich konnte nicht sagen, was schlimmer war, die Hitze oder der Qualm, der mir den Atem raubte und drohte, mich zu ersticken. Ich sah, dass Jennifer langsamer wurde und holte auf.
»Los weiter!«, feuerte ich sie an und blieb hinter ihr.
Berger hatte wohl bemerkt, dass wir ein ganzes Stück hinter ihm waren, denn er blieb stehen und wartete auf uns.
»Ob das Feuer uns in eine bestimmte Richtung treiben soll?«, fragte Berger.
Ich zuckte mit den Schultern, und wir flohen wieder vor den Flammen. Berger lief nach links. Wir verließen uns auf Bergers Instinkte und Orientierungssinn und folgten ihm dichtauf. Dann sprang er über einen brennenden Baumstamm. Jennifer zögerte, doch dann sprang auch sie. Ich folgte ihr schnell. Zwar war ich ein Elitesoldat und früher wohl schon einmal auf diesem Planeten gewesen, aber durch meinen Gedächtnisverlust konnte ich mich an nahezu nichts mehr erinnern. Berger führte uns sicher durch die gefahrvolle Situation, also überließ ich ihm die Führung.
Doch dann stutzte ich. Wo wollte Berger hin? Hatte er denn völlig den Verstand verloren? Er lief direkt auf eine Flammenwand zu. Innerhalb weniger Minuten wurde mein Gesicht glühend heiß und meine Kehle staubtrocken. Wenige Augenblicke später musste ich husten. Jennifer erging es wohl ebenfalls wie mir. Sie hustete und wurde langsamer.
»Los weiter!«, feuerte ich sie wieder an und hoffte, dass Berger wusste, was er tat.
Kurz vor der Flammenwand, drehte Berger nach rechts ab. Wir folgten ihm blindlings. Das Atmen war durch den Qualm bis jetzt unangenehm gewesen, doch nun wurde es zur Qual. Keiner von uns durfte jetzt das Bewusstsein verlieren, das wäre das Todesurteil. Berger sprang wieder über einen Baumstamm, doch dieses Mal brannte er zum Glück nicht. Wir liefen immer weiter. Als die Flammenwand endete und wir sie ein Stück hinter uns gelassen hatten, schrie Berger: »Hier entlang!« Er bog nach links ab. Und endlich waren wir den Flammen entkommen.
Zu früh gefreut, denn als ich nach links blickte, sah ich, dass die Flammenhölle wieder aufholte. Ich zitterte ein wenig und schnappte nach Luft, aber mir war klar, dass ich weitermusste.
»Verdammt, ich kann nicht mehr«, hustete Jennifer und wurde wieder langsamer. Ich nahm sie an die Hand.
»Komm weiter!«, sagte ich und legte einen Schritt zu.
»Lasst mich hier.«
»Bist du verrückt?«
»Ich schaffe es nicht«, schrie Jennifer und blieb stehen. Ich ließ ihre Hand los.
»Entweder schaffen wir beide es oder ...«
»Los, macht schon!«, brüllte Berger. »Hierher«, winkte er uns zu. »Hier ist ein See«, ergänzte er.
Als wir Berger erreichten, stand er am Ufer eines kleinen Sees. Er schnappte sich einen kleinen Baumstamm.
»Schnell! Hilf mir mal!«, fuhr er mich an, und wir schleppten das Ding zum Wasser.
In der Mitte des Sees wuchs Schilf. Mir war nun klar, was Berger vorhatte.
»Komm, Jennifer«, sagte ich. »Da vorne im Schilf sind wir sicher vor den Flammen.«
Wir gingen ins Wasser, hielten uns am Baumstamm fest und schwammen hinüber ins Schilf. Vorerst konnten wir aufatmen. Nur wusste niemand von uns, wie dicht der Qualm rings um den See werden würde. Wir konnten immerhin noch ersticken. Und außerdem wussten wir nicht, ob es gefährliche Tiere im See gab. Mittlerweile brannten auch die Bäume am Ufer lichterloh.
»Woher haben Sie gewusst, in welche Richtung wir laufen mussten?«, wandte ich mich an Berger.
»Ich habe ein paar Tiere vor den Flammen fliehen sehen«, antwortete Berger, »und dachte, es wäre eine gute Entscheidung, ihnen zu folgen.«
»Ja, das war es«, bestätigte ich ihm.
»Hoffentlich taucht der Raumgleiter nicht wieder auf«, sagte Jennifer.
Ich sah, wie sie zitterte.
»Vielleicht sucht der Pilot ja an der falschen Stelle nach uns«, sagte Berger.
»Sollen wir ans andere Ufer schwimmen?«, fragte Jennifer und deutete hinter uns. Das Feuer breitete sich zwar aus, aber es schien nicht um den See zu kommen. Wir konnten ja schlecht den ganzen Tag hier im Wasser verbringen, also schwammen wir mit dem Baumstamm ans andere Ufer.
Als wir das Ufer erreicht hatten, legten wir eine kurze Pause ein und blieben unter den Bäumen sitzen. Jennifer fuhr sich mit der Hand durch das Haar, und mir fiel auf, dass ihre Haarspitzen zum Teil versengt waren.
»Wie geht es jetzt weiter?«, wollte Jennifer von mir wissen.
Was sollte ich antworten? Ich schwieg.
»Ob der Pilot uns in eine bestimmte Richtung treiben wollte?«, überlegte Berger.
»Vielleicht«, antwortete ich und verzog dabei leicht die Mundwinkel.
Jennifer zuckte wortlos mit den Schultern.