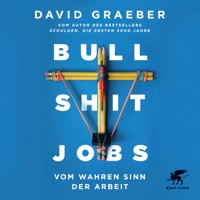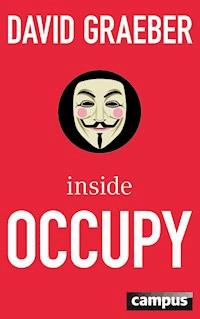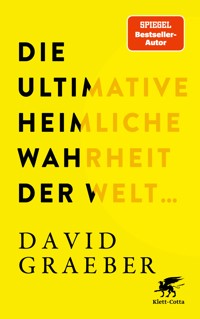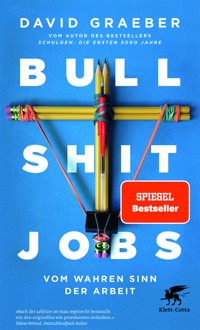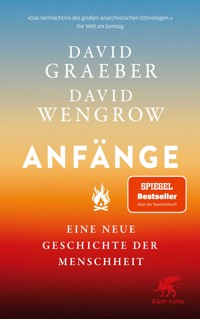
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Faszinierend, provozierend, bahnbrechend. Ein Buch, das in den kommenden Jahren für Diskussionen sorgen wird." Rutger Bregman, Autor von »Utopien für Realisten« Ein großes Buch von gewaltiger intellektueller Bandbreite, neugierig, visionär, und ein Plädoyer für die Macht des direkten Handelns. David Graeber, der bedeutendste Anthropologe unserer Zeit, und David Wengrow, einer der führenden Archäologen, entfalten in ihrer großen Menschheitsgeschichte, wie sich die Anfänge unserer Zivilisation mit der Zukunft der Menschheit neu denken und verbinden lässt. Sie revidieren unser bisheriges Menschenbild und erzählen Menschheitsgeschichte, wie sie noch nie erzählt wurde. Über Jahrtausende hinweg, lange vor der Aufklärung, wurde schon jede erdenkliche Form sozialer Organisation erfunden und nach Freiheit, Wissen und Glück gestrebt. Graeber und Wengrow zeigen, wie stark die indigene Perspektive das westliche Denken beeinflusst hat und wie wichtig ihre Rückgewinnung ist. Lebendig und überzeugend ermuntern sie uns, mutiger und entschiedener für eine andere Zukunft der Menschheit einzutreten und sie durch unser Handeln zu verändern. David Graeber war der bedeutendste Kulturanthropologe seiner Generation, der wichtigste Vordenker der Occupy-Bewegung und ein weltbekannter Intellektueller. Er lebte seine Ideen von sozialer Gerechtigkeit und Befreiung, gab den Unterdrückten Hoffnung und inspirierte zahllose andere zur Nachfolge. Am 2. September 2020 starb David Graeber völlig überraschend im Alter von 59 Jahren in Venedig; drei Wochen zuvor hatten er und David Wengrow "Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit" beendet. Vor mehr als zehn Jahren hatten beide Autoren ihre Arbeit an diesem Opus magnum außerhalb ihrer akademischen Verpflichtungen aufgenommen: Ein Anthropologe und ein Archäologe beleben mit dem heute vorhandenen Quellenmaterial den großen Dialog über die menschliche Geschichte wieder. Dieses Meisterwerk ist das Vermächtnis von David Graeber. »Ein faszinierendes Werk, das uns dazu bringt, die Natur der menschlichen Fähigkeiten neu zu überdenken. Es handelt von den stolzesten Momente unserer eigenen Geschichte, unserem Austausch und unserer Schuld gegenüber indigenen Kulturen und ihren vergessenen Intellektuellen. Herausfordernd und erhellend.« Noam Chomsky »Graeber und Wengrow entlarven Klischees über die weit zurückreichende Geschichte der Menschheit, um unserem Denken zu erschließen, was in der Zukunft möglich ist. Es gibt kein vitaleres, kein unserer Zeit angemesseneres Projekt.« Jaron Lanier, Autor von Anbruch einer neuen Zeit » ›Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit‹ ist eine Synthese neuerer Forschungen. Dieses Buch verwirft alte und überholte Annahmen über die Vergangenheit, erneuert unsere intellektuellen und spirituellen Ressourcen und enthüllt auf wundersame Weise die Zukunft der Menschheit als offenes Ende. Es ist das erfrischendste Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe.« Pankaj Mishra, Autor von Das Zeitalter des Zorns: Eine Geschichte der Gegenwart »Indem Graeber und Wengrow die neuesten archäologischen Forschungen und die jüngsten anthropologischen Aufzeichnungen durchforsten, zeigen uns die Autoren eine Welt, die vielfältiger und unerwarteter ist, als wir sie kannten, und offener und freier, als wir sie uns vorstellen. Dies ist Sozialtheorie im großen, altmodischen Sinne, vorgetragen mit fesselnder Geschwindigkeit und einem erheiternden Gefühl der Entdeckung.« Corey Robin, Brooklyn College and Graduate Center, New York, Autor von The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump »Das ist kein Buch. Das ist ein intellektuelles Fest. Es gibt kein einziges Kapitel, das (spielerisch) angepasste und eingeschliffene intellektuelle Überzeugungen umstößt. Es ist tiefgründig, mühelos ikonoklastisch, faktisch rigoros und angenehm zu lesen.« Nassim Nicholas Taleb, Autor von Der schwarze Schwan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1312
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
David GraeberDavi Wengrow
Anfänge
Eine neue Geschichte der Menschheit
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Henning Dedekind, Helmut Dierlamm, Andreas Thomsen
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel: »The Dawn of Everything. A New History of Humanity« bei Allen Lane, Penguin Random House, London, New York
© 2021 by David Graeber & David Wengrow
Für die deutsche Ausgabe
© 2022, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg. Unter Verwendung einer Abbildung von Shutterstock/Pranch
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96614-5
E-Book ISBN 978-3-608-11841-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
David Wengrow
Vorwort und Widmung
Dank
Kapitel Eins
Abschied von der Kindheit der Menschheit
Oder warum dies kein Buch über die Ursprünge der Ungleichheit ist
Warum sich aus der Menschheitsgeschichte nach Hobbes und Rousseau verhängnisvolle politische Konsequenzen ergeben
Warum das verbreitete Verständnis der gesamten Menschheitsgeschichte größtenteils falsch ist – oder die ewige Wiederkehr des Jean-Jacques Rousseau
Über das Streben nach Glück
Warum das herkömmliche Narrativ der Menschheitsgeschichte nicht nur falsch, sondern völlig langweilig ist
Über das Folgende
Kapitel Zwei
Sündhafte Freiheit
Indigene Kritik und Fortschrittsmythos
Wie Kritik am Eurozentrismus nach hinten losgehen kann und indigene Denker zu »Sprechpuppen« werden
Was die Einwohner Neufrankreichs von den europäischen Eindringlingen hielten, insbesondere in Fragen von Großmut, Geselligkeit, materiellem Wohlstand, Verbrechen, Strafe und Freiheit
Als Europäer von indigenen Amerikanern etwas darüber lernten, wie logische Argumentation, persönliche Freiheit und die Ablehnung willkürlicher Gewalt miteinander verbunden sind
Wir stellen den Wendat-Philosophen und Staatsmann Kondiaronk vor und erklären, wie seine Ansichten über die menschliche Natur und Gesellschaft in den Salons der europäischen Aufklärung zu neuem Leben erwachten – einschließlich eines Exkurses über zwischenmenschliche Abgrenzung (»Schismogenese«).
Wir erklären die demiurgischen Kräfte von Turgot und wie er die indigene Kritik an der europäischen Zivilisation auf den Kopf stellte und so die Grundlage für die meisten modernen Sichtweisen gesellschaftlicher Evolution schuf. Oder wie aus einem Streit um »Freiheit« ein Streit über »Gleichheit« wurde
Wie Jean-Jacques Rousseau, nachdem er einen renommierten Essaywettbewerb gewonnen hatte und in einem anderen ausgeschieden war, weil er den zulässigen Textumfang überschritt, die gesamte Menschheitsgeschichte eroberte
Die Beziehung von indigener Kritik, dem Fortschrittsmythos und der Geburt der Linken
Jenseits des »Mythos vom dummen Wilden« und warum all diese Dinge für unser Anliegen in diesem Buch so wichtig sind
Kapitel Drei
Die Eiszeit auftauen
Mit oder ohne Ketten: Die proteischen Möglichkeiten menschlicher Politik
Warum das ›Sapiens-Paradox‹ eine falsche Fährte ist. Sobald wir zu Menschen wurden, begannen wir, menschliche Dinge zu tun.
Warum selbst sehr erfahrene Forscher immer noch an der Idee vom »Ursprung« der sozialen Ungleichheit festhalten
Große Bauwerke, fürstliche Bestattungen und andere unerwartete Merkmale eiszeitlicher Gesellschaften haben unsere Annahmen über das Verhalten von Jägern und Sammlern revolutioniert. Sie werfen die Frage auf: Gab es vor 30 000 Jahren ›soziale Schichtung‹?
Wir entledigen uns des Vorurteils, ›primitive‹ Menschen seien aus irgendeinem Grund zu bewusster Reflexion nicht in der Lage gewesen, und machen auf die historische Bedeutung der Exzentrizität aufmerksam.
Was Claude Lévi-Strauss von den Nambikwara über die Rolle von Häuptlingen und über saisonale Veränderungen des Gemeinschaftslebens lernte
Zeugnisse für ›extreme Individuen‹ und für saisonale Schwankungen des Sozialverhaltens in der Eiszeit und darüber hinaus
Die sogenannte ›Büffelpolizei‹ – an ihr entdecken wir die Rolle der Saisonalität im politischen und sozialen Leben der Menschen wieder
Warum die Frage nicht lautet: »Was sind die Ursprünge der sozialen Ungleichheit?«, sondern eigentlich lauten muss: »Warum sind wir stecken geblieben?«
Was heißt es wirklich, sapiens zu sein
Kapitel Vier
Freie Menschen, der Ursprung der Kulturen und die Entstehung des Privateigentums
Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge
Warum der generelle Verlauf der Geschichte dazu führt, dass der Lebensbereich der meisten Menschen immer kleiner wird, während die Populationen größer werden
Was genau ist in »egalitären« Gesellschaften gleich?
Marshall Sahlins’ »Die ursprüngliche Wohlstandsgesellschaft« oder was passieren kann, wenn extrem scharfsinnige Menschen über Urgeschichte schreiben, ohne über tragfähige Zeugnisse zu verfügen
Neue Entdeckungen in Bezug auf die prähistorischen Jäger und Sammler in Nordamerika und Japan stellen die soziale Evolution auf den Kopf.
Wie der Mythos, Wildbeuter lebten in einem Zustand der kindlichen Einfältigkeit, heute noch (durch Trugschlüsse) aufrechterhalten wird
Eine Widerlegung der besonders dämlichen Ansicht, es sei etwas Besonderes, wenn Jäger und Sammler sich in Territorien ansiedeln, die für Jagen und Sammeln besonders geeignet sind
Die Frage des Eigentums und ihre Beziehung zum Heiligen
Kapitel Fünf
Vor langer Zeit
Warum kanadische Jäger und Sammler Sklaven hielten und ihre kalifornischen Nachbarn nicht – oder das Problem der »Produktionsweisen«
Die Frage der kulturellen Differenzierung
Die Frage der »Kulturareale« und ihre bisweilen abfällige, nur selten anregende und oftmals unzureichende Behandlung
Die Anwendung der Erkenntnisse von Marcel Mauss auf die Pazifikküste und warum Walter Goldschmidts absurde Bezeichnung der kalifornischen Ureinwohner als »protestantische Jäger und Sammler« uns dennoch etwas zu sagen hat
Eine Schismogenese zwischen »protestantischen Jägern und Sammlern« und »Fischerkönigen«
Über »Produktionsweisen« und das Wesen der Sklaverei
Die »Geschichte der Wogie« – ein warnendes indigenes Beispiel dafür, wie gefährlich es sein kann, andere zu versklaven, um schnell reich zu werden (und eine kleine Nebenbemerkung über »Gewehre, Saatgut und Stahl«)
Ist es besser Fische zu fangen oder Eicheln zu sammeln?
Die Pflege der Differenz in der pazifischen »Splitterzone«
Ein paar Schlussfolgerungen
Kapitel Sechs
Die Adonis-Gärten
Die Revolution, die niemals stattfand: Wie jungsteinzeitliche Völker die Landwirtschaft umgingen
Platonische Vorurteile und wie sie unsere Vorstellung von den Anfängen des Ackerbaus vernebeln
Wie Çatalhöyük, die älteste Stadt der Welt, eine neue Geschichte bekam
Wir betreten eine verbotene wissenschaftliche Zone und diskutieren die Möglichkeit jungsteinzeitlicher Matriarchate
Wie das Leben in der berühmtesten jungsteinzeitlichen Stadt der Welt ausgesehen haben könnte
Das soziale Leben früher Ackerbaugesellschaften im jahreszeitlichen Ablauf
Wie der Fruchtbare Halbmond auseinanderbrach
Langsam kultivierter Weizen und populäre Theorien, wie wir Bauern wurden
Warum es so lange dauerte, bis sich die jungsteinzeitliche Landwirtschaft entwickelte und warum dabei keine umfriedeten Felder entstanden, wie Rousseau es sich vorstellte
Über die Frau, die Wissenschaftlerin
Ackerbau oder nicht Ackerbau – alles Kopfsache (womit wir nach Göbekli Tepe zurückkehren)
Über semantische Fallstricke und metaphysische Trugbilder
Kapitel Sieben
Die Ökologie der Freiheit
Wie die Landwirtschaft erst einen Sprung nach vorn machte, dann strauchelte und sich schließlich um die ganze Welt mogelte
Zur Begrifflichkeit über die weltweite Verbreitung von Nutzpflanzen und Nutztieren
Warum sich die Landwirtschaft nicht früher entwickelte
Ein abschreckendes Beispiel aus der Jungsteinzeit: Das grausige und überraschende Schicksal der ersten europäischen Bauern
Über einige ganz andere Orte, an denen die jungsteinzeitliche Landwirtschaft Fuß fasste: Die Umwandlung des Niltals (ca. 5000–4000 v. Chr.) und die Besiedlung der ozeanischen Inseln (ca. 1600–500 v. Chr.)
Über den Fall Amazonien und die Möglichkeiten einer ›spielerischen Landwirtschaft‹
Aber warum ist das alles von Bedeutung? Eine kurze Wiederholung zu den Gefahren teleologischen Denkens
Kapitel Acht
Imaginäre Städte
Eurasiens erste Städter – in Mesopotamien, dem Indus-Tal, der Ukraine und China – und wie sie Städte ohne Könige erbauten
Das leidige Thema »Größenordnung«
Wir stecken den Rahmen für eine Welt der Städte ab und spekulieren über ihre Entstehung
»Megastätten«: Wie archäologische Funde in der Ukraine das herkömmliche Wissen über die Entstehung von Städten auf den Kopf stellen
Über Mesopotamien und eine ›nicht ganz so primitive‹ Demokratie
Wie die Geschichtsschreibung (und wahrscheinlich auch die mündliche Erzählkunst) begann: mit großen Räten in den Städten und kleinen Königreichen in den Hügeln
War die Indus-Zivilisation ein Beispiel dafür, dass das Kastensystem vor dem Königtum entstand?
Über einen offenkundigen Fall von »urbaner Revolution« in der chinesischen Vorgeschichte
Kapitel Neun
Im Verborgenen schlummernd
Die indigenen Ursprünge des sozialen Wohnungsbaus und der Demokratie in Amerika
Fremde als Könige im Tiefland der Maya und ihre Verbindung mit Teotihuacán
Wie die Bewohner von Teotihuacán auf die Errichtung von Monumenten und auf Menschenopfer verzichteten und stattdessen ein bemerkenswertes Projekt des sozialen Wohnungsbaus in Angriff nahmen
Über Tlaxcala, eine indigene Republik, die sich dem Aztekenreich widersetzte und später mit den spanischen Invasoren verbündete, und darüber, wie diese schicksalhafte Entscheidung aus demokratischen Beratungen in einem städtischen Parlament hervorging (im Gegensatz zu den faszinierenden Auswirkungen europäischer Technologie auf das Denken der ›Indianer‹)
Kapitel Zehn
Warum der Staat keinen Ursprung hat
Die bescheidenen Anfänge von Souveränität, Bürokratie und Politik
Die drei Grundformen der Herrschaft und ihre Auswirkungen auf die menschliche Geschichte
Über Azteken, Inka und Maya (und dann auch die Spanier)
Exkurs: Die »Form der Zeit« und wie Wachstums- und Verfallsmetaphern einen politisch voreingenommenen Blick auf die Geschichte bewirken
Politik als Sport: Der Fall der Olmeken
Chavín de Huántar: Ein Reich auf Bildern errichtet?
Souveränität ohne »Staat«
Wie Fürsorge, rituelle Tötungen und »winzige Blasen« in Ägyptens Frühzeit zusammenkamen
Die Unterschiede der »frühen Staaten« von China bis Mesoamerika
Der frühe ägyptische Staat im Licht der drei Grundformen von Herrschaft und das Problem der »Dunklen Zeitalter«
Die wahren Ursprünge der Bürokratie und ihre überraschend kleinen Anfänge
Die Prämissen der gesellschaftlichen Entwicklung im Spiegel des neuen Wissens
Zivilisation, leere Wände und eine neue Geschichtsschreibung
Kapitel Elf
Der Kreis schließt sich
Über die historischen Grundlagen der indigenen Kritik
Die Argumentation von James C. Scott in Bezug auf die vergangenen 5000 Jahre und die Frage, ob die heutige Weltordnung wirklich unvermeidlich war
Warum hatte ein Großteil Nordamerikas ein einziges einheitliches Clan-System, und welche Rolle spielte die »Hopewell-Interaktionssphäre« dabei?
Die Geschichte von Cahokia, dem vermutlich ersten »Staat« in Amerika
Wie der Zusammenbruch der Welt am Mississippi und die Ablehnung ihres Vermächtnisses während der europäischen Invasion neuen Formen indigener Politik den Weg ebnete
Das Prinzip der Selbstverfassung bei den Osage, das später in Montesquieus
Vom Geist der Gesetze
gepriesen wurde
Die Irokesen und die politischen Weltanschauungen, mit denen Kondiaronk aufwuchs
Kapitel Zwölf
Schluss
Anfänge – eine neue Geschichte der Menschheit
Anhang
Bibliographie
Anmerkungen
1. Abschied von der Kindheit der Menschheit
2. Sündhafte Freiheit
3. Die Eiszeit auftauen
4. Freie Menschen, der Ursprung der Kulturen und die Entstehung des Privateigentums
5. Vor langer Zeit
6. Die Adonis-Gärten
7. Die Ökologie der Freiheit
8. Imaginäre Städte
9. Im Verborgenen schlummernd
10. Warum der Staat keinen Ursprung hat
11. Der Kreis schließt sich
12. Schluss
Bild- und Kartenverzeichnis
Namen- und Ortsregister
David Wengrow
Vorwort und Widmung
David Rolfe Graeber starb am 2. September 2020 im Alter von 59 Jahren gut drei Wochen, nachdem wir dieses Buch beendet hatten. Es hatte vor mehr als zehn Jahren als eine Ablenkung von unseren »ernsteren« akademischen Pflichten begonnen: ein Experiment, ja fast ein Spiel, in dem ein Anthropologe und ein Archäologe mit dem heute vorhandenen Quellenmaterial versuchten, den großen Dialog über die menschliche Geschichte wiederzubeleben, der in unseren Fächern einst ganz normal gewesen ist. Es gab keine Regeln und keine Fristen. Wir schrieben, wie und wann wir Lust hatten, und dies entwickelte sich allmählich zu einer täglichen Praxis. Das Projekt kam in den letzten Jahren vor seiner Vollendung immer stärker auf Touren, und es war nicht ungewöhnlich, dass wir zwei- oder dreimal am Tag darüber sprachen. Dabei verloren wir oft aus den Augen, wer welche Idee oder welche neuen Fakten und Beispiele beisteuerte. Alles landete im »Archiv«, das schon bald weit mehr Material enthielt, als für ein einzelnes Buch gereicht hätte.
Das Ergebnis ist kein Flickenteppich, sondern eine echte Synthese. Wir bekamen ein Gefühl für unseren jeweiligen Stil zu schreiben und zu denken, und näherten uns einander schrittweise an, bis alles zu einem einzigen Strom zusammenfloss. Als wir erkannten, dass wir die geistige Reise, zu der wir aufgebrochen waren, noch nicht beenden wollten und dass viele der Konzepte, die in diesem Buch vorgestellt werden, von weiterer Entwicklung und Erläuterung profitieren würden, planten wir, nicht weniger als drei Fortsetzungen zu schreiben.
Doch das erste Buch musste irgendwo enden. Also verkündete David Graeber am 6. August 2020 um 21:18 Uhr mit dem typischen Twitter-Flair (und einem Zitat frei nach Jim Morrison), dass es geschafft sei: »My brain feels bruised with numb surprise« (»Mein Geist ist wie geprellt von dumpfer Überraschung«). Wir kamen genauso zum Abschluss unseres Projektes, wie wir es angefangen hatten: im Dialog und durch ständigen Austausch von Entwürfen, während wir dieselben Quellen lasen und oft bis in die frühen Morgenstunden über sie sprachen.
David Graeber war weit mehr als ein Anthropologe. Er war ein Aktivist und öffentlicher Intellektueller von internationalem Ruf. Seine Ideen von sozialer Gerechtigkeit und Befreiung versuchte er zu leben, gab den Unterdrückten Hoffnung und inspirierte zahllose andere zur Nachfolge.
Dieses Buch ist dem liebevollen Andenken David Graebers (1961–2020) und dem Gedenken an seine Eltern Ruth Rubinstein Graeber (1917–2006) und Kenneth Graeber (1914–1996) gewidmet. Mögen sie zusammen in Frieden ruhen.
Dank
Traurige Umstände zwingen mich – David Wengrow –, diesen Dank in David Graebers Abwesenheit zu schreiben. Zurück geblieben ist seine Frau und ständige Gefährtin Nika Dubrovsky. Sein Tod löste eine große Welle der Trauer aus, die Menschen über Kontinente, Klassen und ideologische Grenzen hinweg verband.
Zehn Jahre gemeinsames Schreiben und Denken sind eine lange Zeit, dennoch kann ich nur vermuten, wem David in diesem besonderen Kontext hätte danken wollen. Seine Mitreisenden auf den Wegen, die zu diesem Buch führten, werden bereits wissen, wer sie sind und wie sehr er ihre Unterstützung und Zuwendung und ihren Rat schätzte.
Eines jedoch weiß ich ganz sicher: Dieses Buch, oder wenigstens irgendein Buch in der nun realisierten Form, wäre ohne die Inspiration und Energie von Melissa Flashman, unserer klugen Beraterin in allen literarischen Dingen, niemals zustande gekommen. Mit Eric Chinski von Farrar, Straus and Giroux und Thomas Penn von Penguin in Großbritannien fanden wir ein Herausgeberteam und echte geistige Partner. Für ihre leidenschaftliche Auseinandersetzung mit unserem Denken und ihre leidenschaftlichen Interventionen geht unser herzlicher Dank an Debbie Bookchin, Alpa Shah, Erhard Schüttpelz und Andrea Luka Zimmerman. Dank schulden wir auch für ihre großzügige und fachmännische Unterstützung bei verschiedenen Aspekten des Buches Manuel Arroyo-Kalin, Elizabeth Baquedano, Nora Bateson, Stephen Berquist, Nurit Bird-David, Maurice Bloch, David Carballo, John Chapman, Luiz Costa, Philippe Descola, Aleksandr Diachenko, Kevan Edinborough, Dorian Fuller, Bisserka Gaydarska, Colin Grier, Thomas Grisaffi, Chris Hann, Wendy James, Megan Laws, Patricia McAnany, Barbara Alice Mann, Simon Martin, Jens Notroff, José R. Oliver, Mike Parker Pearson, Timothy Pauketat, Matthew Pope, Karen Radner, Natasha Reynolds, Marshall Sahlins, James C. Scott, Stephen Shennan und Michele Wollstonecroft.
Verschiedene Thesen dieses Buches wurden zuerst im Rahmen von Vorlesungsreihen oder in wissenschaftlichen Zeitschriften vorgestellt: Eine frühere Version von Kapitel Zwei erschien in Frankreich unter dem Titel »La sagesse de Kondiaronk: La critique indigène, le mythe du progrès et la naissance de la Gauche« (La Revue du MAUSS); Teile von Kapitel Drei erschienen erstmals unter dem Titel »Farewell to the Childhood of Man: Ritual, Seasonality, and the Origins of Inequality« (The 2014 Henry Myers Lecture, Journal of the Royal Anthropological Institute); Teile von Kapitel Vier unter dem Titel »Many Seasons ago: Slavery and its Rejection among Foragers on the Pacific Coast of North America« (American Anthropologist); und von Kapitel Acht unter dem Titel »Cities before the State in Early Eurasia« (The 2015 Jack Goody Lecture, Max Planck Institute for Social Anthropology).
Unser Dank sei auch den verschiedenen akademischen Einrichtungen und Forschungsgruppen ausgesprochen, die uns einluden, über Themen im Zusammenhang mit diesem Buch zu sprechen und zu debattieren, und insbesondere an Enzo Rossi und Philippe Descola für die denkwürdigen Veranstaltungen an der Universität Amsterdam und am Collège de France. James Thomson (der frühere Chefredakteur von Eurozine) half uns als Erster, unsere Ideen durch den Aufsatz »How to Change the Course of Human History (at least, the Part that’s already Happened)« weltweit zu verbreiten. Er nahm ihn aus Überzeugung in sein Blatt auf, als andere Medien noch davor zurückschreckten; Dank schulden wir auch den vielen Übersetzern, die seither die Leserschaft des Aufsatzes vergrößert haben. Und wir danken Kelly Burdick von Lapham’s Quarterly, die einen Beitrag zu einer Sonderausgabe über das Thema Demokratie bei uns anforderte; darin stellten wir einige der Ideen vor, die hier in Kapitel Neun zu finden sind.
Von Anfang an integrierten David und ich die Arbeit an diesem Buch in unsere Lehrveranstaltungen in der Abteilung für Anthropologie an der London School of Economics (LSE) beziehungsweise dem Institut für Archäologie am University College London. Deshalb möchte ich unseren Studenten in unserer beider Namen für ihre vielen Einsichten und Überlegungen in den vergangenen zehn Jahren danken. Martin, Judy, Abigail und Jack Wengrow waren jeden Schritt des Weges an meiner Seite. Mein letzter und tiefster Dank geht an Ewa Domaradzka für die schärfste Kritik und die leidenschaftlichste Unterstützung, die sich ein Partner wünschen kann. Du bist ganz ähnlich wie David und dieses Buch in mein Leben getreten:
»Rain riding suddenly out of the air,Battering the bare walls of the sun …Rain, rain on dry ground!«
»Regen plötzlich aus der Luft,Schlägt gegen die nackten Mauern der Sonne …Regen auf trockener Erde.«
Christopher Fry
Kapitel Eins
Abschied von der Kindheit der Menschheit
Oder warum dies kein Buch über die Ursprünge der Ungleichheit ist
Diese Stimmung macht sich ja überall bemerkbar, politisch, sozial und philosophisch. Wir leben im Kairos für den »Gestaltwandel der Götter«, das heißt der grundlegenden Prinzipien und Symbole.
C. G. Jung(1), Gegenwart und Zukunft (1957)
Unwiederbringlich ist der größte Teil der Menschheitsgeschichte für uns verloren. Homo sapiens, unsere Spezies, existiert seit mindestens 200 000 Jahren. Für diesen Zeitraum haben wir jedoch größtenteils keine Ahnung, was mit dem Homo sapiens passierte: In der Höhle von Altamira(1) in Nordspanien(1) wurden beispielsweise in einem Zeitraum von mindestens 10 000 Jahren, von etwa 25 000 bis etwa 15 000 v. Chr., Gemälde und Gravuren geschaffen. Vermutlich sind in dieser Zeit eine Menge interessanter Dinge geschehen, wurde eine Vielzahl einzigartiger Objekte zum ersten Mal überhaupt erst geschaffen und hervorgebracht, aber wir haben keine Möglichkeit zu erfahren, um was für Ereignisse es sich bei den meisten von ihnen handelte.
Für sehr viele Menschen hat dies so gut wie keine Bedeutung. Sie denken ohnehin kaum über den Gesamtverlauf der Menschheitsgeschichte nach. Dazu haben sie auch kaum einen Grund. Wenn das Thema überhaupt aufkommt, dann hängt es meistens mit der Frage zusammen: Warum befindet sich die Welt offenbar in einem so miserablen Zustand und warum behandeln Menschen einander so oft schlecht? Das Thema hängt also zusammen mit der Frage nach den Ursachen für Krieg, Gier, Ausbeutung und der systematischen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden anderer. Waren wir schon immer so? Oder ist an irgendeinem Punkt etwas schrecklich missraten?
Im Grunde genommen ist dies eine theologische Debatte, denn eigentlich geht es um die Frage: Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse? So formuliert hat die Frage genau betrachtet jedoch kaum einen Sinn. »Gut« und »böse« sind rein menschliche Konzepte. Niemandem würde es einfallen, darüber zu streiten, ob ein Fisch oder ein Baum gut oder böse ist, denn »gut« und »böse« sind Begriffe, die wir Menschen erfunden haben, um uns miteinander vergleichen zu können. Ein Streit, ob die Menschen dem Wesen nach gut oder böse sind, hat deshalb etwa genauso viel Sinn, wie ein Disput darüber, ob sie im Grunde dick oder dünn sind.
Dennoch kommen Menschen, wenn sie über die Lehren aus der Vorgeschichte nachdenken, fast immer auf solche Fragen zurück. Mit der christlichen Antwort sind wir alle vertraut: Wir lebten einst in einem Zustand der Unschuld, sind jedoch durch die Ursünde verdorben. Wir wollten sein wie Gott und wurden dafür bestraft. Nun leben wir in einem gefallenen Zustand und hoffen auf Erlösung.
Die populäre Version dieser Geschichte ist heute vermutlich irgendeine aktualisierte Fassung von Jean-Jacques Rousseaus(1) 1754 geschriebener Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Einst, so heißt es in der Geschichte, waren wir Jäger und Sammler, die in kleinen Gruppen in einem anhaltenden Zustand kindlicher Unschuld lebten. Diese Gruppen waren egalitär, und das war genau deshalb möglich, weil sie so klein waren. Erst mit der »Neolithischen Revolution«, die je nach Region vor 10 000, teilweise schon vor 20 000 Jahren begann, und noch mehr mit dem Aufstieg der Städte ging dieser glückliche Zustand zu Ende und wurde von der »Zivilisation« und »dem Staat« abgelöst. Dies brachte auch Literatur, Wissenschaft und Philosophie hervor, aber zugleich kam auch fast alles Schlechte in die Welt: das Patriarchat, stehende Heere, Massenhinrichtungen und nervige Bürokraten, die von uns verlangen, dass wir den größten Teil unseres Lebens damit verbringen, Formulare auszufüllen.
Das alles ist selbstverständlich ausgesprochen grob vereinfacht, und doch scheint es wirklich die Gründungsgeschichte zu sein, die immer dann an die Oberfläche kommt, wenn irgendjemand, sei es ein Industriepsychologe oder ein Revolutionstheoretiker, beispielsweise behauptet: »Aber natürlich lebte der Mensch für den größten Teil seiner Entwicklungsgeschichte in Gruppen von zehn oder zwanzig Mitgliedern« oder »die Landwirtschaft war vielleicht der größte Fehler der Menschheit«.
Viele populäre Schriftsteller vertreten, wie wir sehen werden, ausdrücklich diese Ansicht. Das Problem ist nur, dass jeder, der nach einer Alternative zu diesem doch recht deprimierenden Geschichtsbild sucht, schnell feststellen wird, die einzig verfügbare ist sogar noch schlimmer: wenn nicht Jean-Jacques Rousseau(2) (1712–1778), dann Thomas Hobbes(1) (1588–1679).
1651 erschien die Erstausgabe des Leviathan von Thomas Hobbes(2). Dieses Buch ist in vieler Hinsicht der Gründungstext der modernen politischen Theorie. Ihm zufolge sind die Menschen selbstsüchtige Wesen. Deshalb war ihr Leben auch im Urzustand keineswegs unschuldig, sondern »einsam, armselig, scheußlich, tierisch und kurz«. Eigentlich herrschte ein Kriegszustand; jeder kämpfte gegen jeden. Wenn es aus diesem finsteren Urzustand irgendeinen Ausweg gab, so war dieser, wie ein Schüler von Hobbes(3) argumentieren würde, zum größten Teil jenen repressiven Institutionen zu verdanken, über die sich Rousseau(3) beschwerte: Regierungen, Gerichte, Bürokratien und Ordnungskräfte. Auch diese Sicht der Dinge existiert schon sehr lange Zeit. Und es hat seinen Grund, dass die englischen(1) Wörter »politics« (Politik), »polite« (höflich) und »police« (Polizei) so ähnlich klingen; sie alle leiten sich von dem griechischen Wort polis (Stadt) ab. Sein lateinisches Äquivalent ist civitas, dem wir die Wörter »Zivilität«, »zivil« und ein gewisses modernes Vorverständnis von »Zivilisation« verdanken.
Die menschliche Gesellschaft beruht demnach auf der kollektiven Unterdrückung unserer niedrigeren Instinkte; je mehr Menschen an einem Ort leben, umso nötiger wird diese Triebhemmung. Ein heutiger Anhänger von Hobbes(4) würde deshalb argumentieren, wir hätten tatsächlich während des größten Teils unserer Entwicklungsgeschichte in kleinen Gruppen gelebt, die vor allem deshalb zurechtkamen, weil sie ein gemeinsames Interesse am Überleben ihrer Nachkommen hatten (»Elternaufwand« nennen dies Evolutionsbiologen).
Selbst diese Gruppen waren jedoch keineswegs auf Gleichheit gegründet. Vielmehr wurden sie, folgt man dieser Anschauung, immer von irgendeinem »Alpha-Mann« geführt. Hierarchie, Herrschaft und zynisches Eigeninteresse waren demnach schon immer die Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Nur haben wir kollektiv gelernt, dass es zu unserem Vorteil ist, wenn wir unseren langfristigen Interessen im Vergleich zu unseren unmittelbaren Instinkten die höhere Priorität einräumen; oder besser noch, Gesetze schaffen, die uns zwingen, unsere negativsten Impulse auf gesellschaftlich nützlichen Gebieten wie der Ökonomie auszuleben und sie sonst überall zu verbieten.
Wie der Leser aus dem Ton unserer Äußerungen schließen dürfte, sind wir nicht gerade begeistert davon, zwischen diesen beiden Alternativen wählen zu müssen. Unsere Einwände lassen sich grob in drei Kategorien einteilen. Um den generellen Verlauf der Menschheitsgeschichte darzustellen, sind sie
schlicht und einfach unwahr,
mit schlimmen politischen Konsequenzen verbunden und
dafür verantwortlich, dass die Vergangenheit langweiliger als nötig erscheint.
Dieses Buch ist ein Versuch, mit der Erzählung einer anderen, hoffnungsvolleren und interessanteren Geschichte zu beginnen. Diese neue Erzählung berücksichtigt die Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte stärker. Dabei geht es teilweise darum, die in Archäologie, Anthropologie und verwandten Fächern angehäuften Zeugnisse zusammenzubringen, die offenbar auf eine völlig neue Darstellung der Entwicklung menschlicher Gesellschaften in den vergangenen 30 000 Jahren hindeuten. Fast all diese Forschungsergebnisse stehen zum vertrauten Narrativ im Gegensatz, aber allzu oft sind die bemerkenswertesten Entdeckungen auf die Arbeit von Spezialisten begrenzt, oder sie wurden abgeleitet, indem man bei wissenschaftlichen Publikationen zwischen den Zeilen las.
Um wenigstens ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie neu das so entstehende Bild ist: Heute wissen wir, dass menschliche Gesellschaften vor der Entstehung der Landwirtschaft nicht auf kleine, egalitäre Gruppen beschränkt waren. Ganz im Gegenteil – schon zuvor fanden in der Welt der Jäger und Sammler mutige soziale Experimente statt, die weit mehr einem Karnevalszug politischer Formen glichen als den öden Abstraktionen der Evolutionstheorie. Die Landwirtschaft wiederum war nicht mit der Entstehung des Privateigentums verbunden, und sie bedeutete keineswegs einen irreversiblen Schritt Richtung Ungleichheit. In Wirklichkeit waren viele der ersten landwirtschaftlichen Gemeinden relativ frei von Rängen und Hierarchien. Und eine überraschend große Zahl der ersten Städte auf unserem Planeten war weit davon entfernt, Klassenunterschiede in Stein zu meißeln. Sie waren in robusten egalitären Strukturen organisiert – ohne Bedarf an autoritären Herrschern, ehrgeizigen Krieger-Politikern oder auch nur herrischen Verwaltern.
Die Informationen, die für solche Themen relevant sind, werden in allen Weltgegenden gesammelt mit dem Ergebnis, dass Forscher rund um den Globus das ethnographische und historische Material in einem neuen Licht betrachten. Die Teile des Puzzles sind heute vorhanden, um eine völlig andere Weltgeschichte zusammenzusetzen. Doch bis jetzt sind sie nur ein paar privilegierten Experten bekannt (und selbst diese zögern, ihren eigenen kleinen Teil des Puzzles liegen zu lassen und ihre Aufzeichnungen mit anderen Forschern außerhalb ihres Spezialgebiets zu vergleichen).
Ziel dieses Buches ist es, einige Teile des Puzzles zusammenzufügen in dem vollen Bewusstsein, dass noch kein Mensch über ein auch nur annähernd vollständiges Set verfügt. Die Aufgabe ist gewaltig, und die Themen sind so wichtig, dass es Jahre der Forschung und Diskussion brauchen wird, um die Folgen des Bildes, das wir zu sehen beginnen, auch nur ansatzweise zu verstehen. Dennoch ist es von großer Bedeutung, den Prozess in Gang zu setzen.
Eines wird dabei sehr schnell deutlich werden, nämlich dass das vorherrschende »große Bild« der Geschichte, das von den modernen Anhängern von Hobbes(5) und Rousseau(4) gleichermaßen geteilt wird, so gut wie nichts mit den Fakten zu tun hat. Um jedoch die neuen Informationen, die wir jetzt vor Augen haben, zu verstehen, reicht es nicht aus, riesige Datenmengen zu sammeln und zu sichten. Auch eine konzeptionelle Transformation ist erforderlich.
Diese Transformation ist nur möglich, wenn wir einige der ersten Schritte zurückverfolgen, die zu unserer modernen Vorstellung von gesellschaftlicher Entwicklung geführt haben: die Idee, dass menschliche Gesellschaften nach Entwicklungsstufen geordnet werden könnten, die jeweils über eigene charakteristische Technologien und Organisationsformen verfügen (Jäger und Sammler, Ackerbauern, städtisch-industrielle Gesellschaft usw.). Wie wir sehen werden, wurzeln solche Vorstellungen in einer konservativen Gegenreaktion gegen die Kritik an der europäischen(1) Zivilisation, die in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts an Boden gewann. Die Ursprünge dieser Kritik liegen jedoch nicht bei den Philosophen der Aufklärung (so sehr diese sie anfangs auch bewunderten und nachahmten), sondern bei indigenen Kommentatoren und Beobachtern der europäischen(2) Gesellschaft, wie etwa dem indianischen (Wendat(1)-Huronen-)Staatsmann Kondiaronk(1) (1649–1701), über den wir im nächsten Kapitel ausführlich berichten.
Wieder aufzugreifen, was wir als »indigene Kritik« bezeichnen, bedeutet Beiträge zum sozialen Denken ernst zu nehmen, die nicht dem europäischen(3) Kanon, sondern insbesondere jenen indigenen Völkern entstammen, denen westliche Philosophen in der Geschichte entweder die Rolle von Engeln oder von Teufeln zuweisen. Beide Positionen schließen jede reale Möglichkeit eines intellektuellen Austauschs oder gar Dialogs aus: Es ist genauso schwer, mit jemandem zu diskutieren, den man verteufelt, wie mit jemandem, den man vergöttert. Denn alles, was der Teufel oder Engel denkt oder sagt, wird dabei entweder für irrelevant oder für äußerst tiefgründig gehalten.
Die meisten Personen, über die wir in diesem Buch sprechen, sind schon lange tot, und es ist nicht mehr möglich, irgendein Gespräch mit ihnen zu führen. Dennoch sind wir fest entschlossen, die Vorgeschichte so aufzuzeichnen, dass sie von Menschen handelt, mit denen wir sprechen könnten, wenn sie noch lebten – Menschen, die nicht nur als öde Muster, Typen, Sprachrohre oder Spielbälle irgendeines unerbittlichen Gesetzes der Geschichte existieren.
Selbstverständlich gibt es Tendenzen in der Geschichte. Einige sind mächtig. Deren Strömungen sind so stark, dass es kaum möglich ist, gegen den Strom zu schwimmen (wenngleich es anscheinend immer jemand schafft, es dennoch zu tun). Die »Gesetze« jedoch werden ausschließlich von uns selbst erdacht. Womit wir bei unserem zweiten Einwand wären.
Warum sich aus der Menschheitsgeschichte nach Hobbes(6) und Rousseau(5) verhängnisvolle politische Konsequenzen ergeben
Die politischen Folgen des Modells von Thomas Hobbes(7) bedürfen keiner näheren Erläuterung. Eine Grundannahme unseres Wirtschaftssystems lautet, der Mensch ist im Grunde genommen ein böses und egoistisches Wesen. Seine Entscheidungen gründen eher auf zynischem, egoistischem Kalkül als auf Altruismus oder Kooperation. Trifft dies zu, können wir bestenfalls auf möglichst wirksame interne und externe Kontrollen unseres angeblich angeborenen Drangs zu Anhäufung und Selbstüberhöhung hoffen.
Jean-Jacques Rousseaus(6) Geschichte, wie die Menschheit von einem Urzustand egalitärer Unschuld in die Ungleichheit abstieg, scheint optimistischer zu sein (es gab wenigstens einmal etwas Besseres, von dem man herabsinken konnte). Heutzutage jedoch wird diese Erläuterungsgeschichte meist eingesetzt, um uns davon zu überzeugen, das System, unter dem wir leben, sei zwar ungerecht, wir könnten aber realistischerweise nicht mehr als ein wenig und recht bescheiden daran herumbasteln. Sehr erhellend ist in dieser Hinsicht der Begriff »Ungleichheit«.
Seit dem Finanzcrash des Jahres 2008 und den darauffolgenden Verwerfungen ist die Frage der Ungleichheit – und damit auch deren langwährende Geschichte – ein wichtiges Diskussionsthema geworden. Unter Intellektuellen und bis zu einem gewissen Grad auch in der politischen Sphäre hat sich eine Art Konsens herausgebildet, das Ausmaß der sozialen Ungleichheit sei außer Kontrolle geraten und die meisten Weltprobleme beruhten auf der Kluft zwischen Besitzenden und Mittellosen, die immer breiter werde. Diese Feststellung bedeutet wirklich eine Herausforderung für die globalen Machtstrukturen, sie ist aber so formuliert, dass die Menschen, die von den gegebenen Strukturen profitieren, sie immer noch beruhigend finden können, weil sie einschließt, eine sinnvolle Problemlösung sei unmöglich.
Man braucht sich nur vorzustellen, das Problem würde so formuliert, wie man es vermutlich vor fünfzig oder zweihundert Jahren getan hätte: als Konzentration von Kapital, als Oligopol oder als die Macht einer Klasse. Das Wort »Ungleichheit« klingt im Vergleich zu diesen Begriffen so, als sei es bewusst darauf angelegt, halbe Maßnahmen und Kompromisse zu fördern. Den Kapitalismus abzuschaffen oder die Macht des Staates zu brechen, kann man sich vorstellen, aber es ist nicht einmal klar, was es auch nur bedeuten könnte, die Ungleichheit zu beseitigen: Welche Art von Ungleichheit? Des Vermögens? Der Chancen? Wie gleich müssten die Menschen genau sein, damit wir sagen könnten, wir hätten die Ungleichheit überwunden? Der Begriff »Ungleichheit« bringt soziale Probleme in eine adäquate Form für ein Zeitalter technokratischer Reformer, die von vornherein annehmen, eine wirkliche Vision sozialer Veränderung stehe überhaupt nicht zur Debatte.
Wer über Ungleichheit diskutiert, kann mit Zahlen jonglieren, über Gini-Koeffizienten und Dysfunktionsschwellen reden, Steuer- oder Sozialsysteme nachjustieren und sogar die Öffentlichkeit mit Zahlen darüber schockieren, wie schlecht die Lage inzwischen geworden ist: »Können Sie sich das vorstellen? Der reichste Teil der Weltbevölkerung besitzt 44 Prozent des Weltvermögens!« Doch er kann das alles tun, ohne sich auch nur wegen eines der Faktoren zu beunruhigen, die angesichts der »ungleichen« sozialen Arrangements die Betroffenen tatsächlich stören: etwa, dass es manchen gelingt, ihren Reichtum in Macht über andere umzuwandeln; oder dass Menschen gesagt wird, ihre Bedürfnisse seien unwichtig und ihr Leben sei weder selbstbewusst noch wertvoll. Letzteres, sollen wir glauben, sei das unvermeidliche Ergebnis von Ungleichheit, und Ungleichheit sei immer unvermeidlich, wenn man in einer großen, komplexen, urbanen, technologisch hoch entwickelten Gesellschaft lebt. Vermutlich wird Ungleichheit uns immer begleiten. Nur in welchem Ausmaß – das ist die eigentliche Frage.
Das Nachdenken über Ungleichheit erlebt heute einen regelrechten Boom: Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist »globale Ungleichheit« seit 2011 regelmäßig ein Spitzenthema der Debatte. Es gibt Ungleichheitsindizes, Institute zur Erforschung der Ungleichheit und einen unaufhörlichen Strom von Publikationen, die danach trachten, die heutige Besessenheit vom Thema Ungleichheit in die Steinzeit zurückzuverfolgen und dort festzumachen. So hat man sogar schon versucht, das Einkommensniveau und den Gini-Koeffizienten für altsteinzeitliche Mammutjäger zu berechnen (beide haben sich als sehr niedrig entpuppt).[1] Das nimmt sich so aus, als hätten wir das Bedürfnis, mathematische Formeln zu finden, um eine Feststellung zu rechtfertigen, die schon zu Rousseaus(7) Zeiten populär war, nämlich dass in solchen Gesellschaften »alle gleich waren, weil alle gleich arm waren«.
Der ultimative Effekt all dieser Geschichten über einen ursprünglichen Zustand der Unschuld und Gleichheit wie auch der Verwendung des Begriffs »Ungleichheit« selbst besteht darin, einen wehmütigen Pessimismus über den Zustand der Menschheit als Ausdruck gesunden Menschenverstands erscheinen zu lassen, als das natürliche Ergebnis, wie wir uns selbst durch das weitgeöffnete Kameraobjektiv der Geschichte betrachten. Ja, wäre man Pygmäe oder Kalahari-Bewohner, könnte man vielleicht in einer wirklich egalitären Gesellschaft leben. Aber wer heute eine wirklich egalitäre Gesellschaft errichten will, muss einen Weg finden, wieder in winzigen Gruppen von Jägern und Sammlern ohne nennenswerten persönlichen Besitz zu leben. Und weil Jäger und Sammler ein ziemlich großes Territorium zur Nahrungssuche benötigen, müsste man dafür die Weltbevölkerung um etwa 99,9 Prozent verkleinern. Ansonsten können wir bestenfalls darauf hoffen, die Größe des Stiefels ein wenig zu verringern, der uns bis in alle Ewigkeit ins Gesicht treten wird, oder vielleicht ein bisschen Bewegungsspielraum zu erreichen, damit ihm einige von uns vorübergehend ausweichen können.
***
Ein erster Schritt zu einem genaueren, hoffnungsfroheren Bild der Weltgeschichte könnte darin bestehen, den Garten Eden ein für alle Mal zu verlassen und einfach mit der Vorstellung aufzuräumen, alle Menschen auf der Erde hätten über Hunderttausende von Jahren dieselbe idyllische Form der sozialen Organisation gemeinsam erlebt. Seltsamerweise wird dies jedoch oft als reaktionärer Schritt angesehen. »Willst du damit sagen, dass wahre Gleichheit nie erreicht worden ist? Dass sie deshalb unmöglich ist?« Unserer Ansicht nach sind solche Einwände kontraproduktiv und offen gesagt höchst unrealistisch.
Zunächst einmal ist die Vorstellung bizarr, dass in den 10 000 Jahren (manche würden sagen, eher 20 000), seitdem Menschen die Wände der Höhle von Altamira(2) bemalten, niemand – und das nicht nur in Altamira, sondern überall auf der Erde – mit alternativen Formen der sozialen Organisation experimentiert haben soll. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem so war?
Zweitens: Ist nicht die Fähigkeit, mit verschiedenen Formen sozialer Organisation zu experimentieren, ein wesentlicher Teil dessen, was uns zu Menschen, also zu Wesen mit der Fähigkeit zur Selbsterschaffung, ja zur Freiheit, macht? Das ultimative Problem der Menschheitsgeschichte ist, wie wir sehen werden, nicht der gleichberechtigte Zugang zu materiellen Ressourcen (Land, Kalorien, Produktionsmitteln), obwohl diese Dinge offensichtlich sehr wichtig sind, sondern die Frage, ob wir alle die gleiche Möglichkeit haben, an Entscheidungen mitzuwirken, die unser Zusammenleben betreffen. Natürlich setzt die Wahrnehmung dieser Möglichkeit voraus, dass es überhaupt etwas Sinnvolles zu entscheiden gibt.
Wenn, wie viele meinen, die Zukunft unserer Spezies heute von unserer Fähigkeit abhängt, etwas anderes zu schaffen (z. B. ein System, in dem sich Reichtum nicht frei in Macht umwandeln lässt oder in dem nicht einigen Menschen gesagt wird, ihre Bedürfnisse seien unwichtig oder ihr Leben habe keinen eigenen, inneren Wert), dann geht es letztlich um die Frage, ob wir die Freiheiten wiederentdecken können, die uns überhaupt erst zu Menschen machen. Schon im Jahr 1936 schrieb der Vorgeschichtler Vere Gordon Childe(1) (1892–1957) ein Buch mit dem Titel Der Mensch schafft sich selbst, dessen Geist wir heraufbeschwören wollen. Wir Menschen sind Projekte kollektiver Selbsterschaffung. Wie wäre es, wenn wir auch die Menschheitsgeschichte mit dieser Prämisse angehen würden? Wie wäre es, wenn wir die Menschen ab dem Beginn ihrer Geschichte als phantasievolle, intelligente, spielerische Wesen behandeln würden, die es verdienen, als solche verstanden zu werden? Wie wäre es, wenn wir, statt eine Geschichte darüber zu erzählen, wie unsere Spezies aus einem idyllischen Zustand der Gleichheit gefallen ist, fragen würden, wie es dazu kam, in so engen konzeptionellen Fesseln gefangen zu sein, dass wir uns nicht einmal mehr die Möglichkeit vorstellen können, uns neu zu erfinden?
Warum das verbreitete Verständnis der gesamten Menschheitsgeschichte größtenteils falsch ist – oder die ewige Wiederkehr des Jean-Jacques Rousseau(8)
Als wir um das Jahr 2010 dieses Buch auszuarbeiten begannen, beabsichtigten wir, neue Antworten auf die Frage nach den Ursprüngen sozialer Ungleichheit zu finden. Bald erkannten wir, dass unser Ansatz nicht sehr glücklich gewählt war. Betrachteten wir die Menschheitsgeschichte so, gingen wir notwendigerweise davon aus, die Menschheit hätte sich einst in einem idyllischen Zustand befunden und ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre alles schiefgegangen. Mit dieser Prämisse war es fast unmöglich, auch nur eine der Fragen zu stellen, die uns wirklich interessierten. Wir bekamen das Gefühl, wir alle säßen in derselben Falle. Die meisten Spezialisten weigerten sich, allgemeine Aussagen zu machen. Und wer es doch riskierte, reproduzierte und variierte fast ausnahmslos Rousseau(9).
Betrachten wir ein einigermaßen beliebiges Beispiel für eine dieser allgemeinen Darstellungen: Francis Fukuyamas(1)The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution (2011). Darin beschreibt der Autor, was seiner Ansicht nach als gängiges Wissen über frühmenschliche Gesellschaften angesehen werden kann: »In ihren frühen Stadien ähnelt die politische Organisation des Menschen einer Gesellschaft auf Hordenebene, die man schon bei höheren Primaten wie den Schimpansen beobachten kann«. Dies könne als eine »Standardform der sozialen Organisation« betrachtet werden. Im weiteren Verlauf behauptet Fukuyama (* 1952), Rousseau(10) habe mit seiner These weitgehend recht, der Ursprung der politischen Ungleichheit liege in der Entwicklung der Landwirtschaft, weil Jäger- und Sammlergesellschaften kein Konzept von Privateigentum besaßen und daher wenig Anreiz hatten, ein Stück Land abzustecken und zu sagen: »Das gehört mir.« Deshalb sind Gesellschaften auf Hordenebene laut Fukuyama »extrem egalitär«.[2]
Jared Diamond(1) (* 1937) vertritt in Vermächtnis: Was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können (2012) die Auffassung, Horden (in denen die Menschen, wie er meint, »auch noch vor 11 000 Jahren« lebten) umfassten nur »wenige Dutzend Personen, von denen viele zu einer oder mehreren Großfamilien gehörten«. Eine solche Gruppe fristet ein relativ ärmliches Dasein, indem sie »wilde Tiere jagt oder die Pflanzenarten sammelt, die zufällig auf einigen hundert Quadratmetern Waldland gedeihen«. Ihr Sozialleben ist, so Diamond, beneidenswert einfach. Entscheidungen werden in »persönlichen Gesprächen« getroffen; es gibt nur »wenige persönliche Habseligkeiten« und »weder eine formelle politische Führung noch eine starke wirtschaftliche Spezialisierung«.[3] Der Autor zieht daraus die Schlussfolgerung, der Mensch habe bedauerlicherweise nur in solchen urzeitlichen Gruppierungen je ein signifikantes Ausmaß an sozialer Gleichheit erreicht.
Für Diamond(2) und Fukuyama(2) waren es, genau wie für Rousseau(11) einige Jahrhunderte zuvor, die Erfindung der Landwirtschaft und der damit verbundene Anstieg der Bevölkerung, die diese Gleichheit, überall und für immer, beendet hätten. Bedingt durch die Landwirtschaft hätten »Stämme« die »Horden« abgelöst. Die Anhäufung von Nahrungsmittelüberschüssen führte zu einem größeren Bevölkerungswachstum, wodurch sich einige Stämme zu hierarchischen Gesellschaften, sogenannten »Stammesfürstentümern«, entwickelten. Mit einem nahezu biblischen Tableau malt Fukuyama diese Entwicklung, eine Art Abschied vom Paradies, aus: »Als kleine Horden von Menschen wanderten und sich an verschiedene andere Umgebungen anpassten, ließen sie den Naturzustand hinter sich, indem sie neue soziale Institutionen entwickelten.«[4] Kriege führten sie um Ressourcen. Unbeholfen und pubertär, wie sie waren, steuerten diese Gesellschaften buchstäblich auf Probleme zu.
Aber es war an der Zeit, erwachsen zu werden und eine richtige Führung einzusetzen. Hierarchien bildeten sich aus. Gegenwehr war sinnlos, weil Hierarchiebildung laut Diamond(3) und Fukuyama(3) unvermeidlich ist, sobald Menschen große, komplexe Organisationen hervorbringen. Es gab kein Zurück mehr, selbst wenn sich die neuen Anführer erbärmlich benahmen, landwirtschaftliche Überschüsse abschöpften, ihre Lakaien und Verwandten damit förderten, ihren Status dauerhaft und erblich machten, Schädel als Trophäen sammelten, sich Sklavinnen in Harems hielten oder Rivalen mit Obsidianmessern das Herz aus der Brust schnitten. Schon bald hatten die Häuptlinge andere davon überzeugt, dass sie als »Könige« oder sogar »Kaiser« bezeichnet werden mussten. Denn, wie Diamond(4) uns geduldig erklärt:
Eine große Bevölkerung funktioniert nicht ohne Führungspersonen, die Entscheidungen treffen, und ebenso braucht sie ausführende Organe, welche die Entscheidungen umsetzen, und Bürokraten, die Entscheidungen und Gesetze verwalten. Pech für alle Leser, die Anarchisten sind und von einem Leben ohne Staatsregierung träumen: Das sind die Gründe, warum ihr Traum unrealistisch ist. Sie müssten einen winzigen Clan oder Stamm finden, der sie aufnimmt, denn nur dort ist niemand ein Fremder, und Könige, Präsidenten oder Bürokraten werden nicht gebraucht(5).[5]
Eine unangenehme Schlussfolgerung, nicht nur für Anarchisten, sondern für jeden, der sich jemals gefragt hat, ob es eine gangbare Alternative zum aktuellen Status quo geben könnte.
Wirklich bemerkenswert ist freilich: Solche Behauptungen beruhen trotz ihres selbstsicheren Tons auf keinerlei wissenschaftlicher Evidenz. Wie wir bald sehen werden, gibt es überhaupt keinen Grund zu glauben, kleine Gruppen seien mit besonders großer Wahrscheinlichkeit egalitär – oder umgekehrt, große Gruppen müssten unbedingt Könige oder Präsidenten haben oder benötigten Bürokratien. Aussagen wie diese sind nichts als Vorurteile, die als Fakten oder sogar als historische Gesetze präsentiert werden.[6]
Über das Streben nach Glück
Wie schon gesagt, ist das alles eine endlose Wiederholung der Geschichte, die Rousseau(12) 1754 als Erster erzählte. Viele zeitgenössische Gelehrte werden schlicht kundtun, seine Vision habe sich als richtig erwiesen. Aber das wäre ein ganz außerordentlicher Zufall, denn Rousseau selbst hat nie behauptet, es hätte den unschuldigen Naturzustand wirklich gegeben. Im Gegenteil, er bestand darauf, dass es sich um ein Gedankenexperiment handelte: »Man darf nicht die Untersuchungen, in die man über dieses Thema eintreten kann, für historische Wahrheiten halten, sondern nur für hypothetische und bedingte Überlegungen, die mehr dazu geeignet sind, die Natur der Dinge zu erhellen, als ihren wirklichen Ursprung aufzuzeigen«.[7]
Rousseaus(13) Darstellung des Naturzustands und seiner Ablösung durch die aufkommende Landwirtschaft war nie als Grundlage für die Evolutionsstufen gedacht, auf die sich schottische Philosophen wie Adam Smith(1) (1723–1790), Adam Ferguson(1) (1723–1816) oder John Millar(1) (1735–1801) Mitte des 18. Jahrhunderts (und später Lewis Henry Morgan(1) (1818–1881) im 19. Jahrhundert) bezogen, wenn sie von ›Wildheit‹ oder ›Barbarei‹ sprachen. Rousseau stellte sich diese verschiedenen Seinszustände keineswegs als Stufen einer sozialen und moralischen Entwicklung vor, die mit historischen Veränderungen von Produktionsweisen wie Jagen und Sammeln, Naturweide- und Tierwirtschaft, Ackerbau und Industrieproduktion einhergingen. Was er präsentierte, glich eher einer Parabel, dem Versuch, ein grundlegendes Paradoxon menschlicher Politik zu untersuchen: Wie kommt es also, dass uns unser angeborenes Streben nach Freiheit immer wieder zu einem »spontanen Marsch in die Ungleichheit« führt?[8]
Im Zusammenhang mit seiner Beschreibung, wie die Erfindung des Ackerbaus zuerst zum Privateigentum und dann zur Notwendigkeit eines bürgerlichen Staates zum Schutz des Eigentums führt, formuliert Rousseau(14) dieses Phänomen folgendermaßen: »Alle rannten auf ihre Ketten los und glaubten, sie würden ihre Freiheit sichern; denn obgleich sie genügend Vernunft besaßen, um die Vorteile einer politischen Ordnung zu bemerken, besaßen sie doch nicht genügend Erfahrung, um deren Gefahren vorherzusehen.«[9] Sein imaginärer Naturzustand wurde in erster Linie herangezogen, um diesen Punkt zu veranschaulichen.
Tatsächlich hatte Rousseau dieses Konzept nicht erfunden: Der Naturzustand diente in der europäischen(4) Philosophie damals schon seit einem Jahrhundert als rhetorisches Mittel. Von Naturrechtstheoretikern vielfach eingesetzt, erlaubte der Begriff jedem Denker, der sich (wie John Locke(1) (1632–1704), Hugo Grotius(1) (1583–1645) und andere) für die Ursprünge des Staates interessierte, Gott zu spielen, indem er seine je eigene Variante des menschlichen Urzustands kreierte und sie als Sprungbrett für seine Spekulationen benutzte.
Genau dasselbe tat Hobbes(8), als er in seinem Leviathan schrieb, der Urzustand der menschlichen Gesellschaft sei notwendigerweise ein »Bellum omnium contra omnes« gewesen, ein Krieg aller gegen alle, der nur durch die Schaffung einer absoluten souveränen Macht überwunden werden konnte. Damit wollte er nicht behaupten, es habe wirklich eine Zeit gegeben, in der alle Menschen in einem solchen Urzustand gelebt hätten. Hobbes(9)’ Kriegszustand sei, so vermuten manche, in Wirklichkeit eine Allegorie für den Englischen Bürgerkrieg Mitte des 17. Jahrhunderts gewesen, der den royalistischen Autor ins Exil nach Paris(1) getrieben hatte. Wie dem auch sei, Hobbes(10) selbst kam der Behauptung, dieser Zustand existiere tatsächlich, am nächsten, als er feststellte, dass die einzigen Menschen, die der Autorität eines Königs gar nicht unterworfen wären, die Könige selbst seien. Und diese Könige schienen sich einander stets zu bekriegen.
Trotz alledem behandeln viele moderne Autoren den Leviathan so, wie andere Rousseaus(15)Abhandlung von dem Ursprunge der Ungleichheit behandeln: als ob sie die Grundlage für eine Studie über die historische Entwicklung legen würden. Obwohl Rousseau und Hobbes(11) völlig verschiedene Ausgangspunkte hatten, ist das Ergebnis auffallend ähnlich.[10]
***
»Was die Gewalt in vorstaatlicher Zeit betrifft«, schreibt der Psychologe Steven Pinker(1), »redeten Hobbes(12) und Rousseau(16) ins Blaue hinein: Beide wussten nicht das Geringste über das Leben vor Beginn der Zivilisation.« In diesem Punkt hat Pinker(2) (* 1954) vollkommen recht, will uns im selben Atemzug jedoch außerdem weismachen, dass Hobbes(13), während er 1651 (offensichtlich ins Blaue hinein) schrieb, irgendwie richtig riet, als er eine Analyse der Gewalt und ihrer Ursachen in der Menschheitsgeschichte vornahm, die »ebenso gut ist, wie alles, was heute geschrieben wird«.[11] Dieses Urteil würde ein erstaunliches – und ausgesprochen negatives – Licht auf die Ergebnisse von Jahrhunderten empirischer Forschungsarbeit werfen, wenn es denn wahr wäre. Wie wir sehen werden, kommt diese Einschätzung der Wahrheit nicht einmal ansatzweise nahe.[12]
Wir können Pinker(3) als die Quintessenz des modernen Hobbesianers(14) betrachten. In seinem Opus magnum Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit (2011) und seinen nachfolgenden Büchern wie Aufklärung jetzt: Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt: Eine Verteidigung (2018) vertritt er die Ansicht, wir würden heute in einer Welt leben, die insgesamt weit weniger gewalttätig und grausam ist als alles, was unsere Vorfahren je erlebt hatten.[13]
Nun mag dies jedem, der regelmäßig die Nachrichten verfolgt oder gar viel über die Geschichte des 20. Jahrhunderts weiß, nicht gerade einleuchtend erscheinen. Pinker(4) jedoch glaubt ernsthaft daran, eine seriöse, nicht durch Gefühle verzerrte Analyse beweise, dass wir in einem Zeitalter beispiellosen Friedens und beispielloser Sicherheit leben. Dies, behauptet er, sei das logische Ergebnis eines Lebens in souveränen Staaten, die allesamt über ein Monopol für den legitimen Einsatz von Gewalt auf ihrem Staatsgebiet verfügen, im Gegensatz zu den von ihm sogenannten »anarchischen Gesellschaften« unserer fernen Vergangenheit, in der das Leben für die meisten ihrer Mitglieder typischerweise »scheußlich, tierisch und kurz« war.
Steven Pinker(5) geht es genau wie Thomas Hobbes(15) um die Ursprünge des Staates; daher ist sein zentraler Übergangspunkt nicht das Aufkommen der Landwirtschaft, sondern die Entstehung der Städte. »Wie wir von den Archäologen wissen«, schreibt er, »lebten die Menschen in einem Zustand der Anarchie, bis sich vor rund 5000 Jahren die Zivilisation herausbildete. Damals schlossen sich sesshafte Bauern in Städten und Staaten zusammen, die ersten Regierungen entstanden.«[14] Was nun folgt, ist, unverblümt ausgedrückt, das, was sich ein moderner Psychologe beim Schreiben so alles ausdenkt. Man sollte erwarten, ein leidenschaftlicher Verfechter der Wissenschaft nähere sich dem Thema wissenschaftlich, also durch eine ausführliche Würdigung der Quellen, aber genau dieser Umgang mit der menschlichen Vorgeschichte scheint Pinker(6) gar nicht zu interessieren. Stattdessen vertraut er auf Anekdoten, Bilder und einzelne sensationelle Entdeckungen wie den schlagzeilenträchtigen Fund von »Ötzi, dem Tiroler Mann aus dem Eis« im Jahr 1991.
»Woran liegt es«, fragt er an einer Stelle, »dass die prähistorischen Menschen uns offenbar keine interessante Leiche hinterlassen konnten, ohne auf gewalttätige Methoden zurückzugreifen?«[15] Die Antwort liegt auf der Hand: Es kommt darauf an, welche Leiche man für interessant hält. Ja, vor etwas mehr als 5000 Jahren verendete ein Mann, der durch die Alpen wanderte, und verließ die Welt der Lebenden tatsächlich mit einem Pfeil in der Seite. Doch es gibt keinen besonderen Grund, Ötzi als repräsentativ für die Menschheit im Urzustand zu behandeln, außer vielleicht, dass dies gut zu Pinkers(7) Argument passt. Wenn wir freilich nur die Rosinen herauspicken wollten, hätten wir genauso gut einen viel älteren Leichnam wählen können, etwa den, der von den Archäologen (nach dem kalabrischen Felsenunterstand, in dem er gefunden wurde) als Romito 2(1) bezeichnet wird. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit und überlegen, was dies bedeuten würde.
Romito 2(2) ist das 10 000 Jahre alte Grab eines Mannes mit der seltenen genetischen Störung Akromesomele Dysplasie (AMD), einer schweren Form des Kleinwuchses, die ihn auf Grund seiner Anomalie zeit seines Lebens einschränkte. Sie hinderte ihn daran, an seiner Gemeinschaft aktiv teilzuhaben, wie sie ihn auch unfähig machte, sich an der Jagd, die überlebensnotwendig war, in Höhenlagen zu beteiligen. Untersuchungen seiner Pathologie zeigen, dass seine Gemeinschaft von Jägern und Sammlern trotz ihres allgemein schlechten Gesundheits- und Ernährungszustands ihn während der Kindheit und bis ins frühe Erwachsenenalter unterstützt haben muss. Sie gaben ihm genauso viel Fleisch wie allen anderen und bestatteten ihn ausnehmend sorgfältig und an einem geschützten Platz.[16]
Romito 2(3) ist kein Einzelfall. Wenn Archäologen umsichtige Auswertungen von Jäger- und Sammlerbestattungen aus dem Paläolithikum – der Altsteinzeit, die den Zeitraum von ca. 600 000 bis 10 000 v. Chr. umfasste – vornehmen, finden sie häufig gesundheitsbedingte Behinderungen, aber auch ein überraschend hohes Maß an Fürsorge bis zum Zeitpunkt des Todes (und darüber hinaus, da einige der Bestattungen bemerkenswert verschwenderisch waren).[17] Wollte man aus der statistischen Häufigkeit von Gesundheitsindikatoren bei vorgeschichtlichen Bestattungen eine allgemeine Schlussfolgerung darüber ziehen, wie menschliche Gesellschaften ursprünglich wirkten, müsste man zum genauen Gegenteil des Bildes gelangen, das Hobbes(16) (und Pinker(8)) zeichnet: Ursprünglich, so könnte man behaupten, sei unsere Spezies hilfsbereit und fürsorglich gewesen, und es habe einfach keine Notwendigkeit gegeben, dass das Leben hätte scheußlich, tierisch und kurz sein müssen.
Wir schlagen nicht vor, diesen Schluss zu ziehen. Wie wir sehen werden, besteht Grund zu der Annahme, während des Paläolithikums seien nur eher außergewöhnliche Menschen überhaupt begraben worden. Wie leicht es wäre, den Spieß umzudrehen, nur darauf wollen wir hinweisen – das wäre in der Tat einfach, aber nicht sehr erhellend.[18] Wenn wir uns mit den tatsächlich vorliegenden Quellen auseinandersetzen, stellen wir immer wieder fest, dass die Realitäten des frühen menschlichen Soziallebens weitaus komplexer und um einiges interessanter waren, als jeder moderne Naturzustandstheoretiker es jemals vermuten würde.
***
Geht es darum, anthropologische Fallstudien herauszupicken und sie als repräsentativ für unsere »heute lebenden Vorfahren« darzustellen, also als Modelle dafür, wie die Menschen in einem Naturzustand gewesen sein könnten, dann berufen sich Forscher, die der Tradition von Rousseau(17) verbunden sind, tendenziell auf afrikanische(1) Jäger und Sammler wie Hadza(1), Pygmäen(1) oder !Kung, wohingegen Hobbes(17)-Anhänger die Yanomami(1) bevorzugen.
Die Yanomami(2) sind ein indigenes Volk, das in seiner traditionellen Heimat im Amazonas(1)-Regenwald an der Grenze zwischen dem südlichen Venezuela(1) und dem nördlichen Brasilien(1) hauptsächlich vom Anbau von Kochbananen und Maniok lebt. Sie haben seit den Siebzigerjahren den Ruf, der Inbegriff des gewalttätigen Wilden zu sein, »wilde Menschen«, wie Napoleon Chagnon(1) (1938–2019), ihr berühmtester Ethnograph, sie nannte. Damit scheint man jedoch den Yanomami(3) entschieden unrecht zu tun, denn Statistiken belegen für die Yanomani, keineswegs besonders gewalttätig zu sein: Im Vergleich zu anderen indianischen Gruppen fallen ihre Mordraten durchschnittlich bis niedrig aus.[19] Auch im Fall der Yanomami(4) gilt jedoch, dass korrekte Statistiken offenbar weniger Gewicht haben als dramatische Bilder und Anekdoten. Der wirkliche Grund, warum die Yanomami(5) so berühmt sind und einen so schillernden Ruf haben, ist allein Napoleon Chagnon(2) zu verdanken, seinem 1968 erschienenen Buch Yanomamö: The Fierce People (Yanomamö: Das kriegerische Volk), das sich millionenfach verkaufte, und einer Serie von Filmen, die mit seiner Beteiligung gedreht wurde, wie etwa The Ax Fight, der dem Zuschauer ein leidenschaftliches Bild von Stammeskriegen vermittelt. All dies machte Chagnon(3) eine Zeit lang zum weltweit berühmtesten Anthropologen, und die Yanomami(6) wurden zu einer berühmt-berüchtigten Fallstudie primitiver Gewalt, auf die ihre wissenschaftliche Bedeutung im neu aufkommenden Feld der Soziobiologie zurückgeht.
Lassen wir Chagnon(4) Gerechtigkeit widerfahren (was nicht jeder tut): Er hat nie behauptet, die Yanomami(7) sollten als lebende Überbleibsel der Steinzeit behandelt werden; tatsächlich betonte er immer wieder, dass sie das offensichtlich nicht seien. Gleichzeitig jedoch, und das ist etwas ungewöhnlich für einen Anthropologen, stellte er sie dar, indem er sie eben tendenziell nicht mit den positiven Merkmalen ihrer Kultur verband, sondern in erster Linie mit den Dingen, die ihnen (wie etwa Schriftsprache, Polizei, formelles Gerichtswesen) fehlten. Damit ließ er die Yanomani als Inbegriff der Primitiven erscheinen.[20] Chagnons(5) wichtigstes Argument lautete, erwachsene Yanomami(8)-Männer erzielten sowohl kulturelle als auch reproduktive Vorteile, indem sie andere erwachsene Männer töten, und diese Rückkopplung zwischen Gewalt und biologischer Stärke, wenn sie generell repräsentativ für die Lage des Frühmenschen wäre, könnte für die Entwicklung unserer gesamten Spezies Folgen gehabt haben.[21]
Dieses ›Wenn‹ ist äußerst fragwürdig, aber ein Wenn von enormer Tragweite. Andere Anthropologen begannen, Chagnon(6) mit unfreundlichen Fragen ins Kreuzfeuer zu nehmen.[22] Ihm wurde berufliches Fehlverhalten vorgeworfen (meist ging es um ethische Standards seines Faches), und jeder ergriff dabei Partei. Einige Anschuldigungen waren offenbar unbegründet, aber Chagnons(7) Verteidiger reagierten so heftig, dass er (wie es Clifford Geertz(1) (1926–2006), ein anderer berühmter Anthropologe, ausdrückte) nicht nur zum Inbegriff des streng wissenschaftlichen Anthropologen hochstilisiert wurde, sondern alle, die ihn oder seinen Sozialdarwinismus in Frage stellten, als »Marxisten«, »Lügner«, »Kulturanthropologen der akademischen Linken«, »Ayatollahs« und »politisch korrekte Gutmenschen« geschmäht wurden. Bis heute ist nichts leichter, Anthropologen zu veranlassen, sich gegenseitig als Extremisten zu diffamieren, indem man den Namen Napoleon Chagnon(8) erwähnt.[23]
Der springende Punkt dieser Auseinandersetzung besteht darin, die Yanomami(9) als »Volk ohne Staat« seien angeblich beispielhaft für den Zustand, den Steven Pinker(9) als »Hobbessche(18) Falle« bezeichnet: ein Zustand, in dem Stammesgesellschaften in sich wiederholenden Zyklen von Raubzügen und Kriegen gefangen sind und sich immer nur wenige Augenblicke entfernt vom gewaltsamen Tod durch die Spitze einer scharfen Waffe oder den Schlag einer rachsüchtig geschwungenen Keule befinden, folglich ein höchst angespanntes und völlig unsicheres Leben führen. Dies ist laut Pinker(10) das düstere Schicksal, das die Evolution für uns bestimmt hat. Wir sind diesem Verhängnis nur durch die Bereitschaft entronnen, uns unter den gemeinsamen Schutz von Nationalstaat, Gerichten und Polizeikräften zu stellen, und auch, indem wir die Tugenden der vernunftbestimmten Debatte und Selbstbeherrschung übernommen haben, die Pinker(11) als das exklusive Erbe eines europäischen(5) »Zivilisatorischen Prozesses« ansieht, der das Zeitalter der Aufklärung hervorgebracht hat (mit anderen Worten: Ohne Voltaire(1) (1694–1778) und die Polizei würde das Hauen und Stechen um Chagnons(9) Befunde physisch und nicht nur akademisch ausgetragen).
Diese Argumentation ist mehrfach problembehaftet. Beginnen wir mit dem Offensichtlichsten: Der Gedanke, unsere heutigen Ideale von Freiheit, Gleichheit und Demokratie seien irgendwie Produkte der »westlichen Tradition«, hätte Voltaire(2) enorm überrascht. Wie wir in den weiteren Kapiteln sehen werden, legten die Denker der Aufklärung, die solche Ideale vertraten, diese fast ausnahmslos Ausländern, ja sogar »Wilden« wie den Yanomami(10) in den Mund. Eigentlich ist das keine wirkliche Überraschung. Denn es ist fast unmöglich, in der genannten westlichen Tradition von Platon(1) über Marc Aurel(1) bis Erasmus(1) von Rotterdam auch nur einen einzigen Autor zu finden, der nicht deutlich machen würde, gegen solche Ideen eingestellt zu sein. Erfunden wurde das Wort »Demokratie« wohl in Europa(6) – und das auch nur um ein Haar, denn Griechenland(1) war in der fraglichen Zeit Afrika(2) und dem Nahen Osten(1) kulturell viel näher als, sagen wir zum Beispiel, England(2) –, doch es ist nahezu ausgeschlossen, vor dem 19. Jahrhundert auch nur einen einzigen Autor aufzuspüren, der nicht die Ansicht vertreten hätte, dass die Demokratie nichts anderes als eine schreckliche Regierungsform sei.[24]
Die Position von Hobbes(19) bevorzugen offensichtlich eher Personen aus dem rechtsgerichteten, die von Rousseau(18) eher aus dem linksgerichteten politischen Spektrum. Steven Pinker(12) positioniert sich als rationaler Zentrist und verdammt diejenigen, die er für die Extremisten beider Seiten hält. Warum aber besteht er dann darauf, alle relevanten Formen menschlichen Fortschritts vor dem 20. Jahrhundert seien nur der einen Gruppe von Menschen zu verdanken, die sich früher als »weiße Rasse« bezeichnete (und heute im Allgemeinen das eher akzeptierte Synonym »westliche Zivilisation« verwendet)? Für diese Ansicht gibt es schlicht und einfach keinen Grund. Genauso einfach (ja sogar eher einfacher) wäre es, rund um den Erdball das zu finden, was sich als erste Regung von Rationalismus, Gesetzlichkeit, deliberativer Demokratie und so weiter umschreiben lässt, und erst dann die Geschichte zu erzählen, wie sich aus alledem das heutige globale System zusammenfügte.[25]
Wer auf der gegenteiligen Ansicht besteht, alles Gute komme ausschließlich aus Europa(7), motiviert dazu, dass seine Arbeit als Völkermordapologie (miss)verstanden werden kann, weil Versklavung und Vergewaltigung, Massenmord und Vernichtung ganzer Kulturen, die die europäischen(8) Mächte über die Welt brachten, (für Pinker(13) allem Anschein nach) nur ein weiteres Beispiel für menschliche Handlungsweisen sind, sich so zu verhalten, wie Menschen es schon immer getan haben, weshalb das alles keineswegs ungewöhnlich war. Wirklich bedeutsam ist Pinker(14) zufolge nur, dass all dies seiner Ansicht nach ermöglichte, das zu verbreiten, was er für »rein« europäische(9) Vorstellungen von Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und Menschenrechten unter den Überlebenden hält.
Trotz der unerfreulichen Ereignisse in der Vergangenheit haben wir laut Pinker(15) allen Grund, optimistisch, ja glücklich darüber zu sein, welchen Weg unsere Spezies insgesamt eingeschlagen hat. Pinker(16) räumt zwar ein, in Bereichen wie Armutsbekämpfung, Einkommensgleichheit oder in der Tat auch in der Friedens- und Sicherheitspolitik seien noch ernsthafte Anstrengungen notwendig, insgesamt jedoch und angesichts der großen Zahl von Menschen, die heute auf der Erde leben, habe sich unsere heutige Lage spektakulär gegenüber allem verbessert, was unsere Spezies in ihrer bisherigen Geschichte erreicht habe (es sei denn, man wäre schwarz oder lebte zum Beispiel in Syrien(1)). In fast jeder Hinsicht ist das moderne Leben für Pinker besser als alle früheren Zustände. Hier legt er aufwendige Statistiken vor, die angeblich zeigen, dass sich Gesundheit, Sicherheit, Bildung, Komfort und fast jeder andere denkbare Parameter tatsächlich mehr und mehr verbessern.
Sich mit und über Zahlen zu streiten ist schwer, aber wie Ihnen jeder Statistiker sagen wird, sind Statistiken nur so gut wie die Prämissen, auf denen sie beruhen. Hat die »westliche Zivilisation« das Leben wirklich für alle verbessert? Dies läuft letztlich auf die Frage hinaus: Kann man menschliches Glück messen? Und wenn ja, wie? Das ist bekanntermaßen schwierig. Der einzige verlässliche Weg, den man je gefunden hat, um festzustellen, ob eine Lebensweise wirklich befriedigender, erfüllender ist und glücklicher macht oder aus einem anderen Grund einer anderen vorzuziehen wäre, besteht darin, Menschen zu ermöglichen, zwei verschiedene Lebensweisen gründlich kennenzulernen, sie dann wählen zu lassen und zu beobachten, was sie konkret tun. Hätte Pinker(17) recht, müsste beispielsweise jeder geistig gesunde Mensch, der die Wahl zwischen (a) dem gewaltgeprägten Chaos und der erbärmlichen Armut einer »Stammesgesellschaft« und (b) der relativen Sicherheit und dem Wohlstand der westlichen Zivilisation hätte, ohne Zögern die Sicherheit wählen.[26]
Tatsächlich liegen empirische Daten zu dieser Frage vor, und diese lassen vermuten, dass mit Steven Pinkers(18) Schlussfolgerungen etwas ganz grundsätzlich nicht stimmt.
***
In den vergangenen Jahrhunderten haben Menschen bei zahlreichen Gelegenheiten genau diese Entscheidung getroffen. Aber sie entschieden sich fast nie so, wie Steven Pinker(19) es vorausgesagt hätte. Einige haben uns klare, vernünftige Erklärungen für ihre Entscheidung hinterlassen. Betrachten wir zum Beispiel den Fall von Helena Valero(1) (ca. * 1918), einer brasilianischen(2) Frau aus einer Familie spanischer Abstammung. Pinker(20) beschreibt sie als »weißes Mädchen«, das 1932 von Yanomami(11) entführt wurde, während sie mit ihren Eltern den abgelegenen Rio Dimití(1) entlangreiste.
In den beiden Jahrzehnten danach lebte Valero(2) in mehreren Yanomami(12)-Familien, war zweimal verheiratet und erreichte schließlich eine einigermaßen angesehene Stellung in ihrer Gemeinschaft. Pinker(21) zitiert kurz den Bericht, den sie später über ihr Leben verfasste und in dem sie schildert, wie brutal ein Überfall der Yanomami(13) war.[27] Was er zu erwähnen vergisst, ist, dass Valero(3) die Yanomami(14) 1956 verließ, um ihre Geburtsfamilie zu suchen und wieder in der »westlichen Zivilisation« zu leben, nur um sich dann in einer Situation wiederzufinden, die durch gelegentlichen Hunger und ständige Niedergeschlagenheit und Einsamkeit gekennzeichnet war. Als sie nach einiger Zeit fähig war, eine wirklich begründete Entscheidung zu treffen, kam sie zu dem Schluss, ihr gefalle das Leben bei den Yanomami(15) besser, und kehrte zu ihnen zurück.[28]
Ungewöhnlich ist Helenas(4) Geschichte keineswegs. Aus der Kolonialgeschichte Nord(1)- und Südamerikas(1) gibt es zahlreiche Berichte über Siedler, die von indigenen Gesellschaften gefangen oder aufgenommen wurden und sich, wenn sie die Wahl bekamen, fast immer für die indigene Gesellschaft entschieden.[29]