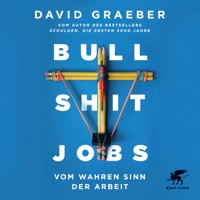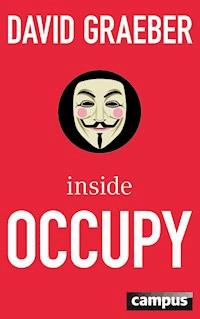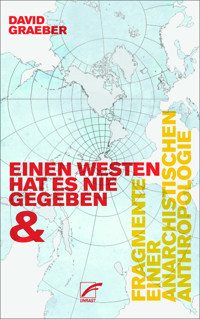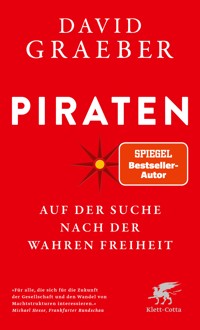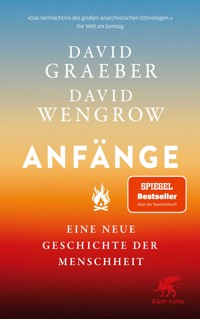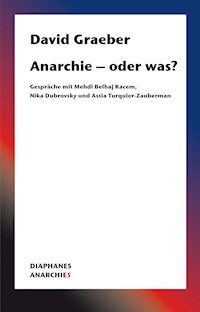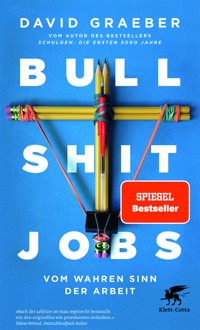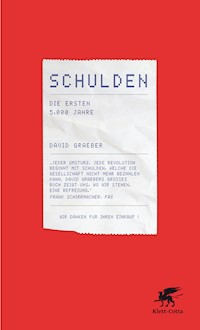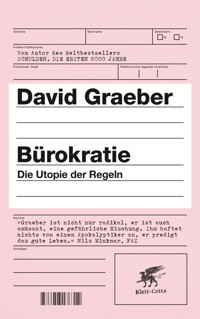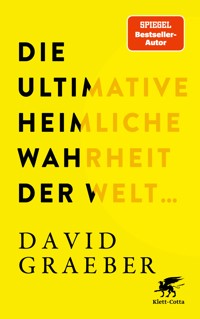
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
David Graebers Vermächtnis »Die ultimative heimliche Wahrheit der Welt besteht darin, dass wir selbst die Welt gestalten und sie genauso gut anders gestalten könnten.« Kaum jemand dachte so frei, kaum jemand schrieb so geistreich gegen den Kapitalismus und die aus ihm erwachsene Unfreiheit an: David Graeber gehört zu den radikalsten Denkern der letzten Jahrzehnte. Dieser Band versammelt 18 so überraschende wie intellektuell anregende Texte zu seinen wichtigsten Themen – die Essenz seines Schaffens und sein geistiges Vermächtnis. Warum akzeptieren wir Ungleichheit? Wieso sehen wir gesellschaftliche Hierarchien als gegeben an? Und warum nehmen wir die Ausbeutung durch den Kapitalismus einfach so hin? Der international anerkannte Anthropologe und Bestsellerautor David Graeber machte es sich zur Lebensaufgabe, die Widersprüche unserer Gesellschaft und deren Wurzeln schonungslos zu offenbaren. Durch seine scharfsinnig verfassten und gegen den Strich gebürsteten Publikationen hat er ein ganz neues Denken in die Mitte der Diskussionen getragen und unzählige Debatten befeuert. Diese Sammlung seiner bedeutendsten und teils bislang unveröffentlichten Essays sprüht förmlich vom Geist, der unwiderstehlichen Suggestion und dem überraschenden Witz Graebers. Die Auswahl, ergänzt um Interviews mit Thomas Piketty und Hannah Appel, umfasst alle Themen seines bedeutenden Werks: Antikapitalismus, soziale Ungleichheit, radikale Demokratie, Anarchie und grenzenlose Freiheitsliebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
David Graeber
Die ultimative heimliche Wahrheit der Welt
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Helmut Dierlamm, Werner Roller, Hans Freundl und Katrin Behringer
Klett-Cotta
Impressum
Der Essay »Einen Westen hat es nie gegeben« (original: »There Never Was a West«), welcher Teil der amerikanischen Originalausgabe ist, ist in dieser deutschen Ausgabe nicht enthalten.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Ultimate Hidden Truth of the World« im Verlag Farrar, Straus and Giroux, New York City
© 2024 by David Graeber
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg, in Anlehnung an das Originalcover von Farrar, Straus and Giroux; Cover-Design: © Thomas Colligan
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96605-3
E-Book ISBN 978-3-608-12482-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort: Mit wilder Freude
Einleitung
TEIL I
GEGEN DIE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
Finanz ist nur ein anderes Wort für anderer Leute Schulden
Zum Phänomen der Bullshit Jobs
Gegen die Wirtschaftswissenschaft
Quetscht die Reichen aus
TEIL II
JENSEITS DER MACHT
Kultur als kreative Ablehnung
Teil I: Weltgeschichte
Teil II: Madagaskar
Hass ist zum politischen Tabu geworden
Tote Zonen der Fantasie
I
II
III
IV
V
VI
Die Bühne des Schlägers
Feigheit ist auch ein Anliegen
Über grundlegende Mängel
Grund(schul)strukturen von Herrschaft
Die Grausamkeit der Menge
Hört auf, euch selbst zu schlagen
Mir war nicht klar, wie weit verbreitet Vergewaltigung war. Dann fiel der Groschen
Zur Phänomenologie der Riesenpuppen
Eine Problematik
Medien-Bilder
Symbolische Kriegführung durch die Polizei
Die Truppen sammeln
Analyse I: Das Prinzip Hollywoodfilm
Analyse II: Schöpferische Zerstörung und die Privatisierung des Verlangens
Analyse III: Die Gesetze des Krieges
Warum also hassen die Cops Puppen?
Einige sehr dürftige Schlussfolgerungen
TEIL III
DER AUFSTAND DER FÜRSORGLICHEN
Sind Sie ein Anarchist?
Armee der Altruisten
Zu viel Fürsorge
Der Aufstand der betreuenden Klasse
Das Wesen des zeitgenössischen Kapitalismus, wenn man ihn denn als solchen bezeichnen kann
Betreuung als Arbeit, die zur Freiheit anderer beitragen soll
TEIL IV
WAS BRINGT’S, WENN ES UNS KEINEN SPASS MACHT?
Eine andere Kunstwelt, Teil 1
Kunst-Kommunismus
Das verwirrende Erbe der Romantik
Das Betreuungs-Museum
Was bringt’s, wenn es uns keinen Spaß macht?
Das Überleben der Außenseiter
Warum ich?
Tanzen die Elektronen?
Mit den Fischen schwimmen
Anmerkungen
Vorwort: Mit wilder Freude
Finanz ist nur ein anderes Wort für anderer Leute Schulden
Quetscht die Reichen aus
Kultur als kreative Ablehnung
Hass ist zum politischen Tabu geworden
Tote Zonen der Fantasie
Die Bühne des Schlägers
Zur Phänomenologie der Riesenpuppen
Der Aufstand der betreuenden Klasse
Eine andere Kunstwelt, Teil 1
Was bringt’s, wenn es uns keinen Spaß macht?
Weiterführende Informationen zu den Texten
Vorwort und Einleitung
Teil I: Gegen die Wirtschaftswissenschaft
Teil II: Jenseits der Macht
Teil III: Der Aufstand der Fürsorglichen
Teil IV: Was bringt’s, wenn es keinen Spass macht?
Register
Vorwort: Mit wilder Freude
von Rebecca Solnit
David Graebers Temperament und seine Neigungen waren in seinen Schriften genauso spürbar wie im persönlichen Kontakt. Das heißt, die Prosa in diesem Buch galoppiert förmlich, und sie ist einladend. Graeber war ein begeisterungsfähiger Mensch, der gern feierte, ein Enthusiast, redselig und Feuer und Flamme für die Möglichkeiten, die die Ideen und Ideologien bargen, mit denen er rang. Immer, wenn wir uns trafen, von New Haven in den frühen Zweitausenderjahren bis London einige Jahre vor seinem Tod, war er im Grund derselbe geblieben: strahlend und zerzaust, mit einer rastlosen Energie, die der permanenten Bewegung seines Geistes zu entsprechen schien; Wörter entströmten ihm, als würden sie in ihrer unaufhaltsamen Fülle überlaufen. Dennoch genoss er in aktivistischen Zirkeln großen Respekt, denn er war ein guter Zuhörer, und er lebte seinen radikalen Egalitarismus durch die Art, wie er sich auf die Menschen in seinem Umfeld bezog.
Er war immer ein Anthropologe(1). Nachdem er bei traditionellen Völkern in Madagaskar(1) Feldforschung betrieben hatte, hörte er nicht mehr damit auf, konzentrierte sich jedoch auf seine eigene Gesellschaft(1). Er fand sie sowohl interessant als auch analysierbar, weil sie auf spezifischen (oft auch sonderbaren) Überzeugungen und Gewohnheiten beruhte. Aufsätze wie »Tote Zonen der Fantasie. Über Gewalt(1), Bürokratie(1) und Interpretationsarbeit« und sein Buch Bullshit Jobs(1) beruhten darauf, dass er mit seinem Werkzeug als Anthropologe(2) etwas analysierte, das man normalerweise für langweilig hält oder überhaupt nicht beachtet, nämlich die Funktion und den Einfluss der Bürokratie(2). Sein Bestseller Schulden(1) erinnert uns daran, dass Geld(1) und Finanzen(1) zu den sozialen Arrangements gehören, die man zum Wohl der Allgemeinheit neu arrangieren müsste.
Er bestand hartnäckig darauf, dass die industrialisierte euro-amerikanische Kultur wie auch andere Gesellschaften(2) der Vergangenheit und der Gegenwart nur eine von zahllosen Möglichkeiten ist, Dinge zu erledigen. Er kam immer wieder auf historische Augenblicke zurück, in denen Gesellschaften(3) den Ackerbau(1) oder technologische(1) Errungenschaften oder soziale Hierarchien verwarfen und sich, weil es ihnen mehr Freiheit(1) brachte, für Alternativen entschieden, die oft als primitiv verworfen werden. Diese Arbeit(1) kündigte sich in dem Essay »Einen Westen hat es nie gegeben« an und kulminierte in dem Buch Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit aus dem Jahr 2021 (deutsche(1) Ausgabe 2022), das er mit David Wengrow(1)(2) schrieb. Auch verwarf er all die linearen Narrative, die den heutigen Menschen entweder als ein Wesen beschreiben, das eine ursprüngliche Unschuld verloren hat, oder als eines, das einer ursprünglichen primitiven Barbarei entwachsen ist. Statt einem einzigen Narrativ entwickelte er viele Versionen und Variationen: eine Vision von Gesellschaften(4) als fortlaufenden Experimenten und Menschen als endlos und rastlos kreativen Wesen. Diese schiere Vielfalt war eine Quelle der Hoffnung für ihn, eine Grundlage dafür, dass er immer wieder darauf bestand, dass die Verhältnisse nicht so sein müssen, wie sie sind.
Wie Marcus Rediker in seiner Rezension von Davids postum erschienenem Werk Piraten. Auf der Suche nach der wahren Freiheit(2) richtig erkannte, war »alles, was Graeber schrieb […] zugleich eine Genealogie der Gegenwart und eine Darstellung, wie eine gerechte Gesellschaft(5) aussehen könnte«. Er war, wie in allen Essays dieser Sammlung und in all seinen Büchern zu sehen ist, besorgt über jede Art von Ungleichheit(1), auch über die Ungleichheit(2) der Geschlechter in dieser und anderen Gesellschaften(6), und über die Gewalt(2), mit der Ungleichheit(3) und Unfreiheit durchgesetzt werden. Und er machte sich Gedanken darüber, wie sie delegitimiert werden konnten und wo und wann ihnen Gesellschaften(7) zuvor schon entronnen waren. Sein Fokus war, kurz gesagt, die Freiheit(3) und wie sie eingeschränkt wird.
Oft wurde ihm das Verdienst zugeschrieben, den Slogan »Wir sind die 99 Prozent(1)« geprägt zu haben, doch er bestand darauf, dass er nur die »99 Prozent(2)« beigetragen hatte. Der Spruch wurde eine so überzeugende Parole von Occupy(1) Wall Street, dass »das eine Prozent« bis heute eine weit verbreitete Bezeichnung für die höchste Elite(1) ist. Der Begriff »99 Prozent(3)« ist im Vergleich zu dem alten Schichtenmodell von Arbeiter(2)-, Mittel- und Oberklasse eine hoffnungsvolle Bezeichnung. Sie bedeutet, dass die große Mehrheit von uns arbeitet(3), und das oft in prekären Jobs oder in finanzieller(2) Not, und dass die meisten von uns sehr viel gemeinsam haben – und jede Menge Gründe, gegen die Superreichen zu sein.
Die hier gesammelten Essays sind eine Erinnerung daran, dass David weit über das Feld der Anthropologie(3) hinaus auch historische, ökonomische(1), archäologische(1) und politologische Literatur(1) verschlang. Seine Schriften sind eine Synthese der darin behandelten materiellen und kulturellen(1) Ereignisse, wie er sie mit seiner eigenen aufrührerischen Imagination verdaute. Er liebte Ideen. Er hatte Freude an seiner Arbeit(4) und daran, wie sie sich mit den aktuellen Ereignissen an der gesellschaftlichen(8) Basis und insbesondere mit den radikalen Bewegungen der Neunzigerjahre und des neuen Jahrtausends überschnitt. So etwa mit der Bewegung gegen die von den Konzernen gesteuerte Globalisierung, die mit der Blockade der Konferenz der Wirtschafts- und Handelsminister der Welthandelsorganisation(1) in Seattle(1) ihren Höhepunkt erreichte, mit dem 1994 begonnenen Aufstand der Zapatistas(1) in Mexiko(1) und mit den vielen Formen eines radikalen Egalitarismus, der sich in Experimenten mit direkter Demokratie(1) und im Widerstand gegen ungerechte(1) Institutionen und Regierungen manifestierte – insbesondere auch 2011 in der Bewegung Occupy(2) Wall Street(3), an der er stark beteiligt war.
Freude. Vielleicht sollte angesichts von Ideen, die Möglichkeiten eröffnen oder verschließen, jeder dieses Gefühl empfinden, oder um den Satz, dem der Titel dieses Buches entstammt, zu zitieren: »Die ultimative heimliche Wahrheit der Welt besteht darin, dass wir selbst die Welt gestalten und sie genauso gut anders gestalten könnten.« Wer das wirklich glaubt und die Welt als etwas wahrnimmt, das in Übereinstimmung mit bestimmten Annahmen und Werten(1) konstruiert ist, der erkennt, dass sie verändert werden kann, und das nicht zuletzt dadurch, dass man Annahmen und Werte(2) ändert.
Wir erkennen, dass Ideen wichtig sind und wir eine gewisse Rolle bei der Auswahl der Ideen spielen, die die Realitäten unseres Lebens bestimmen, und wir erkennen, dass die Tätigkeit von Wissenschaftlern und Denkern ungeheuer wichtig ist. Zu viele Intellektuelle messen Ideen überhaupt keinen Wert mehr bei, und selbst wenn sie beruflich mit Ideen zu tun haben, glauben sie nicht mehr an ihre Macht, die Welt zu verändern. Wenn Sie es doch können, haben wir als Menschen, die mit Ideen arbeiten(5), die Pflicht, die Welt zu verändern, oder andere in die Lage zu versetzen, dies zu tun. Wir müssen ihnen dabei helfen, Ideen zu demontieren, die versklaven(1) und erniedrigen. Und wir müssen erkennen, dass Ideen Werkzeuge sind, mit denen wir arbeiten(6) und die uns eine gewisse Macht verleihen.
David wollte diese Werkzeuge allen Menschen in die Hand geben oder sie daran erinnern, dass sie bereits vorhanden sind. Deshalb arbeitete er hart daran und schaffte es auch, in einem Stil zu schreiben, der angesichts seiner Themen nicht immer einfach, aber immer so klar und zugänglich wie möglich war. Egalitarismus muss sich auch im Stil niederschlagen. Unsere gemeinsame Freundin, die Schriftstellerin, Filmemacherin und Schulden(2)-Abolitionistin Astra Taylor(1) schrieb ihm einen Monat vor seinem Tod am 2. September 2020 folgende Textnachricht: »Lese gerade Schulden(3) noch einmal. Du bist so ein verdammt guter Schriftsteller. Ein seltenes Talent bei einem Linken.« Und er schrieb zurück: »Oh, danke! Wenigstens versuche ich einer zu sein. Ich nenne es, ›nett zum Leser sein‹, eine Erweiterung der Politik gewissermaßen.«
Um daran zu glauben, dass Menschen sich ohne Institutionen und Hierarchien, die Zwang ausüben, selbst regieren können, muss ein Anarchist(1) großes Vertrauen in normale Menschen haben, und das traf auf David zu. Ein Satz, den Lyndsey Stonebridge über Hannah Arendt(1) schrieb, würde auch auf ihn gut passen: »Es überrascht nicht, dass Hannah Arendt(2) schon in sehr jungen Jahren unglaublich klug war, aber wenn man sich zu sehr auf ihren außergewöhnlichen Geist konzentriert, dann übersieht man etwas Wichtiges in ihren Lektionen über das Denken: Sie zeigt uns, dass Denken etwas ganz Gewöhnliches ist – und genau darin liegt seine heimliche Stärke.«
Trotz seines Scharfsinns und seiner Originalität oder womöglich gerade deswegen war Davids akademische(1) Karriere schwierig. In Frei von Herrschaft: Fragmente einer anarchistischen(2) Anthropologie(4), dem ersten Buch, das ich von ihm las, einem buchstäblich kleinen Buch, das vor großen Ideen beinahe platzte, schrieb er: »In den Vereinigten Staaten(1) gibt es Tausende akademischer Marxisten(1) der einen oder anderen Sorte, aber kaum ein Dutzend Wissenschaftler, die bereit wären, sich offen als Anarchisten(3) zu bezeichnen […] Es hat ganz den Anschein, als hätte der Marxismus(2) eine Affinität zur akademischen(2) Welt, die der Anarchismus(4) nie haben wird. Schließlich war jener die einzige große soziale Bewegung, die von einem Dr. der Philosophie(1) erfunden wurde, auch wenn die Bewegung später die Arbeiterklasse(7)(1) organisieren wollte.« Und dann vertritt David die Ansicht, dass der Anarchismus(5) im Gegensatz zum Marxismus(3) keine Idee ist, die nur von ein paar Intellektuellen geprägt wurde. Stattdessen gibt es »die grundlegenden Prinzipien des Anarchismus(6): Selbstorganisation(1), freiwilliger Zusammenschluss, gegenseitige Hilfe« schon »so lange wie die Menschheit« selbst. David war Anarchist(7) aus Veranlagung und aus Neigung.
In einem Essay aus dem Jahr 2017 erklärte er: »Die akademische(3) Welt hat viele Geheimnisse, die angemessene Gegenstände für eine ethnografische Analyse wären. Eine Frage, die mich unablässig beschäftigt, ist die Festanstellung. Wie kann es sein, dass ein System, das angeblich so angelegt ist, dass es den Wissenschaftlern die notwendige Sicherheit geben soll, gefährliche Dinge zu sagen, in ein System verwandelt wurde, das so grauenhaft und psychologisch(1) destruktiv ist, dass 99 Prozent(4) der Wissenschaftler, wenn sie endlich eine sichere Position erreicht haben, nicht mehr wissen, was es bedeuten würde, einen gefährlichen Gedanken zu haben?« David war zugleich Mitglied und Außenseiter und Feind der akademischen(4) Welt, ja sie entwickelte sogar eine massive Feindseligkeit gegen ihn, weil er nicht nach ihren Regeln operierte.
In diesem Zusammenhang schreibt er mit der für ihn so typischen kecken Offenheit: »Ich erklärte mich bereit, dies zu schreiben, weil ich auf absehbare Zeit nicht die Absicht habe, mich in Amerika auf eine akademische(5) Stelle zu bewerben. Vermutlich gibt es nicht einen einzigen Abschnitt in diesem Essay, in dem ich nicht Selbstzensur geübt hätte, wenn dem nicht so wäre.« Mir tut es sehr leid, dass David nie eine vollständige anthropologische(5) Analyse der akademischen(6) Welt mit ihren seltsamen Initiationsriten, ihren verfestigten Hierarchien, ihren dysfunktionalen Systemen und ihrer Verwendung der Sprache nicht nur als Mittel für Inklusion und Kommunikation, sondern auch als Mittel zur Ausgrenzung durchgeführt hat.
Der Schlachtruf, den er als Wissenschaftler und Aktivist(1) immer wieder benutzte, war: »Es muss nicht so sein.« Wo die akademische(7) Welt kalt und auf der Hut ist und direktes Engagement vermeidet, war er warm und enthusiastisch und wollte erleben, wie Ideen zu Handlungen führen, die die Welt verändern können. Wie Astra Taylor(2) beobachtet, »verachtete er die Langeweile der universitären Bürokratie(3), liebte aber aktivistische Versammlungen, genoss ihre ideologischen Debatten und schwelgte in den verschiedenen Formen von Planung, Ränkeschmieden und Unfug«. Er war voller Hoffnung, nicht aus Narrheit, sondern aufgrund der Beweise, die er dafür gesammelt hatte, dass menschliche Gesellschaften(9) eine unendliche Vielfalt von Formen annehmen können, dass Menschen, die angeblich machtlos sind, gemeinsam durchaus eine Menge Macht haben können und dass Ideen wichtig sind. (Eine meiner liebsten Stellen in Fragmente einer anarchistischen(8) Anthropologie(6) handelt vom Volk der Sakalava auf Madagaskar(2), das offiziell tote Könige(1) verehrt. Doch diese Könige(2) artikulieren ihren Willen »durch Geistmedien(1). Gewöhnlich sind das ältere Frauen von nichtadeliger Herkunft.«[1] Es handelt sich also um ein System, das offiziell von Männern der Elite(2) geleitet, in Wirklichkeit jedoch von Frauen einfacher Abstammung kontrolliert wird.)
Hoffnung ist bei Intellektuellen und Aktivisten(2) eine verzwickte Sache. Zynismus(1) dagegen verleiht ihnen den Anschein von Raffinesse, auch wenn er, sowohl was die menschliche Natur(1) als auch was die politischen Möglichkeiten betrifft, oft schlicht und einfach unangebracht ist; Verzweiflung wird oft als feinsinnig und weltklug betrachtet, und Hoffnung gilt als naiv, wenngleich es nicht selten umgekehrt ist. Hoffnung ist riskant; man kann verlieren, und oft passiert das auch, doch die Erfahrung zeigt, dass man manchmal auch gewinnt, wenn man etwas unternimmt. Das ist der Grund, warum Davids nicht in dieser Sammlung enthaltener Essay »The Shock of Victory« mit dem Satz beginnt: »Das größte Problem von direkten Aktionsbewegungen besteht darin, dass wir nicht wissen, wie wir mit einem Sieg umgehen sollen.« »Despair Fatigue«, ein weiterer hier nicht enthaltener Essay, beginnt mit einem ähnlichen Satz: »Ist es möglich, dass einem Hoffnungslosigkeit langweilig wird?«
Davids Superkraft bestand darin, dass er ein Außenseiter war. Er ging nicht von allgemein anerkannten Annahmen aus, sondern versuchte, sie zu demontieren, wollte uns zeigen, dass sie willkürlich, einschränkend und optional sind, und lud jeden dazu ein, die Räume zu betreten, die sich durch ihre Destruktion öffneten (und er begrüßte alle, die bereits dort waren). Ein Großteil seiner Schriften hat die Kernfrage: »Was geschieht, wenn wir das nicht akzeptieren?« – wenn wir es auseinandernehmen, um seine Ursprünge und Auswirkungen zu erkennen, oder wenn wir es ablehnen, wenn wir es abwerfen wie eine unnötige Last oder eine Ausrüstung, die wir nicht benötigen. Was geschieht, wenn wir frei werden? Davids Analyse dient der Befreiung, ist befreiend, was ihre Mittel und ihre Ziele betrifft. In dieser Hinsicht ist sie ein Geschenk, und zwar ein großzügiges. Danke, David.
Einleitung
von Nika Dubrovsky(1)
Seit Davids Tod im Jahr 2020 dreht sich ein Großteil meines Lebens um sein riesiges Archiv mit veröffentlichten und unveröffentlichten Texten, Hunderten von Notizbüchern, Ton- und Videoaufnahmen und Briefwechseln. David sagte einmal, die wirkliche Fürsorge für einen »großen Mann« beginne nach seinem Tod und werde meistens von Frauen geleistet. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat.
Wenn David von Fürsorge sprach, fügte er immer hinzu, dass sie nur dann wirklich etwas bedeutet, wenn sie zur Freiheit(4) befähigt. Gefängnisse(1) sorgen auch für ihre Gefangenen, geben ihnen Essen und Unterkunft, aber kaum einer von uns würde diese Art von Fürsorge gern erleben. Eltern sorgen für ihre Kinder(1), damit sie spielen und frei sein können. Ich frage mich: Welche Art von Fürsorge könnte David nach seinem Tod benötigen, und zu welcher postumen Freiheit(5) könnte sie ihn befähigen?
Unser westliches Verständnis von Freiheit(6) geht auf die gesetzliche Autorität(1) der römischen Patriarchen(1) über ihre Familie und ihre Sklaven(2) zurück. Es beruht auf der Idee des Eigentums, verstanden nicht als Beziehung zwischen Menschen, sondern als Beziehung zwischen einem Menschen und einer Sache oder zwischen zwei Menschen, von denen einer eine Sache ist (Sklaven(3) waren nach dem römischen Gesetzt so definiert: Sie waren Personen, aber auch res, Sachen). Sklaverei(4) bedeutete den sozialen Tod; ein Sklave(5) war eine Person, die des Rechts beraubt war, ihre eigenen sozialen Bande zu knüpfen. Umgekehrt kann das lateinische Wort für Körper, corpus, auch für eine Sammlung von Schriften oder eine Sammlung von Gesetzen stehen und ist verbunden mit der Idee des Privateigentums und des freien Mannes, der über seinen Körper verfügen und Eigentum besitzen kann. Aber corpus kann auch Leichnam – toter Körper – bedeuten. Ein corpus von Werken, bestimmt für die Ewigkeit, unveränderlich über den normalen Sterblichen schwebend: Es wäre schwierig, eine Beschreibung für Geschriebenes zu finden, die schlechter zu David passte.
Sein Verständnis von Freiheit(7) war antithetisch zu der aus dem alten Rom(1) stammenden westlichen Auffassung. In seinen Vorträgen sagte er häufig, wir seien vermutlich die einzige Kultur, die fast ausschließlich auf der bizarren Verbindung von Privatbesitz und Freiheit(8) aufgebaut sei. Nahezu Davids gesamtes Werk beruht auf der Theorie, dass wahre Freiheit(9) ein Prinzip ist, das dem Universum zugrunde liegt und sich im Spiel und in sozialen Beziehungen manifestiert; für David leitet sich Freiheit(10) nicht von Gesetzen ab und beruht nicht auf individuellen Eigentumsrechten. (In einem Essay für die Kulturzeitschrift The Baffler(1)(2), der am Ende dieser Sammlung steht, schreibt David über die wichtigen Themen Freiheit(11) und Spiel, die er mit den Philosophen(2) Roy Bhaskar(1) und Mehdi Belhaj Kacem(1) diskutiert hat.)
Schreiben war für ihn eine Übung in Freiheit(12), ein rebellisches Projekt, oft gemeinsam mit anderen, um kollektiv die gesellschaftliche(10) Ordnung zu ändern und buchstäblich einen existierenden sozialen Kodex zu revidieren. Sein Verständnis von Veränderung unterschied sich von dem vieler Revolutionäre(1)(2), und insbesondere von dem Wladimir Iljitsch Lenin(1)s(2). Er glaubte nicht daran, dass die Revolution(3) darin besteht, dass man den Louvre übernimmt oder neue Politiker an die Macht bringt, wenngleich auch dies manchmal dazu beitragen mag, dass die Welt ein besserer Ort wird. David glaubte vielmehr, dass eine »Revolution(4) dann stattfindet, wenn sich das kollektive Bewusstsein ändert«.
David lebte mit dem tiefen Verständnis, dass »die ultimative heimliche Wahrheit der Welt«, der Kodex, nach dem die unsichtbaren sozialen Mechanismen unserer Gesellschaft(11) funktionieren, die dazu führen, dass wir einander entweder im Krieg(1) umbringen oder Gratiswohnungen bauen, dass wir jahrelang in Bullshit Jobs(2) arbeiten(8) oder Stellen im Pflegebereich annehmen, obwohl sie sehr schlecht bezahlt sind, ein Kodex sei, der »darin besteht, dass wir selbst ihn gestalten und ihn genauso gut anders gestalten könnten«.
Von Jorge Luis Borges(1) stammt der berühmte Satz: »Wenn Schriftsteller sterben, werden sie Bücher, das ist letztlich keine allzu schlechte Inkarnation.« Das gefällt mir. Um allerdings wirklich Davids Geist zu verkörpern, müsste ein Buch open source sein. Bei Open-Source-Projekten ist die Teilnahme für alle offen, Methodologie und Ergebnisse sind transparent, und wenn die »führenden Programmierer« verschwinden, entwickelt sich das Projekt auch ohne sie weiter.
David war das, was die Franzosen als Homme de Lettres bezeichnen. Er lebte, um seine Ideen mit anderen zu teilen und sie auf so viele Arten auszudrücken, wie er konnte. Ganz ähnlich wie Noam Chomsky(1), ein anderer bekannter anarchistischer Wissenschaftler, war auch er außerhalb der akademischen(8) Welt verfügbar und sprach fast überall dort, wo er eingeladen wurde.
Er verstand Anarchismus(9) nicht als eine Identität, sondern als eine Praxis, die die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen betrifft, und man könnte sagen: Sein wichtigstes intellektuelles Projekt mit Ausnahme der Veröffentlichung seiner Werke war die Demokratisierung des Schreibprozesses selbst.
David sagte immer, dass er beim Schreiben mit seiner Mutter sprach, und wenn er das Gefühl hatte, dass sie ihn verstand, glaubte er, dass auch andere ihn verstehen würden. Er schrieb seine Texte stets offen für die Diskussion und Weiterentwicklung durch andere. Sein Ziel war es, unser kollektives Bewusstsein zu ändern, und diese Aufgabe konnte nur kollektiv gelöst werden.
Wie mir scheint, war er damit bemerkenswert erfolgreich. Von Buch zu Buch und von Essay zu Essay gelang es David, lieb gewordene Annahmen in Frage zu stellen, die Art, wie wir denken, den Kern unseres kollektiven sozialen Kodex’. David stellt stolz fest, dass der Begriff »Ungleichheit(4)« nach Occupy(4) Wall Street(5) selbst in den Reden der konservativsten amerikanischen Politiker auftauchte und die meisten Amerikaner unter 35 den Sozialismus(1) dem Kapitalismus(1) vorzogen. Die Bewegung Occupy(6) Wall Street(7), der David später mehrere Bücher widmete, verbreitete sich auf der ganzen Erde. Obwohl die Parole »Wir sind die 99 Prozent(5)« oft ihm zugeschrieben wird, war sie eine kollektive Erfindung, im Kampf geboren und auch heute noch, lange nach Davids Tod, von globaler Resonanz und Wirksamkeit.
Ich habe diese Sammlung in Zusammenarbeit mit Davids Studenten und Kollegen vom David Graeber Institut(1)e und vom Museum of Care(1)zusammengestellt, um von seinen wichtigsten Lebensprojekten (soweit sie schon bekannt sind) ein Bild zu vermitteln. Sein Archiv ist riesig und muss noch vollständig erschlossen werden. Die Essays dieser Sammlung sind eine Geschichte seiner sozialen Beziehungen, eine Erkundung seiner Freundschaften, seiner Gegner und seiner Gesprächspartner. Sie drehen sich um das dialogische Wesen des menschlichen Bewusstseins, um Kooperation als menschliche Freiheit(13) und letztlich um den Ursprung des »kollektiven Bewusstseins«.
Im Vorwort zu Piraten bezeichnet David sein Buch als Teil eines größeren intellektuellen Projekts, das er zuerst 2007 in dem Essay »Einen Westen hat es nie gegeben« (Erster Teil) vorstellte und durch das zusammen mit David Wengrow(3) verfasste Buch Anfänge fortsetzte – ein Projekt, das er als »Entkolonialisierung(1) der Aufklärung« bezeichnete.
Er schreibt in Piraten: »Zweifellos dienten viele der Gedanken, die wir heute als Ergebnisse der europäischen(1) Aufklärung des 18. Jahrhunderts betrachten, tatsächlich der Rechtfertigung außergewöhnlicher Grausamkeit, Ausbeutung und Zerstörung, die sich nicht nur gegen die arbeitende Bevölkerung im eigenen Land, sondern auch gegen die Bewohner anderer Kontinente richtete. Aber die pauschale Verurteilung des aufklärerischen Gedankenguts ist ihrerseits eher abwegig.«
David verfolgte sein ganzes Leben das Projekt, die nichtwestlichen Quellen der Aufklärung und deren verblüffend andere Sicht auf das Wesen des Menschen und der Demokratie(2) zu enthüllen. Dadurch verschaffte er uns Zugang zu einer anderen Aufklärung, die wir noch entdecken müssen. In Piraten berichtet er von weißen europäischen(2) Siedlern auf Madagaskar(3), die es größtenteils vermieden, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, die wir heute als Kolonialismus(2) bezeichnen. Ihre Geschichte ist ein Beispiel für eine Form der Kolonisierung, bei der die Alte Welt der Neuen Welt begegnete, sich mit der lokalen Bevölkerung vermischte und eine neue Kultur und sogar ein neues Volk schuf: die heute noch auf Madagaskar(4) lebenden Zana-Malata. Das alles gestützt auf die Ideen der Gleichheit, Freiheit(14) und Demokratie(3), die uns im Westen heute noch wichtig sind.
David hat viele zentrale Ideen dieses Projekts 2013 in dem Artikel »Dead Zones of the Imagination« artikuliert. Aber er begann schon als Doktorand über das Projekt nachzudenken, als er auf Anraten seines Anthropologieprofessors und geistigen Mentors an der University of Chicago(1) Marshall Sahlins(1)(2) nach Madagaskar(5) reiste.
Seine Arbeit(9) stützt sich auf Sahlins(3)’ Kritik an den ökonomischen(2) und kulturellen(2) Modellen des Westens und ist stark durch die Übernahme von Einsichten russischer(1) Denker wie insbesondere Pjotr Kropotkin(1)s(2)(3) und Michail Bakunins(1), aber auch Fjodor Michailowitsch Dostojewskijs(1) und Michail Bachtin(1)s geprägt. Es ist bemerkenswert, dass er nur zwei Bücher mit nach Madagaskar(6) nahm: Die Brüder Karamasow von Dostojewskij und Rabelais und seine Welt von Bachtin(2). Eine der grundlegenden Ideen, auf die er bei seinen wissenschaftlichen und politischen Projekten, aber auch bei seinen anthropologischen Studien, immer wieder zurückkam, ist die, dass »der Mensch keine endgültige und definierte Größe ist, auf die man zuverlässige Berechnungen stützen könnte; der Mensch ist frei und kann deshalb jegliche regulierende Normen verletzen, die man ihm womöglich aufzuzwingen sucht […]« (Michail Bachtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics). Bachtin(3) und Dostojewskij beschrieben die menschliche Natur(2) als eine Potentialität, die sich durch einen polyphonen, karnevalesken(1) Dialog mit anderen Menschen herauskristallisiert.
David pflegte zu sagen: »Alle Menschen sind Projekte gegenseitiger Schöpfung. Den größten Teil der Arbeit(10), die wir tun, machen wir aneinander.« So verstand David sich selbst und den Zweck seines Schreibens.
Als ich die Texte für die hier versammelten Texte für Teil I »Gegen die Wirtschaftswissenschaft(3)« und Teil III »Der Aufstand der Fürsorglichen« auswählte, erinnerte ich mich daran, dass David bei der Vorstellung eines seiner Bücher einmal die Frage einer Frau beantwortete, die als Pflegerin in einem Altenheim arbeitete. Sie fragte: »Warum haben Menschen wie ich keinen Zugang zu Entscheidungsprozessen?« Und er antwortete: »Unsere Gesellschaft(12) ist so organisiert, dass der Zugang zu Macht mit dem Zugang zu Gewalt(3) verbunden ist. Menschen, die für andere sorgen, dürfen kaum wichtige Entscheidungen treffen. Es sind die Armeechefs, die Bosse von großen Konzernen und so weiter, die bestimmen, wie wir alle unser Leben leben.« Dann fragte er seinerseits die Frau: »Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft(13) leben, die nach den Idealen dieser Leute organisiert ist?«
Ich saß damals unter den Zuschauern in Berlin und war von Davids Antwort verblüfft, weil Menschen, die 500-seitige Bücher schreiben, sich normalerweise nicht die Mühe machen, ihre komplizierten Gedankengebäude (insbesondere, wenn sie ökonomisch sind) mit der Alltagsrealität normaler Menschen in Verbindung zu bringen. Es ist nämlich sehr schwierig, grundlegende Entdeckungen – neue Paradigmen des Wissen, der Geschichte und der Machtausübung – Menschen begreiflich zu machen, die keine Spezialausbildung haben.
Aber genau das ist notwendig, um das zu ändern, was die Öffentlichkeit(1) als vernünftig betrachtet.
Für Teil I habe ich Essays ausgewählt, die mir als zentral für Davids Verständnis von Macht und Gerechtigkeit erschienen. In dem Interview »Finanz(3) ist nur ein anderes Wort für anderer Leute Schulden(4)« erwähnt David einige Menschen, mit denen er im Gespräch war. Ich aber möchte hier besonders auf Michael Hudson(1) hinweisen, einen Wirtschaftswissenschaftler, der sowohl in der akademischen(9) Welt als auch an der Wall Street arbeitet(11), und dem David das Verdienst zuschreibt, sein Interesse für die Beziehungen zwischen Kreditgebern und Schuldnern, beziehungsweise für die Schulden(5), als kritischen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte geweckt zu haben. (David war außerdem von Hudsons(2) unglaublichem Leben fasziniert. Als wir eines Tages mit ihm essen gingen, flüsterte David mir zu: »Das Erstaunlichste von allem ist, dass alles, was Michael über sich selbst erzählt, wirklich wahr ist!« Hudson(3) war der Patensohn von Leo Trotzki, und dieser wurde mit einem Eispickel ermordet, der Michaels Tante gehörte. Solche Geschichten interessierten David weit mehr als irgendwelche akademische(10) Leistungen.) Ein anderer Text in Teil I, »Zum Phänomen der Bullshit Jobs(3)«, entstand nach zwanglosen Gesprächen mit Leuten, die ihre Arbeit(12) als sinnlos oder sogar schädlich empfanden, obwohl sie viel Geld(2) verdienten und ein hohes Sozialprestige hatten. Bemerkenswert an Davids Ansatz ist das Mitgefühl, das er wegen der »spirituellen Gewalt(4)« empfand, die den Inhabern von Bullshit Jobs(4) angetan wird. Schließlich sind es diese Leute, die die privilegiertesten Positionen in der Gesellschaft(14) innehaben und die die Linke (nicht zu Unrecht) traditionell für ihre Komplizenschaft mit den Herrschenden tadelt und für die Leiden der Unterdrückten verantwortlich macht. David jedoch lenkt die Aufmerksamkeit speziell auf ihr Elend, und zeigt, dass dieses »eine Narbe auf unserer kollektiven Seele« hinterlässt.
Die Frage, wie die Machtstrukturen unserer Gesellschaft(15) funktionieren, und, wichtiger noch, wie sie funktionieren könnten, war für David immer am wichtigsten. Als er die Wendung »Care und Freiheit(15)« prägte, war care noch kein Modewort. Heute ist das Wort in der akademischen(11) Welt, in der Kunst(1) und im Journalismus allgegenwärtig. Ein ganzer Teil in diesem Buch, »Der Aufstand der Fürsorglichen«, ist Michaels Vorschlag gewidmet, marxistische(4) und feministische(1) Ansätze zu integrieren und eine neue Arbeitswerttheorie zu schaffen.
Zum Abschluss dieser Einleitung will ich noch einmal auf den Titel der Essay-Sammlung zurückkommen. Ich hoffe, nach der Lektüre des Buches sollte klar sein, dass sich »die ultimative Wahrheit der Welt« nicht irgendwo hinter den verschlossenen Türen von Museen befindet. Sie liegt auch nicht in Archiven, die mit den staubigen Werken großer Autoren der Vergangenheit gefüllt sind, noch ist sie in den Palästen von Königen(3) oder in den Reden von Parteiführern zu finden. Diese Wahrheit gehört uns allen, und sie lautet folgendermaßen: Wir dürfen sie ändern, wie wir es für richtig halten.
Ohne magische Tricks oder eine leninistische(3) »Besetzung der Brücken und Telegrafenämter« setzt David Kräfte frei, die bereits in uns waren: unsere gemeinsame Sehnsucht nach Freiheit(16) und Fürsorge.
Angesichts dieser Tatsache betrachte ich Davids Texte, sein Archiv, nicht als einen unveränderlichen Korpus von Werken, sondern als eine sehr großzügige Struktur, in der man Raum für horizontale Verbindungen schaffen kann, die von zahlreichen offenen Fragen, Zweifeln und unerwarteten Verbindungen zu verschiedenen Arten zu denken geprägt sind und die fast überall Möglichkeiten für Leserkommentare bieten.
In unserem Essay »Eine andere Kunstwelt« suchten wir nach einer Beschreibung, wie diese andere Welt aussehen konnte, griffen auf die ursprüngliche Kulturvorstellung der Romantiker(1) und auf Alexander Bogdanows(1) Proletkult zurück, eine experimentelle kulturelle(3) Föderation in den ersten Jahren der Russischen(2) Revolution(5), die ein riesiges Netzwerk volkstümlicher künstlerischer Amateurkollektive aufbaute, die vom Staat und der Kontrolle der Partei unabhängig(1) waren.
Wenn ich darüber nachdenke, welche Art von Fürsorge David gefallen hätte, und dabei seine Fähigkeit berücksichtige, sowohl persönlich als auch in seinen Texten, direkte emotionale(1) und intellektuelle Verbindungen mit anderen zu knüpfen, frage ich mich, wie man aus seinem Vermächtnis ein lebendiges Projekt machen könnte, das sich kontinuierlich weiterentwickelt und an dem wir alle – seine Leser und andere Schriftsteller – teilnehmen können.
Das ist die Art von Fürsorge, die David selbst nicht nur unterstützt, sondern auch praktiziert hat. In einem solchen sich entwickelnden kollektiven Raum können wir weiterhin mit ihm zusammenarbeiten, auch wenn er körperlich nicht mehr unter uns weilt.
Ich hoffe, dass diese 18 Texte der Anfang einer Serie von Publikationen sind, die Davids nicht veröffentlichte Schriften, seine Tagebücher, seine 62 Vorträge und die komplette Sammlung seines Archivs enthalten. Meine wichtigste Hoffnung ist jedoch, dass es immer mehr Menschen geben wird, denen es gelingt, frei und fürsorglich in einem kollektiven Dialog eine andere Welt zu schaffen, die genau ihren Vorstellungen entspricht.
TEIL I GEGEN DIE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT(4)
Finanz(4) ist nur ein anderes Wort für anderer Leute Schulden(6)
Ein Gespräch mit Hannah Chadeayne Appel(1)
Seltsame Dinge ereigneten sich im Herbst 2011, als Occupy(8) Wall Street Downtown Manhattan zu bewohnen begann. Leute fuhren mit Schildern in der U-Bahn, die die Vorzüge des Glass-Steagall Act[1] priesen, und sie begannen auf den Gehwegen Gespräche über Konzerne als juristische Persönlichkeit und über den gesellschaftlichen(16) Zweck von Derivaten. Gesetze, Präzedenzfälle und Finanzprodukte, die zuvor obskur gewesen waren, wurden in ein neues öffentliches(2) Licht getaucht.
In den Monaten, nachdem die Stadt die Besetzer gewaltsam(5) vom Liberty Square (amtlich Zuccotti Park) vertrieben hatte, zerstreute sich mit den Besetzern auch das öffentliche(3) Gespräch. Der Dialog hörte nicht auf, sondern verbreitete sich, nahm neue Formen an und schlug Wurzeln in New York(1) und darüber hinaus. Die Schilder in der U-Bahn und die ursprünglichen Gespräche über eine Regulierung der Finanzindustrie(5) (und das damit verbundene Unbehagen) machten neuen Referenten und Signifikanten Platz, zu denen nicht zuletzt Schulden(7) (seien es studentische, medizinische, zur Zwangsvollstreckung führende, städtische oder staatliche(2)) und ein substanzielles, rot eingebundenes Buch desselben Namens gehörten. Schulden(8): Die ersten 5000 Jahre wurde fast sofort zu einem intellektuellen Bezugspunkt, doch es war auch ein sichtbares Zeichen für die Beteiligung an einem neuen gesellschaftlichen(17) Dialog über die Frage, wer wem was schuldet.
Ich setzte mich im Herbst 2012 mit David Graeber zusammen, mehr als ein Jahr nachdem er zu den ersten Organisatoren von Occupy(9) gehört hatte und nachdem Schulden(9) nicht nur im Fach Anthropologie(7) oder auch nur in der akademischen(12) Welt, sondern auch im The New York(2) Times(1) Book Review, in der Financial Times, im Guardian und anderswo als eines der wichtigsten Bücher des Jahres besprochen worden war. Vielleicht am wichtigsten für David selbst war dabei der Umstand, dass das Buch in den aktivistischen Netzwerken, die sich von New York(3) bis Oakland und von Griechenland(1) bis Deutschland(2) erstrecken, Pflichtlektüre wurde. Er und ich setzten uns in ein winziges Café in der Innenstadt von San Francisco und machten dieses Interview. David holte sich an der Theke einen Kaffee, während ich halbverhungert und (was David nicht wusste) im vierten Monat schwanger das üppigste Frühstück im Angebot bestellte: Eier, Wurst, Toast, Orangensaft und Obst. Als ich das fast ausschließlich von mir vertilgte Frühstück bezahlen wollte, bestand er darauf, die Rechnung zu übernehmen. Er erklärte das mit einem breiten Grinsen mit der Tatsache, dass ihm sein Buch über Schulden(10) endlich ein bescheidenes verfügbares Einkommen eingebracht hatte, das er nun unbedingt unter die Leute bringen wolle. Ich schulde ihm ein Dankeschön für das Frühstück und für das folgende Interview. Mögen sich all unsere künftigen Schulden(11) als ähnlich leicht rückzahlbar erweisen.
HANNAH CHADEAYNE APPEL(2): Es heißt, Sie hätten eine radikale Jugend gehabt. Erzählen Sie uns von Ihrem familiären Hintergrund und davon, wie Sie politisch erwachsen wurden.
DAVID GRAEBER: In meiner Kindheit(2) gab es wahrscheinlich wirklich viel radikale Politik, aber ich habe das gar nicht voll registriert. Mein Vater stammte aus Lawrence(1), Kansas. Er war einer von zwei Menschen an der Universität(1) von Lawrence(2), die sich freiwillig für den Kampf im Spanischen(1) Bürgerkrieg(2) meldeten. Er diente dort als Krankenwagenfahrer. Ich glaube, er hatte schon vorher einen anarchistischen(10) Zug. Als er sich das erste Mal politisch engagierte, war auf dem Campus nur der lokale Jugendverband der Kommunistischen Partei aktiv, und der hat ihn rekrutiert. Er war nie Parteimitglied und hat schon bald mit dem Jugendverband gebrochen. Und in der Gruppe der Spanienveteranen(2) gehörte er immer zu den Gegnern der KP. Aber er erzählte mir die Geschichte, wie die ganzen Freiwilligen über die Pyrenäen nach Spanien(3) kamen und in einem erhebenden Moment nach dem Grenzübertritt alle zusammen, aber in zwölf verschiedenen Sprachen, die Internationale sangen.
Dann kamen sie zur Grundausbildung(1). Und die war wie überall: ein Hindernisparcours, wo man über Dinge springt und unter ihnen hindurchkriecht und dabei schießen sie einem mit Maschinengewehren über die Köpfe. Als mein Vater in der Schlange wartete und das sah, ging er zum diensthabenden Offizier und sagte: »Diese Männer, die da mit Maschinengewehren schießen, sind das auch bloß Rekruten? Oder sind es erfahrene Soldaten?« Der Offizier antwortete: »Ich weiß es nicht. Ich glaube es sind Leute, die gestern ihre Grundausbildung(2) gemacht haben, und die wir heute dafür einsetzen.« »Was?!«, schrie mein Vater. »Die wissen nicht, was sie tun? Wir könnten getötet werden.« Da sagte der Offizier etwa Folgendes: »Du bist hier in der Armee, Junge. Also tu, was man dir sagt.« Mein Vater fand das lächerlich. »Ich lasse mich doch nicht schon in der Grundausbildung(3) umbringen. Ich mache da nicht mit.« Der Diensthabende lief wutentbrannt zum kommandierenden Offizier und der sagte, als er die Geschichte hörte: »Okay Graeber, haben Sie einen Führerschein? Dann fahren Sie einen Krankenwagen.« Mein Vater war eindeutig nicht zum Fußsoldaten geeignet, der einfach blind dummen Befehlen gehorchen muss. Also kam er als Krankenwagenfahrer zu den Sanitätern. Er war in Barcelona stationiert, wurde aber überall eingesetzt, wo gekämpft wurde, machte also auf eine Art den gefährlichsten Job. Man kam immer da hin, wo Menschen getötet wurden. Aber mein Vater hatte unglaubliches Glück. Er wurde nie verwundet oder sonst irgendwie verletzt. Der andere Mann aus Lawrence(3) dagegen wurde fast sofort getötet, und das verursachte daheim in Kansas einen kleinen Skandal, als seine Eltern es herausfanden.
Nach dem Krieg(3) kehrte mein Vater in die Vereinigten Staaten(3)(4) zurück und beendete sein Studium. Im Zweiten Weltkrieg(1)(4) war er bei der Handelsmarine. Auch dieses Mal war er zu dem Schluss gekommen, dass Fußsoldat nicht wirklich das Richtige für ihn war. Er lernte meine Mutter kennen, die als Zehnjährige aus Ostrow in Polen(1) nach Amerika gekommen war. Zufällig sind die Orte, aus denen die Familien meiner Eltern stammen, nicht weit voneinander entfernt. Die Graebers kommen ursprünglich aus Bartenstein in Ostpreußen. Johann Graeber kämpfte tatsächlich in den Schlachten von Leipzig und Waterloo. Er war mein Ur-Urgroßvater, ein Schuhmacher und Soldat. Alle Männer der Familie waren Schuhmacher. Inzwischen habe ich entdeckt, dass es eine recht ausgeprägte Geschichte radikaler Schuhmacher aus Bartenstein gibt. Johanns Sohn Carl August Graeber (oder Charlie, wie er später genannt wurde) kam kurz nach 1848 in die Vereinigten Staaten(5)(6), was allein schon ein verdächtiges Datum ist. Er ließ sich während des Amerikanischen Bürgerkriegs(5) in Lawrence(4), Kansas(5), dem Zentrum des amerikanischen Abolitionismus und Radikalismus, nieder. Angeblich versteckte sich die Familie (aber eigentlich nur die Männer) in einem Heuschober, als die rassistische Guerillatruppe Quantrill’s Raiders in den Ort kam. Die Frauen und Kinder(3) sprachen mit den Bewaffneten und sagten, die Männer seien in der Stadt. So wird die Geschichte in der Familie erzählt.
Charlies Sohn, Gustavus Adolphus Graeber, oder Dolly, wie ihn alle nannten, lebte lange als Musiker(1) an der frontier im Westen. Er ist das berühmteste Mitglied unserer großen Familie, denn er hat offenbar die Mandoline(1) in die amerikanische Musik(2) eingeführt. Seine erste Mandoline(2) erwarb er tatsächlich von einer Gruppe Zigeuner, die durch die Stadt kam. Er kaufte sie ohne Saiten und wusste nicht, was er damit tun sollte. Also fragte er in der Universität(2) nach, und dort glaubte man, dass sie wie eine Geige gestimmt werde. Er ließ sich aus Europa(3) Noten schicken und gründete die erste Mandolinenband(3) in den Vereinigten Staaten(7)(8), in der er selbst freilich Gitarre spielte. Später betrieb er das Bootshaus in Lawrence(6), wo die Studenten aus dem College Boote mieten konnten. Er war berühmt dafür, dass er Welse fangen konnte, indem er sich eine Leine mit einem Haken an das Handgelenk band und sie den Damm entlang führte. Er war stark mit dem Fluss verbunden. Mein Vater wuchs in Lawrence(7) auf, und Dolly lernte ihn erst kennen, als er schon älter war. Deshalb ist mein Großvater väterlicherseits vor dem Bürgerkrieg(6) geboren. Er war schon in den Fünfzigern, als mein Vater auf die Welt kam. Mein Vater war Ende 40, als ich geboren wurde. Soweit sein Hintergrund.
Er lernte also meine Mutter kennen, die aus einer jüdischen Familie in Polen(2) stammte und nach Amerika gekommen war. Sie war ein sehr frühreifes Kind(4) und kam schon mit 16 aufs College, brach es aber ein Jahr später wieder ab und nahm einen Job in einer BH-Fabrik an, weil die Familie in der Weltwirtschaftskriese ihre Unterstützung brauchte. Sie war in der ILGWU(1) (International Ladies’ Garment Workers’ Union). Damals wurde ein Sieben-Stunden-Tag eingeführt. Die Führung der Gewerkschaft(1) hatte ihn durchbekommen, und nun waren in ihrer Freizeit alle in der Gewerkschaft(2) aktiv, und eine dieser Aktivitäten war die Aufführung einer Musikkomödie. Gewerkschaftliche(3) Stücke galten damals als belehrend und langweilig, doch die Gruppe meiner Mutter führte etwas Lustiges auf. Das Stück hieß Pins and Needles(1)und wurde am Broadway ein Überraschungserfolg. So kam es, dass meine Mutter diese seltsame Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte hatte, weil sie mit einer weiblichen Hauptrolle am Broadway berühmt wurde und die Zeitschrift Life ein Porträt von ihr brachte. Sie hieß in dieser Zeit Ruth Rubenstein und tourte einige Jahre mit dem Stück durch das Land und spielte sogar im Weißen Haus. Aber nach drei oder vier Jahren kehrte sie wieder in die Fabrik zurück. Meinen Vater heiratete sie, nachdem sie ihn auf irgendeinem linken Sommerlager kennengelernt hatte. Beide waren Zionisten(1), aber auch radikale, an Martin Buber orientierte Sozialisten(2), sogenannte Hashomer Hatzair, die den Erfolg der zionistischen Bewegung daran maßen, wie erfolgreich sie sich in die lokale arabische Bevölkerung integrierte, und extrem antireligiös waren. Mein Cousin Chesky wuchs in einem Kibbuz in Israel(1) auf, das Schweine züchtete, nur um die religiösen Juden(1) zu ärgern. Das war eine Art Tradition. Meine Mutter wurde von ihrer Familie verstoßen, als sie meinen Vater heiratete. Er war nicht nur kein Jude, sondern auch noch deutscher(3) Herkunft, wenngleich er das war, was man damals einen »verfrühten Antifaschisten(1)(1)« nannte, da er im Spanischen(4) Bürgerkrieg(7) gekämpft hatte. Ich meine, viel weniger Nazi kann man nicht sein, doch das spielte für die Familie meiner Mutter keine Rolle. So kam es, dass ich meine Großmutter nie kennenlernte, obwohl sie weiterhin in Brooklyn lebte und erst starb, als ich etwa 16 war. Es war schon ein böser Bruch zwischen den Familien.
Es ist schon seltsam, wie schwer man als Heranwachsender seine Eltern cool finden kann. Tatsächlich sind die eigenen Eltern sozusagen definitionsgemäß uncool. Auch ich brauchte deshalb recht lange, bis ich durchblickte … Ich weiß noch, dass ich einmal mit meinem Vater sprach, bevor er in die Genossenschaft zog und sie noch im Village über dem St. Mark’s Place wohnten, ich glaube dort, wo heute das Yaffa ist. Damals war es ein armenisches Lokal. Ich erzählte ihm, dass ich zu einem Hockeyspiel wollte, und mein Vater sagte so ungefähr Folgendes: »Ich bin seit etwa 30 Jahren nicht mehr bei einem Hockeyspiel gewesen, ich glaube das letzte Mal habe ich mit diesem Beat Poet eins besucht. Wie hieß er doch gleich?« Und ich weiß noch, dass ich damals dachte: »Moment mal, du bist tatsächlich cool.« Ich wusste nicht, dass meine Eltern außergewöhnlich waren. Ich merkte es erst allmählich, als sie noch lebten, also waren sie immerhin noch auf der Welt, als mir klar wurde, wie cool sie waren, aber es hatte lang gebraucht.
Ich glaube mein Vater sympathisierte stark mit dem Anarchismus(11), weil er erlebt hatte, dass er funktionierte. Er war in Barcelona gewesen, als es praktisch nach anarchistischen(12) Prinzipien organisiert war. Und es funktionierte gut. Es gab Probleme, doch die Probleme wurden gelöst. Wie ich immer sage, glauben die meisten Leute nicht, dass der Anarchismus(13) nur eine schlechte Idee ist, sie halten ihn für verrückt, nicht wahr? »Das kann doch niemals funktionieren! Ach komm!« Mein Vater wusste, dass das nicht stimmt. Anarchismus(14) galt in meiner Familie nie als verrückt. Deshalb ist es keine große Überraschung, dass ich mich sehr früh damit anfreundete. Ich hatte alle Arten von verrückten Interessen und Obsessionen, die nicht ausdrücklich politisch waren, als ich ein Kind(5) war. Ich interessierte mich stark für Robert Graves(1) und seine Gedanken über Dichtung. Und ich war fasziniert von den Hieroglyphen der Maya(1). Deshalb bin ich an der Phillips Academy in Andover(1) gelandet. Vorher ging ich von PS 11 und IS 70 (staatliche(9) Schulen in New York(4)) mit einem Stipendium an eine private Eliteschule und dann wieder zurück an das Purchase College der SUNY(1) (State University of New York(5)). Also von einer privaten wieder an eine staatliche(10) Schule und am Ende nach Chicago. Ich sprang hin und her.
APPEL(3): Seit wann verstehen Sie sich als Anarchist(15)?
GRAEBER: Teilweise hat es mit einem Vetter von mir zu tun, den ich nie besonders gut kannte, aber ich glaube, er betrachtete sich als Anarchist(16) und schlug vor, dass ich mich mit der Sache befasse. Bis zum Ende meiner Teenagerjahre fand ich nie, dass ich eine bestimmte politische Identität hatte. Ich war halt irgendwie radikal. Der Vetter sagte, ich solle was über Spanien(5) lesen. Ich fragte meinen Dad, und der versuchte fair zu sein, und gab mir Mein Katalonien von George Orwell(1)(2) zum Lesen. Und er warnte mich: »Dir muss klar sein, dass der Mann total parteiisch ist und eine Menge Bullshit schreibt. Aber es ist trotzdem ein guter Anfang.« Mein Vater war von Leuten rekrutiert worden, die die Anarchisten(17) heftig ablehnten, und er kritisierte sie ständig. Aber er hatte in Spanien(6) viele Anarchisten(18) persönlich kennengelernt und sich gut mit ihnen verstanden. Am Ende hatte er in Bezug auf Spanien(7) die Position, dass es notwendig gewesen war, für den Kampf gegen die Faschisten(2) eine moderne Armee aufzubauen, aber die Unterdrückung der eigentlichen Revolution(6) war seiner Ansicht nach verrückt und selbstmörderisch gewesen. Die Struktur des anarchistischen(19) Militärs konnte nicht funktionieren, aber die anarchistische(20) Sozialstruktur und die politökonomische Struktur funktionierten sehr wohl. Als die zerstört wurden, war das der Anfang vom Ende. Ich las also Orwell(3) und dann noch mehr über Spanien(8) und Politik, und so kam ich zu der Überzeugung, dass Anarchismus(21) eine vernünftige Einstellung ist.
APPEL(4): Können Sie uns kurz Ihr politisches Engagement skizzieren, nachdem sie Anarchist(22) geworden waren und vielleicht Occupy(10)in die Gesamtheit ihres politischen Engagements einordnen?
GRAEBER: Die Bewegung der Globalisierungskritiker entstand, wie ich geschrieben habe, durch die Vereinigung mehrerer Bewegungen, sodass man ihre Bestandteile weit zurückverfolgen kann. Doch es war in der Anti-Atombewegung der 70er Jahre, dass sich die Teile wirklich zusammenfügten. Und es handelte sich um eine Konvergenz von anarchistischen(23) Traditionen, dem Feminismus(2) (der bei der Etablierung des Konsensprinzips(1) die wichtigste Rolle spielte) und gewissen spirituellen Traditionen einschließlich der der Quäker(1). Diese hatten bis dahin niemand beigebracht, wie man Konsensversammlungen(2) abhält, weil sie das als eine Form von Missionierung ablehnten. Für sie war Konsensbildung eine spirituelle Übung. Und so kamen die einzelnen Elemente, Affinitätsgruppen, Sprecherräte und das alles, tatsächlich in der Anti-Atombewegung zusammen, und sie kamen auch später immer wieder ins Spiel, wenn es um die Organisation vieler Menschen ging. Bei der Organisation kleinerer Gruppen hörten sie nie auf, eine Rolle zu spielen. Food Not Bombs ist ein großartiges Beispiel für eine Gruppe, die aus der Anti-Atombewegung hervorgeht und überlebt und dann wieder auftaucht und das Essen für alle großen Mobilisierungen der Globalisierungskritiker organisiert. Dies ist natürlich ein sehr stark auf Nordamerika zentrierter Blickwinkel. Die Bewegung der Globalisierungskritiker selbst stammt gar nicht aus dem Norden, sondern wurde von den Zapatistas(2) in Mexiko(2), der Bewegung der Landlosen(1) (MST) in Brasilien(1) und dem Bauernverband Karnataka Rajya Raitha Sangha (KRRS(1)) in Indien(1) initiiert. Sie war eine der ersten weltweiten sozialen Bewegungen, deren organisatorische Initiativen allesamt aus dem Süden und nicht aus dem Norden kamen. Doch im nordamerikanischen Kontext nahmen diese Impulse aus dem Süden eine besondere Form der Direkten Demokratie(4) an, die man hier als ein anarchistisches Verfahren betrachtet. Nach seinen Ursprüngen zu urteilen, könnte man es aber genauso gut als feministisches Verfahren sehen.
Wirklich engagiert habe ich mich 2000, als ich von Seattle(2) hörte. Vorher hatte ich irgendwie in meiner eigenen akademischen(13) Wolke geschwebt. Ich hatte, etwa in den 80er Jahren, immer wieder versucht, mich für anarchistische(24) Anliegen zu engagieren, war aber von den Erfahrungen nicht sonderlich beindruckt gewesen. Ich nenne die 80er Jahre gerne die Bob-Black-Periode des amerikanischen Anarchismus(25), als alle in diesen kleinen schreienden, sektiererischen Parteien waren, die aus einer Person bestanden. Ich versuchte es auch. Ich meine, es waren tolle Dinge am Laufen, aber ich bin einfach nicht über sie gestolpert. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich in Yale(1) aus einer Vorlesung kam, die ich im Rahmen einer Vorlesungsreihe über »Power, Violence, and Cosmology« gehalten hatte. Es war die letzte Vorlesung der Reihe gewesen. Als ich aus dem Gebäude kam, sah ich diesen kleinen Zeitungskasten mit der Schlagzeile: »Martial Law Declared in Seattle(3)« (»Kriegsrecht(8) in Seattle(4) erklärt«). Und ich dachte nur: »Was?!« Sowas passiert, wenn die Presse nicht mehr über Aktionen der linken Bewegung berichtet und die dann etwas wirklich Großes macht. »Wie zum Teufel kam das zustande?!«, war damals die typische New Yorker(6) Reaktion auf die Ereignisse. Und ich dachte: »Das ist die Bewegung, die ich mir immer gewünscht habe, und jetzt haben sie sie aufgebaut. Sie ist entstanden, als ich nicht aufpasste. Was mache ich jetzt?« Und so engagierte ich mich. A16, der 16. April 2000, die Aktionen gegen den IWF(1) (den Internationalen Währungsfonds) und die Weltbank(1)(1) in Washington(1), DC, da wurde ich erstmals aktiv. Und mit der Zeit engagierte ich mich stark beim Direct Action Network(1)in New York(7).
Dann, nach dem 11. September(1), haben sie die Repression verschärft und die Einsatzregeln änderten sich massiv zu ihren Gunsten. Eine Menge Leute brannten damals aus, gaben auf, zogen auf eine Bio-Farm, setzten ihr Studium fort oder verzweifelten irgendwie. Ich gehörte zu denen, die durchhielten. »Es kommt irgendwann wieder«, sagten wir uns. »Vielleicht dieses Jahr.« Wir machten einfach weiter und rannten mit dem Kopf gegen die Wand. Nicht, dass es je ganz aufgehört hätte. Ich war beim G8(1)-Gipfel(2) in Japan(1). Und bei dem in Gleneagles(1). Das war, als auf dem Höhepunkt der Aktionen eine Bombe hochging. Sie hatte nichts mit uns zu tun, aber danach brach alles zusammen. Nichts wurde je wieder ganz so, wie es vorher gewesen war. Aber wir rannten weiter mit dem Kopf gegen die Wand.
Eines will ich zur Entstehung von Occupy(11)sagen: An irgendeinem Punkt stellt man fest, dass man sein Leben um eine Sache herum organisiert, von der man auf einer bestimmten Ebene gar nicht glaubt, dass sie passieren wird. Wir hatten immer gewusst, dass Direkte Demokratie(5) ansteckend ist. Das ist immer so. Man kann sie den Leuten nicht erklären, aber wenn sie sie tatsächlich erfahren, ändert sie ihr Leben; sie können nicht mehr zurück. Doch die Frage ist, wie bringt man sie in den richtigen Raum. Deshalb dachten wir: »Irgendwann wird es passieren.« Aber auf einer anderen Ebene glaubten wir nicht, dass es passieren würde, weil man sich irgendwie wappnen muss gegen die permanente Enttäuschung. Und dann passierte es doch und wir sagten: »Ach du lieber Gott! Es passiert tatsächlich! Endlich passiert es! Wie gefällt dir das?!« Ich sprach tatsächlich mit einem Typ in Ägypten(1), der mir genau das Gleiche erzählte. All die Jahre organisiert man Veranstaltungen oder Demonstrationen, und es kommen nur 25 Leute, und man ist deprimiert. Schon wenn 300 kommen, bist du happy! Und dann kommen eines Tages 300 000, und du denkst: »Wie kommt das denn?! Was haben wir anders gemacht?« Genau so war es. Ich denke, eine meiner wichtigsten Rollen bei Occupy(12)bestand darin, dass ich einfach diese Brücke zwischen den Generationen war. Dass ich all diese Leute anrufen konnte und sagen: »Nein, diesmal passiert es wirklich. Ich weiß, ihr habt mich das schon früher sagen gehört …«
APPEL(5): Wenn man die längerfristige Entwicklung betrachtet, aus der Occupy(13)hervorging, wie unterscheidet sich dann das heutige Geschehen von früher?
GRAEBER:Occupy(14)erfindet sich ständig neu. Strike Debt ist dafür ein gutes Beispiel. Aber reden wir von der Strategie, Räume zu besetzen und zu halten, von der Wichtigkeit des Lagers oder der Gemeinschaft. Wie die globalisierungskritische Bewegung kommt auch das nicht aus dem Norden. Die Methode, einen Raum zu besetzen, beginnt mit dem Tahrir-Platz in Tunesien(1) und setzt sich mit dem Syntagma-Platz in Athen(1) und der Placa de Catalunya in Barcelona fort. Im Gegensatz dazu war das wichtigste thematische Zentrum der globalisierungskritischen Bewegung der Karneval(2) oder das Fest: Fest des Widerstands, Karneval(3) gegen den Kapitalismus(2), deshalb die ganzen Puppen(1) und Clowns. Und es war sinnvoll, als wir es im Grunde mit einer Solidaritätsbewegung(1) zu tun hatten, die die ganze Struktur der Global Governance lächerlich machen oder angreifen wollte. In dieser neuen Runde stehen dagegen kaum mehr Puppen(2) oder Clowns im Zentrum. Es gibt noch ein paar, aber die spielen bei unserem Anliegen keine zentrale Rolle mehr. Diesmal war es viel mehr das Lager, die Gemeinschaft. Dennoch gibt es eine gewisse Kontinuität: Wir schaffen Organisationsformen, die nicht nur zeigen, dass die Organisationen, die wir bekämpfen, wie jeder weiß, schlecht sind, sondern auch, dass sie unnötig sind. Wir setzten ihnen die Alternative direkt vor die Nase, weil das die wirksamste Art ist, ihre Legitimität und Autorität(2) zu zerstören. In der ersten Runde war der Karneval(4) sinnvoll, aber das Wirksamste, was wir als gezieltes Symbol gegen die Wall Street schaffen konnten, war eine Gemeinschaft von Menschen, die füreinander sorgten. Und es gibt nichts Radikaleres, als exemplarisch Liebe(1)(2) zu leben vor diesem Symbol der Unmöglichkeit einer Gesellschaft(18), die auf Liebe(3) basiert.
APPEL(6): Was ist mit den verschiedenen Projekten, die nach den Zeltlagern aus Occupy(15)entstanden – Strike Debt, Schuldnergewerkschaften, neue Strategien?
GRAEBER: Eine der effektivsten Methoden, die in Frankreich(1) den Washington(2) Consensus und die neoliberale Hegemonie untergruben, waren die Arbeitslosengewerkschaften(4)(1), die sich überall in Frankreich(2) gründeten und die 1996 eine wichtige Rolle spielten, als sie die dortige Sparpolitik abschwächten. Frankreich(3) sollte tatsächlich das einzige Land sein, in dem diese Politik nicht durchkam. Es gibt also eine lange Geschichte von Gewerkschaften(5), die auf anderen Dingen als der Arbeit(13) beruhen. Ein Teil des Problems besteht darin, dass die Gewerkschaften(6) politisch so zahnlos geworden sind, dass sie bei größeren Problemen womöglich nutzlos sein könnten. Aber Schuldner sind bekanntermaßen schwer zu organisieren. Es ist eine echte Herausforderung. Und es gibt ein seltsames Paradox in dieser Sache: Die ersten Auswirkungen von Schulden(12) sind Isolation, Scham und Demütigung und die Angst, überhaupt über das Thema zu sprechen. Andererseits sind in der Geschichte die weitaus meisten Revolten und Aufstände wegen Schulden(13) entstanden. Verschuldung ist also ideologisch ein extrem wirksames Mittel, um Menschen zu isolieren. Aber wenn sie diese Isolation überwinden, sind die Ergebnisse immer explosiv. Verschuldung gehört zu den Dingen, gegen die die meisten Menschen am ehesten revoltieren. Der Einsatz ist also hoch; die Sache ist wirklich schwierig. Aber wenn sie gelingt, ist sie ungemein effektiv.
APPEL(7): Können Sie uns helfen, die Beziehung zwischen Verschuldung und Finanzindustrie(6) zu verstehen?
GRAEBER: Die Art, wie wir über die Finanzindustrie(7) reden, hat fast gar nichts mit unseren tatsächlichen sozialen Beziehungen und schon gar nichts mit Klassenverhältnissen zu tun, und das war es natürlich, worum es bei Occupy(16)immer ging, die Erinnerung daran, dass es die Macht von Klassen(1) tatsächlich gibt. Um nichts anderes ging es bei »den 99 Prozent(6)«. Doch die Finanzindustrie(8) wird immer auf dieselbe Art dargestellt: »Wow, diese Typen haben einen Weg gefunden, alle anderen zu betrügen, indem sie einfach aus nichts Geld(3) machen!« Es gibt diese Vorstellung, dass diese Leute nur herumsitzen und an einem Computer oder mit irgendwelchen Papieren herumspielen und sagen: »Oh, schau mal: Geld(4)!« Oder dass sie ins Casino gehen und spielen und irgendwie durch den Kauf von Chips mehr Chips produzieren. Natürlich tun sie alles, um dieses Missverständnis aufrechtzuerhalten. Da gibt es diese ganze Phrasendrescherei … Ich weiß noch, wie ich unmittelbar vor dem Crash im Jahr 2007 auf diese Konferenzen ging, und dort waren diese Kulturtheorie-Typen, sehr clever und sehr trendy, die bei ihrer Arbeit(14) überhaupt nicht mehr zwischen Formen von Wissen, Formen von Macht und der materiellen Realität differenzierten. Und sie meinten: »Das ist ja unglaublich! Die benutzen Formen der Verbriefung, um die materielle Natur(3) der Realität und der Zeit zu verändern! Wir müssen von diesen Leuten lernen, die aus dem Nichts Werte(3) schaffen können.« Ich weiß noch, dass ich hinten im Raum saß und dachte: »Ich glaube in der Geschäftswelt würde man das als Betrügereien bezeichnen!« Die Leute durchschauten es nicht. Sie fielen darauf herein. Und die Schwindler vergrößerten das Missverständnis, indem sie die Illusion von Fachwissen weckten: »Ja, natürlich, wir haben da diese Programme, die nur ein Astrophysiker(1) durchführen kann. Es gibt nur fünf Menschen auf der Welt, die das verstehen können.« Ich sah ein Interview mit einem dieser Astrophysiker(2), und er sagte so ungefähr Folgendes: »Also wissen Sie, wir haben uns das einfach während der Arbeit(15) aus den Fingern gesogen.« Also legte jeder jeden herein. Was jedoch wirklich passierte und was Finanzialisierung(9) wirklich bedeutet, ist, dass sie mittels diverser raffinierter Formen der Bestechung mit der Regierung übereinkamen, das Gesetz so zu ändern, dass sich alle immer weiter und weiter verschulden und ihr Einkommen direkt der Finanz(10)-, der Versicherungs- und der Immobilienindustrie in den Rachen werfen.
Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Es ist bezeichnend, dass sie nicht zu bekommen sind. Aber etwa 15 bis 25 Prozent des durchschnittlichen amerikanischen Haushaltseinkommens werden direkt in Form von Zinsen, Geldstrafen, Gebühren, Versicherungsgebühren usw. abgeschöpft. Und es muss offensichtlich viel mehr Geld(5) pro Haushalt sein, weil 25 Prozent der Haushalte entweder zu arm oder zu reich sind, um Schulden(14) zu haben. Sie holen euch das Geld(6) aus der Tasche. Wenn ihr euch die Gewinne der Wall Street anseht, hat ein immer kleinerer Prozentsatz etwas mit Handel oder Industrie zu tun. Ich glaube nur 9 bis 11 Prozent sind noch industriell, und das ist weit übertrieben, weil bei Konzernen wie General Motors (GM)(1) (wenigstens bis 2007/8) kein Cent der Gewinne von den Autos kam. Der Gewinn wurde ausschließlich dadurch erzielt, dass Geld(7) für den Kauf von Autos verliehen wurde, und das galt als industriell. Tatsächlich sind nahezu die gesamten Gewinne finanzwirtschaftlich(11), resultieren also im Grunde aus der Verschuldung von Menschen.
Ich beschreibe das gern folgendermaßen: Schauen wir uns die 50er Jahre an, als der Chef von GM den Spruch prägte: »Was gut ist für GM, ist auch gut für Amerika.« Das ergab Sinn in einer Zeit, als GM mit 60 bis 70 Prozent besteuert(1) wurde und seine Manager mit 90 Prozent. Sie erwirtschafteten gewaltige Gewinne, und der größte Teil der Gewinne ging an den Staat, und der nutzte das Geld(8)