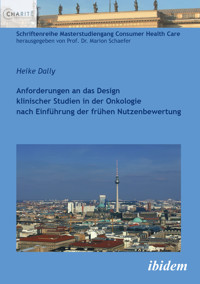
Anforderungen an das Design klinischer Studien in der Onkologie nach Einführung der frühen Nutzenbewertung E-Book
Heike Dally
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care
- Sprache: Deutsch
Ist der Goldstandard der Zulassungsstudie, die kontrollierte randomisierte Doppelblindstudie, in der Onkologie noch adäquat? Die therapeutische Behandlung von Patienten mit onkologischen Erkrankungen orientiert sich nicht mehr nur an der Histologie und am Tumorstadium, sondern zunehmend an den molekularen Eigenschaften des Tumors. In den letzten Jahren wurden viele zielgerichtete Krebsmedikamente zugelassen – mit steigender Tendenz. Die herkömmlichen Studiendesigns können die komplexen Fragestellungen der zielgerichteten Therapien nur noch unzureichend beantworten. Seit Inkrafttreten des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes [AMNOG] im Januar 2011 werden neu zugelassene Arzneimittel auch hinsichtlich ihres Zusatznutzens bewertet. Basis für die Bewertung der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von neuen Medikamenten sowie für deren Zusatznutzen sind die Daten aus den Zulassungsstudien. Heike Dally analysiert das Design der Zulassungsstudien, die für die Zusatznutzenbewertungen in den Verfahren bis Januar 2015 herangezogen wurden, und zeigt die wichtigsten Kritikpunkte der Health-Technology-Assessment-Behörden am Studiendesign auf. Dally verknüpft die bei den mündlichen Anhörungen genannten wichtigsten Kritikpunkte zu den Anforderungen an klinische Studien in der Onkologie mit den neuartigen, zielgerichteten Therapien und zeigt neue Lösungsansätze für die Konzeption und Durchführung von zukünftigen Arzneimittelstudien in der Onkologie auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
ADO
Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie
AkdÄ
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
ALCHEMIST
Adjuvant Lung Cancer Enrichment Marker Identification and Sequencing Trial
ALK
Analplastische Lymphomkinase
AMNOG
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
AM NutzenV
Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung
BRAF
„Rat Fibrosarcoma“ Proteinkinase der Isoform B
CI
Konfidenzintervall
CR
Komplette Remission (complete remission)
CTCAE
Common Terminology Criteria for Adverse Events
DCR
Krankheitskontrollrate (disease control rate)
DFS
Krankheitsfreies Überleben (disease-free survival)
DGHO
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie
ECOG
Eastern Cooperative Oncology Group
EFS
Ereignisfreies Überleben (event-free survival)
EGFR
Epidermal Growth Factor Receptor
EMA
Europäische Arzneimittelagentur (European Medicines Agency)
EORTC QLQ-C30
European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire: Fragebogen zur Messung der HR-QoL
EPAR
European Public Assessment Report
EQ-5D
European Quality of Life-5 Dimensions
FDA
Federal Drug Administration – amerikanische Zulassungsbehörde
G-BA
Gemeinsamer Bundesausschuss
GKV
Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung
HR-QoL
Gesundheitsbezogene Lebensqualität (health-reported quality of life)
IQWiG
Institut für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen
HTA
„Health Technology Assessment“
KOF
Körperoberfläche
NCI
National Cancer Institute
NIH
„NationalInstituteofHealth“, USA
NSCLC
Nicht-kleinzelligiges Bronchialkarzinom (non-small cell lung cancer)
ORR
Objektive Ansprechrate (objective response rate)
OS
Gesamtüberleben (overall survival)
PhRMA
Pharmaceutical Research and Manufacturers ofAmerica
PRO
Symptomatik aus Patientensicht (patient-reported outcomes)
PFS
Progressionsfreies Überleben (progression-free survial)
PD
Progression (progressive disease)
PR
Partielle Remission (partial remission)
pU
Pharmazeutischer Unternehmer
QALY
Quality Adjusted Life Year (Qualitätskorrigiertes Lebensjahr)
RCT
Randomized Controlled Trial
RECIST
ResponseEvaluationCriteriaInSolidTumors
SD
Stabile Erkrankung (stable disease)
SGB
Sozialgesetzbuch
SmPC
Produktinformation – Zusammenfassung (Summary of Product Characteristics)
SUE
Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis
TTF
Zeit bis zum Therapieversagen (time to treatment failure)
TTP
Zeit bis zur Tumorprogression (time to progression)
UE
Unerwünschtes Ereignis
VFA
Verband Forschender Arzneimittelhersteller
ZVT
Zweckmässige Vergleichstherapie
1Zusammenfassung
SeitInkrafttreten des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes [AMNOG] imJanuar 2011 werden neu zugelassene Arzneimittelhinsichtlich ihresZusatznutzensbewertet. Parallel dazu hat sich in der Onkologie in den letzten Jahren ein deutlicher Trend von der chemotherapeutischen Behandlung für Patienten mit derselben Histologie hin zur zielgerichteten Therapie bei Patienten mit spezifischen molekularen Subgruppen entwickelt.Basis für die Bewertung der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von neuen Medikamenten sowie für deren Zusatznutzen sind die Daten aus den Zulassungsstudien. Der Goldstandard für Studiendesignssindauch in der Onkologiekontrollierterandomisierte Doppelblindstudien.Obwohlregulatorische- und„Health-Technology-Assessment [HTA]-Behördendie Daten aus den Zulassungsstudienparallelbewerten,habenbeideunterschiedliche methodische Ansätze und Ziele. Damit steht die Konzeption von adäquaten Studiendesigns in der Onkologie vor grossen Herausforderungen.
Die vorliegende Arbeit untersucht in einem quantitativen Ansatz das Studiendesignvon18 Zulassungsstudien. Die Daten aus diesen Zulassungsstudien wurdenfür dieBewertungdes Zusatznutzens in 21Verfahrenim Zeitraum Januar 2011 bis einschliesslich Januar 2015herangezogen. Die wichtigsten Kritikpunkte am Studiendesign wurden qualitativ bei 5 Nutzenbewertungenfür Ipilimumab, Vemurafenib und Dabrafenib zur Behandlungdes Melanoms herausgearbeitet.Diese Wirkstoffe sind Beispiele für zielgerichtete, stratifizierteTherapien.
Von den 18 Zulassungsstudien wurden 8 als kontrolliert randomisierte Doppelblindstudie durchgeführt.In zweidieser Studienwar ein Therapiewechsel[Cross-Over-Design]möglich.Vonden10 unverblindetdurchgeführten Studienhatten 5StudieneinCross-Over-Design.
Die primären StudienendpunkteGesamtüberleben[OS]und progressionsfreies Überleben[PFS]wurden etwa gleich häufig erhoben: OSin 7Studien,PFS in6 Studien. Drei Studien hatten co-primäre Studienendpunkte aus OS/PFS. In den 6 Studien, die PFS als alleinigen Studienendpunkt aufwiesen, berücksichtigte derGemeinsame Bundesausschus [G-BA]diesen Endpunkt nicht für das Gesamturteil der Nutzenbewertung.
Aus 15 Zulassungsstudien liegen Daten zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität(HR-QoL)vor; die Daten aus 8 Studienhat der G-BAfür die Bewertung des Zusatznutzens berücksichtigt.Bei den 7 Studien,bei denen die Daten zur HR-QoL nicht akzeptiert wurden, war der Hauptgrund die geringe Rücklaufquote von unter 70% sowie die fehlende Validierung der Fragebögen.
Siebzehnmal wurdein den 21 Verfahrenin der Gesamtwertung ein Zusatznutzen vergeben, davonachtmal ein „Hinweisgekoppelt mit einembeträchtlichen Zusatznutzen“. In 4 Verfahren, also etwa einem Fünftel, konnte kein Zusatznutzen nachgewiesen werden. Dieser Anteil ist vergleichsweise gering im Vergleich zu Verfahren, dienichtonkologische Präparate betreffen. Hierwurde beimehr als 50%der Verfahren kein Zusatznutzenfestgestellt. Die höchste Kategorie „Beleg für einen erheblichen Zusatznutzen“ wurdebis zu diesem Zeitpunkt in keinem Nutzenbewertungs-Verfahrenvergeben.Einer der Gründe dafür könnte sein, dass die meisten der in den Verfahren berücksichtigten Zulassungsstudieneinige ZeitvorEinführungdes AMNOG geplant bzw. durchgeführtwurden.
Diequalitative Analyseverdeutlicht, dass der strukturelle Ablauf des gesamten Verfahrens der Nutzenbewertung optimiert werden sollte.Die methodischen Beanstandungen liessen sich durch eine frühzeitige initiale Beratung vorKonzeption derStudienverringern.Andieser Beratung solltensowohl derpharmazeutische Unternehmer [pU], regulatorische und HTA-Behörden, die entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften und ein unabhängiges Institut fürStatistikteilnehmen. Die Beratungsollteauch während der Durchführung der Studiebei Bedarf möglich sein.
Zukünftige klinische Studien in der Onkologie solltentumorzentrierteEndpunktewie z. B. das progressionsfreie Überlebenmitpatientenorientierten Endpunkten wie der gesundheitsbezogen Lebensqualitätkombinieren.Auch bei dembishervondenHTA-Behördenwenig in Frage gestellten Endpunkt „Gesamtüberleben“wäre die Kombination mit Daten zur Lebensqualität wünschenswert.
2Einleitung
Die Entwicklung von Arzneimitteln in der Onkologie,insbesondere von zielgerichteten Therapien[1],hat in den letzten JahrenzueinerdeutlichenZunahme derZulassungenonkologischer Präparate geführt. Gründe hierfür sind u. a. Fortschritte in der Charakterisierung molekularbiologischer Merkmaledes Tumors,die eineindividuelleauf die Krebserkrankungdes Patientenangepasste Therapieim Vergleich zur herkömmlichen Chemotherapieermöglichen.
In derEuropäischen Wirtschaftsgemeinschaftwurde der Nachweis der therapeutischen Wirksamkeit von neuen Arzneimitteln erstmals im Rahmen der Richtlinie 65/65/EWG vom 26. Januar 1965 gefordert. Eine deutlichere Konkretisierung erfolgte mit der Richtlinie 75/319/EWG von 1975. Im gleichen Zeitraum wurden auch Ergebnisse aus den ersten randomisierten Studien bei Brustkrebs mit adjuvanter Chemotherapie publiziert (De Vita, 2008).
Die Zulassung bzw. Zulassungserweiterung für onkologische Arzneimittel in Europa erfolgt inzwischen entsprechend der EU-Verordnung EG-Nr.726/2004 in einem zentralisierten Verfahren der Europäischen Arzneimittelagentur [EMA]. Im Dezember 2005 veröffentlichte die EMA eine Richtlinie zur Durchführung von interventionellen Studien für onkologische Präparate. Die Richtlinie spricht u. a. Empfehlungen für die Auswahl von klinischen Endpunkten in onkologischen konfirmatorischen Studien aus (EMA Guideline on the Evaluation of Anticancer Medicinal Products in Man, 2006). Sie wurde im Jahr 2008 durch methodische Überlegungen zum progressionsfreien Überleben [PFS] als primärem Endpunkt in Zulassungsstudien ergänzt (EMA Appendix 1 to the guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man). Im Juli 2013 wurde die Richtlinie an aktuelle Entwicklungen in der Onkologie angepasst; so wurde beispielsweise die Rolle von Biomarkern und zielgerichteten Therapien bei der klinischen Entwicklung berücksichtigt (EMA Guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man, 2013).
Neben dem Nachweis von Sicherheit,Wirksamkeitund Qualitätdes Prüfpräparates bei den regulatorischen Behörden ist mit derEinführung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes(AMNOG)seit Januar 2011auch der Zusatznutzen im Vergleich zur zweckmässigen Vergleichstherapie (ZVT) nachzuweisen. Bei der ZVT handelt es sich um einebereits zugelasseneTherapiein der gleichen Indikation, wobeider G-BAfestlegt, welche Vergleichstherapie als zweckmässig für den Vergleich erscheint.Der Zusatznutzen wird belegt durch die Verbesserung des Gesundheitszustandesdes Patienten, Verkürzung der Krankheitsdauer, Verlängerung des Überlebens, Verringerung von Nebenwirkungenund/oder dieVerbesserung der Lebensqualität.
Grundlage für die Zulassung neuer Arzneimittel unddiefrühe Nutzenbewertung sind die Daten aus den Zulassungsstudien. Mit Einführung der frühen Nutzenbewertung werden diese Daten noch einmal neu bewertet hinsichtlich des Zusatznutzens. Zusammen mit den in der Onkologiehäufiger werdendenzielgerichteten Therapien stellt das Verfahren besondere Anforderungen anzukünftigeklinische Studiendesignsin der Onkologie.
3Ziel undAufgabenstellung
Die Kritikpunktean Studiendesigns zielgerichteter Tumortherapienund daraus ableitbare Anforderungendurch die frühe Nutzenbewertung sollen durch folgende Fragestellungen beantwortet werden:
Quantitative Analyse:
oAnzahl derVerfahren zur frühen Nutzenbewertung onkologischer Präparate im Zeitraum Januar 2011 bis einschliesslich Januar 2015
oAnzahl der berücksichtigten Zulassungsstudien in den Verfahren
oAuswahl derprimären Endpunkte in den ausgewerteten Zulassungsstudien
oAnzahl der Zulassungsstudien, inwelchendie gesundheitsbezogenen Lebensqualität erhoben und akzeptiert wurde
oZeitpunkt der Planung der jeweiligen Zulassungsstudie
oVergabedesZusatznutzensim Gesamturteil beiden ausgewerteten Verfahren
Qualitative Analyse:
oErarbeitung der wichtigstenDiskussions- und Kritikpunkte am Studiendesign bei den Nutzenbewertungender Therapiendes Melanoms:Ipilimumab, Dabrafenib und Vemurafenib
4Material und Methode
Für diequantitative Analyse wurdenDatenaus der Verfahrensdatenbank des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller(VFA-Verfahrensdatenbank)alsAnhangzur vorliegenden Arbeit zusammengestellt. DieseDatenlieferten die GrundlagefürdieAbbildungenund Tabellenim Ergebnisteil.Es wurden alle VerfahreninderOnkologieim Zeitraum Januar 2011 bis einschliesslich Januar 2015 erfasst.PräparatezurBehandlung seltener Erkrankungen[Orphan Drugs[2]]wurden ausgeschlossen, da hier Sonderregelungen getroffen wurden.Für Orphan Drugsgilt derZusatznutzen als belegt, jedochmussein Dossier vom pU eingereicht werden,umdas Ausmassdes Zusatznutzens zu bestimmen.
Die Analyse der Nutzenbewertung beim Melanomerfolgte auf der Basis einer qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring(Mayring Qualitative Inhaltsanalyse). Dazuwurdenalle 5 mündlichen Anhörungendurchgesehen und die Hauptkritikpunkte aus den Nutzenbewertungenin Bezug auf das klinische Studiendesign im Ergebnisteil zusammengefasst.Zusätzlich zurmündlichen Anhörung wurden auch weitere Dokumente als Datenquellenherangezogen, wie z. B. die Nutzenbewertung des IQWiG und die Beschlüsse des G-BA,welcheauf derInternetseite desGemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) im Untermenü „frühe Nutzenbewertung“ zu finden sind(G-BA - frühe Nutzenbewertung).Der Diskussionsteilfasstdie Erkenntnisse des Ergebnisteils als Kategorien in einzelnen Unterkapitelnzusammenund interpretiert diese. Vorschläge für Verbesserungen werden im Kapitel „Schlussfolgerungen“ dargelegt.
DieDatender Zulassungsstudienkommen ausderStudiendatenbank des „National Institutes of Health“(Clinical Trials Gov, 2015)und/oder waren unterdem jeweiligen Studiennamen inPubMedzu finden(PubMed). Eine Literaturrecherche zu den Stichworten„progressionfree survival“, „clinical endpoints“und„AMNOG“erfolgte ebenfallsinPubMed.
5ZulassungvonArzneimitteln zur Behandlungvon Krebserkrankungen
Die Zulassung onkologischer Präparate nimmt im Vergleich zur Zulassung von Medikamenteninanderen Indikationen, z. B. bei Herz-Kreislauferkrankungen,eine Sondersituation ein.Denn die therapeutischen Zielesindbei Krebserkrankungen sehr heterogen.Bei verschiedenen Krebserkrankungen,aber auchinnerhalb derselben Krebsart sind unter der Therapieje nach Agresssivität des TumorsÜberlebenszeiten von wenigen Wochen bis hin zu mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten möglich.Bei geringer Lebenserwartung spielt bereits eine Verlängerung der Lebenszeit um wenige Monate eine bedeutende Rolle.Auch die Symptomatik kann je nach Tumorart und Stadium der Erkrankung sehr unterschiedlich sein. Gerade bei Krebserkrankungen,die mit einer geringen Lebenserwartung verbunden sind, können zugelassene Präparate dieBegleitsymptome des Tumorswie z. B.Schmerzen lindern, selbst wenn sie nicht zu einem verlängerten Überleben führen, aberdie Lebensqualität aus Patientensicht erhöhen.Diesertherapeutische Erfolgkann jedochdennochmitweiterenNebenwirkungen verbundensein(Ricevuto, 2010).Eine besondere Herausforderung für zukünfige Studiendesigns in der Onkologie stellen auch diesich aufgrund von speziellen tumorgenetischen Eigenschaften in immer kleinere Teilpopulationen aufteilendenPatientengruppendar, für die es zunehmend schwerer wird, statistisch ausreichende Patientenzahlen in einem bestimmten Zeitraum zu finden.
Die kontrollierte randomisierte Doppelblindstudie wirdbisheute als Goldstandardin der Onkologieangesehen.Im Studiendesign sollte das Studienzieleindeutig definiertund die Fallzahlgrössestatistischabgesichertsein.Zu den Qualitätsstandards gehört die Festlegung desprimärenZielkriteriums,da in vergleichenden Therapiestudien immer nur eine Fragestellung konfirmatorischgeprüft werdenkann.Die Ergebnisse aus sekundären Zielkriterienund Subgruppenanalysenkönnen aus statistischer Sichtgegebenenfalls Hinweise fürFragestellungen inweiterenStudiengeben.
DieWirksamkeitvon Prüfsubstanzenwirdin der Regelin sogenannten Überlegenheits-Studien der Phase IIIund gelegentlich auch der Phase IIuntersucht, die in der Regel aus einem Kontroll-Arm und einem Verum-Arm mit der zuprüfendenStudienmedikation besteht (Abbildung 1).Die Auswahl des primären Endpunktesist dabeizentral. Der primäre Endpunkt legt fest, wie der klinische Nutzen definiert ist. Da





























