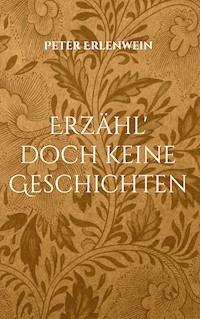Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Küchenerinnerungen an Nachkriegs-Berlin, an Lindow in der Niederlausitz, an Reisen und Begegnungen auf vier Kontinenten. Geschichten und Anekdoten rund um's Essen mit, für jeden Ignoranten wie mich, allgemein verständlichen Anregungen zum Selberkochen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Freunde,die dieses Buch ganz sicher nicht brauchen
INHALTSVERZEICHNIS
MAHLZEIT
WERKZEUGE UND LEBENSMITTEL-VORRÄTE
HERD
MESSER
PFANNEN UND TÖPFE
LEBENSMITTEL-VORRÄTE
TISCHGEBRÄUCHE
GROßE TAFEL
EßTISCH
GETRÄNKE
EINFACH, SCHNELL UND MÖGLICHST BILLIG
GERÖSTETES BROT
RÜHREI/OMELETT MIT TOMATEN
RÜHREI MIT SHRIMPS
BRÜHKARTOFFELN
URSCHLAMM
KARTOFFELPUFFER
VON DER BOULETTE BIS ZUM ZEHLENDORFER STEW
RAN AN DIE BOULETTEN
CURRYWURST
CURRYWURST-SAUCE NACH HERTA HEUWER
CURRYWURST-SAUCE NACH ART DES HAUSES
BOCKWURST
FALSCHER HASE
BERLINER KALBSLEBER
BERLINER SCHMORGURKEN
EISBEIN MIT SAUERKRAUT NACH BERLINER ART
KASSLER MIT SAUERKRAUT
PELLKARTOFFELN, SCHICHTKÄSE UND LEINÖL
BERLINER (LINDOWER) SCHLACHTEPLATTE
ZEHLENDORFER STEW
KARTOFFELN
KARTOFFEL-VARIATIONEN
SALZKARTOFFELN
PELLKARTOFFELN
KARTOFFELN, GEDÄMPFT
BRATKARTOFFELN
GEBACKENE KARTOFFELN
FOLIENKARTOFFELN
KARTOFFELN IM RÖMERTOPF
RÖSTI
QUETSCH-/STAMPFKARTOFFELN/KARTOFFELPÜREE
QUETSCHKARTOFFELN MIT SELLERIE
POMMES FRITES (NACH THIS-BENCKHARD)
KARTOFFELSUPPE
BERLINER KARTOFFELSALAT MIT BOCKWURST
ROSMARINKARTOFFELN
TOMATEN
TOMATEN-VARIATIONEN
TOMATENSUPPE MIT GRAUPEN
TOMATENSUPPE PUR
TOMATENSUPPE MIT ESTRAGON (WINKFIELD-SUPPE)
TOMATENSALAT MIT GURKEN UND BROT
SPARGEL
SPARGEL-VARIATIONEN
SPARGEL PUR
PASTA & PIZZA
PASTA-VARIATIONEN
SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO
SPAGHETTI MIT RAGOUT BOLOGNESE
SPAGHETTI MIT GARNELEN UND TOMATEN
PASTA NACH ART DES HAUSES
REIS
REIS-VARIATIONEN
REIS PUR
URSCHLAMM ASIATISCH
REISGEMANSCHE
GEWÜRZE
KNOBLAUCH (FRISCH)
FETTE UND ÖLE
GEKLÄRTE BUTTER
OLIVENÖL
EINFACHE SAUCEN
MEHLSCHWITZE
DILLSAUCE
TOMATENSAUCE
TOMATEN'SUBSTANZ'
BÉCHAMELSAUCE
SENFSAUCE
PETERSILIENSAUCE
BLUMENKOHLSAUCE
JÄGERSAUCE
VOM FELD UND AUS DEM WALD
GURKENSALAT
SAUERKOHL
SAUERKRAUTSUPPE
BROCCOLISUPPE
ROTKOHL
BLUMENKOHL
GRÜNKOHL
KOHLRABI
ROSENKOHL
WEIßE BOHNEN MIT TOMATENSAUCE
WEIßE BOHNEN „PROVENCALE“
ERBSEN MIT SPECK
GRÜNE BOHNEN EINTOPF
BUNTE BOHNEN EINTOPF
LINSENEINTOPF
PORREE-PFANNE MIT TOMATEN UND EIERN
PORREEGEMÜSE (MIT SALZKARTOFFELN)
SPINAT
SELLERIESUPPE
PILZE
FRISCHE PFIFFERLINGE
STEINPILZSUPPE
ESSBARES – GEFLÜGELT
HUHN-, GEMÜSEEINTOPF
PUTENBRUST MIT ANANAS
GESCHMORTE ENTENKEULEN
GÄNSEBRATEN
GÄNSESCHMALZ
ESSBARES AUS DEM WASSER
KRUSTENTIERE
SEE- ODER FLUßFISCHE
DORADE ROYALE
MEERESFRÜCHTE SUPPE
FISCHSUPPE EINFACH
FORELLEN
FORELLE NACH MÜLLERIN ART
FORELLE BLAU
KABELJAU IN DILLSAUCE
MEDITERRANE GARNELENPFANNE
ESSBARES VON DER WEIDE
ZUBEREITUNG VON FLEISCH
GULASCH (GULYÀS)
RINDERROULADEN
RINDERSCHMORBRATEN
TAFELSPITZ MIT MEERRETTICHSAUCE
KÖNIGSBERGER KLOPSE
SCHAFE UND ZIEGEN
LAMMFOND
LAMM MIT WEIßEN BOHNEN
LAMMKEULE
LAMMCURRY
LÖFFELLAMM
ESSBARES AUS DEM STALL
SCHWEINEBRATEN
RESTE UND REISEN
WAN TAN - SUPPE
MISO-SUPPE
BOUILLABAISSE
CHILI CON CARNE
SERBISCHES REISFLEISCH
BORSCHTSCH
GAZPACHO
ULTIMATIVE ANTI-FETT-SUPPE
RATATOUILLE
ZWIEBELSUPPE
PAELLA
UND WO BLEIBT DER KÄSE?
KÄSE-AUFBEWAHRUNG
KÄSE-SORTEN
DAS ULTIMATIVE REZEPT
FAKTEN UND DATEN
LITERATUR
REZEPT- UND STICHWORTVERZEICHNIS
MAHLZEIT
... für Leser, die rasch zur Sache kommen wollen:
Sie haben von nix ‘ne Ahnung, wollen oder müssen aber ganz schnell mal selbst etwas zum Essen zubereiten? O.k., machen wir’s kurz: Falls Sie den Raum, der in Ihrem Wohnungsmiet- oder Kaufvertrag als Küche bezeichnet ist, bislang nur als Abstellraum wahrgenommen haben, vergessen Sie die kurze Begegnung mit diesem Buch - und „Tschüß“!
... für Leser mit Neugier und etwas Geduld:
Immer noch da? Das freut mich! Gucken Sie in’s Inhaltsverzeichnis und verlassen Sie sich auf die Überschriften. Sollten Sie Abkürzungen nicht verstehen, schauen Sie unter „Fakten und Daten“ nach, dort ist fast alles erklärt.
Dieses Buch ist weder Rezepte-Sammlung noch Kochbuch. Es will auch nicht belehren. Es erzählt selbst erlebte oder erfahrene Geschichtchen und Anekdoten rund ums Essen.
Was der Mensch ißt, wie er die ihm verfügbaren Rohstoffe zubereitet und mit welchen Zutaten er sie versieht, entzieht sich jeder Dogmatik. Jedes Dorf, jede Region auf unserem Planeten ernährte sich ursprünglich von dem, was ihnen jeweils nah' verfügbar war.
Daraus hat sich bis in unsere Zeit eine schier unendliche Vielfalt der Auf- und Zubereitung tierischer und pflanzlicher Nahrungsmittel entwickelt. Es wäre schön, wenn wir sie uns erhalten könnten.
Was verwendet und wie es zubereitet wird, das "receptum (lat.)", ist weder Imperativ, noch Dogma. Jeder Mensch hat seine eigenen Vorlieben für Gemüse, Fleisch, Fisch und Gewürze. In der Art der Zubereitung macht er eigene Erfahrungen, ganz gleich, ob er kocht oder kochen läßt. In diesem Buch wurde daher an Stelle des Wortes "Rezept" die liberalere Bezeichnung "Variation" (der dominierenden Zutat) verwendet. Apropos Vorlieben: Beschrieben werden nur Gerichte, die ich selbst gerne esse!
Diese Variationen einmal auszuprobieren und sie dann hemmungslos zu ändern, sie an die eigenen Vorlieben anzupassen, wär' meine Idee von der Nutzung dieses Buches.
Finden Sie es auch bemerkenswert, wie nachhaltig präsent uns geschmackliche Erinnerungen sind? In Frankreich hat vor über hundert Jahren ein erwachsener Mann eine Madeleine in seinen Tee getunkt. Als er sie in den Mund nahm, löste ihr Geschmack Erinnerungen aus, denen wir einen der schönsten Romane der Weltliteratur verdanken.
Meine eigenen Erinnerungen rühren her aus meiner Kinder- und Jugendzeit im Nachkriegs-Berlin und einem kleinen Dorf in der Nieder-Lausitz. Leider habe ich nur den Geschmack behalten, nicht aber die Rezepte, die ihn bewirkten. Anderes habe ich von Reisen mitgebracht und aus Einladungen zum Essen bei Freunden und Bekannten. Wieder andere stammen aus allgemein zugänglichen Berichten, die ich ausprobiert und meinem Geschmack angepaßt habe, sowie aus Gesprächen mit professionell kochenden Menschen.
Lernen ist kein Kunststück, falls man für Neues, auch Anderes offen ist - und den Mund zum Fragen aufbekommt. Lesen zu können, ist kein Nachteil; Freunde zu haben, die selbst kochen, ein großer Vorteil. Dennoch war 'Kochen' in meinen Gesprächen immer nur Randthema. Ehrlich!
Kulinarische Extravaganzen und exotische Zutaten sind nicht mein Ding. Sollte mir hier und da doch eine solch' fremd klingende Zutat untergekommen sein, ist sie im nächstliegenden Asia-Laden zu finden.
Typen wie mich gibt's zuhauf; sie haben von nix in der Küche eine Ahnung, lassen sogar das Kaffeewasser anbrennen. Mit dem Beginn einer gleichberechtigten Partnerschaft, vulgo: Ehe, entwickeln sie aber den Ehrgeiz, die nebenberuflich anfallenden Arbeiten fair mit der Partnerin zu teilen. In eben dieser Situation durfte ich wählen. Putzen und Waschen wollte ich nicht, also habe ich mir "Küche komplett" ausgesucht: Einkaufen, Kochen, Abwaschen und Küche sauberhalten.
Zubereitete Speisen nennt man Gerichte, weil über das, was man da ´angerichtet´ hat‚ gerichtet wird. Das hab' ich mir so zurecht gereimt, vielleicht stimmt's ja sogar. Zu Beginn meiner Kochversuche habe ich mit den gekauften Lebensmitteln Schlimmes angerichtet. Ich kann von Glück sagen, daß mich meine Frau, ob der versalzenen, überwürzten, faden oder schlicht matschigen 'Gerichte', nicht wegen Körperverletzung vor Gericht zitierte.
Zunächst gab's gerade noch eßbares Standardgekochtes; stur nach Rezepten zubereitet, verstanden hatte ich nichts. Allmählich aber wurde das Zeug genießbarer. Learning by doing!
Schon als Kind und Jugendlicher hatte ich eine Vorliebe für Eintöpfe in allen möglichen Variationen. Irgendwann gelangen die Nachkochversuche zunehmend besser. "Was stinkt denn hier so gut?", war das erste Lob meiner Frau nach mehreren Monaten meiner Kochversuche. Zuvor hatte sie schweigend gelöffelt und gelitten.
Schließlich bekam das Kochen einen eigenen, kleinen Stellenwert als entspannende und kreative Freizeitbeschäftigung. Damit stiegen aber auch die Ansprüche. Und sofort häuften sich die Mißerfolge! Woran lag´s?
Dem Naturwissenschaftler und Heimwerker war evident, daß auch in der Küche professionelles Gerät und Kenntnisse über dessen Handhabung und Pflege unverzichtbar sind.
Sein Mangel an trivialsten Kenntnissen dieser Art aber war eklatant. Mit dubiosen Mengenangaben für Gewürze (eine Prise, ein dash) und der für ihn absolut unbrauchbaren Anweisung: "... abschmecken mit ..." begann der Frust – und Ärger.
Was, zum Kuckuck, soll das heißen? Handelt es sich hier um einen Übertragungsfehler? War nicht gemeint, daß man den Finger in die Suppe tauchen und ihn dann "abschlecken" sollte?
Im Ernst: Abschmecken bedeutet, den Löffel ins Gericht zu tauchen und dann von ihm zu kosten. Dann Nachwürzen und wieder kosten. Doch schon beim zweiten Kosten mit demselben Löffel überträgt dies die Mundbakterien des Kochs in das Gericht. Unabhängig vom hygienischen Aspekt reduziert es die Haltbarkeit praktisch auf "sofort verzehren".
In keinem meiner damaligen Kochbücher fand ich darauf einen Hinweis. Angehende Naturwissenschaftler gehören offenbar nicht zur Zielgruppe der Autoren.
Weshalb gerieten mir Spiegeleier manchmal exzellent und dann wieder so schlecht, daß ich sie am liebsten wegschüttet hätte? Weshalb wurden die Braten manchmal würzig, saftig und fest und dann wieder laberig und pappig? Weshalb gelang das Gemüse manchmal knackig und bissig und war dann wieder schlaff und fad?
Nach der Lektüre einer respektablen Sammlung von Kochbüchern (respektabel hinsichtlich der Anzahl, nicht aber der Qualität) wuchs die Erkenntnis, daß sie zur Lösung meiner Küchenprobleme nichts beitrugen.
Besonders ärgerlich fand ich, daß diese Bücher alle möglichen Rezepte unter immer anderen Titeln fast ohne weitergehende Empfehlungen wiederholen.
Die Probe aufs Exempel ist einfach: Angenommen, man verfügt über mehrere Kochbücher. Man suche sich ein möglichst gängiges Gericht heraus und vergleiche die jeweils beschriebenen Rezepte miteinander. Der Unterschied ist meist marginal und beschränkt sich oft nur auf die verwendeten Gewürze. Die Beschreibung der Zubereitungsart ist meist hingeschludert. Frustrierende Ergebnisse sind damit vorprogrammiert.
Worauf ein Laie wirklich achten muß, wird in kaum einem Buch erläutert. Dies gilt nach meiner Erfahrung auch für teure Hochglanz-Ausgaben.
Eine Ausnahme hiervon bilden alte Kochbücher (etwa vom Anfang des 20. Jahrhunderts). Davon besitze ich eins /DAV/ und hatte mit ihm immer wieder Erfolgserlebnisse durch das Befolgen der detaillierten und präzisen Anweisungen. Auch Kochbücher aus der Zeit kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs sind nützliche Ratgeber. Das meiste Andere aber ist, aus meiner Sicht, überwiegend hochstilisierter Nonsens und nicht zu gebrauchen.
Wirklichen Gewinn und Erfolgserlebnisse brachten mir neben den erwähnten Titeln insbesondere die Bücher von Hervé This-(Benckhard), einem französischen Physiko-Chemiker. Er beschreibt verständlich und nachvollziehbar, was Kochen in chemischer oder physikalischer Hinsicht bedeutet /TB1/ und wie man sich dieses Verständnis tagtäglich in der Küche zunutze machen kann /TB2/. This-Benckhard ist ein begnadeter Kommunikator, einer der seltenen Übersetzer und Vermittler von Wissenschaft in tägliches Leben.
Am stärksten geprägt aber wurden meine Vorlieben durch die Ferienaufenthalte in meiner Jugendzeit in Lindow. Was ich dort geschmeckt, gesehen, erlebt und gelernt habe, sind dauerhafte Eindrücke. Der Kontrast zwischen Dorf und Großstadt war, rückblickend gewertet, ein unschätzbarer Gewinn für mich - für das Sonntagskind.
Eigentlich wollte ich nur ein paar Ratschläge für meinen Sohn aufschreiben, der seine erste eigene Wohnung bezog und die Küche mangels Eigenbedarf am besten untervermietet hätte. Was aus diesen paar Ratschlägen geworden ist, liegt vor Ihnen.
WERKZEUGE UND LEBENSMITTEL-VORRÄTE
Was sollte man wissen, wenn man alltägliche Gerichte schmackhaft zubereiten will?
Geeignetes Handwerkszeug sollte man haben und es zu nutzen wissen. Dessen (evtl. teure) Anschaffung ist allerdings erst dann sinnvoll, wenn man sich sicher ist, daß Kochen zum Hobby geworden ist. Gutes Werkzeug ist grundsätzlich unabhängig von seinem Verwendungsbereich, aber immer die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Arbeiten.
Elementare Grundkenntnisse darüber, was in Topf oder Pfanne geschieht und wie sich Lebensmittel bei ihrer Zubereitung verhalten bzw. verändern, sind vonnöten. Die findet man problemlos im Internet oder bekommt sie auf YouTube vorgeführt; ein spezielles Buch ist unnötig.
Ist das Kochen aber erst zum Vergnügen geworden, freut man sich über Gleichgesinnte. Wie ich mich über Sie. Oder weswegen haben Sie dieses Buch sonst gekauft?
Auch Kochen ist zunächst Handwerk. Wer selten kocht, braucht, um gut und schmackhaft zu kochen und zu braten, kein teures Gerät, es reicht das Billig-Produkt aus dem Warenhaus. Allerdings verlangen solche Produkte hohe Aufmerksamkeit und ständige Präsenz in der Küche, denn auf Überschreitung ihrer engen Gebrauchs-Grenzwerte reagieren sie sehr unangenehm. Dem gegenüber verhalten sich professionelle Geräte wesentlich fehlertoleranter.
Nach vielen Fehlern und unnötigen Ausgaben hatte auch ich begriffen: Handwerk mit qualitativ minderwertigem Werkzeug ist meist frustrierende Plackerei. Mit hochwertigem Gerät dagegen kann es ein wahres Vergnügen sein. Geht dennoch ein Gericht daneben, weiß man wenigstens, woran es nicht lag.
Herd
Zum Kochen braucht’s viel Wärme, Hitze genannt. Ob die Hitze vor zehntausend Jahren vom zufällig durch einen Blitz entzündetem Holz geliefert wurde, oder heute durch das Einschalten des Herdes oder der Mikrowelle, macht hinsichtlich der Garung der verzehrbaren Rohstoffe keinen Unterschied.
Auch heute noch gibt es vielfältige Varianten von Hitzequellen für das Kochen: Lagerfeuer und Holzkohlegrill im sozialen Spaßbereich und Gas- bzw. Elektroherde unterschiedlichster Technik im Alltag. Nicht zu vergessen auch die oft geschmähte und vielfach unterschätzte Mikrowelle.
Profis kochen auf Gas. Ich hatte nie einen Gasherd, sondern immer Elektroherde: zuerst einen mit den üblichen Kochplatten, dann einen mit CERAN-Feldern. Auf diesen Herden habe ich meine Erfahrungen gesammelt. Eine dieser Erfahrungen ist, daß man auf einem CERAN-Feld die Töpfe niemals verschieben darf, sondern sie umsetzen muß. Das hatte mir niemand gesagt und dementsprechend sieht das Kochfeld heute aus. Nicht nur deswegen habe ich einen Wechsel geplant, den zum induktiven Heizen.
Messer
Messer (germ.: matizsaha - im Stein versteckt; steinzeitlicher Ursprung) in hochwertiger Qualität sind in der Küche unverzichtbar. Klinge und Griff sollten aus besten Materialien gefertigt, handgerecht geformt und von schwerer Qualität sein. Messer verdienen ihren Namen nur, wenn sie „rattenscharf“ sind. Mein Bestand:
1 Haushaltsmesser, 1 Brotmesser, 3 Buckelsmesser
1 Messer zum Entbeinen mit schmaler Klinge
1 Messer mit zur Spitze hochgerundeter Klinge für die Zubereitung von Kleingeschnittenem
1 Geflügelschere
Ein Tipp, der sich auszahlt: hochwertige Messer sollten mit Respekt behandelt werden. Hat man auf einem Holz- oder Kunststoffbrett etwas kleingeschnitten, streift man es fast unweigerlich mit der Messerklinge nach unten vom Brett in den Topf. Das tut der "rattenscharfen" Schneide gar nicht gut! Besser ist es, das Kleingeschnittene mit dem Messerrücken vom Brett zu streifen. Dasselbe gilt auch für das Schaben von z.B. Mohrrüben!
Pfannen und Töpfe
Über die besten Materialien für Töpfe und Pfannen (griech.: patana - flache Schüssel) läßt sich lange philosophieren. Für mich hat sich die schwere Qualität aus modernem Gußeisen (STAUB, LE CREUSET) als die beste erwiesen. Sie hat den Vorteil einer fast gleichmäßigen Wärmeverteilung über den Boden und die Wand des Gefäßes und ist durch die, aufgrund ihres Gewichtes vergleichsweise fest schließenden Deckel für ‚sanfteres‘ Kochen und Schmoren optimal geeignet. Da auch die Griffe aus Eisen sind, kann man die Behältnisse bei Bedarf auch in den Backofen geben. Ein kleiner Nachteil ist allerdings, daß man immer Topflappen bereit halten muß.
Mein Bestand:
1 großer ovaler Bräter mit Deckel (Längsachse 40 cm) aus Gußeisen
1 mittlerer Topf aus Gußeisen (20 cm)
1 Kasserolle aus Edelstahl (15 cm)
1 große, hohe Pfanne mit Deckel (30 cm) aus Gußeisen
1 große, flache Pfanne (30 cm) aus Gußeisen
1 kleine Pfanne (15 cm) aus Gußeisen
Hilfsgeräte
Küchenwaage, Erlenmeyerkolben 250 ml
Kartoffelschäler, Spargelschäler, Kernausstecher (Äpfel)
Schneckenzange
stabile Knoblauchpresse (Puristen werden Knoblauch nie zerquetschen, sondern ihn fein hacken)
breiter Holzspatel
Pfeffer- und Salzmühlen (die massiven Geräte von PEUGEOT sind eine lohnenswerte Anschaffung für Generationen)
eine scharfe Reibe
Lebensmittel-Vorräte
Jetzt wird’s prinzipiell. Meine Vorräte sind absolut unideologisch zusammengestellt. Für Prepper wie auch jeden anderen Fundamental-Pessimisten ist das Folgende irrelevant. Bei jeder Art von Endzeit-Szenario wären Vorräte ein ohnehin nur geringfügiger Zeitgewinn.
Woher soll ich heute wissen, worauf ich übermorgen Appetit habe? Eben! Ungeduld ist die Schwester der Kreativität. Und ohnehin ist gerade Sonntag und alle Geschäfte sind geschlossen. Was also ist im Kühlschrank und in den Schränken zu finden?
frisch:
Kartoffeln
Zwiebeln
Tomaten
Sellerie (Knolle oder Staude)
Porree
Milch, Eier
Fette und Öle (haltbar 1-2 Monate)
Butter
Butterschmalz
Olivenöl extra vergine
Traubenkernöl
Essig
Weinessig (Aceto balsamico tradizionale)
trocken
Pasta verschiedenster Art
Langkornreis (Basmati)
Bohnen, weiß
Linsen
getrocknete Pilze (Pfifferlinge, Steinpilze, chinesische Pilze)
Gewürze
Konserven
Tomaten in Püree
Tomatenmark in der Tube (dreifach konzentriert)
Champignons, Mohrrüben
Erbsen, grüne Bohnen
Rosenkohl, Rotkohl
Sauerkraut
Meerrettich in der Tube
Fonds
Fisch, Rind, Wild, Lamm, Gemüse, Geflügel
tiefgekühlt
Rind-, Lamm- und Geflügelfilet
Gehacktes vom Rind
Fischfilets, Shrimps, Meeresfrüchte
magerer und durchwachsener Speck (geräuchert und frisch)
TISCHGEBRÄUCHE
Menschen sind soziale Wesen. Für ihre Entwicklung zu Gemeinschaften waren die Entwicklung und Beachtung von Regeln Voraussetzung. Deren wichtigste ist die der Rücksichtnahme auf den Nachbarn. Vernunft, gesunder Menschenverstand und Empathie sind dafür völlig ausreichend. Diese Grundwahrheit ist jedem Kind erklär- und vermittelbar. Als Nebeneffekt ergeben sich aus ihr fast alle vernünftigen Tischgebräuche oder, allgemeiner, die des „guten Benehmens“.
Es gibt eine Unzahl von Regeln. Für fast alle gab es zur Zeit ihrer Entstehung vernünftige, d.h. nachvollziehbare Begründungen. Ob diese aber heute noch stichhaltig sind, sollte man jeweils prüfen.
So sind z.B. Besteckregeln aufgrund von Materialeigenschaften heute nicht mehr relevant. Modeerscheinungen, deren Beachtung schon immer fragwürdig war, sind längst sinnentleert. Ihre Beachtung (z.B. Serviette niemals im Kragen) grenzt in unserer Zeit an Dummheit.
Eine Regel, deren Sinn nicht offensichtlich und nachvollziehbar ist, braucht nicht beachtet zu werden.
Dennoch gibt es ein paar einfache Grundsätze, deren Beachtung unser Miteinander freundlicher machen kann.
Große Tafel
Links und rechts Nachbarn, sehr nahe. Jetzt gilt es, die Ellenbogen bei sich zu behalten. Um dies zu lernen, klemmte mir meine Mutter links und rechts je ein Buch unter die Achseln und ließ mich dann mit Messer und Gabel essen. Fiel das Buch herunter, lachte sie: „Siehste?!“
Bemerkens- und beachtenswert
Was man selbst als abstoßend empfindet, sollte man auch anderen nicht zumuten: Schlürfen, Schmatzen, Rülpsen und Furzen wird in unseren Breiten allgemein nicht als Höflichkeitsbezeigung, sondern als eklig empfunden (in anderen Ländern kann das aber ganz anders bewertet werden).
Fleischfasern zwischen den Zähnen sind ungemein störend. Aber mit dem Zahnstocher hinter ‚dezent‘ vorgehaltener Hand zu operieren, mit der Zunge zu zutzeln oder gar mit dem Finger im halb offenen Mund zu puhlen, sind allesamt Belästigungen der zwangsläufig zuschauen müssenden Mitmenschen am Tisch. Ein Gang in den Waschraum wäre hier angemessen.
Mit vollem Mund spricht man nicht! Noch heute habe ich diesen Satz meiner Mutter im Ohr. Sie hatte recht. Kauend, dabei mit zwangsläufig geöffnetem Mund weitersprechend, demonstriert der Mensch eindrucksvoll die erste Phase seines Verdauungsprozesses. Der Brei der zerkauten Speise wird gut sichtbar für den Zuhörer von der Zunge hin und her gedrückt, je nachdem, welcher Vokal oder Konsonant zu betonen ist. Dabei werden zur Unterstützung des manchmal kaum Verständlichen Gabel und Messer deutend und gestikulierend gegen den Zuhörenden gestoßen, der sich vergebens bemüht, diesem wenig appetitlichen Anblick zu entgehen.
Zu viel gegessen? Gürtel zu eng? Den Gürtel am Tisch zu öffnen gelingt, anders als man meint, kaum jemals unauffällig. Diese Unsitte ist ähnlich der, im Strand-Restaurant die Suppe 'oben ohne' zu löffeln. Sollte ich diesen Anblick jetzt altersund/oder geschlechtsspezifisch ausmalen?
Ob man immer beide Hände auf dem Tisch halten soll, ist abhängig davon, in welchem Kulturkreis man sich befindet. In Zeiten ohne aus der Wand fließenden Wassers versuchte man, eine Hand sauber zu halten; schließlich aß man meist noch ohne Besteck. Die unreine Hand hielt man unter dem Tisch, um nicht versehentlich mit ihr das Brot anzufassen. Fremde Länder, fremde Sitten. Sich vorher zu informieren, erspart Peinlichkeiten.
Das Zerteilen eines Fisches endet leider oft in schlimmem Gemansche. Dabei ist es sehr einfach, einen Fisch zu filetieren. Man muß nur ein einziges Mal jemandem, der es kann, aufmerksam zusehen. Das dauert nicht länger als 2 Minuten. Dieser Jemand findet sich immer.
Geflügelknochen darf man in die Hand nehmen. Weshalb nur sie, habe ich noch nicht rausgekriegt. Bis auf weiteres nehme ich also auch Kotelett-Knochen in die Hand.
Minimalismus-Prinzip: Falls man ein Gericht auch ohne Messer essen kann, sollte man auch keins benutzen.
Spaghetti werden am Tellerrand mit der Gabel aufgedreht und in Gabelportionen gegessen. Einen Löffel braucht man dazu nicht. Vernehmliches Reinschlürfen kommt nicht gut an.
Unwichtig, aber gut zu Wissen
Die in Deutschland übliche Speisenfolge ist Suppe, Hauptgericht, Salat/ Dessert. Wie vieles in unserem Leben, ist auch dies heute nicht mehr sachlich begründbar. Die Suppe vor der eigentlichen Mahlzeit zu nehmen, wurde als typisch deutsche Sitte (alla tedesca), schon in venezianischen Kochbüchern des 16. Jahrhunderts als Besonderheit verzeichnet. In China dagegen schließt die Suppe die Tafel ab.
In Frankreich wird, anders als in Deutschland, der Salat als erster Gang serviert. Eine Sitte, die mir einleuchtet und sehr sympathisch ist. Der Salat dämpft die "Gefräßigkeit" und führt unauffällig zu vernünftigem Mengenkonsum.
Ob man sich vor dem Schluck aus dem Weinglas mit der Serviette den fetten Bratensaft von den Lippen wischt, ist nicht nur eine Frage der Ästhetik (Fettrand am Glas) sondern auch eine Frage des Geschmacks am Wein.
Mit heutigem Besteck, überwiegend aus Edelstahl, haben alle Regeln, die sich auf die Verwendung bestimmter Besteck-Materialien beziehen, ihren Sinn verloren. Wer allerdings seine Frühstückseier mit einem versilberten Löffel zu essen versucht, wird diesen Versuch sehr rasch bereuen. Die Chemie kennt keine Mode und Schwefelwasserstoff stinkt und schmeckt widerlich.
Servietten darf man sich nicht in den Kragen stecken: Früher trug der Mann von Stand ein kunstvoll gefältelt-aufgebauschtes Jabot, eine Serviette hätte das Jabot plattgedrückt. Heute gibt‘s keine Jabots mehr und Spaghetti Bolognese zu essen ist (nach eigenen, zigfachen Erfahrungen) deutlich folgenärmer, wenn man sich die Serviette in den Kragen steckt.
Wer's mag oder nicht lassen kann, soll ruhig den kleinen Finger von der Tasse abspreizen. „Boofkes“ nannte meine Mutter diese „Spreizmenschen“. Aber was soll’s? Jedem Tierchen sein Plaisirchen.
Suppenteller darf man nicht kippen. Wieso eigentlich nicht? Ich tu´s jedenfalls; es müssen ja nicht gleich 45° sein. Eine gute Freundin hat mir geraten, den Teller nach vorn zu kippen. Welch' ein kluger Ratschlag!
Fingerschalen (gibt’s heute nur noch selten) aus Glas, Porzellan oder Silber werden gereicht, wenn man Speisen bestellt, die man mit den Fingern ißt, zum Beispiel Krebse, Austern oder Artischocken. Sie werden mit dem entsprechenden Gang serviert und stehen links vom Platzteller. Die Schalen enthalten lauwarmes Wasser, meist mit einer Zitronenscheibe oder einem Minzenblatt dekoriert.
Regeln; nicht selbsterklärend
Die Serviette wird vor dem Essen einmal zu einem Rechteck gefaltet und auf den Schoß gelegt, jedoch erst dann, wenn der Gastgeber nach seiner Serviette greift und damit das Essen eröffnet. Sie dient in erster Linie dazu, sich vor dem Trinken die Lippen abzutupfen, um Speise- und Fettränder an den Gläsern zu vermeiden. Auch zum Abwischen des Mundes während des Essens benutzt man die obenliegende Hälfte der Serviette und legt sie anschließend wieder auf den Schoß. Die unten liegende Hälfte der Serviette bleibt damit zum Schutz der Kleidung sauber.
Nach der Mahlzeit wird die Serviette entgegen ihrem Originalkniff gefaltet, um die Flecken nach innen zu verdecken, und links neben dem Teller abgelegt. Papierservietten kann man auch auf den leeren Teller legen, aber nicht zusammengeknüllt in die Speisereste.
Welches Glas paßt zu welchem Getränk? Die Antwort auf diese Frage treibt im Wesentlichen die Hersteller von Trinkgläsern um. Es gibt Gläser, aus denen man alles trinken kann und aus denen auch alles schmeckt. Pappbecher allerdings gehören zu den dümmsten Produkten unserer Zeit. Aus ihnen kann man alles trinken und alles schmeckt gleich schlecht. Für Plastikbecher gilt dasselbe, aber zusätzlich sind sie noch extreme Umwelt-Schädlinge. Zum Überleben ist es einfacher, direkt aus der Flasche zu trinken.
Eßtisch
Das Besteck sollte groß und schwer sein; nur so liegt es gut in der Hand und läßt sich auch bequem benutzen.
Bestecke werden von außen nach innen in der Reihenfolge der Gänge gelegt (keine „Querlöffel“; z.B. für Dessert). Die Gabeln mit den Zinkenspitzen nach unten zu legen, ist aus hygienischen Gründen sinnvoll.
Selbstverständlich darf man mit unterschiedlichem Geschirr eindecken (z.B. falls das vorhandene Service nicht für alle Gäste reicht). Nicht die Teller sind wichtig, sondern das, was sie tragen.
Es gibt eine Bestecksprache. Demnach bedeutet ein mit den Spitzen gekreuztes Besteck, daß der Gast noch nicht fertig ist oder gerne noch einen Nachschlag hätte. Liegen Messer und Gabel parallel nebeneinander (die Schneide des Messers zur Gabel), so bedeutet dies, daß das Essen beendet ist. Gekreuzt bedeutet, daß man nur eine Pause einlegt.
Soll man das kalte Abendbrot mit Messer und Gabel essen oder darf man es in die Hand nehmen? Messer und Gabel find' ich bequemer. Schon mal mit dem Schinken gekämpft und dabei die ganze Scheibe auf einmal verschlungen?
Mit den Händen darf (soll) man essen:
Geflügel
Brot brechen und Brot als „Schieberchen"
Krebse, Hummer
Artischocken
„Would you like some salt?“ Als ich diese Frage in einem Restaurant in Dover zum erstenmal hörte, antwortete ich höflich: "No, thank you." Weshalb sich der Fragende daraufhin kopfschüttelnd abwandte, war mir unerklärlich. Die Frage war keine Frage, sondern die Bitte um das Zureichen des Salzstreuers. Der folgt man wortlos. Fremde Länder, fremde Sitten.
Man beginnt zu essen, wenn die Hausfrau beginnt. Damit aufhören sollte man, wenn es der Hausherr tut. Ein höflicher Gastgeber wird also immer als letzter fertig. Heute scheint mir diese Regel nicht mehr angemessen, doch würde ich nicht noch lange weiteressen, nachdem der letzte Tischgenosse sein Besteck parallel legt.
Getränke
Zum ersten Schluck fordert immer derjenige auf, der eingeladen hat. Das Glas sollte stets am Stiel gehalten werden. Es klingt beim Anstoßen besser und man vermeidet unerwünschtes Erwärmen des Getränks durch die Handwärme.
Beim Anstoßen sollte man sich in die Augen sehen. Weshalb? Keine Ahnung, aber ich habe diesen Brauch (fast) immer als angenehm empfunden.
Aperitifs, wie Portwein oder Sherry, werden als appetitanregende Getränke gereicht. Hat das Essen begonnen, werden sie nicht mehr getrunken.
Wird die Weinsorte gewechselt, sollte man vom vorher servierten Wein nicht mehr trinken. Wenn das Glas noch gefüllt ist, kann man es einfach stehen lassen. Allerdings wird es jeder Gastgeber respektieren, wenn man lieber bei einer Sorte bleiben will.
Und was sagte Aristoteles?
"Biertrinker kippen nur nach hinten. Weintrinker nach allen Seiten".
Schließlich noch eine elementare Erfahrung, vielfach bewährt: Man geht in ein unbekanntes Restaurant, um zu essen. Bevor man die Karte studiert, sollte man die Toilette aufsuchen. Toiletten sind viel einfacher hygienisch sauberzuhalten als Küchen. Wenn also schon die Toilette nicht makellos sauber ist, wie mag's dann erst in der Küche aussehen? Die Seife zum Händewaschen sollte geruchlos sein! Weshalb? Man wasche sich die Hände mit Kernseife und esse dann, zum Beispiel, Spargel!
Die obige Schlußfolgerung ist natürlich nicht umkehrbar:
Selbst wenn die Toilette vor Sauberkeit blinkt und die Seife absolut geruchlos ist, kann die Küche dennoch ein Saustall sein. Umgedreht aber ist sie es mit Sicherheit.
EINFACH, SCHNELL UND MÖGLICHST BILLIG
In der Zeit zwischen Schule und Beruf waren dies die einzigen Kriterien, die zählten.
Bei den meisten Gerichten waren Eier die Hauptzutat. Eier mochte ich schon als Kind und bei schmalem Etat belasten sie auch das Portemonnaie des Erwachsenen nicht sehr. Als Kinder klopften wir zu Ostern unsere hartgekochten Eier aneinander. Wessen Ei heil blieb, der bekam das angeknackste Ei des Gegners. „Eier picken“ hieß das. In diesem Spiel war ich wirklich gut! Mindestens zehn hartgekochte Eier konnte ich an einem Tag verdrücken, ohne daß mir schlecht wurde. Meine Oma hielt das für ein mittleres Wunder.
Später variierte ich immerhin zwischen gerührten oder 'gespiegelten' Eiern. Alle kamen in die Pfanne, in zerlassene Margarine, wurden gesalzen und gepfeffert.
Eier-Tips
Falls man unterscheiden muß zwischen rohen und gekochten Eiern, läßt man das fragliche Ei auf der Tischplatte kreisen. Dreht es sich ruhig um die eigene Achse, ist es gekocht. Wackelt und kreist es schlecht, ist es noch roh.
Das gekochte Ei ist eine kompakte Einheit. Das rohe Ei dagegen besteht aus seiner Schale und dem flüssigen Inneren. Beim Drehen wird die Schale unmittelbar beschleunigt, während das Innere, dem Trägheitsgesetz folgend, zunächst ruhend verbleibt. Erst durch nach und nach übertragene Reibungskräfte wird auch das Ei-Innere in Bewegung versetzt.
Angeknackste Eier kochen? Kein Problem, wenn man etwas Essig in das Kochwasser gibt. Das verhindert das Auslaufen des Eiweiß'.
Brät man ein Spiegelei, wird der dünne Rand oft schon schwarz, während es rund um den Dotter noch ‚glibberig‘ ist. Die Kochchemie verrät uns, daß das Eiklar bei niedrigeren Temperaturen rascher gart, wenn man es salzt. Salzt man also gezielt so nah wie möglich am Dotter, bekommt man ein gleichmäßig gebratenes Ei. Vor dem Kochen sollte man Eier am stumpfen Ende anstechen, dann platzen sie beim Kochen nicht.
Eier hartkochen: Angestochene Eier in einen Topf mit kaltem Wasser legen. Aufkochen lassen. Die Kochzeit sollte 10 min nicht überschreiten, um die Bildung von schwefligen Verbindungen (z.B. H2S) zu vermeiden. Dann 15 min zugedeckt stehen lassen.
Geröstetes Brot
Leerer Magen aber keine Zeit und auf dicke Stulle keinen Bock? Etwas zu essen wär‘ aber schon gut? Kein Problem. Es ist alles nur geklaut …! Bruschetta oder Crostini heißt‘s in den Rezepten. Wichtig ist aber nur das Prinzip.
Zutaten:
Brot, Schrippen, Baguette, ganz egal
Olivenöl bester Qualität
Tomaten, gehackt (Dose)
Basilikum (trocken ist gut, frisch und gehackt besser)
Knoblauch (s. Seite 117)
Zubereitung:
Backware in daumendicke Scheiben schneiden.
Tomaten in Sieb geben (Saft aufheben)
Tomatenstücke mit Knoblauch und Basilikum vermengen
Olivenöl in der Pfanne erhitzen (Herd 50 %)
Backscheiben in die Pfanne legen und von beiden Seiten hellbraun anrösten. Scheiben herausnehmen und mit Tomaten belegen.
Rührei/Omelett mit Tomaten
Rührei:
Butter in die heiße Pfanne, die Eier reinhauen und mit der Gabel kräftig rühren; heißt ja schließlich Rührei! Oder?
Omelett:
Die Eier nur zermanschen und dann ohne zu rühren stocken lassen.
Ode möchte man etwas Besseres als Eiergemansche essen? Dann muß man sich schon etwas Mühe geben.
Zubehör für beide: große Pfanne, Holzspatel
Zutaten
für beide Zubereitungsarten
2
Tomaten (groß)
2
Frühlingszwiebeln (Schalotte)
½
Bund glatte Petersilie
6
Eier (groß)
1 El
Butter, gesalzen
2 El
Sonnenblumenöl
½ Tl
Pfeffer
Tabasco und Worchestersauce nach Geschmack
Vorbereitung für beide:
Eier: Eine Untertasse o.ä. bereitstellen. Die Eier mit einem Messer sanft, aber nachdrücklich anschlagen. Die Eier senkrecht über die Untertasse halten und die Hälften voneinander trennen. Ein Teil des Eiweiß' läuft auf die Untertasse. Durch wiederholtes Wechseln des Dotters von der einen in die andere Schalenhälfte trennt man alles Eiweiß von Dotter. Die einzige kleine Schwierigkeit besteht darin, den Dotter unverletzt zu halten. Das ist viel einfacher, als es sich hier liest.
Das Eiweiß salzen und mit einer Gabel verquirlen. Das Eigelb mit Öl und wenigen Spritzern Tabasco und Worchestersauce vermengen (zu teuer? Geht auch mit Salz und Pfeffer). Die beiden Ei-Fraktionen zusammenmischen.
Tomatenschale kreuzweise dünn einschneiden und die Tomaten ca. 30 sec in kochendem Wasser blanchieren. Haut abziehen, entkernen und kleinschneiden. Frühlingzwiebeln in dünne Scheiben schneiden, Petersilie kleinhacken.
Rührei: 1 Eßlöffel Butter in der Pfanne bei Stufe 50% erhitzen. Eine kleingeschnittene Frühlingszwiebel zugeben und in ca. 2 Minuten bei offenem Deckel dünsten. Tomaten dazugeben, kurz mitdünsten. Auf 25% herunterschalten. Die restlichen Frühlingszwiebeln, die Petersilie und die Eimasse zugeben. Die sich verfestigende Masse mit dem Holzspatel flächendeckend vom Pfannenboden abheben und ständig wenden.
Wenn die Masse eben noch ‚feucht glänzt‘, Pfanne vom Herd nehmen. Mit Salz und frisch gemahlenem weißen Pfeffer würzen und servieren.
Omelett: