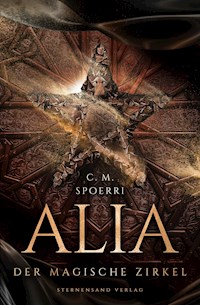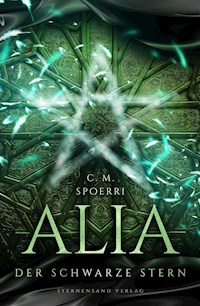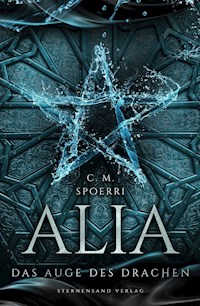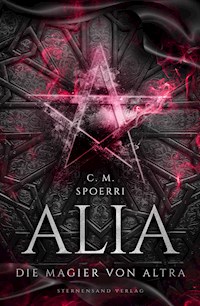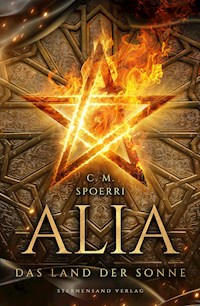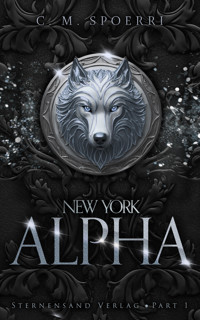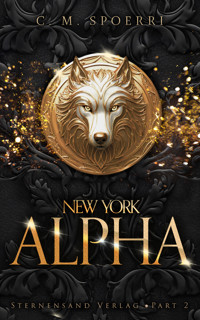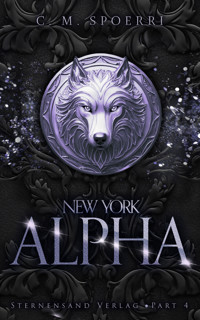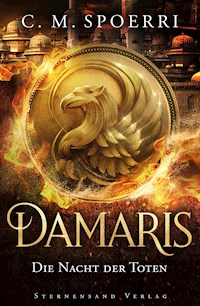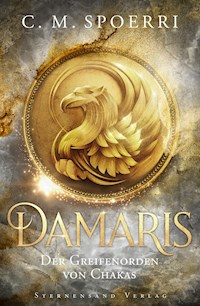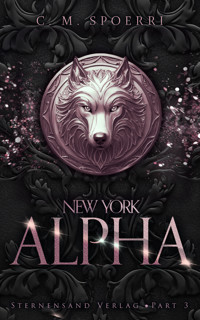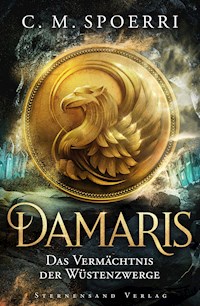Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Angel
- Sprache: Deutsch
Als Angel de Flores eine Kreuzfahrt im Mittelmeer bucht, will er nur eines: Frieden mit seinen inneren Dämonen schließen und damit die traumatischen Bilder jenes Tages loswerden, der seinem Leben als Navy SEAL ein brutales Ende setzte. Doch schon am ersten Tag an Bord begegnet er dem jungen Kunsthändler Hannes Schmidt, der ebenfalls aus New York stammt und mit seiner Chefin Kate durch Europa reist. Der blonde Sonnenschein droht mit seiner fröhlichen Art Angels Dasein als einsamer Wolf ein Ende zu bereiten. Obwohl der Ex-Soldat keinen Kopf für eine neue Liebe hat und ihn Hannes' Annäherungsversuche nerven, muss er sich eingestehen, dass der quirlige Mitpassagier ihn nicht so kaltlässt, wie er es gerne hätte. Aber reicht die Sonne Griechenlands aus, um die Dunkelheit einer gequälten Seele zu durchdringen? Und kann man wirklich ein normales Leben – oder gar eine Beziehung – führen, wenn der Alltag aus Abgründen besteht, in die man jederzeit fallen könnte?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Übersicht
Kapitel 1 - Einundzwanzig, zweiundzwanzig
Kapitel 2 - Me estás tocando los cojones
Kapitel 3 - Ich sag’s dir noch ein Mal, chico
Kapitel 4 - Das war knapp
Kapitel 5 - Wir sind quitt
Kapitel 6 - Babysitter
Kapitel 7 - Hach, wär das doch ein Disneyfilm …
Kapitel 8 - Wenn Athena Aphrodite spielt
Kapitel 9 - Shit! Shit! Shit!
Kapitel 10 - Ein Engel für Charlie
Kapitel 11 - De puta madre …
Kapitel 12 - Wir sind verlobt!
Kapitel 13 - Schnurrender Panther
Kapitel 14 - Wir müssen reden
Kapitel 15 - Wenn Achilleus schwul wäre
Kapitel 16 - Schwarz steht dir
Kapitel 17 - Wir lieben Schlager!
Kapitel 18 - Dirty Talk à la Hannes
Kapitel 19 - Wie du befiehlst, mein schöner Engel
Kapitel 20 - Was zum Teufel sind Klöße?
Kapitel 21 - Ich bin nicht sauer!
Kapitel 22 - Fliegende Kühe und seufzende Brücken
Kapitel 23 - Venedig by night
Kapitel 24 - Wenn Träume wahr werden
Kapitel 25 - Nicht stark genug
Kapitel 26 - Besuch aus London
Kapitel 27 - ¿Estás bien?
Kapitel 28 - Adiós
Kapitel 29 - Ready to party!
Kapitel 30 - Chiquitita
Kapitel 31 - Was wäre gewesen, wenn …
Kapitel 32 - Wenn Stalker gestalkt werden
Kapitel 33 - Die unverblümte Wahrheit
Kapitel 34 - Rendezvous mit einem Engel
Kapitel 35 - Sissi
Kapitel 36 - Neujahrsvorsätze
Kapitel 37 - Ven conmigo
Kapitel 38 - Überzeugende Argumente
Kapitel 39 - Feliz año nuevo
Epilog - Zwei, die gleich f… äh ticken
Nachwort und Dankefein der Autorin
Dreingabe (… und drauf auch ;-) )
C. M. Spoerri
Angel
Dein Weg zu mir
Gay Romance
Angel: Dein Weg zu mir
Als Angel de Flores eine Kreuzfahrt im Mittelmeer bucht, will er nur eines: Frieden mit seinen inneren Dämonen schließen und damit die traumatischen Bilder jenes Tages loswerden, der seinem Leben als Navy SEAL ein brutales Ende setzte. Doch schon am ersten Tag an Bord begegnet er dem jungen Kunsthändler Hannes Schmidt, der ebenfalls aus New York stammt und mit seiner Chefin Kate durch Europa reist. Der blonde Sonnenschein droht mit seiner fröhlichen Art Angels Dasein als einsamer Wolf ein Ende zu bereiten. Obwohl der Ex-Soldat keinen Kopf für eine neue Liebe hat und ihn Hannes' Annäherungsversuche nerven, muss er sich eingestehen, dass der quirlige Mitpassagier ihn nicht so kaltlässt, wie er es gerne hätte. Aber reicht die Sonne Griechenlands aus, um die Dunkelheit einer gequälten Seele zu durchdringen? Und kann man wirklich ein normales Leben – oder gar eine Beziehung – führen, wenn der Alltag aus Abgründen besteht, in die man jederzeit fallen könnte?
Die Autorin
C. M. Spoerri wurde 1983 geboren und lebt in der Schweiz. Sie studierte Psychologie und promovierte im Frühling 2013 in Klinischer Psychologie und Psychotherapie. Seit Ende 2014 hat sie sich jedoch voll und ganz dem Schreiben gewidmet. Ihre Fantasy-Jugendromane (›Alia-Saga‹, ›Greifen-Saga‹) wurden bereits tausendfach verkauft, zudem schreibt sie erfolgreich Liebesromane. Im Herbst 2015 gründete sie mit ihrem Mann den Sternensand Verlag.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, April 2021
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2021
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Natalie Röllig
Korrektorat zwei: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick
Sensitivity Reading: Lektorat Laaksonen | Stefan Wilhelms
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-187-1
ISBN (epub): 978-3-03896-188-8
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Pierre
und alle, die ›on fleek‹ sind:
Bleibt euch treu.
Ihr könnt Außergewöhnliches bewirken,
denn euer Strahlen bringt die Welt zum Leuchten.
Herzlich willkommen auf der Reise Ihres Lebens,
Angel de Flores!
Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren
Aufenthalt und unvergessliche Erinnerungen!
Ihr Kapitän und die Crew
Ihre Kreuzfahrt im Überblick:
Kapitel 1 - Einundzwanzig, zweiundzwanzig
Angel
Das Erwachen aus einem Albtraum war jedes Mal das Schlimmste. Nicht nur wegen der Bilder, die in mir nachhallten – es zeigte mir gleichzeitig auf, wie verloren ich war. Wie hilflos. Den verfickten Erinnerungen ausgeliefert, die ich nicht mehr verändern konnte.
Und dennoch waren die Gefühle genau gleich wie an jenem Tag, der sich in mein Leben gebohrt hatte wie ein Granatsplitter in schutzloses Fleisch.
Ich schaltete das Licht an und brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass ich mich nicht zu Hause in meinem New Yorker Apartment, sondern auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer befand. Der Jetlag machte mir zu schaffen, aber das war nicht der Grund, warum ich kaum geschlafen hatte.
Schwer atmend lag ich auf dem Bett in meiner Kabine und verfluchte wieder einmal Gott und die Welt.
Nun ja, vor allem die Welt, denn einen Gott gab es definitiv nicht, das hatte ich im Krieg oft genug erlebt. Gäbe es einen Gott, wäre ich jetzt tot und hätte nicht so viel Leid über Menschen gebracht, die ich noch nicht einmal kannte.
›Todesengel‹ hatten sie mich in meiner Einheit genannt … ja, das war ich auch. Ich hatte so oft getötet. Unzählige Male. Männer, Frauen, Kinder … Ihre Blicke, ehe ich ihnen mit ihrem Leben das Letzte nahm, was sie noch besaßen, verfolgten mich fast genauso in meinen Albträumen wie jener verhängnisvolle Tag vor einem dreiviertel Jahr, der meinem Leben als Navy SEAL ein abruptes Ende setzte.
Aber im Krieg hieß es: entweder sie oder du … da machte es keinen Unterschied, wer mit einer Waffe in der Hand auf einen zulief. Es gab nur Schwarz und Weiß – Verbündete und Gegner. Freunde, denen man Deckung gab, Feinde, die niedergeschossen werden mussten. Selbst wenn der Feind vor einigen Stunden noch mit einem Teddy im Arm geschlafen hatte.
Genau diese gottlose Welt hasste und verfluchte ich.
Ein Teil von mir war viel zu lange ein Stück davon gewesen und daran elendiglich krepiert. Verreckt wie ein Regenwurm in der Sonne. Der andere Teil hatte den Krieg mit nach Hause gebracht. Mit einem Regiment an Dämonen, die mich nicht mehr losließen.
Ich bemühte mich täglich, zu vergessen, zu verarbeiten und irgendwie zu begreifen, wie tief ein Mensch sinken konnte. Was man alles tat, nur weil es irgendwo auf einem Papier stand und jemand den Befehl gab, die Worte zu befolgen.
»¡Mierda!«, fluchte ich in meiner Muttersprache Spanisch, ballte die Hand zur Faust und schlug damit auf die Bettdecke, die ein hässliches Blumenmuster aufwies. »Scheiße!«
Doch die Stimmen verbannte ich damit nicht aus meinem Kopf. Den Nachhall des Albtraums.
›Angel! Renn!‹
»¡Vete!«, zischte ich den Dämon zwischen zusammengepressten Zähnen an, der mich gerade mit den Worten meines toten Kameraden heimsuchte. »Verschwinde, lass mich in Ruhe.«
Ich kniff die Augen so fest zusammen, dass es fast schon wehtat. Aber der Dämon war lauter als ich.
›Bring dich in Sicherheit, verdammt!‹
»No«, flüsterte ich in die Stille meiner Schiffskabine.
Damals hatte ich das Wort geschrien. Jetzt … ich hatte kaum noch Kraft, es zu hauchen.
Der Film lief weiter vor meinem inneren Auge ab. Ich sah meinen besten Freund, wie er auf dem verstaubten Boden lag, hilflos dem Scharfschützen ausgeliefert, der irgendwo zwischen den Ruinen eines zerbombten Hauses hockte. Rick war angeschossen worden, konnte sich nicht aus eigenen Kräften aus der Gefahrenzone bringen.
Ich beobachtete mich selbst, wie ich zu ihm rannte, versuchte, ihm auf die Beine zu helfen.
Und dann …
Mein Körper zuckte zusammen, als würde ich erneut von der Kugel getroffen. Ich stöhnte, presste mir die Faust auf den Mund und riss die Augen auf.
Wie von selbst tastete meine andere Hand nach meinem rechten Knie, das damals zertrümmert worden war.
Por todos los demonios …
Ich verfluchte den Typen, den ich nie gesehen hatte. Aber in meinen Albträumen besaß er immer ein Gesicht. Manchmal war es ein Mann, manchmal eine Frau, ab und an sogar ein Kind. Und immer hatte der Schütze dieses diabolische Lächeln auf den Lippen, ehe er Rick in meinen Armen erschoss – und dann die Waffe nochmals auf mich richtete.
Der Knall ertönte zum tausendsten Mal in meinem Kopf, bevor die Welt ebenso wie der Schmerz in meiner Schulter explodierte, als ich von einer weiteren Kugel getroffen wurde.
Bis heute war ich mir sicher, dass der Scharfschütze mich extra nicht tödlich verwundet hatte. Das verfluchte Schwein wollte, dass ich diese Scheiße überlebte. Und hetzte mir in dem Moment, in dem er mir die zweite Kugel verpasste, die Dämonen auf den Hals, die mir ab sofort dieses klägliche Leben zur Hölle machten.
Joder … Fuck …
Wieder kniff ich die Augen zusammen und atmete tief durch, wie es mich der Psychiater gelehrt hatte, den ich nach meiner Entlassung aus dem Dienst ein halbes Jahr lang wöchentlich zu Gesicht bekam. Der meinen Dämonen den Namen PTSD (Posttraumatische Belastungsstörung) verpasste. Das endgültige Aus für meine Einsätze bei der Navy, denn mit dieser Diagnose war es so gut wie unmöglich, die Security Clearance zu behalten – die Sicherheitseinstufung, die notwendig war, um an die hochgeheimen Informationen für die Missionen zu gelangen. Instabile SEALs wurden aussortiert. So einfach war das. Aber ich hatte nach Ricks Tod ohnehin genug von all dem Mist, und mit meinem kaputten Knie hätte ich sowieso keine Einsätze mehr geschafft.
Mein Psychiater Dr. Turner war jung, frisch von der Uni und hatte weiche unschuldige Hände, die ich kaum zu schütteln wagte, wenn ich in sein Sitzungszimmer trat. Seine Finger versanken förmlich in meinen Pranken und ich hatte immer das Gefühl, einen Teil von dem Blut, welches ich berührt hatte, an ihn abzugeben. Obwohl da schon lange kein Blut mehr klebte. Das war abgewaschen, meine Hände sauber. Was man von meiner Seele nicht behaupten konnte, denn in solch tiefe Abgründe vermochte nicht einmal Wasser zu sinken.
Dr. Turners Mondgesicht und der rundliche Bauch standen in krassem Gegensatz zu meinem durchtrainierten Körper, den ich auch nach meiner Entlassung aus der Army täglich mit Yoga und Fitnesstraining in Form hielt.
Ich hatte den Kerl abstoßend gefunden, als ich ihm das erste Mal gegenüberstand. Ein Bürohengst, der keine Ahnung vom richtigen Leben da draußen besaß und dessen größte Herausforderung des Tages wahrscheinlich darin bestand, ein Bier am Abend vor dem Fernseher zu öffnen.
Unsere erste Sitzung war eine Katastrophe gewesen und ich hatte mir geschworen, nie wieder zu diesem Psychodoktor zu gehen.
Diesen Vorsatz hielt ich eine ganze Woche lang durch und als ich das nächste Mal vor seiner Tür stand, öffnete er mir ohne Vorwürfe oder unnötige Vorträge und bat mich herein. Da wusste ich, dass ich ihm eine Chance geben sollte.
Und diese Chance hatte sich gelohnt, denn er hatte es nach unzähligen Therapiesitzungen geschafft, dass ich zumindest tagsüber kaum mehr Flashbacks bekam und auch nicht mehr bei jedem lauten Knall zusammenzuckte (trotzdem hasste ich Feuerwerke wie die Pest). Aber gegen die Albträume in der Nacht war selbst er machtlos.
Sie kehrten immer wieder.
Jede. Verdammte. Nacht.
Inzwischen ging ich nur noch sporadisch zu den Sitzungen mit ihm. Bei einer der letzten hatten wir diese Reise besprochen, auf der ich mich nun befand. Die mir helfen sollte, wenigstens mit einem Teil meiner Vergangenheit abzuschließen und damit vielleicht die Albträume zu vertreiben.
Ich bezweifelte, dass das jemals möglich war, aber eine andere Lösung hatte ich nicht parat, daher buchte ich die Kreuzfahrt. Schaden konnte es ja nicht.
»Im Hier und Jetzt bleiben«, murmelte ich mein Mantra und öffnete die Augen einen Spalt, um mich zu fokussieren.
Die geschmacklos eingerichtete Schiffskabine, die ich seit gestern Abend bewohnte, half mir nicht sonderlich dabei, schöne Bilder heraufzubeschwören. Aber wenigstens vermochte ich meine Gedanken zu sortieren, während ich auf den schwarzen Flatscreen gegenüber dem Bett starrte. Direkt daneben befand sich eine Duschkabine, das Bad mit dem Klo lag zu meiner Rechten in einem separaten Raum neben der Kabinentür.
Einundzwanzig. Zweiundzwanzig.
Einatmen.
Einundzwanzig. Zweiundzwanzig.
Ausatmen.
Langsam verblassten die Bilder, und die Stimme des Dämons wurde leiser, ließ mich endlich los und in die Gegenwart zurückkehren.
Ein Blick auf mein Handy verriet mir, dass es noch sehr früh war, um aufzustehen. Dennoch wusste ich, dass ich keine Chance mehr haben würde, wieder einzuschlafen, ohne dass die Erinnerungen mich weiter verfolgten. Wenn sie so real waren und ich sogar Ricks Stimme hörte, blieb ich besser wach und wartete, bis mich meine verfluchte Vergangenheit vollständig aus ihren Klauen entließ.
Manchmal half ein Schluck Alkohol – oder mehrere. Von Drogen hatte ich bisher die Finger gelassen, aber was noch nicht war, konnte ja noch werden. Ganz verwerfen wollte ich diese Option nicht, sollte diese Reise keinerlei Verbesserung mit sich bringen.
Mit einem Seufzen schwang ich die Beine aus dem Bett und ging ins angrenzende Bad. Der Raum war klein und zweckmäßig eingerichtet, aber das war genau das, was ich wollte.
Obwohl Geld keine Rolle spielte, hatte ich eine der günstigsten Kabinen gebucht, da ich keine Luxuskreuzfahrt brauchte. Mein Ziel war nicht, den Urlaub meines Lebens zu verbringen, wie es mir vom Bildschirm des Fernsehers entgegengeleuchtet hatte, als ich gestern die Kabine betrat. Ich wollte überhaupt leben. Das konnte man auch in einer Zehn-Quadratmeter-Innenkabine mit verfickter Blümchenmusterdecke.
Ich spritzte mir etwas kaltes Wasser ins Gesicht, stützte die Hände auf dem Waschbecken ab und ließ den Kopf zwischen den Schultern hängen, während ich versuchte, meinen Puls zu beruhigen.
Dann hob ich langsam den Blick und betrachtete das Bild, das mir der Spiegel zeigte.
»Maldito«, murmelte ich. »Verdammt.«
Spiegel waren beschissen, denn sie waren tausendmal ehrlicher, als es ein Mensch je sein könnte. Sie beschönigten nichts, verhüllten keine Makel, keine Ecken oder Kanten.
Ich hasste sie dafür. Hasste das Bild, das sie mir präsentierten.
Dennoch konnte ich nicht anders, als hinzustarren.
Die dunklen Augen, die gehetzt wirkten, die zusammengepressten Lippen, welche von einem kurz getrimmten Bart umrahmt wurden. Das schwarze Haar, zerzaust vom Schlaf.
Ich versuchte, den zweiunddreißigjährigen Mann vor mir mit den Augen eines Kindes zu sehen, das seine Schusswaffe auf ihn richtete, wie es mir Dutzende Male passiert war.
Würde ich abdrücken? Den Kerl da vor mir töten, um mein eigenes Leben zu retten?
Ja. Ohne zu zögern.
Denn der Mann, der mir entgegensah, war ein Wrack – ein Schatten seiner selbst. Die Welt wäre absolut besser dran ohne ihn.
Wieso verdammt noch mal lebte ich dann noch? Wieso hatte es in all den beschissenen Jahren keine einzige Kugel geschafft, mich dort zu treffen, wo sich der Off-Knopf befand?
Ich starrte auf meine nackte Brust, auf der ich an einer silbernen Kette meine Erkennungsmarke trug, die auch Hundemarke genannt wurde. Das kleine Stück Stahl, auf dem mein Name, Sozialversicherungsnummer, Blutgruppe und Religion vermerkt waren, war alles, was mir von meinem Dasein als Soldat noch blieb. Das und die Narben an und in meinem Körper, die von all den Feinden zeugten, die ich überlebt hatte.
Stirnrunzelnd betrachtete ich das Einschussloch der Kugel, die nur knapp meine Lunge verfehlt hatte. Die Ärzte hatten von ›Glück‹ gesprochen. Ich empfand es als Demütigung und die Narbe als Hohn des Schützen.
Sein Lachen konnte ich förmlich hören und presste mir die Hände auf die Ohren.
»Vete«, murmelte ich. »Hau ab.«
Doch seine Stimme blieb, er lachte über mich und mein armseliges Leben, das er mir gelassen hatte.
Kein Wunder, dass ich wieder single war, obwohl ich glaubte, endlich den Mann gefunden zu haben, mit dem ich alt werden wollte. Aber John hatte leider recht gehabt mit den Worten, die er mir an den Kopf schmiss, ehe er mich vor ein paar Monaten verließ: Ich war verachtenswert und kaputt – zu sehr in meinen Problemen und dem Selbsthass gefangen, als dass irgendjemand mich daraus befreien, geschweige denn mich lieben könnte.
Wie wollte mir jemand helfen, wenn ich selbst es nicht konnte? Wenn nicht einmal der Psychiater weiterwusste und mich vor lauter Ratlosigkeit auf eine verdammte Kreuzfahrt schickte?
Ich atmete tief durch, ging zum Klo und entleerte meine Blase. Dann griff ich zum elektrischen Rasierer, entfernte die dunklen Stoppeln von den Wangen.
Anschließend kehrte ich zurück in die Kabine und machte ein paar Yogaübungen, die mir halfen, den Kopf durchzulüften. Jeder SEAL praktizierte das, da es nicht nur den Körper fit hielt, sondern auch die Konzentration und das Stressmanagement förderte. Denn neben der körperlichen Fitness war vor allem mentales Training wichtig. Damit man für die Einsätze gewappnet war, in denen das eigene Leben und das seiner Kameraden oft am seidenen Faden hing und man binnen eines Lidschlags schwerwiegende Entscheidungen treffen musste.
Auch wenn ich nicht mehr in der Navy war, begann ich jeden Morgen mit Yoga, nur schon, um irgendeine Routine in meinen Alltag zu bekommen. Gemäß Dr. Turner war das sehr wichtig beim Kampf gegen PTSD.
Danach stellte ich mich unter die Dusche, die viel zu klein für mich war. Keine Ahnung, mit was für Gästen die hier rechneten, aber offensichtlich nicht mit muskulösen Puerto-Ricanern, die sich während des Duschens auch noch drehen wollten. Meine Schultern stießen bei jeder Bewegung gegen die Glaswände.
So gut es ging, wusch ich mir den Schweiß vom Körper, trocknete mich notdürftig ab und griff zu Deo und Aftershave, ehe ich Boxershorts, Jeans sowie irgendein Shirt und Turnschuhe anzog, um nach draußen an die frische Luft zu gehen. Das Handy steckte ich in die Hosentasche.
Meine Kabine lag in einem der unteren Decks und ich musste erst einen langen Gang hinter mich bringen, bis ich endlich ins Freie treten konnte.
Wenigstens etwas Gutes hatte diese Reise, das wurde mir bewusst, als ich das Meer vor mir sah und die salzige Luft einsog. Vielleicht hätte ich mir doch besser eine Meerblick-Kabine gönnen sollen, denn die Weite, die sich vor mir auftat, ließ mich durchatmen. Der Wind wühlte in meinen Haaren, strich über meine braun gebrannten Unterarme.
Endlich kehrte so etwas wie Ruhe in meine Gedanken, während ich über das dunkelblaue Wasser zum Horizont blickte, wo soeben die Sonne dabei war, den neuen Tag zu begrüßen. Es war noch kühl, aber würde ein warmer Tag werden. So zumindest die Wettervorhersage meines Handys für diesen Samstag.
Wieso konnte nicht jeder Morgen mit Ruhe beginnen? Wieso mussten mich immer wieder diese verwünschten Erinnerungen quälen, die mir den Tag schon verdarben, ehe er überhaupt gestartet hatte?
Ich schlang beide Hände um das schmale Geländer der Reling und drückte das Kreuz durch, um erneut tief einzuatmen – da wurde ich mit einem Mal so hart von hinten in den Rücken gestoßen, dass mir kurz die Luft wegblieb.
Mein Körper reagierte mit jahrelang antrainierten Reflexen. Ich wirbelte herum und packte den Kerl, der gerade versuchte, sein Gleichgewicht wiederzuerlangen, am Hals. Keine Sekunde später hatte ich ihn gegen die Bordwand gepresst und er starrte mich aus schreckgeweiteten dunkelbraunen Augen an.
»Sorry, ich … au, das tut weh, lass mich los!«, rief er auf Englisch.
Ich blickte auf den jungen Mann hinunter, der mindestens einen Kopf kleiner als ich sein musste. Er war wahrscheinlich Ende zwanzig, sein blondes Haar zerzaust und fiel ihm teilweise ins Gesicht. Seine Wangen waren gerötet und kleine Schweißperlen glänzten auf Oberlippe und Nase, während er um Atem rang. Anscheinend war er gerade noch gerannt.
Mein Blick schien ihn einzuschüchtern, denn ich spürte, wie er zu zittern begann, ehe ich ihn ruckartig losließ.
»¡Cretino!«, knurrte ich und wandte mich von ihm ab.
»Ich kann nicht so gut Spanisch, aber hast du mich gerade ›Dummkopf‹ genannt?«, tönte er hinter meinem Rücken.
»Sí. Pass gefälligst auf, wo du hinläufst!«
»Hey, du sprichst auch Englisch!«
Na, da hatten wir ja mal einen Blitzmerker …
»Tut mir leid, ich wollte dich nicht anrempeln«, murmelte er. »Aber dieser Wellengang … vielleicht ist Joggen auf einem Schiff doch nicht die beste Idee.«
Ich knurrte in mich hinein und umfasste die Reling wieder mit beiden Händen.
»Hi, ich bin Hannes«, erklang es neben mir und eine schlanke Hand schob sich in mein Blickfeld. »Und du bist?«
Ich verengte die Augen, ohne den Kopf zu ihm zu drehen. »Nicht interessiert«, brummte ich.
»Oh … schade.«
Ich glaubte tatsächlich, so etwas wie Bedauern in seiner Stimme mitschwingen zu hören, und presste die Kiefer aufeinander.
Obwohl meine abweisende Körperhaltung im Grunde für sich sprach, ließ sich der Typ dadurch nicht abwimmeln. Er plapperte ungeniert weiter.
»Bist du hier, um dir den Sonnenaufgang anzusehen? Oder macht dir einfach der Jetlag zu schaffen? Du stammst auch aus Amerika, oder?«
Maldito, dieser Kerl ging mir gehörig auf die Eier.
»Lass mich einfach in Ruhe«, erwiderte ich barsch.
»Oookay.« Die Hand verschwand endlich aus meinem Blickfeld. »Vielleicht können die Sonnenstrahlen ja etwas Wärme in dein dunkles Gemüt zaubern. Bye, man sieht sich.«
Hoffentlich nicht.
Ich überlegte, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass ich dem Typen nochmals über den Weg lief.
Gut, auf einem Kreuzfahrtschiff mit knapp dreitausend Passagieren nicht ganz abwegig, aber ich würde ihn einfach ignorieren. Denn ich war nicht hier, um Freunde zu finden, sondern wegen ihm. Rick.
Al diablo con esto …
Wann würde meine Vergangenheit endlich aufhören, so verflucht wehzutun?!
Kapitel 2 - Me estás tocando los cojones
Angel
Wer behauptete, dass Kreuzfahrten geil waren, dem gehörte die Zunge rausgerissen. Dieses Schwanken die ganze Zeit, das Aufeinanderhocken in einem Blechkasten … Dass ausgerechnet Rick mich in diese Lage befördert hatte, erschien mir wie ein letzter schlechter Scherz von ihm.
Oh ja, wir hatten viele Witze gerissen. ›Galgenhumor‹ nannte man das. Aber es hatte uns geholfen, nicht an all das Leid zu denken, das wir im Begriff waren, über die Menschen zu bringen. Rick war ein absolut miserabler Witzerzähler gewesen, der jede Pointe versaute und oft schon in einen Lachanfall verfiel, ehe er überhaupt richtig zu erzählen begonnen hatte.
Während ich mit dem Lift zu einem der Sonnendecks hinauffuhr und eine Liege suchte, um mir nun tatsächlich den Sonnenaufgang anzusehen, erschien Ricks Gesicht wieder vor mir. Seine stahlblauen Augen, die in diesem Moment mit dem Meer um die Wette gefunkelt hätten. Seine kurzen schwarzen Haare, das kantige Gesicht. Ich hatte ihn besser als irgendjemand sonst auf dieser Welt gekannt – er war mein bester Freund gewesen.
Auch wenn ich homosexuell war, hatte ich mich nie körperlich zu ihm hingezogen gefühlt. Das war so ein dummes Vorurteil, dass Schwule nicht mit Männern befreundet sein konnten, ohne mit einer Latte in der Hose herumzurennen.
Rick wusste (ebenso wie ich von ihm) alles über mich. Kannte jeden dunklen Winkel meiner Seele und er hatte mich dennoch stets bedingungslos akzeptiert, nie irgendetwas infrage gestellt. Auch nicht meine Homosexualität, was ich ihm hoch anrechnete, denn im Militär war das leider immer noch ein ziemliches Tabuthema. Obwohl sich diesbezüglich in den letzten Jahren ein bisschen was zu verändern begann. Dennoch war Rick in unserer Einheit der Einzige gewesen, dem ich es erzählt hatte.
Es war nun über neun Monate her, dass ich ihm in die gebrochenen Augen geblickt hatte. Doch der Schmerz war so gegenwärtig, als wäre es gestern gewesen. Wenn man jemanden verlor, der einem so viel bedeutete, starb immer ein Teil der eigenen Seele mit ihm. Das war die schreckliche Wahrheit, die ich seither kannte.
Ich beobachtete die Sonne, wie sie immer höher stieg, hörte die Lautsprecherstimme, die in vier verschiedenen Sprachen verkündete, dass das ›Early Bird‹-Frühstücksbuffet eröffnet sei.
Aber obwohl mein Magen verlangend nach Speck knurrte, wollte ich noch eine Weile hier auf dem Sonnendeck sitzen, in die Ferne starren und an meinen Freund denken, dem ich näher gestanden hatte als einem Bruder.
Ich war derart in Gedanken versunken, dass ich den Typen erst bemerkte, als er sich laut seufzend neben mich auf eine Liege fallen ließ.
Mein Kopf schnellte herum und meine Miene verfinsterte sich, noch während ich erkannte, wer da neben mir Platz genommen hatte.
Santa mierda, wenn Nervensägen rollen würden, müsste der Kerl den Berg rauf bremsen.
»Hach, Sonnenaufgänge sind schon was Feines, oder?« Er strich sich durch das blonde Haar, das nun frisch gewaschen war, und leuchtete mich mit seinen großen braunen Augen an, während ein leichtes Lächeln um seine Lippen spielte. »Isst du kein Frühstück?«
»Keinen Hunger.« Ich wandte den Blick wieder von ihm ab.
Leider schien ihn meine Wortkargheit nicht abzuschrecken. »Verrate mir mal eines: Wieso reist ein hübscher Kerl wie du auf einem Familien-Kreuzfahrtschiff, wenn er seine Ruhe haben will?«
Hatte er gerade ›hübsch‹ gesagt? Dass Männer einem Wildfremden Komplimente machten, war etwa so selten wie eine Blume in einer asphaltierten Straße. Bedeutete das etwa, dass er auch schwul war? Falls ja, wusste er ja nichts von meiner Homosexualität, was mir den Vorteil verschaffte, ihn endlich loszuwerden.
»Ich warte auf meine Verlobte«, log ich, ohne ihn anzusehen.
Ein leises Prusten erklang zu meiner Rechten, was mich wieder den Kopf zu ihm drehen ließ.
Seine Augen funkelten belustigt, während sein Lächeln breiter wurde. »Entschuldige, falls ich dir zu nahe trete, aber alle meine Antennen sagen mir, dass du auf Männer stehst«, gab der Schlaumeier von sich. »Und meine Antennen haben in den meisten Fällen recht.«
»Ach?« Ich hob desinteressiert eine Augenbraue.
»Etwa nicht?« Er setzte sich auf der Liege gerade hin, wandte sich mir zu.
»Me estás tocando los cojones«, erwiderte ich grimmig. Wenn ich emotional wurde, schwappte ich oft ins Spanisch, ohne es zu merken. Das wurde mir gerade wieder bewusst, weil mein Gegenüber mich mit Fragezeichen in den Augen ansah. Daher riss ich mich zusammen und atmete tief durch. »Hier gibt es sicher noch andere Kerle, denen du auf die Eier gehen kannst«, verdeutlichte ich meinen Missmut auf Englisch.
»Schon verstanden.« Er nickte immer noch lächelnd. »Du möchtest noch eine Runde einsamer Wolf spielen.«
»Geh einfach.«
Langsam riss mir der Geduldsfaden und das machte mich noch wütender. Als SEAL hatte ich mich stets unter Kontrolle gehabt, aber seit ich dieses verdammte PTSD mit mir rumschleppte, fuhr ich ständig aus der Haut. Und ebendas hielt mir vor Augen, wie kaputt ich war – wie stark mich der Krieg gezeichnet hatte.
Ja, gut, es war schräg, wenn ein Single eine Mittelmeer-Kreuzfahrt von Kreta nach Venedig buchte. Aber ich war nicht hier, um antike Säulen zu bestaunen, sondern um ein Versprechen einzulösen. Eines, das ich einem Toten gegeben hatte und das mir hoffentlich half, mit jenem verhängnisvollen Tag abzuschließen, der ihn aus meinem Leben riss.
Aber das würde ich bestimmt nicht auf die Stupsnase dieses blonden Engelchens binden, das immer noch grinsend neben mir auf der Sonnenliege hockte.
Wenigstens erhob sich der Kerl nun endlich und ich setzte alles daran, stur nach vorne aufs Meer zu starren, während er neben mir stehen blieb. Wahrscheinlich wollte er noch etwas sagen, doch meine abweisende Haltung schien endlich Wirkung zu zeigen, sodass er schließlich mit einem leisen Seufzen von dannen zog.
Dass ich die Luft angehalten hatte, merkte ich erst, als ich mich wieder auf meinen Körper konzentrierte, der in der Jeans, dem Shirt und dem immer stärker werdenden Sonnenschein zu schwitzen begann.
Aber ich wartete noch fünf Minuten, ehe ich auch aufstand, um nun doch noch zum Frühstücksbuffet zu gehen.
Natürlich hatte ich Hunger. Den hatte ich immer am Morgen und ich war froh gewesen, als ich in der Broschüre gesehen hatte, dass die Reise all-inclusive war. Ich konnte also wenigstens so viel essen und trinken, wie ich wollte, wenn ich diese bescheuerte Kreuzfahrt schon auf mich nahm.
Ich lud meinen Teller, so voll ich konnte, und suchte dann im Heck des Schiffes nach einem ruhigen Tisch. Im Frühstücksraum zu essen, kam für mich nicht infrage. Viel zu laut, und das fröhliche Gelächter der anderen Passagiere kratzte zusätzlich an meinen Nerven.
Gerade als ich mich niedergelassen hatte, ertönte der Summton meines Handys. Ich nahm es aus der Hosentasche und warf einen Blick darauf.
Unwillkürlich breitete sich ein Schmunzeln auf meinen Lippen aus, als ich den Namen und die Nachricht las, die mir im Sperrbildschirm angezeigt wurden.
Charly❤️:
Und, wie ist Griechenland so? Vermiss dich.
Gleichzeitig lösten die Worte aber auch eine Sehnsucht in meinem Herzen aus, die ich gerade jetzt nicht dort haben wollte. Also verstaute ich das Handy wieder in der Hosentasche und biss in den Speck, den ich mir auf dem Teller geschichtet hatte. Ich würde später zurückschreiben.
Gestern Abend hatte das Kreuzfahrtschiff in Kreta abgelegt und heute gegen acht Uhr fuhren wir in den Hafen von Santorin ein. Eine griechische Inselgruppe, die sich im Ägäischen Meer befand.
Es war der erste Landgang unserer Reise, und die Einfahrt in den Hafen, der sich in einem überfluteten Vulkankrater befand, sei ein Highlight, wie die Lautsprecherstimme gerade erklärte. Sie forderte die Reisenden auf, an die Reling zu gehen, um sich einen guten Platz zu sichern, damit sie ja nichts verpassten.
Während die Passagiere brav aus dem Frühstücksraum strömten, lehnte ich mich zurück und war froh, diesen der Sonne abgewandten Tisch gefunden zu haben.
Ich stellte mir vor, dass Rick neben mir säße. Er hätte ebenso wie ich darauf verzichtet, sich in die Menschenmassen zu stellen, um ein Foto irgendeines Hafens zu schießen. Wir tickten da ziemlich ähnlich, er und ich.
Meine Gedanken drifteten zu einem unserer ersten Gespräche. Wir waren beide dazu abkommandiert worden, einen Bauernhof in der Nähe der Stadt Tikrit zu observieren, und hatten darauf gewartet, dass die Nacht hereinbrach. Während wir nebeneinander im Steppengras lagen, erschienen die ersten Sterne über uns.
»Und, was tust du so in deiner Freizeit?«, fragte er mich und grinste dabei schief.
»Krafttraining, Yoga, Kampfsport, Joggen … das Übliche«, erwiderte ich. »Wieso?«
»Ich reise für mein Leben gern.« Sein Grinsen wurde breiter, während er den Blick wieder nach vorne richtete. »Warst du schon einmal in Europa? Also ich meine, als Tourist?«
Ich schnaubte leise und schüttelte den Kopf.
»Ich leider auch nicht«, sagte Rick bedauernd. »Aber würde es dich nicht interessieren? Die alten Städte zu sehen? Die Wunder, die die Kultur der alten Welt groß gemacht haben?«
»Du meinst die großartige Kultur, die dazu führte, dass wir jetzt hier im Gras liegen und darauf warten, in ein Haus einzudringen, das uns nicht gehört?«
Rick schmunzelte über meinen Zynismus. »Ich würde gern irgendwann eine Kreuzfahrt übers Mittelmeer machen«, meinte er. »Vielleicht Athen oder Venedig besuchen. Das wär was.«
Bevor ich ihm antworten konnte, waren wir abgelenkt worden, da der Bauernhof in Flammen aufging, noch ehe wir überhaupt irgendetwas hatten untersuchen können.
Später erfuhr ich, dass in dem Gebäude ein alter Bauer mit seiner Frau gelebt hatte, die anscheinend Wind davon bekamen, dass das Militär in der Nähe war. Sie hatten das Feuer selbst gelegt und dafür gesorgt, dass kein Stein auf dem anderen blieb, damit wir nichts finden würden. Ob sie überhaupt etwas versteckt hatten oder nur verhindern wollten, vom US-Militär gefangen genommen und verhört zu werden, konnte niemand im Nachhinein mehr sagen.
So viel zu unserer großartigen Kultur.
Rick würde jetzt die Augen verdrehen und sich dann am Oberarm kratzen, wie er es immer getan hatte, wenn er über etwas nachdachte.
Genug mit den Erinnerungen. Ich war hier, weil ich meinem Freund einen letzten Gefallen erweisen wollte. Und das würde ich gleich in Angriff nehmen, denn inzwischen hatte ich den Teller leer gegessen und die Durchsagestimme verriet mir, dass wir beim Hafen von Santorin angekommen waren.
Seufzend erhob ich mich von meinem Tisch und schlenderte zum Versammlungsort für die Reisegruppen im Eingangsbereich des Schiffes. Dort hatten sich die meisten anderen Passagiere schon eingefunden und standen in Grüppchen zusammen, die anhand von Nummern gebildet wurden, welche ein Lautsprecher ausrief.
Je nachdem, welches Tagesprogramm man gebucht hatte, musste man sich in einer anderen Lounge zusammenfinden und erhielt einen dem Tagesziel entsprechenden Flyer mit Infos in die Hand gedrückt.
Eigentlich hätte ich den Ort gerne auf eigene Faust erkundet, aber hier ging es nicht um mich und meine Wünsche, sondern um die von Rick. Es standen drei Tagesausflugs-Varianten im Angebot: einmal das ›historische Santorin‹, dann ›Inselhighlights‹ und ›Griechenland pur‹.
Tja, wofür hätte Rick sich wohl entschieden? Leider war das, worauf seine Wahl gefallen wäre, definitiv nicht nach meinem Geschmack. Trotzdem würde ich es für ihn durchziehen.
Kapitel 3 - Ich sag’s dir noch ein Mal, chico
Hannes
»Na, suchst du jemanden?«
Die Frauenstimme ließ mich schuldbewusst zusammenzucken, denn ja, ich hatte tatsächlich in der Lobby, wo sich alle für den Landgang versammelten, nach jemandem Ausschau gehalten. Jemandem, den ich seit heute Morgen nicht mehr aus dem Kopf bekam.
Ich wandte mich zu der jungen Frau um, die mich mit einem breiten Lächeln musterte. Sie war sechsundzwanzig und damit zwei Jahre jünger als ich, seit Kurzem meine Chefin und inzwischen auch eine meiner besten Freundinnen.
Es gibt diese Menschen, die man einmal sieht und bei denen man direkt weiß, dass man mit ihnen auf einer Wellenlänge ist. Das war bei Kate und mir so, als wir die Kunstausstellung eines gemeinsamen Bekannten in New York besucht hatten. Eigentlich hieß sie Kathleen, aber alle nannten sie bloß Kate, da sie diese Abkürzung lieber mochte. Der Name passte auch besser zu ihr, sie war einfach eine Frohnatur und mir daher ähnlich.
Mit ihren jungen Jahren hatte sie es schon wahnsinnig weit gebracht und ich bewunderte sie für ihren Biss und Ehrgeiz. Sie war einer der klügsten Menschen, die ich kannte, und auch einer der warmherzigsten. Wenn sie einen anlächelte, fühlte man sich direkt geborgen – also ich zumindest.
Sie strich sich eine blaugrüne Strähne aus der Stirn, die ihr trotzdem direkt wieder ins Gesicht fiel.
Ja, Kate hatte ein gewöhnungsbedürftiges Auftreten, das so gar nicht zu ihrem Beruf als Kunsthändlerin passte. Meist trug sie farbenfrohe Kleider, die selbst mir (und ich hatte echt nichts gegen Experimentierfreudigkeit) mehr als einmal beinahe die Tränen in die Augen getrieben hätten. Kombiniert mit ihrem Augenbrauenpiercing und der bunten Mähne fiel sie auf wie ein Pfau in einem See voller Schwäne.
Konnten Pfaue überhaupt schwimmen? Egal.
Jedenfalls war sie eine Erscheinung und jeder musste selbst entscheiden, ob von der guten oder schlechten Sorte.
Heute trug sie ein leichtes Sommerkleid mit einem rosa Blumenprint, das ihre schlanke Figur betonte. Wenigstens hatte sie ihre riesige Handtasche, die sie normalerweise immer mit sich herumschleppte, gegen eine leichte Umhängetasche aus weißem Leder getauscht.
Gerade setzte sie sich einen nicht wirklich zu ihrem Outfit passenden gelben Hut auf, der sie vor der Sonne Griechenlands schützen sollte. Ebenso wie ich bekam sie rasch einen Sonnenbrand, weshalb wir schon mehr als einmal darüber gelacht hatten, dass ausgerechnet wir beide uns für eine Kreuzfahrt im Mittelmeer entschieden hatten.
Sie hatte mir meinen allerersten Urlaub in Europa schlicht und ergreifend geschenkt – mit der Voraussetzung, dass wir möglichst viele antike Stätten besuchten, um mein Wissen, was die ›alte Welt‹ anging, aufzupolieren. Denn Kate hatte mich vor einiger Zeit als Mitarbeiter in ihrem Laden eingestellt und ich ihr erst später gestanden, dass ich im Grunde keine Ahnung von den antiken Kulturen unserer Welt besaß.
Ja, ich hatte mich immer schon für Kunst interessiert, aber eben nur für die modernen Werke. Genau das wollte sie nun ändern. Zudem hielt sie stets nach weiteren Sammlerstücken für ihren Laden Ausschau und hoffte, in Europa fündig zu werden.
Und da waren wir nun: Zwei befreundete Singles, die sich auf eine abenteuerliche Woche im Mittelmeer freuten, nachdem wir bereits eine kleine Reise hinter uns hatten. Denn aufgrund meiner Flugangst waren wir mit dem Schiff von New York nach Europa gefahren.
Nach dieser Kreuzfahrt würden wir durch Italien und vielleicht auch Frankreich ziehen. Ich hatte überlegt, kurz einen Zwischenstopp in London einzulegen, wo gute Freunde von mir wohnten, aber diese Option wollte ich noch offenhalten. Schließlich war bereits Herbst und das hieß, ich würde sie ohnehin bald in New York treffen, wenn sie mich dort wie immer zur Weihnachtszeit besuchten.
»Du wirkst nachdenklich«, bemerkte meine Freundin und tippte mir mit dem Zeigefinger gegen die Brust.
Da ich selbst nicht der größte Mann war, konnten wir auf Augenhöhe kommunizieren. Was mich wieder zu dem düsteren Schönling von heute Morgen brachte. Dieser überragte mich um mehr als einen Kopf, war viel breiter gebaut als ich und allein der Gedanke, wie er mich gepackt hatte, ließ eine Gänsehaut über meinen Rücken jagen.
Okay, es war nicht nur dieser Gedanke, sondern vielmehr die vielen Gedanken, die auf diesen Gedanken folgten. Ich stellte mir vor, wie es wäre, von ihm zärtlich, aber bestimmt gepackt zu werden. Wie seine Augen leidenschaftlich glühten, wie seine Muskeln sich anfühlten, die ich unter dem Shirt, das er trug, erahnt hatte. Wie er mir mit diesem sexy lateinamerikanischen Akzent irgendwelche Schweinereien ins Ohr knurrte.
Nachdenklich? Oh ja, ich war gerade ziemlich nachdenklich. Aus gutem Grund, denn selten hatte ich diese Vibes einem Mann gegenüber gespürt, wie ich sie bei dem mysteriösen Fremden heute früh erlebt hatte.
Dieser Kerl … er besaß einfach alles, was ich mir bei einem Mann wünschte.
Konnte man es mir dann verdenken, dass ich in ihn schockverliebt war und mir bereits malerische Sonnenuntergänge mit ihm vorstellte? Nein. Eben.
»Erde an Hannes«, machte Kate einen weiteren Anlauf, mich aus meinem Gedankenkarussell herauszuzerren, in dem ich definitiv nicht nur auf einem Schaukelpferdchen ritt.
»Ja, sorry«, murmelte ich und strich mir mit dem Handrücken über die Augenpartie, um damit hoffentlich auch das Bild des fremden Adonis aus dem Kopf zu kriegen.
Fehlanzeige. Keine Chance. Es hatte sich wie eine Klette in meinen Gehirnwindungen festgesetzt und ich wusste, dass ich es da nicht so rasch wieder wegbekommen würde. Ich war nun mal begeisterungsfähig und gerade erreichte meine Begeisterung ungeahnte Höhen – trotz meiner Höhenangst.
»Ist was?«, hakte Kate nach und sah mich mit schief gelegtem Kopf an. »Du bist irgendwie abwesend. Ich dachte, du freust dich so auf den Landgang in Santorini.«
»Nein, alles okay«, log ich und wusste, dass sie mich direkt durchschaute.
Ihr Lächeln, das erneut auf ihren Lippen erschien, sprach Bände.
»Du weißt, dass man seine Chefin nicht anflunkern sollte?«, fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
Ich seufzte leise, da mir bewusst war, dass ich nun in der Bredouille saß. Entweder ich erzählte ihr von der Begegnung mit Mr. ›Ich bin mürrisch und unnahbar, träum gefälligst von mir‹, was zur Folge hätte, dass Kate mich mit Fragen löchern würde. Oder aber ich verschwieg ihr die Begegnung, was ebenso zur Folge hätte, dass Kate mich mit Fragen löchern würde.
Pattsituation.
Mist …
Doch ehe ich ihr überhaupt etwas erzählen konnte, wurde meine Aufmerksamkeit auf einen breitschultrigen dunkelhaarigen Mann gelenkt, der sich in ebendiesem Augenblick der Gruppe anschloss, in der wir standen und die sich für das ›historische Santorin‹ entschieden hatte. Eine Tatsache, die mich gleichzeitig verwirrte, erfreute und verblüffte.
Historische Wissbegierde hätte ich dem Düster-Latino nicht zugetraut. Es machte ihn noch spannender als ohnehin schon.
Als sich unsere Blicke trafen, konnte ich das ›Scheiße‹ förmlich in seinen Augen lesen.
Okay, einen gravierenden Fehler wiesen meine Tagträume auf: Prinz Nicht-Charming schien kein Interesse an mir zu haben. Aber das ließ sich korrigieren. Hoffte ich.
»Wer ist das?«
Natürlich war Kate meinem Blick gefolgt und musterte nun ihrerseits den mürrisch dreinblickenden Grund meiner zukünftig schlaflosen Nächte.
»Keine Ahnung leider«, antwortete ich. »Bin ihm heute beim Joggen begegnet.«
»Der sieht wahnsinnig heiß aus«, flüsterte Kate ehrfürchtig.
»Ja, aber er befindet sich in meinem Jagdrevier, nicht in deinem«, stellte ich meine Besitzansprüche klar.
Sie zog eine ihrer Augenbrauen in die Höhe (dafür beneidete ich sie, ich wollte das auch können!) und sah mich fragend an. »Nicht dein Ernst, oder?«
»Schwulsein ist kein Tattoo, das man auf der Stirn trägt.« Ich zuckte mit den Schultern. »Glaub mir, er ist es.«
»Das glaube ich dir erst, wenn ich es von ihm selbst höre«, wandte meine Chefin ein und machte eine Geste, als wollte sie sich die nicht vorhandenen Ärmel hochkrempeln.
»Du wirst dir an ihm die Zähne ausbeißen«, prophezeite ich ihr und schmunzelte, da ich mir vorstellen konnte, dass die finstere Ausstrahlung des Fremden an Kate ebenso wie an mir abprallen würde.
Wir waren einfach zu positive Menschen, um uns davon beeindrucken zu lassen. Ein Grund, wieso wir beide uns so fantastisch verstanden.
»Wetten, dass ich ihn – sollte er wirklich schwul sein – bekehren kann?« Sie sah mich grinsend von der Seite an.
»Kate«, stöhnte ich. »Hör bitte auf mit diesem Klischeedenken. Sexuelle Orientierung ist kein Shirt, das man einfach mal umdreht und auf der anderen Seite trägt.«
»Jaja, ist ja gut.« Sie schob schmollend die Unterlippe vor. »Dennoch schade für die Frauenwelt, wenn du recht behalten solltest.«
»Ich hab bei so was immer recht«, hielt ich dagegen und streckte den Rücken durch – zuckte aber direkt zusammen, da sich Mr. Universum mit einem Mal auf uns zubewegte.
Sein Gang glich dem eines Panthers, der sich an seine Beute anpirschte. Na gut, eher eines verletzten Panthers, denn mir fiel in ebendiesem Moment auf, dass er das eine Bein etwas nachzog.
»Oh«, hauchte Kate, die sein Näherkommen ebenfalls bemerkt zu haben schien.
Ich schluckte, denn der verärgerte Blick, mit dem der Fremde uns bedachte, ließ nichts Gutes erahnen. Mein Herz schlug mit einem Mal viel zu schnell und meine Handflächen wurden feucht, während ich ihn wahrscheinlich wie ein verschrecktes Kaninchen anstarrte.
Als er bei uns angekommen war, versenkte er seinen dunklen Blick erst in meinen, danach in Kates Augen und schnaubte grimmig. »Wenn ihr dann fertig seid mit eurer Analyse über mich: Ich bin weder an dir, Goldlöckchen, noch an dir, Papagei, interessiert«, knurrte er und mein Herz, das eben noch wie ein Kolibri geflattert hatte, stürzte augenblicklich in die Hose ab.
Mist, er hatte unsere Diskussion mitbekommen! Wie peinlich war das denn?!
Aber wer hätte auch ahnen können, dass dieser Typ das Gehör einer Fledermaus besaß?
Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken, aber da hatte ich die Rechnung ohne Kate gemacht.
Meine Freundin schien die Ansage des verärgerten Schönlings als Herausforderung zu sehen. Sie streckte ihr Kinn in die Höhe, baute sich zur vollen Größe auf (was dennoch bloß dazu führte, dass sie dem Fremden bis zur Brust reichte), und ich konnte gerade noch ›Tu es nicht‹ denken, da tat sie es auch schon.
»Woran bist du dann interessiert?«, fragte sie in einem provozierenden Tonfall. »Vielleicht lässt sich was arrangieren.«
Der Fremde schob seine Augenbrauen so stark zusammen, dass die Zornesfalte dazwischen wie ein Krater wirkte, und funkelte meine Chefin wütend an. »¿Eres tonto o tiras piedras a los aviones?«
Ich hatte keine Ahnung, was er gerade gesagt hatte, aber es klang wie eine Beleidigung.
Sein Gesicht verfinsterte sich noch stärker, ehe er leise durchatmete und Kate erneut anschnauzte, dieses Mal auf Englisch. »Bist du dumm, ignorant oder einfach nur frech, mir solch eine Frage zu stellen?!«
Das rief mich auf den Plan. Keiner nannte meine Freundin ›dumm‹!
»He, keiner nennt meine …« Weiter kam ich nicht, denn da hatte sich der Fremde bereits an mich gewandt und der flammende Blick, den er mir schenkte, ließ jedes weitere Wort in meinem Hals ersticken.
»Ich sag’s dir jetzt noch ein Mal und hoffe, dass das reicht, chico«, knurrte er mit rauchiger Stimme, die zu der Glut in seinen Augen passte. »Lass mich in Ruhe und halte dich von mir fern.«
Okay, ich hätte vielleicht eingeschüchtert sein sollen, stattdessen verspürte ich ein Kribbeln im Magen. Eines von der guten Sorte, denn die Art, wie er mich mit diesem finsteren Gesichtsausdruck ansah, war einfach nur sexy. Und wenn er ›chico‹ sagte, klang es fast wie ein Kosename, obwohl es ›Kleiner‹ oder ›Junge‹ hieß und er es wohl abwertend meinte. So gut Spanisch konnte ich.
Jetzt verstand ich die Motten, die immer wieder ins Licht flogen, obwohl sie sich dabei die Flügel verbrannten. Denn das Feuer in den Augen dieses Bad Boys wirkte auf mich wie eine verheerende Flamme, in die ich immer und immer wieder eintauchen wollte. Beinahe magnetisch zog er mich an.
Gruselig …
Nein, ich hatte mir das heute Morgen nicht eingebildet: Da war etwas zwischen uns.
Auch er konnte es in diesem Moment fühlen, das sah ich ihm an. Gerade weil er sich so abrupt und bestimmt abwandte und davonstürmte, dass keine Zweifel mehr blieben.
»Ooookay, du hast recht«, hörte ich Kate neben mir leise sagen. »Er muss auf Männer stehen, so wie die Funken gerade zwischen euch geflogen sind.«
»Du hast es auch bemerkt, oder?« Ich stieß die Luft aus, die ich angehalten hatte.
Als ich Kate den Kopf zuwandte, grinste sie mich an.
»Ay, caramba und wie.« Sie knuffte mich in die Seite. »Und das Gute an einem Kreuzfahrtschiff ist, dass man sich immer wieder über den Weg laufen kann.«
In ebendiesem Moment wurde per Lautsprecher verkündet, dass die Tenderboote bereit seien und sich alle bitte zu ihren Positionen begeben sollten.
Der Reihe nach wurden wir in die Boote verfrachtet, die uns in den Hafen von Santorin bringen würden.
Ich erhaschte einen Blick auf Mr. Unnahbar, der im selben Boot wie Kate und ich saß. Er schien seine Pläne also trotz allem durchziehen zu wollen.
Geradlinig auch noch … ja, er wurde immer mehr zu meinem Traummann. Auch wenn er mich seinerseits wohl eher als seinen Albtraum bezeichnet hätte.
Kapitel 4 - Das war knapp
Angel
Da unser Kreuzfahrtschiff zu groß war, um im Hafen von Santorin anzulegen, wurden wir zu den Ausflugszielen getendert. So nannte man das, wenn eine Horde Touristen zusammengepfercht in schwankenden Eierschalen vom Ankerplatz zum Ziel gefahren wurde.
In den Tenderbooten gab es Platz für bis zu hundertfünfzig Personen und sie wurden von den Griechen selbst gestellt, wie uns eine fröhliche Lautsprecherstimme mitteilte. Tender von Reedereien waren in Santorin verboten.
Sinnvoll, so bleibt das Geld zumindest hier.
Das Ganze dauerte nur ein paar Minuten, worüber ich froh war, denn ich spürte die Blicke von Blondie und seiner Freundin in meinem Nacken. Sie saßen ein paar Bänke weiter hinten.
Na gut, vielleicht hatte ich vorhin etwas überreagiert. Aber wenn zwei Wildfremde in aller Öffentlichkeit über mich tratschten (und dann noch meine Sexualität thematisierten), brachte mich das nun mal auf die Palme. Ich war noch nie ein Mensch gewesen, der einen Konflikt scheute. Nicht nur, weil ich ein Ex-Soldat war, sondern auch, weil ich es nicht mochte, wenn andere Leute über einen ein Urteil fällten, obwohl sie gar keine Ahnung von ihrem Gegenüber hatten.
Für einen Augenblick hatte ich überlegt, den blöden Landgang sausen zu lassen und einfach den ganzen Tag am Pool zu liegen, der wohl menschenleer wäre, da alle Passagiere Santorin unsicher machten. Doch dann hatte ich mich an Rick erinnert. Daran, wie seine Augen geleuchtet hätten, wäre er jetzt hier.
Al diablo con eso.
Ich wollte das durchziehen. Für ihn. Für mich! Davon konnten mich auch kein dämlicher Mitreisender und seine verpeilte Freundin abhalten!
Als SEAL war es mit das Wichtigste, dass man niemals aufgab. Nie. Mochten die Widerstände noch so groß sein, man hielt durch. Da wäre es lächerlich, wenn ich mich von Knallfröschen wie denen direkt am ersten Tag aus der Bahn werfen ließe – die zwei waren gegen die Hell Week ein Witz.
Ich würde ihnen heute einfach aus dem Weg gehen, und beim nächsten Ausflug hätte ich sie mit Sicherheit nicht mehr an der Backe. Denn ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese zwei Clowns sich jedes Mal dafür entschieden, die historischen Wurzeln der alten Welt zu verfolgen.
Wahrscheinlich erwarteten sie eine Indiana-Jones-Tour und würden vom ›historischen Santorin‹ derart enttäuscht sein, dass sie sich beim nächsten Landgang gut überlegten, ob sie sich das nochmals geben wollten.
Anders als ich. Ich hatte vor, mir die ganze verdammte antike Dröhnung reinzuziehen, die diese Reise zu bieten hatte. Für Rick. Das tat ich tatsächlich nur für ihn.
Während wir dem Land entgegentenderten, richtete ich meinen Blick zum ersten Mal bewusst auf Santorin, oder Santorini, wie es korrekterweise genannt wurde. Die Lautsprecherstimme erklärte soeben, dass der Name aus dem italienischen stamme (von ›Santa Irene‹) und die Stadt etwas mehr als siebzehntausend Einwohner habe.
Da hat jemand wohl Wikipedia vor sich geöffnet.
Diese Dinge interessierten mich nur marginal. Vielmehr beeindruckte mich die Lage dieser Stadt, die an der dunkelgrauen Kraterwand eines erloschenen und von der Ägäis überfluteten Vulkans erbaut worden war.
Anscheinend war dieser Ort, dessen Caldera etwa sieben mal fünf Meilen maß, vor dreitausendsechshundert Jahren bei einer gewaltigen Eruption entstanden. Der Legende nach sollte dies sogar die Grundlage von Platons Geschichte über das versunkene Atlantis darstellen. Was man ziemlich sicher sagen konnte, war, dass die damalige Naturkatastrophe den Untergang der minoischen Kultur zur Folge hatte, wie die fleischgewordene Wikipedia-Frau vorne im Bug des Bootes gerade ins Mikrofon plapperte.
Der Hafen von Fira, auf den wir zusteuerten, befand sich unterhalb einer fast tausend Fuß hohen Steinklippe, an die sich die typisch griechischen Häuser in blau-weißen Farben schmiegten. Vom Ankerplatz der Tenderboote aus führten eine Seilbahn sowie ein gewundener Weg nach oben in die Stadt, wie ich beim Näherkommen feststellte. Von hier aus fuhren auch Busse um die Insel, aber unsere Reiseroute sah vor, dass wir erst oben in der Stadt in einen Bus wechseln würden.
Nachdem wir aus dem Boot ausgestiegen waren, wurden wir von einer Reiseleiterin versammelt, die für unsere etwa vierzig Touristen zählende Gruppe verantwortlich war. Der Hafen wirkte nicht hektisch, sondern beinahe idyllisch und versprühte den Charme der griechischen Gemütlichkeit, wie ich ihn bereits in Kreta wahrgenommen hatte, wo wir gestern ablegten.
Schwarzer Strand breitete sich am Fuße der Felswand aus, der mir gewöhnungsbedürftig erschien. Ich kannte sonst nur weiße Strände aus feinem Sand und dieser hier bestand aus dunklen Kieselsteinen.
Die Reiseleiterin, eine blonde Dame um die fünfzig, erklärte in gebrochenem Englisch, dass wir nun entweder mit der Seilbahn, zu Fuß oder auf Maultieren zur Innenstadt hinaufgelangen könnten. Wir würden uns dann oben wieder versammeln, wenn es alle hochgeschafft hatten.
Sie zählte uns durch und stellte sicher, dass alle ihre Armbändchen trugen, die wir beim Versammeln auf dem Schiff erhalten hatten und die uns als ›historisch interessierte Englisch sprechende Nerds‹ brandmarkte.
Stirnrunzelnd betrachtete ich die gemäß Reiseleitung etwa siebenhundert Stufen, die sich im Zickzack über die Felswand nach oben schlängelten. Vor meiner Knieverletzung hätte ich, ohne mit der Wimper zu zucken, die Challenge angenommen, zu Fuß hochzusteigen. Und wäre damit ziemlich sicher der Einzige gewesen, so wie unsere Reisegruppe aussah, die Größtenteils aus etwas übergewichtigen Amerikanern und Engländern bestand.
Aber ich wusste, dass mich dies inzwischen an meine Grenzen bringen würde, und das wollte ich mir nicht direkt am ersten Tag antun. Auch so schon konnte ich mit meinem kaputten Knie kaum einen Schritt machen, ohne zu hinken, und wenn ich mich derart überforderte, würde ich heute Nacht nur mit Schmerzmitteln schlafen.
Verdammter Krieg.
Aus dem Augenwinkel registrierte ich, wie der blonde Plagegeist und seine Freundin sich gerade jeweils auf ein Maultier schwangen. Die Tiere warteten hier unten darauf, Touristen nach oben und wieder zum Hafen zu bringen.
Als ich die Halbesel genauer betrachtete, verfing sich mein Blick kurz in dem des Typen mit dem Honigkuchenpferd-Grinsen. Seine Augen konnte ich hinter der übergroßen Sonnenbrille, die er inzwischen trug, nicht erkennen, aber auch so entging mir das glückliche Gesicht nicht, das er aufgesetzt hatte.
So viel geballte Frohnatur war schlicht und ergreifend ein Overkill.
Schon machte sich sein Maultier auf den Weg, die breiten Treppenstufen (mit den vielen Kackhaufen) nach oben.
Ich seufzte leise in mich hinein, da ich wusste, dass ein Maultier mich zwar tragen könnte, aber durch mein Körpergewicht, das auf meine Größe und die Muskeln zurückzuführen war, halb tot oben ankommen würde.
Nein, das wollte ich diesen armen Tieren, deren trauriges Schicksal ohnehin ziemlich sicher Tierschützer auf die Barrikaden trieb, nicht zumuten. Zudem konnte ich gut darauf verzichten, den ganzen Tag nach verschwitztem Esel zu stinken.
Also rückte ich meine Sonnenbrille zurecht und wandte mich der Seilbahn zu, vor der sich bereits eine Schlange gebildet hatte.
Lo siento, Rick, kein Maultier-Abenteuer für dich.
Zwar dauerte die Fahrt mit der Seilbahn nur drei Minuten, aber dafür musste ich eine halbe Stunde warten, weil so viele Touristen in die Stadt hochwollten und immer nur sechs Personen in eine Gondel passten.
Während des Wartens schnappte ich ein Gespräch zwischen zwei jungen Frauen auf, die sich über die Zustände der Maultierhaltung echauffierten. Anscheinend gab es tatsächlich schon mehrere Versuche, die Tiere von ihrer unschönen Aufgabe zu befreien oder sie zumindest erträglicher zu machen. Das erklärte auch, wieso so viele Touristen inzwischen die Seilbahn oder Busse der Maultierquälerei vorzogen.
Oben angekommen, hatte ich noch etwas Zeit, die Aussicht anzuschauen, da wir ohnehin noch auf die Eselreiter warten mussten.
Ich ließ den Blick über die malerische Kraterlandschaft schweifen.
Gut, ich musste Rick ein erstes Dankeschön aussprechen. Ohne ihn hätte ich diesen idyllischen Anblick des gewaltigen Kraters aus dunklem Gestein mit dem blauen Meer und den weißen Häusern um mich herum niemals zu Gesicht bekommen.
Man spürte förmlich den Zauber der Antike. Wenn ich mir vorstellte, dass hier vor Tausenden von Jahren eine derart zerstörerische Naturkatastrophe stattgefunden hatte, konnte ich die Schönheit, die sich nun vor mir ausbreitete, kaum begreifen.
Womöglich brauchte es manchmal eine vollständige Auslöschung, ehe etwas Neues, Schönes entstand.
Welch Ironie.
Die Reiseleiterin riss mich aus den Gedanken, indem sie die Gruppe wieder zusammenpfiff. Inzwischen waren auch die Maultier-Reiter oben in der Stadt eingetrudelt. Zu Fuß hatte sich (wie erwartet) keiner aus unserer Truppe hochgewagt.
Der englischsprachige, historisch begeisterte Anteil der Kreuzfahrtpassagiere befand sich nun allesamt in der Oberstadt, schoss Fotos und Selfies oder bestaunte dieses Wunder der Antike mit Ahs und Ohs. Auch die beiden Plagegeister waren mit von der Partie und stießen begeisterte Rufe aus.
Ich verdrehte die Augen, da mir ihre Euphorie allmählich auf den Sack ging.
Konnte man nicht leise genießen?
Kurz ertappte ich mich beim Gedanken, wie das blonde Engelchen wohl erst im Bett abgehen würde, und schüttelte den Kopf über mich selbst.
Wieso kamen mir bei seinem Anblick solche Bilder?
Siniestro …
Rasch schloss ich mich der Reiseleiterin an, die uns mit einem Fähnchen in der Hand bedeutete, ihr zu folgen. Fröhlich plappernd ging sie durch die Straßen zwischen den schneeweißen Häusern voran und ich hörte nur mit halbem Ohr zu, wie sie dies und das kommentierte.
Nach einem Fußmarsch, der mich das rechte Knie wieder stärker spüren ließ, kamen wir zu einem Bus, welcher uns zu der Ausgrabungsstätte Akrotiri bringen würde.
Die Fahrt dorthin war tatsächlich ein Erlebnis. Wir passierten malerische Dörfer, die in der Sonne hell funkelten.
Die Lautsprecherstimme auf dem Tenderboot hatte nicht zu viel versprochen, als sie von einem ersten Highlight dieser Kreuzfahrt sprach.
Jeder von uns erhielt ein Fläschchen mit Wasser, das war die einzige Verpflegung auf dem etwa vierstündigen Ausflug. Aber da alle ordentlich gefrühstückt hatten, sollte das kein Problem darstellen.
Die Ausgrabungsstätte selbst riss mich dann allerdings nicht vom Hocker. Was vor allem daran lag, dass ich in erster Linie versuchte, Blondchen und seinem Anhängsel aus dem Weg zu gehen, die sich auffällig oft in meiner Nähe tummelten.
Aber auch sonst hätten mir die alten Steine wohl nicht imponieren können. Obgleich ich zugeben musste, dass die Archäologen hier ganze Arbeit geleistet hatten, eine jahrtausendealte Stadt auszugraben – mitsamt Häusern, verschlungenen Straßen und Plätzen.
Danach fuhr uns der Bus zurück nach Fira, wo wir noch ein archäologisches Museum besuchten. Klein und langweilig. Doch was tat man nicht alles für Rick? Also gab ich mir zumindest Mühe, mich für die Artefakte zu begeistern, die aus Zeiten stammten, welche komische Namen besaßen und die ich mir nie im Leben würde merken können.
Himmel, was fanden die Leute nur an diesem alten Zeug?
Wenigstens war der geführte Ausflug danach vorbei und die Reiseleiterin erklärte uns mit einem sonnigen Lächeln, dass wir die restlichen paar Stunden an Land zur freien Verfügung hätten. Sie hatte uns bei der Busstation abgeladen und wir sollten die Stadt Fira noch etwas erkunden, ehe es gegen den späteren Nachmittag wieder mit der Seilbahn nach unten und zurück aufs Schiff ging.
Freie Zeit. Endlich!
Mir schwirrte bereits der Kopf von all dem Gefasel und den Zahlen, die sie uns um die Ohren gehauen hatte. Als Börsenmakler konnte ich nicht anders, als sie mir merken zu wollen.
Das sollte nun jeden Tag so weitergehen? Na, das würde ja heiter.
Ich brauchte jetzt dringend Alkohol. Am liebsten ein Glas Wein. Gestern Abend hatte es auf dem Schiff einen hervorragenden griechischen Rotwein zum Essen gegeben. Vielleicht würde ich ihn hier auf der Insel in einem Restaurant wiederfinden. Auf jeden Fall würde ich aber – wenn ich zurück in New York war – meinen Weinhändler beauftragen, den Tropfen für mich zu bestellen.
Gerade wollte ich mich von der Busstation ab- und der weißen Stadt zuwenden, da registrierte ich im Augenwinkel etwas, das meine im Krieg antrainierten Reflexe erneut aktivierte.
Einer der Reisebusse setzte sich soeben in Bewegung und fuhr rückwärts aus dem Parkplatz, während eine Person sich gleichzeitig genau in seine Richtung aufmachte. Ebenfalls rückwärts, da diese Person ein Bild von seiner schrulligen Begleitung auf seinem Handy verewigen wollte, die sich lasziv gegen eine weiße Hauswand lehnte und dabei theatralisch in den Himmel schaute. So konnte sie den Bus nicht sehen, der viel zu schnell auf ihren stupiden Freund zusteuerte, welcher anscheinend taub war – den Lärm des Motors hätte auch er hören müssen, der Blödmann!
Ehe ich michs versah, stürzte ich in die Richtung des lebensmüden Blondies, dessen Kopf gleichzeitig zu mir herumschnellte. Noch bevor er wirklich begriff, was geschah, hatte ich ihn im letzten Moment vom Heck des Reisebusses weggezerrt, indem ich einen regelrechten Hechtsprung an den Tag legte.
Ich hatte eindeutig zu viel Schwung, denn während ich den Kerl packte, wusste ich bereits, dass unser Flug auf dem Boden endete. Mir war klar, dass ich Goldlöckchen dabei unter mir wie ein Schnitzel erdrücken würde, da er viel kleiner und schlanker war als ich. Daher drehte ich mich noch im Fallen auf den Rücken.
Ein Brennen an meinen Schulterblättern und Oberarmen verriet mir, dass dabei die Haut aufschürfte, und ich presste sowohl Augen als auch Lippen zusammen, um den Schmerz auszuhalten, der meine Wirbelsäule hinaufschoss.
Für eine Sekunde blieb ich schwer atmend liegen, ehe ich die Lider wieder öffnete und erst jetzt richtig wahrnahm, dass Blondchen mit weit aufgerissenen Augen auf mir lag und mich entgeistert anstarrte.
Das Handy, mit dem er das Foto seiner Paradiesvogel-Freundin hatte schießen wollen, hielt er fest umklammert in der Hand.
Einen Moment lang schien die Welt um uns sich langsamer zu drehen, die Zeit beinahe stillzustehen. Und einen Moment lang starrte ich ihn ebenso verwirrt an wie er mich.
Da weder er noch ich eine Sonnenbrille trugen, blickte ich direkt in seine Augen. Mir fiel auf, dass seine Iriden von einem warmen Dunkelbraun mit ein paar helleren Sprenkeln waren, die beinahe golden erschienen. Die Zähne, die ich in seinem halb offenen Mund erspähte, wirkten makellos weiß. Seine Lippen voll, aber nicht zu voll. Das blonde halblange Haar fiel ihm in die Stirn und die freie Hand hatte er an meiner Brust abgestützt.
Sein Geruch drang mir in die Nase. Ich hätte erwartet, dass er irgendein billiges Parfum benutzte, aber er schien nur Seife und ein unaufdringliches Aftershave zu verwenden, das ein bisschen an Calvin Klein erinnerte.
Nein, er roch definitiv nicht nach verschwitztem Esel.
Am Rande registrierte ich, dass sein Becken genau auf meinem lag, und dann geschah etwas, das mich nun endgültig aus allen Wolken fallen ließ. Viel härter als der Sturz auf den Boden und viel intensiver.
Blondchen bewegte sich auf mir, da er gerade versuchte, sich von mir wegzustemmen. Dabei drückte er sein Becken noch stärker gegen meins und zu meiner Verblüffung reagierte mein Schwanz darauf.
Seit ich aus meinem letzten Militäreinsatz zurückgekommen war, hatte ich keine Erektion mehr bekommen – der Todesstoß für meine Beziehung mit John, der nicht damit umgehen konnte, dass ich nicht nur eine beschissene psychische Verfassung aus dem Krieg mitgebracht hatte, sondern obendrein auch noch zum sexuellen Krüppel mutiert war.
Dr. Turner hatte ich die Erektionsstörung lange verschwiegen, doch als meine Beziehung in die Brüche gegangen war, wollte er Gründe genannt haben. Also hatte ich ihm zähneknirschend gestanden, dass ich seit meiner Entlassung aus der Army nicht mehr in der Lage war, einen Ständer zu bekommen. Und John das wohl persönlich nahm. So persönlich, dass er auch die anderen Arten von Sex nicht mehr wollte (zumindest nicht mit mir) und mich verließ.
Dr. Turner hatte dann darüber philosophiert, dass manche traumatischen Erlebnisse, wie ich sie im Krieg durchgemacht hatte, dazu führen konnten, dass man keinen mehr hochbekam, und mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich geschmissen. Eine weitere These von ihm war, dass ich mich eventuell durch die Entlassung aus meiner Einheit entmannt fühlte und sich dies auf meine Libido niederschlug. Er hatte mir Meditationsübungen und anderen Blödsinn empfohlen, der mir beim Entspannen vor dem Sex helfen könnte.