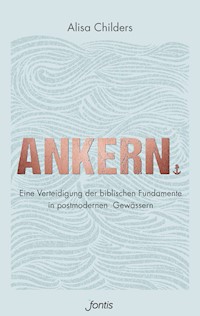
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist ein starker Anker gegen gewisse Unterströme der postevangelikalen Theologie, die seit Jahren die apologetischen Fundamente der Kirche unterspülen. Dies führt mittlerweile zu einer ernsthaften Erosion des Glaubens. Alisa Childers beschreibt eindrücklich, was ihren eigenen Glauben ins Wanken gebracht hat, welche konstruktivistischen Denkfiguren hier toxisch und destabilisierend wirkten und wie sie durch den Zweifel hindurch einen gefestigten Jesus-Glauben zurückgewinnen konnte. Sie liefert ein gut reflektiertes und gründlich recherchiertes Handwerkszeug für theologische Laien, um im Ozean wechselnder Strömungen und Meinungen einen guten Grund zu finden: Christus. Das Buch ist inspirierend und informativ und füllt eine klaffende Lücke im evangelischen Argumentationsgefecht. Das Buch führt eindrücklich vor Augen, in welchen tiefen Zwiespalt oder gar Abgrund solche uferlosen Skeptizismen mit ihren sirenenhaften Beschwichtigungsformeln fromme Seelen stürzen können. Childers Erfahrungen offenbaren zugleich den dringenden Bedarf an neuen theologischen Ansätzen, die nicht nur das Verbürgte verteidigen, sondern die biblische Botschaft mit frischen Augen und einer frischen Denke neu einsichtig machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alisa Childers Ankern.
Für meine Eltern Chuck und Karen Girard. Danke, dass ihr mir
Alisa Childers
Ankern.
Eine Verteidigung der biblischen Fundamente in postmodernen Gewässern
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2024 vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.
Originally published in English in the U.S.A. under the title:Another Gospel?, by Alisa Childers Copyright © by Alisa Childers German edition © 2021 by Fontis Verlag with permission of Tyndale House Publishers, a division of Tyndale House Ministries. All rights reserved.
Ursprünglich auf Englisch in den U.S.A. veröffentlicht unter dem Titel: «Another Gospel?», von Alisa Childers Copyright © by Alisa Childers Copyright deutsche Ausgabe © 2021 by Fontis-Verlag Übersetzt mit Genehmigung von Tyndale House Publishers, einer Abteilung von Tyndale House Ministries. Alle Rechte vorbehalten.
Die Bibelstellen wurden, soweit nicht anders angegeben, folgender Übersetzung entnommen: Hoffnung für alle®, Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.®. Herausgegeben vom Fontis-Verlag Basel.
Übersetzung: Christian Rendel, Witzenhausen Beratend: Írisz Sipos Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Gestaltung Illustration: René Graf, Fontis (Grafiken: PiXXart Photography/stock.adobe.com & Forgem/stock.adobe.com) E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-694-7
Inhalt
Vorbemerkung der Verfasserin
Vorwort von Lee Strobel
1 Glaubenskrise
2 Die Steine in meinen Schuhen
3 Glaubensbekenntnisse, Cobbler und Walter Bauer
4 Reparieren, was nicht kaputt ist
5 Eine andere Art Christentum
6 Nichts Neues unter der Sonne
7 Denn die Bibel sagt es so?
8 War es nur ihre persönliche Wahrheit?
9 Autoritätsprobleme
10 Hölle auf Erden?
11 Kosmische Kindesmisshandlung?
12 Rekonstruktion
Danksagungen
Weitere Ressourcen
Diskussionsleitfaden
Über die Autorin
Nachwort zur deutschen Ausgabe von Dominik Klenk
Anmerkungen
Vorbemerkung der Verfasserin
Dieses Buch enthält meine Erinnerungen an Gespräche aus einem Kurs, an dem ich vor über zehn Jahren teilgenommen habe. Während dieses Seminars wurden meine Überzeugungen infrage gestellt, mein Glaube erschüttert und mein Innerstes in Aufruhr versetzt. Mir ist klar, dass vielleicht andere Seminarteilnehmer manche Details anders in Erinnerung haben, aber da unsere Gespräche den Leitfaden für die Nachforschungen lieferten, mit denen ich nach jenen vier Monaten des Lernens begann, war es mir wichtig, einige dieser Dialoge nach bestem Wissen aus der Erinnerung wiederzugeben. Daraus ergibt sich der Kontext für meine Nachforschungen und die Schlussfolgerungen, die ich in Bezug auf das historische und progressive Christentum gezogen habe. Dem Erzählfluss zuliebe habe ich auch die zeitlichen Abläufe an einigen Stellen gestrafft.
Vorwort von Lee Strobel
Ein Freund nahm mich und einige andere auf einen Segeltörn rund um die herrlichen Britischen Jungferninseln mit. Als Segelanfänger war ich fasziniert davon, wie ernsthaft es abends beim Verankern des Bootes zur Sache ging.
Wir segelten in eine ruhige Bucht und warfen den Anker. Um ganz sicherzugehen, dass der Anker wirklich griff, tauchte jemand ins Wasser und inspizierte ihn. Saß der Anker nicht sicher fest, konnte er sich womöglich nachts, während wir schliefen, unbemerkt lösen. Anfangs wäre das kein Problem – das Boot würde zunächst mehr oder weniger da bleiben, wo wir geankert hatten. Während der langen Nacht aber würde das Boot durch die sanfte Strömung und den unmerklichen Wellenschlag allmählich wegtreiben und womöglich auf die nahe gelegenen Felsen prallen oder auf den Sandstrand auflaufen.
Mir hält die Szenerie das dringende Anliegen dieses Buches vor Augen. Im christlichen Glauben ist die solide biblische Lehre der Anker. Was passiert, wenn er lose ist oder wenn sein Tau absichtlich durchtrennt wird? Nun, so der Philosoph Mark Mittelberg: anfangs nicht viel. Eine Weile wird der Glaube nicht allzu weit abdriften. Dank Tradition und Gewohnheit dümpelt er zumindest eine Zeit lang in derselben geistlichen Umgebung weiter. Richtig gefährlich wird es auf Dauer: Die Strömung der Kultur lässt das Christentum an den Felsen der Irrlehre zerschellen und in der Bedeutungslosigkeit versinken.
Dieses Alarmsignal lässt Alisa Childers in diesem eindringlichen und überzeugenden neuen Buch ertönen. Auf gewinnende wie überzeugende Weise entlarvt sie das falsche Evangelium, das etliche «progressive» christliche Wortführer propagieren, deren abweichlerische Überzeugungen die Ankertaue im Glauben allzu vieler Menschen durchtrennen – auch wenn diese es nicht gleich merken. Infolgedessen steuert das Christentum auf eine Katastrophe zu – ein Trend, der sich nur aufhalten lässt, wenn wir zur grundfesten biblischen Lehre zurückkehren, in der unser Glaube seit jeher verankert war.
Mit diesem Buch leistet Alisa etwas Bedeutendes. Es gelingt ihr, elegant und persönlich zu schreiben und zugleich alles gründlich mit Fakten und Beweisen zu belegen. Wo es angebracht ist, macht sie Zugeständnisse, tritt aber den Verzerrungen und Falschaussagen furchtlos entgegen, die die progressive Theologie allzu oft befeuern. Klar, leidenschaftlich und mit unnachgiebigem Charme entlarvt Alisa das oft subtile Blendwerk, das viele Christen unkritisch für bare Münze nehmen. Ihr Urteilsvermögen ist messerscharf, ihr Kompass ist unbeirrbar auf den wahren Jesus gerichtet, und ihre Schlussfolgerungen ruhen auf soliden Fundamenten.
Es wäre eine Untertreibung, zu sagen, dieses Buch sei wichtig. Es ist lebenswichtig. Es ist das richtige Buch zur richtigen Zeit. Es ist vielleicht sogar das bedeutendste Buch, das Sie in diesem Jahr lesen werden. Bitte studieren Sie es, arbeiten Sie es mit Unterstreichungen und Markierungen durch, sprechen Sie mit anderen darüber, verteilen Sie Exemplare an Freunde und Gemeindeleiter, verwenden Sie es in Ihren Diskussionsgruppen, zitieren Sie daraus in den sozialen Medien. Nehmen Sie sich seine mahnenden Worte zu Herzen. Lassen Sie Ihren Glauben davon festigen, sodass Sie andere mit Zuversicht auf das unveränderliche Evangelium der Erlösung und der Hoffnung hinweisen können.
Kurz, tun Sie das Ihre, um den Anker der biblischen Orthodoxie aufs Neue zu sichern – damit die Gemeinde nicht durch theologisches Abdriften in Gefahr gerät.
Lee Strobel Autor von «Der Fall Jesus» und «In Defense of Jesus»
1
Glaubenskrise
Man weiß nie, wie sehr man an eine Sache wirklich glaubt, bis deren Wahrheit zu einer Frage von Leben oder Tod wird.
C. S. Lewis, «Über die Trauer»
Es war dunkel. Ich saß alles andere als bequem in einem Schaukelstuhl, dessen Armlehnen sich mir unangenehm in die Hüfte drückten. Mein unruhiges Kleinkind in den Armen wiegend, sang ich leise eine Hymne in die Dunkelheit – eine Dunkelheit, die mir so undurchdringlich vorkam, als könne sie meine Schluchzer in dem Moment ersticken, in dem sie meine Kehle verließen. Ich wandte mich an einen Gott, von dem ich nicht mehr länger wusste, ob es ihn überhaupt gab.
«Gott, ich weiß, du bist real», flüsterte ich. «Bitte lass mich deine Gegenwart spüren. Bitte.»
Nichts.
Kein Anflug von Gänsehaut oder von der vertrauten Wärme, die mich sonst seiner Gegenwart vergewisserte. Busen und Bauch waren geschwollen, mein ganzer schwangerer Körper tat weh, während mein Töchterchen auf mir herumturnte und versuchte, es sich in meinem Schoß bequem zu machen. Obwohl mir die Worte im Hals stecken bleiben wollten, schaffte ich es irgendwie, sie singend herauszustoßen:
«Im Himmel dort vor Gottes Thron Tritt jemand anders für mich ein …»
Alles schmerzte. Aber ich protestierte nicht. Ich erinnerte mich an das, was ich mir mitten in den heftigsten Wehen vor der Entbindung meiner Tochter fest vorgenommen hatte. Ich werde mich nie wieder beklagen, wenn mal irgendetwas scheußlich unangenehm ist. Während man so abgrundtiefe Schmerzen wie die einer Geburt erduldet, würde man alles dafür geben, es nur «scheußlich unangenehm» zu haben.
Nach achtzehn Stunden Rücken- und fünf Stunden Presswehen kam Dyllan in einer Notgeburt zur Welt. Als «Willkommensgruß» in diese Welt nahm man sie mir aus den Armen, fixierte sie auf einen kalten Metalltisch und schob ihr Schläuche in die Luftröhre. Diese Schläuche retteten ihr das Leben. Aber es war eine Rosskur. Ihre Geburt hatte uns beide traumatisiert.
Dennoch war ich überwältigt von Gottes Frieden, und als man sie mir endlich wieder in die Arme legte, wusste ich es beim ersten Blick. Ich denke, tief in mir hatte dieses Wissen schon immer geschlummert und nur auf den Moment gewartet, da ich es abrufen würde. Ich wusste, dass es nichts gab, was ich für sie nicht tun würde. Kein Berg konnte so hoch sein, dass ich ihn für sie nicht besteigen würde. Kein Meer konnte so tief sein, dass ich es für sie nicht durchschwimmen würde. Und kein Kampf konnte so schwer sein, dass ich ihn für sie nicht kämpfen würde.
Dass ich derart schnell auf die Probe gestellt werden würde, hatte ich jedoch nicht geahnt. Als ich an jenem Abend meine kleine Tochter in den Armen wiegte, hatte ich wieder Wehen, aber diesmal keine körperlichen. Es waren geistliche Wehen. Und den Kampf musste ich nicht nur um meinetwillen kämpfen. Das Schicksal zweier zusätzlicher Seelen hing davon ab, wie dieser Glaubenskonflikt ausgehen würde.
«Der Hohepriester, Gottes Sohn, Er kann allein mein Mittler sein.»
Aber ist er das wirklich?
Sitzt Gott wirklich irgendwo da draußen, jenseits der Weiten des Alls, auf einem mystischen Thron?
Nimmt er mich überhaupt wahr?
Ist all das, was ich von ihm je geglaubt habe, nur eine Lüge?
Was geschieht, wenn wir sterben?
«Mein Name steht in seiner Hand, Er betet für mich immerfort …»1
Aber stimmt das denn?
Ist die Bibel wirklich Gottes Wort?
Ist die einzige Identität, die ich je kannte, in Wirklichkeit nur leerer Trug?
Was soll ich meinen Kindern sagen?
Ist Religion am Ende wirklich nur Opium fürs Volk?
Existiert Gott überhaupt?
«Weißt du noch, Gott, als Dyllan geboren wurde? Weißt du noch, wie mich damals der Friede unwiderstehlich überflutete? Ich weiß es noch. Dein Friede. – Und weißt du noch in New York, Gott? Jener Tag? Ich brauchte dich. Ich weiß es noch. Ich weiß noch, wie du mich in deiner Gegenwart geborgen hieltest, als ich dort im Bett lag und dachte, ich müsste sterben.»
Oder handelte es sich bei all diesen Erfahrungen in Wirklichkeit um etwas anderes? Vielleicht war das alles nur das Feuerwerk der Synapsen in meinem Hirn, das meinen gestressten Körper mit einem Cocktail aus Endorphinen und Adrenalin flutete? Was, wenn es nicht mehr war? Gilt das für jeden Gottesdienst, jede Freizeit, jede Bibelarbeit?
Ich glaube. Hilf meinem Unglauben.
Mir war, als tauchte ich in einen stürmischen Ozean und die Wellen schlügen über mir zusammen. Kein Rettungsboot. Keine Hilfe in Sicht. Eines der Schlussbilder aus dem Film Der Sturm aus dem Jahr 2000 (Vorsicht: Spoiler) zeigt ein riesiges, kenterndes Schiff, das von einer Welle, so hoch wie ein Wolkenkratzer, unter Wasser gedrückt wird. Für einen Sekundenbruchteil ragt der winzige Kopf eines Menschen aus dem Wasser, um dann wieder in der Tiefe zu verschwinden.
So fühlte ich mich.
Echt und aufrichtig
Was in aller Welt hatte den Glauben einer starken und frommen Christin wie mir derart ins Wanken gebracht? Wie konnte der Zweifel eine Sängerin von ZOEgirl überwältigen, jener bekannten christlichen Band, die durch die ganze Welt tourte, zum Glauben aufrief und viele Jugendliche inspirierte, ihren Glauben zu bekennen und «von den Bergen zu rufen»? – Dazu kommen wir gleich. Zuvor jedoch ein wenig Hintergrundwissen:
Ich war eines jener Kinder. Sie wissen schon. Ein Mädchen, das Jesus in ihr Herz einlud, als sie fünf Jahre alt war. Eine, die schon in der Bibel las, als sie kaum die Buchstaben kannte. Eine, die morgens früher aufstand, um ihre Schule zu umrunden und für eine Erweckung unter ihren Mitschülern zu beten. Eine, die den Andachts-Lobpreis an ihrer christlichen Highschool leitete und mit einundzwanzig nach New York zog, um in der City benachteiligte Kids zu betreuen. Eine, die keinen Missionseinsatz ausließ und im Sommer auf den Straßen von Los Angeles und New York evangelisierte. Eine, um die man sich keine Sorgen zu machen brauchte. Eine, die bestimmt klarkommen würde. Eine, die ihren Glauben nie infrage stellen würde.
Als ich etwa zehn Jahre alt war, engagierte sich meine Mutter ehrenamtlich bei Fred Jordan Missions in Los Angeles. Sie nahm uns an den Wochenenden zur Suppenküche mit, wo ich beobachten konnte, wie sie Prostituierte in die Arme nahm und übelriechende Obdachlose in Wolldecken hüllte. Dort erlebte ich auch, wie mein Vater, ein christlicher Musiker, Scharen frierender und hungriger Seelen im Lobpreis anleitete, aus voller Kehle «Amazing Grace» zu singen.
Den Hungrigen zu essen geben. Die Nackten bekleiden. Die Ausgestoßenen lieben. Das wurde mir als echtes Christentum vorgelebt. So machten Christen das. Sie beteten, sie lasen in der Bibel, und sie dienten. Es war nicht perfekt, aber es war echt und aufrichtig.
Ich kann also nicht behaupten, ich sei in blindem Glauben aufgewachsen. Mein Glaube formte sich im Angesicht eines gelebten Evangeliums. Intellektuell jedoch blieb er schwach und unerprobt. Ich hatte keinen Bezugsrahmen, keine Werkzeugkiste, in die ich hätte greifen können, als alle Gewissheiten, derer ich mir so sicher gewesen war, infrage gestellt wurden. – Und zwar nicht etwa von einem Atheisten, einem säkularen Humanisten, einem Hindu oder Buddhisten! Es war ein Christ, der meine heraufziehende Glaubenskrise auslöste. Genauer gesagt: ein progressiver christlicher Pastor.
Dieser Pastor lud mich zu einer kleinen, exklusiven Gesprächsgruppe ein. Zu einer Schulung, die mir, wie er meinte, eine theologische Ausbildung verschaffen würde, die vergleichbar war mit einem vierjährigen Theologiestudium. «Ausbildung» war stark untertrieben. Es war eher eine Umwälzung. Der Kurs dauerte vier Jahre. Ich hielt ihn vier Monate lang durch.
Man kennt es, dass junge Christen sich vom Glauben abwenden, nachdem sie im Studium von skeptischen Professoren durch die Mühle gedreht wurden. Auch mein Glaube geriet unter Beschuss … allerdings nicht an der Hochschule, sondern in der Kirchenbank. Er wurde von einem Pastor durchgerüttelt, der mein Vertrauen, meinen Respekt und meine Loyalität gewonnen hatte. Er war kein dahergelaufener Spinner, der mir bei einem Straßeneinsatz auf dem Hollywood Boulevard wütende Tiraden über Gott entgegenschleuderte, weil ich ihm ein evangelistisches Traktat in die Hand gedrückt hatte. Er war ein gebildeter, intellektueller, besonnener und beredsamer Gemeindeleiter – jemand, der von der Liebe zu Jesus sprach. Er war ein glänzender Kommunikator, und er hatte mit dem Christentum ein Hühnchen zu rupfen.
Treffen für Treffen legte er jede mir wertvolle Überzeugung von Gott, Jesus und der Bibel auf ein intellektuelles Hackbrett, um sie dann dort zu zerlegen. Als «hoffnungsvoller Agnostiker», wie er sich nannte, nahm der Pastor Grundsätze des Glaubens unter die Lupe. Jungfrauengeburt? – Unwichtig. Auferstehung? – Hat möglicherweise stattgefunden, brauchst du aber nicht zu glauben. Sühnetod? – Geht gar nicht. Und die Bibel? – Bloß nicht meinen, die Bibel wäre irrtumslos. Schon Oberschüler, meinte er, seien über diese primitive Vorstellung hinaus. In unseren Diskussionsrunden galten die «Fundis» (Fundamentalisten) als furchtsame Einfaltspinsel, die einfach schluckten, was man ihnen vorsetzte.
Klar, einiges davon war mir schon zuvor begegnet, auf der Titelseite der Newsweek oder in einer kritischen Fernsehdokumentation über Jesus auf dem Discovery Channel. Aber das hat mich nicht überrascht, schließlich erwartete ich von Nichtchristen nichts Anderes als Unglauben. Die Zeitschrift konnte ich einfach zuklappen, den Fernseher ausmachen und mich meinem Tagewerk widmen. Doch in dieser kleinen Gesprächsgruppe gab es kein Entrinnen. Es kam mir vor, als hätte ich als Einzige im Raum schwer an dem zu kauen, was uns da vorgesetzt wurde. Aber ich hatte keine Antworten. Ich war bisher noch nicht einmal auf manche der Fragen gekommen.
Später erfuhr ich, dass progressive Christen dieses Einreißen von Lehraussagen – bei dem alle zuvor nicht hinterfragten Glaubenssätze der Kindheit systematisch auseinandergepflückt werden – als «Dekonstruktion» bezeichnen.
Nach vier Monaten trennten sich unsere Wege. Der Pastor und die Gemeinde wurden zu einer «progressiven christlichen Gemeinschaft». Gleichzeitig kamen unter Christen landauf, landab, in Internetforen, Cafés und Gemeinderäumen ähnliche Diskussionen in Gang. All ihre lange vertretenen Annahmen über das Wesen Gottes und die Bibel, den Absolutheitsanspruch des Christentums und biblische Normen bezüglich Gender und sexueller Orientierung kamen auf den Prüfstand. Diese desillusionierten Seelen fanden zueinander. Sie verfassten Blogs. Sie schrieben Bücher. Gemeinden begannen, sich als progressiv zu bezeichnen und die Bekenntnisse auf ihren Websites zu entfernen oder zu überarbeiten.
Heute sind viele populäre christliche Autoren, Blogger und Redner progressiv. Ganze Denominationen sind inzwischen voller Leute, die sich so nennen. Dennoch sitzen viele andere Christen Sonntag für Sonntag in den Kirchenbänken, ohne auch nur zu ahnen, dass ihre Gemeinde sich eine progressive Theologie zu eigen gemacht hat.
Progressive Christen meiden absolute Aussagen und sammeln sich typischerweise nicht um Glaubensbekenntnisse oder Glaubensaussagen. Der progressive Blogger John Pavlovitz etwa schrieb, im progressiven Christentum gebe es «keine heiligen Kühe»2. Um progressives Gedankengut zu erkennen, mag es deshalb hilfreich sein, den Finger auf gewisse Hinweise, Stimmungen und Haltungen gegenüber Gott und der Bibel zu legen. So betrachten progressive Christen die Bibel etwa als ein vorwiegend menschliches Buch und betonen das persönliche Gewissen und die persönliche Lebenspraxis gegenüber Gewissheiten und Überzeugungen. Außerdem neigen sie dazu, wesentliche Glaubenslehren, wie die Jungfrauengeburt, die Göttlichkeit Jesu und seine leibliche Auferstehung, umzudefinieren, neu zu interpretieren oder gar ganz abzulehnen.
Als das progressive Christentum auf der Bildfläche erschien, übten seine Vertreter durchaus berechtigte Kritik am evangelikalen Milieu, die es in der Gemeinde dringend zu prüfen und zu bewerten galt. Aber diejenigen Progressiven, die wesentliche Lehren ablehnen – wie etwa die leibliche Auferstehung Jesu –, können arglose Christen verwirren und ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen.
Nachdem ich meine progressiv gewordene Gemeinde verlassen hatte, stürzte ich in einen geistlichen Blackout – in eine nie gekannte Finsternis. Ich wusste, was ich glaubte; nun war ich gezwungen, zu überlegen, warum ich es glaubte. Mühsam paddelte ich mit allen Vieren, um in diesem sturmgepeitschten Meer den Kopf über Wasser zu halten, und flehte Gott um Hilfe an: «Gott, ich weiß, du bist da. Bitte schick mir ein Rettungsboot.»
Und in den folgenden Jahren schickte mir Gott tatsächlich ein Rettungsboot. Und dann noch eines. Und noch eines. Das erste kam, als ich auf der Interstate am Regler meines Autoradios herumdrehte. Ich hielt inne, als eine sanfte, großväterliche Stimme just in jenem Moment auf eine der Behauptungen zu sprechen kam, die mir der progressive Pastor zugeworfen hatte. Was ich da hörte, verschlug mir den Atem. Der Mann im Radio, der – wie sich später herausstellte – an einer Universität Einwürfe von Skeptikern beantwortete, stellte sich systematisch, ohne Furcht oder Zorn, einem Einwand nach dem anderen und entkräftete sie alle. Er war freundlich. Er war entschieden. Er war weitaus überzeugender und mehr an den Fakten orientiert als mein progressiver Pastor. Ich hatte nach Wahrheit gesucht, und an jenem Tag fand ich sie dort im Radio.
Unverzüglich begann ich, jedes Buch über Apologetik und Theologie zu lesen, das ich in die Finger bekam, und besuchte sogar Seminare. Die progressive Welle, die mich gegen Gott, den «starken Fels», geschleudert hatte, hatte meine eingefahrenen Vorannahmen über Jesus, Gott und die Bibel zerschmettert. Nun aber ordnete derselbe Fels diese Bruchstücke allmählich neu, legte einige beiseite und setzte die richtigen Teile dorthin zurück, wo sie hingehörten.
Stärker als zuvor
Dies nun ist mein Bericht von der Rekonstruktion meines Glaubens. Heute sieht mein Christentum nicht mehr genauso aus wie früher. Ich habe meine Ansichten zu gewissen theologischen Punkten neujustiert und bin jetzt sehr viel sorgfältiger bei der Auslegung der Bibel. Manche ganz und gar nicht biblische Vorstellung, die einst so sehr zu meiner christlichen Identität gehörte, dass ich nie auf den Gedanken kam, sie infrage zu stellen, habe ich verworfen.
Unterwegs habe ich jedoch die Entdeckung gemacht, dass die überlieferten Kernaussagen des Christentums wahr sind. Ich habe verstanden, dass die Bibel trotz aller Verleumdungen und Schmähungen durch die Jahrhunderte hindurch unversehrt über dem Schutthaufen der Anklagen aufragt, die gegen sie angehäuft wurden. Mir ist klar geworden, dass die christliche Weltanschauung als einzige eine hinreichende Erklärung für die Wirklichkeit liefern kann. Und ich habe Jesus neu entdeckt … diesen verstörenden Prediger aus Nazareth, an dem sich die Geschichte scheidet und der sein Wort, mich niemals zu verlassen, gehalten hat. Wenn Sie sich nun mit mir auf diese Reise begeben, hoffe und bete ich, dass auch Ihr Glaube gestärkt wird.
Mehr als je zuvor bin ich überzeugt, dass das Christentum keiner Geheimoffenbarung oder selbst-inspirierten Philosophie entspringt. Es ist tief verwurzelt in der Geschichte. Ja, es ist das einzige mir bekannte religiöse Konzept, das davon abhängt, dass ein historisches Ereignis (die Auferstehung Jesu) eine Realität ist – und nicht Fake News.
Wenn mir Zweifel am Glauben kommen oder mir tiefe, bohrende Fragen den Schlaf rauben, kann ich es mir nicht leisten, mir «meine Wahrheit» zu suchen, weil ich der Wahrheit verpflichtet bin. Ich will wissen, was wirklich stimmt. Ich will, dass meine Weltanschauung (die Brille, durch die ich die Welt betrachte) der Wirklichkeit entspricht. Entweder existiert Gott, oder er existiert nicht. Entweder ist die Bibel Gottes Wort, oder sie ist es nicht. Entweder wurde Jesus von den Toten auferweckt oder nicht. Entweder ist das Christentum wahr oder nicht. So etwas wie «meine Wahrheit» gibt es nicht, wenn es um Gott geht.
Leider erschöpft sich für viele die Suche nach der Wahrheit in allen Bereichen des Lebens in dem Spiel «Der hat gesagt, die hat gesagt». Zum Beispiel habe ich gerade nach «gesundheitlichen Vorzügen von Schweinefleisch» gegoogelt (ich liebe nun einmal gebratenen Speck) und bin dabei auf allerlei lustige «Fakten» gestoßen. Ich habe herausgefunden, dass Schweinefleisch proteinreich, arm an Kohlehydraten und glutenfrei ist und eine ausgewogene Mischung aller essenziellen Aminosäuren enthält. In einem Artikel hieß es sogar, Schweinefleisch sorge für eine gesündere Haut, fördere die Schwermetallentgiftung und schütze vor der «Erwachsenenkrankheit» (was immer das sein soll).
Was ich da in fünf Minuten ergoogelt habe, ist offensichtlich eine Mischung aus Fakten und Fantasie. Wie soll ich alle Informationen durchforsten und herausfinden, welchen Quellen ich trauen und welche «Fakten» ich glauben kann? Soll ich etwa einen Haufen Speck in einer Schüssel «glutenfreien Salat» nennen? So gern ich mir aussuchen würde, was ich glaube, und so gern ich das auch anderen zugestehen würde, es ist schlicht realitätsfremd.
Wenn nach «meiner Wahrheit» Schweinefleisch der neue Grünkohl ist, wird das Folgen für meine Wirklichkeit haben – ungeachtet meiner noch so starken Gefühle. Meine Gefühle für gebratenen Speck ändern nichts daran, was er mit meinem Herz, meinem Blutdruck und meinen Oberschenkeln macht. Insofern ist «meine Wahrheit» ein Mythos. So etwas gibt es gar nicht. Speck ist entweder gesund, oder er ist es nicht (oder bitte, Gott, lass ihn irgendwo dazwischen liegen!). Und was ich über Speck glaube, kann Konsequenzen haben, die über Leben und Tod entscheiden.
Ebenso habe ich auf dem Weg durch meine Glaubenskrise gemerkt, dass es nicht mehr reicht, nur die Fakten zu kennen … Wir müssen auch lernen, wie wir sie durchdenken können – wie wir uns Informationen verschaffen und zu vernünftigen Schlussfolgerungen kommen, nachdem wir uns logisch und intellektuell mit religiösen Ideen auseinandergesetzt haben. Wir können nicht zulassen, dass die Wahrheit auf dem Altar unserer Gefühle geopfert wird. Wir dürfen uns nicht aus Furcht, anderen zu nahe zu treten, davon abhalten lassen, sie zu warnen, wenn sie drauf und dran sind, vor einen Bus zu laufen. Wahrheit ist wichtig für Speckliebhaber, und Wahrheit ist wichtig für Christen.
Vielleicht sind Sie ein Christ, der sich mit seinen Überzeugungen allein auf weiter Flur wähnt. Vielleicht sind Sie ein gläubiger Mensch, der gerade unversehens ins progressive Christentum schlittert – oder Sie sind besorgt, weil ein Freund oder Angehöriger diesen Weg beschreitet. Vielleicht sind Sie frustriert, weil Sie in den sozialen Medien überflutet werden mit Artikeln, Blogs und Videos, bei denen Ihre Warnlichter aufleuchten, Sie aber nicht in Worte fassen können, warum. Vielleicht drückt der Schuh, weil Sie in Ihrer Gemeinde Heuchelei wahrnehmen oder sich geistlichem Missbrauch ausgesetzt sehen. Vielleicht sind Sie versucht, sich von der Welle fortspülen zu lassen oder Ihren Glauben ganz aufzugeben.
Wer immer Sie sind, liebe Leserin und lieber Leser, mein Gebet ist, dass dieses Buch für Sie zu einem Rettungsboot wird.
2
Die Steine in meinen Schuhen
Ich hatte das Gefühl, dass sie den Weg Jesu in einen Club der Pharisäer verwandelt hatten, und sie sprachen nicht für mich, obwohl ihre Sprecher jeden Abend im Fernsehen das Gespräch dominierten. Durch das dynamische, aber irregeleitete Wirken dieser Leute verkamen die Begriffe «evangelikal» und sogar «christlich» zu einer unglaubwürdigen Marke.
Brian McLaren, «A New Kind of Christianity»
Als Musikerin auf Tournee habe ich immer die Festivalsaison gefürchtet, die meistens in die größte Sommerhitze fiel. In dieser Jahreszeit mussten wir auf den behaglichen Tourbus – mit persönlicher Koje, Satelliten-TV und Mini-Kühlschrank – verzichten und stattdessen morgens um sechs in den Flieger steigen, in klapprigen Lieferwagen durch die Gegend schaukeln und in muffigen Hotelzimmern übernachten. Und dann die Hitze. Es schien, als müssten unsere Auftritte immer genau dann stattfinden, wenn die Nachmittagssonne sich anschickte, das Zentrum der Bühne mit ihrer ganzen Kraft zu beleuchten. So blinzelten wir in ihre Strahlen und sangen vor Scharen von TobyMac-Fans, die uns höflich erduldeten, aber eigentlich darauf warteten, ihren inneren Jesus-Freak herauszulassen. (Unsere Fangemeinde waren vor allem Mädchen im jungen Teenageralter und eher kein Festival-Stammpublikum.)
An einem besonders trockenen, sonnigen Nachmittag saß ich im Künstler-Raum an einem offenen Fenster mit Blick auf die Hauptbühne des Festivals. Von dort beobachtete ich, wie ein charismatischer Prediger nach seiner Ansprache die jungen Leute aufrief, nach vorn zu kommen und «Jesus in ihr Herz einzuladen». Mit charismatisch meine ich nicht «die Hände heben und in Zungen reden», sondern seine überlebensgroße, magnetisch anziehende Persönlichkeit. Dieser Typ war elektrisierend. Überzeugungsstark.
«Wenn du heute Abend sterben würdest, weißt du, wohin die Reise dann für dich gehen würde? In den Himmel? Oder in die Hölle?», dröhnte seine Stimme, während er auf der Bühne auf und ab marschierte und sich in einer perfekten Mischung aus Dringlichkeit und Begeisterung über sein Mikrofon beugte.
Dutzende junger Leute begannen, sich nach vorn zum Altar zu drängen, der eigentlich nur ein drei Meter breiter Zwischenraum zwischen der ersten Reihe und der Bühne war. Diese Zone, in der später rebellische christliche Hardrock-Fans springen und schubsend tanzen würden, füllte sich nun mit stillen, ernsten und völlig eingeschüchterten Teenagern, denen der Gedanke, für immer in der Hölle zu brennen, überhaupt nicht behagte. Als die erste Welle der Jugendlichen sich vorne ballte, ging der Prediger wieder auf und ab und stocherte mit dem ausgestreckten Finger auf die Menge ein. «Jetzt ist dein Moment! Vielleicht ist dies die letzte Chance, die du je bekommst! Vielleicht wirst du auf dem Heimweg von einem Bus überfahren oder du kriegst einen Herzanfall. Oder vielleicht findet die Entrückung statt und du bleibst zurück. Komm. Komm jetzt! Ich weiß, da sind noch mehr von euch, die jetzt hierherkommen sollten. Wir warten.»
Die Musik schwoll an, und noch ein oder zwei Teenager standen auf und gingen unter dem Applaus anderer erwachsener und gleichaltriger Christen nach vorn.
Der Prediger ließ nicht locker. «Einige von euch sitzen immer noch auf den Stühlen. Aber du spürst etwas. Irgendwo tief im Innern willst du nach vorne kommen, doch da ist diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, lieber dort zu bleiben, wo du bist. Das ist der Teufel. Hör nicht auf ihn. Er ist ein Lügner. Komm jetzt.»
Während noch ein paar Nachzügler sich den Weg nach vorn bahnten, leitete der Prediger seine Zuhörer im Gebet. Alle, die seine Stimme hören konnten, lud er ein, ihm laut nachzubeten. Nach dem Gebet forderte er die Neubekehrten auf, an die Seite der Bühne zu kommen, und wies sie an, eine Karte auszufüllen. Später wurde dem Publikum die Zahl der ausgefüllten Karten bekannt gegeben, inklusive der Bemerkung, dass die Engel im Himmel jetzt ein großes Freudenfest feierten.
Und danach? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was aus dieser Schar von Seelen geworden ist. Vielleicht suchten sie die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und begannen, im Glauben zu wachsen. Vielleicht stellte der Typ mit den Karten Kontakte zu örtlichen Gemeinden her, die sie bei sich aufnahmen und ihnen die ersten Schritte im Glauben nahebrachten. Oder vielleicht gingen sie nach Hause und verschwendeten keinen Gedanken mehr an ihre Entscheidung.
In jenem Moment war ich einerseits froh, dass diese Kids nun in den Himmel kommen würden, wenn sie starben. Aber irgendetwas daran saß mir innerlich quer, störte mich wie ein Kieselstein im Schuh. Man spürt ihn, aber man geht weiter und hofft, er kommt irgendwann von selber heraus. Ich fragte mich, ob diese Jugendlichen wirklich verstanden, worauf sie sich da einließen. Hatten sie begriffen, dass sie dazu aufgerufen waren, sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen? Wussten sie, dass das Heil keine Art metaphysische Feuerversicherung ist – eine einmalige Police, die man sich kauft, um eine Garantie für den Ort zu haben, wo man die Ewigkeit verbringen wird? Hielten sie das Christentum für eine Bereicherung ihres Lebens, die ihnen inneren Frieden verschaffen oder sie glücklich und anständig machen würde? Das ganze Erlebnis erinnerte mich an meine Sommerferienlager in der Unterstufe.
Der erste Kieselstein
Auf dieses Lager freute ich mich jedes Jahr. Zu Dutzenden stiegen wir angehenden Teenager aus meiner Gemeinde in die gelben Schulbusse und konnten kaum an uns halten vor Begeisterung, eine ganze Woche lang von unseren Eltern weg zu sein. Berauscht vom Gefühl unserer Unabhängigkeit und abgeschottet von profanen Ablenkungen wie Fernsehen, Radio und lästigen kleinen Geschwistern begaben wir uns auf Pilgerfahrt in die Berge von San Bernardino in Kalifornien. Wer noch nicht «gerettet» war, wurde im Lager gerettet; wer diesen Schritt schon hinter sich hatte, empfing seine große Berufung.
An jedem Abend der Woche gab es eine lange charismatische Versammlung. (Diesmal meine ich «charismatisch» im Sinne von die Hände heben und in Zungen reden.) Eröffnet wurde sie mit einem Spiel, um das jugendliche Publikum in Fahrt zu bringen und unsere Erwartungen zu schüren. Mit Koffein aufgeputschte Jugendleiter warfen T-Shirts in die pubertierende Horde und stachelten sie an, lauter zu schreien, höher zu springen und wilder zu spielen. Nach ein paar Spielen sangen oder brüllten wir das ganze Album Petra Praise durch. Nach und nach wurde die Musik ruhiger und das Tempo langsamer. Nun waren wir bereit. Nun konnte der Geist Gottes wirken. Nachdem wir mehrere sanfte, tief emotionale Lieder gesungen hatten, hielt einer der Leiter eine kurze Ansprache. Anschließend rief er die Leute auf, nach vorn zu kommen – das war der längste Teil der Versammlung, und er wurde mit jedem Abend eindringlicher und leidenschaftlicher.
Ich war völlig aus dem Häuschen, als einer der «wilden Kerle» aus unserer Jugendgruppe schließlich nach vorn ging. Für diesen Jungen hatten wir alle gebetet. Im jugendlichen Eifer und in meiner Naivität dachte ich, sein Leben würde sich für immer ändern, sobald er nach vorn gegangen war und «das Gebet» gesprochen hatte. (Und dass wir dann vielleicht eines Tages heiraten könnten.) Zwei Wochen später benahm er sich wieder genauso wie vor dem Lager. Gott bedeutete ihm nichts mehr. Der Rausch war verflogen.
Auch ich war nicht immun gegen die emotionale Intensität jener «Rufe nach vorn». Ich hatte auch einmal darauf geantwortet. In meinem Fall war es kein Bekehrungsaufruf gewesen, sondern ein Ruf zu einer tieferen, engeren Beziehung zu Jesus … zu einer Art erneuten Hingabe. Nachdem ich nach vorn gegangen war, führte man mich in ein Hinterzimmer, wo wir gut zwei Stunden lang, so kam es uns zumindest vor, einfach nur saßen und heulten. Dann wurden wir entlassen und durften uns den anderen Lagerteilnehmern an der Snackbar zum geselligen Teil des Abends anschließen. Als ich in jenem Jahr vom Lager zurückkam, verzichtete ich zwei ganze Wochen lang aufs Fernsehen. Warum ich eine erneuerte Hingabe an Jesus mit Fernsehfasten gleichsetzte, weiß ich nicht genau, aber hey, schließlich waren es die Achtziger, und Gesetzlichkeit lag in der Luft. Aber ich geriet ins Grübeln, wie und warum ein solches Erlebnis so rasch verpuffen konnte. Und schon hatte ich wieder einen Stein im Schuh.
Damit es klar ist – ich habe nichts dagegen, wenn bei Veranstaltungen Leute nach vorn gerufen werden. Ich kenne viele gereifte Christen, die irgendwann einmal bei einer Billy-Graham-Veranstaltung oder einem «Harvest Crusade» durch den Mittelgang marschiert sind. Wann immer das Evangelium gepredigt wird und der Heilige Geist Leute dazu treibt, darauf zu antworten, lobe ich Gott dafür.
Aber manchmal kam es mir vor wie ein Zahlenspielchen … oder wie eine «Du-kommst-aus-der-Hölle-frei»-Karte. Während meiner Zwanziger, die ich zu einem beträchtlichen Teil in einem Tourbus verbrachte, habe ich manchen «Ruf nach vorn» miterlebt. Etliche Male war ich sogar direkt daran beteiligt. Immer in bester Absicht, aber ich fragte mich jedes Mal, ob die Wirkung wohl von Dauer sein würde. Wenn ich manche dieser Aufrufe mit dem verglich, was ich in der Bibel las, kamen sie mir vor wie billige Kopien – wie die gefälschten Louis-Vuitton-Handtaschen, die man in der Bleecker Street in New York für zwanzig Dollar ergattern kann. Machten wir etwas falsch? Und wieder hatte ich einen neuen Stein im Schuh.
Auf der Suche nach Gemeinschaft
Ich schätze, es hatten sich mittlerweile einige Steine angesammelt, als ich eingeladen wurde, in einer örtlichen evangelikalen Gemeinde, die sich in der Turnhalle einer Grundschule traf, ein paar meiner neuen Lieder zu singen. Ich erwartete mein erstes Baby, und die Plattenaufnahmen mit ZOEgirl waren langsam Geschichte.
Das Evangelium war mir wichtig wie eh und je, aber als ich zum ersten Mal die Bühne dieser Gemeinde betrat, sang ich in der festen Überzeugung, dass die Gemeinde Jesu einiges verkehrt gemacht hatte:
Doch ich sage, können wir nicht alle miteinander auskommen? Ich sage, an unserer Liebe wird man uns erkennen …
Ich könnte in Engelszungen sprechen Auf dem Wasser gehen, den Himmel berühren Wenn ich einem Fremden nicht die Hand reichen kann Ist alles nur eine Lüge.3
Als Nächstes sang ich von einer Frau, die Jesus in einem Stripclub begegnet war, weil er sich nicht scheute, überall hinzugehen, um sie zu suchen und zu retten. In meinem dritten Song stellte ich die Frage, was wohl passieren würde, wenn alle unsere sprichwörtlichen Leichen im Keller, die wir so lange versteckt haben, zum Vorschein kommen und bei helllichtem Tage herumlaufen würden. Was wäre, wenn sie sich gegenseitig die Hände schütteln und ihre Geschichten erzählen könnten? Vielleicht wären wir dann nicht so schnell dabei, einander zu verurteilen.
Zum Schluss sang ich die komplizierte Geschichte einer Frau, die als kleines Mädchen ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt hatte. Nach der Scheidung ihrer Eltern ließ sie alles fahren, woran sie glaubte, weil ein Mann kam und ihr alles versprach, wonach ihr Herz, dem der Papa fehlte, sich sehnte. Neun Monate später verließ er sie, doch sie behielt ihr Baby, weil sie tief im Innern wusste, dass dem Kind, das sie in sich trug, das Ebenbild Gottes aufgeprägt war. Als alte Frau mit einer Krebsdiagnose sang sie, was sie in allen Phasen ihres Lebens gesungen hatte:
Tauf mich, wasch mich in deinem Wasser Lass es über mich laufen, lass mich dich Vater nennen Bring mich zum Kentern, nenn mich deine Tochter Halt mich fest, bis ich nach Hause komme Lass mich niemals los.4
Die Frau in dem Lied war eine Mischung aus Leuten, die ich im wirklichen Leben kannte. Frauen mit anrüchiger Vergangenheit und einem komplizierten geistlichen Leben. Frauen, die zum rettenden Glauben an Jesus gekommen waren, deren Leben nach ihrer Bekehrung aber nicht dem blitzsauberen christlichen Ideal entsprach. In ihre Geschichten flocht ich meine eigene ein. Die Geschichte meiner Sünde und Erlösung schwang in jedem Wort mit.
Als ich das letzte Lied gesungen hatte, setzte ich mich neben meinen Mann auf einen der braunen Metallstühle, die statt Kirchenbänken in Reihen aufgestellt worden waren. Da ich von lautstark schwadronierenden Predigern die Nase gestrichen voll hatte, bezweifelte ich, dass mir die Botschaft des Pastors, der nun auf die Bühne kam, irgendetwas geben würde. Doch sein bescheidenes, ruhiges Auftreten nahm sofort meine Aufmerksamkeit ein. Respektvoll und in sanftem Tonfall erzählte er die schreckliche Geschichte einer Frau in einem anderen Land, die, wie ich mich erinnere, wegen ihres Glaubens verfolgt worden war.
Ich erspare Ihnen die blutrünstigen Einzelheiten, aber seine leidenschaftliche Erzählung brachte mich tief ins Nachdenken darüber, wie ich in einer ähnlichen Situation wohl reagieren würde. Würde ich mich trotz aller Verluste aus der Asche erheben und Gott loben? Würde ich ihm angesichts solcher Leiden weiter vertrauen? Als die Predigt beendet war, sahen mein Mann und ich uns vielsagend an. Obwohl wir zu dieser Zeit eine andere Gemeinde besuchten, schlossen wir uns schließlich regelmäßiger dieser Schar von Gläubigen an.
Sonntag für Sonntag bekamen wir dort dynamische, nachdenkliche und überzeugende Predigten zu hören. Wir schätzten die intellektuelle Herangehensweise des Pastors und seine frischen biblischen Einsichten. Auch die Gemeinschaft mit anderen ernstlich glaubenden Christen in dieser kleinen, aber wachsenden Gemeinschaft tat uns gut. Zum ersten Mal seit langer Zeit freute ich mich wieder auf den Gottesdienstbesuch. Wir fühlten uns zu Hause.
Besondere Menschen
Etwa acht Monate später lud dieser Pastor mich zu dem Kurs ein, der mein Leben für immer verändern würde – dem Kurs, nach dem ich fortan hinken würde wie Jakob nach seinem Kampf mit Gott. Dem Kurs, der mir dauerhaft eine skeptische Stimme in den Kopf einpflanzen würde – die bis heute meine Fähigkeit beeinträchtigt, ohne inneren Konflikt in der Bibel zu lesen.
Als ich zum ersten Mal mit etwa einem Dutzend anderer Leute in einem Seminarraum der Gemeinde saß, schaute ich mich um. Erst kürzlich hatte die Gemeinde gebaut, sodass sich alles frisch und neu anfühlte. Die Sitzordnung – wir saßen an vier im Karree angeordneten Klapptischen und konnten uns gegenseitig ansehen – förderte eine gute Diskussionsatmosphäre.
Unter den anderen Teilnehmern sah ich hippe, frisch aussehende junge Paare neben älteren Leuten mit wissendem Blick, die eine gelassene Weisheit ausstrahlten. Als junge Mutter mit einem Kleinkind zu Hause verbrachte ich die meiste Zeit damit, Windeln zu wechseln und meine äußerst unternehmungslustige und neugierige Tochter davon abzuhalten, sich mithilfe irgendwelcher Todesfallen zu verstümmeln, die sich als Schreibtischlampe oder gläserner Couchtisch tarnten. Unter «Zeit für mich» stellte ich mir vor, mich zwanzig Sekunden lang einem Tagtraum davon hinzugeben, endlich meine Schwangerschaftshose wegzupacken … oder mal wieder allein aufs Klo zu gehen. Alle intellektuelle Energie, die mir blieb, ging dafür drauf, im Internet nach Tipps fürs Töpfchen-Training oder Infos darüber zu suchen, wie man einem Kind Erdnüsse oder Schalentiere zu essen geben kann, ohne es damit umzubringen. Im Grunde drehte sich mein ganzes Leben darum, ein winziges Menschlein am Leben zu erhalten. Als ich nun in diesem Raum voller Leute saß, die alle clever und gebildet aussahen und ihr Leben im Griff zu haben schienen, fühlte ich mich irgendwie seltsam fehl am Platze.
Was mache ich hier eigentlich? Die anderen sehen alle viel schlauer aus als ich. Ich habe nicht einmal einen College-Abschluss.
«Ich habe Sie alle hierher eingeladen, weil Sie auf irgendeine Weise besonders sind», verkündete der Pastor zu Beginn des ersten Treffens. Wir alle seien, fuhr er fort, Leute, die in ungewohnten Bahnen denken, und dieser Kurs solle für uns ein sicherer Raum sein, in dem wir unsere Zweifel und Fragen verarbeiten könnten. Nachdrücklich erklärte er, er sehe sich nicht als Lehrer dieses Kurses. Stattdessen wolle er die Rolle eines Moderators übernehmen und ermutigte uns als Teilnehmer, unsere Meinung zu sagen und all unsere Gedanken und Fragen mit einzubringen. Als Leitfaden für unsere Diskussionen würden wir etwa alle zwei Wochen ein neues Buch lesen und darüber sprechen.
Ich schaute noch einmal in die Runde der Auserwählten und fragte mich, warum er mich wohl für etwas Besonderes hielt. Vielleicht konnte er die Steine in meinen Schuhen sehen. Vielleicht lag es an dem Song über den Stripclub. Warum auch immer, er sah in mir eine dankbare Abnehmerin für das, was er anzubieten hatte. Für den Augenblick dachte ich, er könne damit recht haben.
Dann offenbarte uns der Pastor: «Ich sehe mich selbst als ‹hoffnungsvollen Agnostiker›.» Das war ein wenig verblüffend; mit Agnostikern hatte ich nicht viel Erfahrung. Als kleines Mädchen hatte ich einmal meinen Gymnastiktrainer gefragt, ob er Jesus kenne, und er hatte geantwortet, er sei ein Agnostiker. Was das genau hieß, wusste ich nicht, aber in meinem kleinen vorpubertären Köpfchen dachte ich, wenn ich ihm ein evangelistisches Traktat gab, würde das diese seltsame geistliche Krankheit, was sich auch dahinter verbarg, schon heilen. Aber was sollte ich mir darunter vorstellen, wenn ein Pastor sich so nannte? Ich wies mein Unterbewusstsein im Stillen streng zurecht, weil es gleich wieder urteilen wollte, und schwor mir, eine offene Haltung zu bewahren.
Das erste Buch, das wir im Kurs lasen und besprachen, war Brian McLarens A Generous Orthodoxy. Darin stieß ich auf eine komplett neue Definition des Wortes Orthodoxie. Ich erfuhr, dass Jesus sich unter keinen Umständen als Christ bezeichnen lassen würde, wenn er heute auf der Erde lebte. Mit jedem Kapitel, das ich las, wuchs mein Unbehagen. Manches fand bei mir Resonanz. McLarens Kritik an historisch unzutreffenden Gemälden von Jesus, an denen ich mich auch schon in dem Song über den Stripclub gerieben hatte, leuchtete mir ein. Ich bin alt genug, um mich noch an die Filzbilder zu erinnern, mit denen die Sonntagsschullehrer meine Aufmerksamkeit fesselten, indem sie die schlichten ausgeschnittenen biblischen Gestalten auf Stoffhintergründen agieren ließen. McLaren schreibt: «Mit diesen Geschichten gewann Jesus mein Herz.»5 Meines auch. Doch mit dem größten Teil des Buches konnte ich mich innerlich nicht abfinden. Vom Kapitel 0 an (das zwischen der Einleitung und Kapitel 1 kommt) scheint McLaren nicht recht zu wissen, was er eigentlich glaubt, und noch bevor er das Kapitel 1 erreicht hat, fängt er schon an, Wörter umzudefinieren. Insgeheim fragte ich mich, ob der Pastor uns diese Lektüre vielleicht deshalb aufgegeben hatte, um das Gespür seiner Kursteilnehmer darauf zu testen, ob ein Autor uns aufs Glatteis zu führen versuchte.
Ich weiß noch, dass mir vor allem ein Konzept von McLaren zu schaffen machte, das er die «Sieben Jesusse» nannte. Er beschrieb sieben Versionen von Jesus, die jeweils auf unterschiedlichen konfessionellen Auffassungen davon basierten, wer Christus ist. Er forderte seine Leser auf, alle unterschiedlichen Versionen zu bejahen und zu feiern. Beim Diskutieren darüber schwelgten die Teilnehmer des Kurses aufklärungsselig im kollektiven Aha-Erlebnis. Ich musste mich fragen, was mit mir nicht stimmte. Ich fühlte mich weder ermutigt noch aufgeklärt noch inspiriert. Mich interessierte eigentlich nur der echte Jesus – der, der in der Bibel beschrieben wurde. Ich gab mir alle Mühe, die sieben Jesusse irgendwie in mein Paradigma einzubauen, aber es gelang mir nicht.
Vielleicht urteile ich zu hart.
Vielleicht bin ich zu engstirnig.
Warum sind die anderen eigentlich alle so begeistert davon?
Eine der jüngeren Frauen in dem Kurs war eine Sängerin und fragte mich, ob wir uns nicht einmal treffen und ein paar Songs zusammen schreiben wollten. «Ich dachte mir, wir könnten doch einen Song über die sieben Jesusse schreiben», schlug sie vor. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich ihr darauf antwortete, aber mein innerer Monolog lief etwa so: Der Song, den ich darüber schreiben würde, würde dir bestimmt nicht gefallen.





























