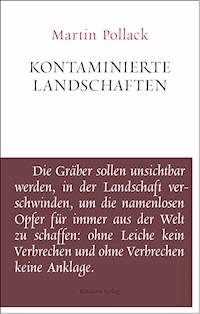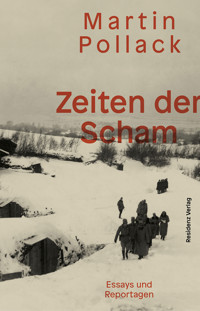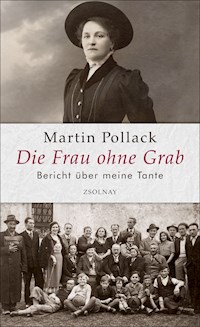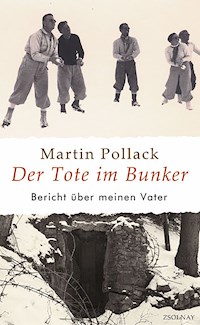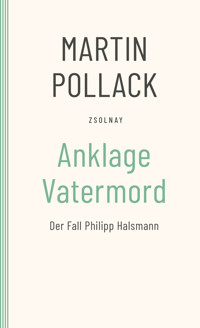
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er zählt zu den besten Fotografen der Welt, seine Porträts der Reichen und Schönen hängen in den wichtigsten Sammlungen. Ein Ereignis lastete jedoch als Trauma auf seinem Leben: Am 10. September 1928 war sein Vater während einer gemeinsamen Bergtour im Tiroler Zillertal tödlich verunglückt, noch am selben Tag wurde Philipp Halsmann wegen Verdachts auf Vatermord verhaftet. In dem politisch aufgeheizten Klima der Zwischenkriegszeit entwickelte sich aus dem Kriminalfall eine internationale Affäre. Martin Pollack ist den Spuren des Falles Halsmann gefolgt und hat sie "mit der Genauigkeit eines leidenschaftlichen Historikers und der Vorstellungskraft eines Erzählers" (Christoph Ransmayr) in einem packenden dokumentarischen Roman aufgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Er zählt zu den besten Fotografen der Welt, seine Porträts der Reichen und Schönen hängen in den wichtigsten Sammlungen. Ein Ereignis lastete jedoch als Trauma auf seinem Leben: Am 10. September 1928 war sein Vater während einer gemeinsamen Bergtour im Tiroler Zillertal tödlich verunglückt, noch am selben Tag wurde Philipp Halsmann wegen Verdachts auf Vatermord verhaftet. In dem politisch aufgeheizten Klima der Zwischenkriegszeit entwickelte sich aus dem Kriminalfall eine internationale Affäre. Martin Pollack ist den Spuren des Falles Halsmann gefolgt und hat sie »mit der Genauigkeit eines leidenschaftlichen Historikers und der Vorstellungskraft eines Erzählers« (Christoph Ransmayr) in einem packenden dokumentarischen Roman aufgezeichnet.
Martin Pollack
Anklage Vatermord
Der Fall Philipp Halsmann
Paul Zsolnay Verlag
Dem Andenken an Ruth Römer und Richard Glaser gewidmet
PROLOG
Während seiner Urlaubsreise hatte Morduch Halsmann einen Traum: Er träumte von einem Freund aus Riga, einem großen und kräftigen Mann, der eines Tages ganz unerwartet gestorben war. Dieser Freund kam auf ihn zu, und Morduch Halsmann wollte ihm schon die Hand zur Begrüßung reichen, da wehrte der Verstorbene erschrocken ab: »Laß das, weißt du denn nicht, daß du einen Toten nicht berühren darfst?«
Sie setzten sich zum Gespräch nieder. Im Verlauf der Unterhaltung vergaß Halsmann, daß er neben einem Toten saß und klopfte dem Freund, wie es seine Gewohnheit war, aufs Knie, um das Gesagte zu bekräftigen. Da rief der Tote entsetzt aus: »Was hast du jetzt getan? Nun mußt auch du sterben!« Er könne den drohenden Tod nur abwenden, sagte der Freund im Traum zu Halsmann, wenn er seine Wohnung neu tapezieren lasse.
Als Morduch Halsmann seiner Frau von diesem Traum erzählte, lachte sie und sagte, nun müßten sie wohl tatsächlich ihre Wohnung neu tapezieren lassen, und dabei sah sie sehr zufrieden aus, weil sie sich das schon seit langem gewünscht hatte, während ihr Mann dies wegen der Kosten und der damit verbundenen Störung des Alltags immer wieder aufschob. Morduch Halsmann pflichtete ihr gutmütig bei und meinte, wenn er noch ein paar solche Träume hätte, dann bliebe ihm wohl wirklich nichts übrig, als den Tapezierer zu rufen.
ERSTES KAPITEL
Über den Beginn der Bergtour ins Tiroler Zillertal wurde im nachhinein kaum mehr gesprochen. Immer nur und immer wieder über die späteren Ereignisse. Wer was gesagt hatte. Wann das gewesen war. Wer wo gesehen wurde. In welchem Aufzug. In welcher Gemütsverfassung. Was er wohl gedacht haben mochte. Erinnerungsfragmente und Spekulationen wurden zu immer neuen Szenen zusammengefügt, die doch nie ein überzeugendes Gesamtbild ergaben oder die ganze Wahrheit enthüllten. Stets blieben Zweifel und Fragen zurück.
Vom Anfang der Tour wissen wir nur so viel, daß Morduch Halsmann und sein Sohn Philipp in Jenbach in den ersten Zug der Zillertalbahn stiegen, der um sieben Uhr abfuhr. Beim Frühstück im Gasthof Goldener Stern, in dem sie übernachtet hatten, hatte Morduch Halsmann seinen Sohn mit barschen Worten zur Eile angetrieben, weil sie sonst noch den Zug versäumen würden. Der Kellnerin, die das Frühstück auftrug, war das grobe Benehmen des Vaters dem erwachsenen Sohn gegenüber in Erinnerung geblieben. Es hatte keinen guten Eindruck bei ihr hinterlassen. Der junge Mann tat ihr leid. Im Zug waren die beiden keinem aufgefallen.
In Mayrhofen, der Endstation der Zillertalbahn, schlugen die Halsmanns den Weg nach Ginzling ein, der in ihrem Reiseführer verzeichnet war: Sie gingen vom Bahnhof durchs Dorf und weiter zwischen Bauernhäusern bis zur Brücke über den Ziller, dann auf der anderen Seite des hellgrünen Flusses entlang bis zu einem Gasthof, hinter dem sie in einen schmalen Feldweg einbogen, der in den Zemmgrund, ein Seitental des Zillertales, führte. Nach drei Stunden erreichten sie Ginzling, eine kleine Häusergruppe am Zemmbach, aus der ein spitzer Kirchturm mit rotem Dach ragte. Hinter dem Weiler wurden die Hänge auf beiden Seiten des Baches, den dichtes Erlengebüsch säumte, immer steiler. Auf den Wiesen standen Braunvieh, Ziegen und manchmal auch Pferde, semmelblonde Haflinger, die den Wanderern nachschauten. Am frühen Nachmittag erreichten die beiden Männer den Gasthof Breitlahner, wo sie Rast einlegten. Es war Samstag, der 8. September 1928.
Der Alpengasthof Breitlahner, an der Stelle errichtet, wo sich das Tal gabelt und der Zamser Bach in den Zemmbach mündet, war eher ein Alpenhotel als ein Gasthof: Ein mächtiges, langgestrecktes Holzhaus, zweistöckig, mit gemauerten Fundamenten, einer geräumigen, verglasten Veranda und vierzig Zimmern. Der Gasthof verfügte schon damals, wie eine zeitgenössische Anzeige vermerkte, über »eigenes elektrisches Licht«, eine eigene Bäckerei, die das Brot bis nach Ginzling lieferte, und sogar eine Sodawassererzeugung. Daneben betrieb der Breitlahnerwirt Wilhelm Eder eine Almwirtschaft, die den Gasthof mit Milch, Butter und Käse versorgte. In der geräumigen Gaststube saßen Sommerfrischler und Bergsteiger mit einheimischen Bauern, Jägern und Hirten zusammen, und manchmal kehrte auch Fürst Franz Josef Auersperg mit einer Gesellschaft ein. Der Fürst besaß im Zillertal ausgedehnte Jagdgründe und war bei der Talschaft sehr beliebt, weil er bei den großen Treibjagden, die er für seine Gäste veranstaltete, die Männer aus Ginzling als Helfer beschäftigte und gut entlohnte. Obendrein ließ er den Großteil des Wildbrets an einheimische Jäger, Treiber oder auch bedürftige Menschen, die sich kein Fleisch leisten konnten, verteilen und behielt nur die Trophäen und die Decken.
Alpengasthof Breitlahner
Hinter dem Gasthof überschritten die Wanderer auf einer überdachten Holzbrücke den Zemmbach und stiegen dann in engen Serpentinen steil bergan. Gegen sechs Uhr abends erreichten sie das Gasthaus Zur Alpenrose. Weil die Dunkelheit hereinbrach und sie schon seit dem Morgen unterwegs waren, beschlossen sie, in der Alpenrose zu übernachten. Dem Wirt Josef Geisler fiel auf, daß Morduch Halsmann für sich und seinen Begleiter, den er als seinen Sohn vorstellte, zwei Einzelzimmer verlangte. Als ihm erklärt wurde, daß alle Einzelzimmer belegt seien und es nur noch Doppelzimmer gebe, beharrte er auf dem Wunsch nach getrennten Zimmern und nahm, ungeachtet der Kosten, zwei Doppelzimmer, was Josef Geisler, wie er später sagte, stutzig machte, weil Bergsteiger für gewöhnlich sparsame Gäste waren und jeden Groschen zweimal umdrehten.
Im Gasthof Zur Alpenrose herrschte an diesem Wochenende reger Betrieb, neben Bergsteigern, die von hier zu weiteren Touren aufbrachen, waren zahlreiche Sommerfrischler aus Mayrhofen und Ginzling unter den Gästen, die den in allen Wanderführern als leicht und gefahrlos beschriebenen Weg bis zur Alpenrose auf sich genommen hatten, um von hier den prachtvollen Blick auf die Eiswelt des Waxeck- und Horngletschers zu genießen. In der Gaststube wurde Karten gespielt, getrunken und gelacht, und Morduch Halsmann schloß rasch mit den Leuten an seinem Tisch Bekanntschaft, von denen ihn manche später als gesellig und unterhaltsam beschrieben, während andere meinten, er habe sich angebiedert. Josefine Gehwolf aus München hatte an diesem Samstag, dem Maria-Geburt-Tag, mit dem Chemiestudenten Max Schmid aus Nürnberg eine Tour auf das Schönbichlerhorn unternommen und war über den sogenannten Berliner Höhenweg zum Zemmgrund abgestiegen und in der Alpenrose eingekehrt. Sie erinnerte sich an Morduch Halsmann als einen älteren Herrn mit rundlichem Gesicht, beginnender Glatze und dünner Goldbrille, hinter der lustige Augen blitzten. Er redete viel und laut, mit deutlichem Akzent, der den Ausländer verriet, und machte gern Witze, die manchmal vielleicht etwas gewagt waren, aber schließlich war man auf einer Hütte und unter Bergkameraden, weshalb sie das nicht weiter übelnahm. Der Sohn war im Gegensatz zum Vater auffallend einsilbig und wirkte durch sein Äußeres noch fremder als dieser: gewelltes, schwarzes Haar, nach hinten gekämmt, ein schütteres Oberlippenbärtchen, schwarze Hornbrillen.
Morduch Halsmann Philipp Halsmann
Im Gespräch stellte sich heraus, daß Morduch Halsmann Zahnarzt in Riga war, während sein Sohn Elektrotechnik in Dresden studierte. Die beiden erklärten, sie wollten am nächsten Tag »den Schwarzenstein machen«, und zwar ohne Führer, weil die Tour in ihrem Buch als einfach und völlig gefahrlos beschrieben wäre. Josefine Gehwolf gab zu bedenken, daß viele Gletscher um diese Jahreszeit tückische Spalten und Schründe aufwiesen, weshalb es ihr doch ratsam erscheine, sich einem Ortskundigen anzuvertrauen, umso mehr, als die Halsmanns, wie sie selber sagten, kaum Bergerfahrung und auch nur eine äußerst dürftige alpine Ausrüstung besäßen. Sie hatten weder Steigeisen noch Eispickel dabei, nur gewöhnliche Wanderstöcke. So könne man auch auf einer an sich ungefährlichen Tour leicht in sein Unglück stürzen, sagte Josefine Gehwolf. Der ältere Halsmann gab ihr recht und erklärte sich bereit, ihrem Rat folgend, einen Führer zu nehmen, ungeachtet der Kosten. Dann fügte er feixend hinzu, sein Sohn würde es vielleicht gar nicht so ungern sehen, wenn er, der Vater, abstürze, denn er warte ja nur darauf, ihn zu beerben, doch diesen Gefallen wolle er ihm nicht tun. Die Gehwolf und ihr Begleiter hielten die Bemerkung für einen Scherz und lachten pflichtschuldig, während Philipp keine Miene verzog und schwieg. Auf Josefine Gehwolf wirkte er verschlossen und mürrisch. Am selben Abend machten die Halsmanns noch die Bekanntschaft eines weiteren Münchner Touristen, der allein unterwegs war und sich bereit erklärte, am nächsten Tag mit ihnen den 3369 Meter hohen Schwarzenstein zu besteigen — auf diese Weise könnten sie die Kosten für den Bergführer teilen und kämen billiger davon. Die Führertaxe von der nahen Berliner Hütte zum Schwarzenstein und zurück war offiziell festgelegt und betrug zwanzig Schilling.
Am frühen Morgen des nächsten Tages stiegen die Halsmanns mit ihrem neuen Bekannten, dem Münchner Elektroingenieur Josef Weil, in Begleitung des Bergführers Franz Steindl zur Berliner Hütte auf, wo sie Steindl an seinen Kollegen Max Pfister aus Jochberg übergab, weil er selber schon eine andere Tour verabredet hatte. Max Pfister war mit seinen Schützlingen bereits einige Zeit unterwegs, als Morduch Halsmann ihn beiläufig fragte, ob er nicht etwas von seinem Tarif nachlassen könne, was Pfister entschieden ablehnte. Er sagte, wenn die Fremden nicht bereit seien, den offiziellen Tarif zu bezahlen, müsse er auf der Stelle umkehren. Halsmann lenkte sofort ein, und der Aufstieg wurde ohne weitere Unterbrechung fortgesetzt. Sonst stellte Pfister den beiden Halsmanns ein gutes Zeugnis aus: Sie gingen sicher und schwindelfrei und hatten nur am Gletscher einige Probleme, weil ihre Bergschuhe zwar neu, aber fürs Eis untauglich waren. Von Unstimmigkeiten zwischen den beiden wollte Pfister nichts bemerkt haben. Morduch Halsmann war gut gelaunt, begrüßte die Bergsteiger, denen sie unterwegs begegneten, mit einem lauten »Berg heil!« und knüpfte gleich eine Unterhaltung an. Auch auf dem Schwarzenstein plauderte und scherzte er angeregt mit anderen Wanderern, besonders mit zwei jungen Schwestern, die in Begleitung von Johann Bauer, Buchhalter eines Sägewerks in Mayrhofen, kurz nach Pfisters Gruppe den Gipfel erreichten. Er zeigte großes Interesse für die alpine Ausrüstung der Tiroler, die Eispickel, Steigeisen und Schneebrillen mitführten. Besonders die Schneebrillen hatten es ihm angetan. Die seien sehr praktisch, sagte er zu seinem Sohn, solche Brillen sollten sie sich für die nächste Tour auch besorgen. »Ach was, das ist nur Einbildung«, erwiderte Philipp abschätzig. Steigeisen seien für solche Höhen unbedingt anzuraten, sagte Johann Bauer, und Marianne Oberforcher, eine der Schwestern, warnte die Fremden, daß eine mangelhafte Ausrüstung ihren Träger leicht in Gefahr bringen könne. »Die Berge verzeihen keinen Fehler«, sagte sie. Als hätte er nur auf dieses Stichwort gewartet, wiederholte Morduch Halsmann seine Äußerung vom Vortag, wonach sein Sohn nur darauf warte, daß er abstürze. Auch diesmal faßten alle die Bemerkung als Scherz auf und lachten. Philipp nahm es gelassen und sagte ironisch: »Sehen Sie, wie schlecht mein Vater von mir denkt?!« Als Johann Bauer später dazu befragt wurde, glaubte er sich allerdings mit einem Mal zu erinnern, daß der Fremde diese Äußerung doch ernst gemeint haben könnte. »Jedenfalls erschien sie mir recht ungewöhnlich.«
Bevor die kleine Gruppe den Abstieg antrat, ersuchte Morduch Halsmann den Bergführer, ihm die Besteigung des Dreitausenders in seinem Notizbuch mit Unterschrift zu bestätigen, wovon Pfister anfangs nichts wissen wollte. Er brummte bloß, so etwas sei in den Bergen nicht üblich, solche Bestätigungen würden nur auf Hütten erteilt. Doch Halsmann ließ nicht locker und meinte, seine Freunde zu Hause in Riga würden ihm sonst nie die Besteigung eines Dreitausenders abnehmen und ihn als Aufschneider verhöhnen, worauf Pfister unwillig ein paar Worte in das hingereichte Notizbuch kritzelte. Die Einheimischen verfolgten die Szene mit amüsiertem Grinsen. Philipp Halsmann sagte rückblickend, die Tiroler hätten sich über sie lustig gemacht, weil sie in ihnen Juden erkannt hätten.
Auf dem Rückweg vom Schwarzenstein unternahmen Morduch und Philipp Halsmann einen Abstecher zum Schwarzsee. Weil es ein heißer Septembertag war, wagten sie ein Bad im klaren, eiskalten Wasser, und während der Vater noch im Gebirgssee planschte, holte Philipp seinen Photoapparat aus dem Rucksack und schoß ein paar Aufnahmen von ihm, die ihn zuerst im Wasser zeigten und dann am Ufer, ausgelassen lachend wie ein Kind. Am Schwarzsee trafen die Halsmanns wieder die Bekannten von der Alpenrose, Josefine Gehwolf und Max Schmid. Josefine Gehwolf erinnerte sich später an eine Bemerkung des alten Halsmann, wonach ihn der Sohn aufgefordert habe, den See zu durchschwimmen. Sie meinte nicht ohne Koketterie, der ältere Herr habe das vielleicht bloß gesagt, um vor ihr zu prahlen. Nach Aussagen seines Sohnes war Morduch Halsmann übrigens Nichtschwimmer.
Vom Schwarzsee gingen die beiden zurück zur Berliner Hütte, in der sie einkehrten. Vor der Hütte fielen Philipp zwei junge Männer auf, die in der Sonne saßen und Bier tranken. Aus ihrer Unterhaltung schloß er, daß sie Italiener waren. Die beiden Männer trugen schwarze Pullover, weshalb er sie für Faschisten hielt oder auch für Deserteure, die über die italienische Grenze gekommen waren (tatsächlich lag die nahe Schwarzensteinhütte bereits auf italienischem Gebiet). Von der Berliner Hütte marschierten die Halsmanns wieder zum Gasthaus Alpenrose, wo sie in denselben Zimmern übernachteten wie am Tag zuvor.
Am Montag, dem 10. September, brachen die Halsmanns, erneut in Begleitung des Münchner Bergsteigers Josef Weil, in der ersten Morgendämmerung zum Schönbichlerhorn auf, das ebenfalls knapp über dreitausend Meter hoch ist. Während des beschwerlichen Aufstiegs über steile Blockhalden und Schneefelder klagte er wiederholt, er wisse nicht, was mit ihm los sei, heute falle ihm das Steigen viel schwerer als gestern. Um zehn Uhr erreichten sie den Gipfel, auf dem ein eisiger Wind wehte. Josef Weil war als erfahrener Alpinist ausreichend für die tiefen Temperaturen in der Höhe gekleidet und wunderte sich über die mangelhafte Ausrüstung seiner beiden Begleiter, die vor Kälte zitterten. Morduch trug zwar einen Pullover, hatte aber keine Windjacke, während Philipp überhaupt nur ein Hemd anhatte und über diesem einen dünnen Gummimantel. Nicht einmal Proviant führten sie mit. Sie blieben daher nur kurz auf dem Gipfel, gerade lang genug, daß Philipp die Bemerkung, »Wie wäre es mit einer Zentralheizung?« ins Gipfelbuch schreiben konnte, dann stiegen sie auf der anderen Seite des Schönbichlerhorns in Richtung Zamsergrund ab. Josef Weil blieb wegen der Aussicht länger auf dem Gipfel zurück. Beim Abstieg ging der Vater wieder ohne Beschwerden und erklärte, er wolle noch am selben Tag bis Mayrhofen marschieren, um den Zug nach Jenbach zu erreichen, wo er von seiner Frau im Gasthof Goldener Stern erwartet wurde. Philipp war von diesem Plan wenig begeistert und meinte, er sei viel zu müde, um am selben Tag bis Mayrhofen zu gehen, er wolle irgendwo übernachten, am besten im Gasthof Breitlahner, und am nächsten Tag nachkommen. Der Vater erklärte sich damit einverstanden, und um die Mutter nicht unnötig zu beunruhigen, schrieb Philipp einen Satz in dessen Notizbuch: »Ich bin vollkommen gesund und grüße Dich.«
Bei einer Scharte unterhalb des Schönbichlerhorns trafen sie eine Gruppe deutscher Bergsteiger, denen die beiden auffielen, weil sie »gänzlich unalpin« ausgerüstet waren, wie es Dr. Wilhelm Geilenkirchen, Syndikus in Bonn, ausdrückte. Als sie außer Hörweite waren, sagte der Bonner Jurist zu seinen Begleitern, »der Alte« (Morduch Halsmann hatte gerade das 49. Lebensjahr vollendet) habe nach Geld gerochen. Was diesen Eindruck in ihm erweckt hatte, wußte er später nicht mehr zu sagen. Von Unstimmigkeiten zwischen den beiden Wanderern hatten die Deutschen nichts bemerkt.
Diesen Eindruck bestätigten auch Alfons Hörhager und Anna Gruber, Hüttenwirt und Kellnerin vom Furtschaglhaus, wo die Halsmanns etwa eineinhalb Stunden nach Verlassen des Gipfels eintrafen. Sie hätten nur wenig miteinander gesprochen und das in einer fremden Sprache, sagte Anna Gruber, trotzdem schienen sie sich gut zu vertragen, ja der Jüngere sei geradezu rührend um das Wohlergehen des Älteren besorgt gewesen. Als Anna Gruber Morduch die Suppe vor dem Wiener Schnitzel servieren wollte, ersuchte sie der Begleiter, diese wieder wegzunehmen und einstweilen warm zu stellen: Sie solle die Suppe erst auftragen, wenn der Vater mit dem Schnitzel fertig sei, dieser esse die Suppe immer erst nach der Hauptmahlzeit. So etwas hatte das Tiroler Mädchen noch nie gehört, und es machte eine dementsprechende Bemerkung zu Alfons Hörhager, der nur die Achseln zuckte. Als Hüttenwirt hatte er schon einiges gesehen und erlebt. Sonst fiel Anna Gruber an den beiden Fremden nichts weiter auf. Sie aßen hastig, weil sie es offenbar eilig hatten, weiterzukommen, und bezahlten mit österreichischem Geld; fremde Valuta sah die Kellnerin keine.
Nach dem Essen machten sich die Halsmanns sofort auf den Weg. Vor dem Furtschaglhaus begegneten sie noch einmal Alfons Hörhager, der gerade dabei war, sein Saumpferd zu satteln, um zum Breitlahner zu gehen, von wo er Brot und andere Lebensmittel holen wollte. Morduch Halsmann schulterte den kleinen Rucksack aus gestreiftem grüngrauen Leinen, den bisher Philipp getragen hatte, und forderte den Sohn auf, Mantel und Hemd auszuziehen, um den lästigen Akneausschlag am Oberkörper, an dem Philipp seit einiger Zeit litt, der Sonne auszusetzen, wie das Philipps Arzt in Dresden empfohlen hatte. Den leichten Gummimantel nahm Philipp über den Arm; in einer Hand trug er den Photoapparat, in der anderen den Wanderstock. Mit dem Ausziehen des Hemdes wollte er warten, bis sie außer Sichtweite der Leute waren, die vor dem Furtschaglhaus in der Sonne saßen.
In der Nähe einer Almhütte wurden die beiden Männer von einem Hirten gesehen, der eine Weile hinter ihnen herging. Vater und Sohn unterhielten sich angeregt. Philipp erzählte später, sie hätten über den Weg gesprochen, der noch vor ihnen lag, und er habe den Vater überreden wollen, mit ihm beim Breitlahner zu bleiben, weil er befürchtete, der Gewaltmarsch nach Mayrhofen könnte ihn zu sehr anstrengen.
Morduch Halsmann war keineswegs von so robuster Gesundheit, wie er gern vorgab, und er hatte während des Urlaubs schon Schwächeanfälle erlitten, die seiner Familie große Sorge bereiteten; doch die Ermahnungen, sich zu schonen und auf seine Gesundheit zu achten, hatte er jedesmal in den Wind geschlagen. Er ließ sich auch jetzt nicht umstimmen. Der Hüterbub verstand nicht, worüber die beiden Männer sprachen, nur daß sie laut in einer fremden Sprache redeten, und er beobachtete, daß der Jüngere dabei heftig mit den Händen fuchtelte. Als der Ältere bei einer Quelle stehenblieb, um Wasser zu trinken, wagte sich der Junge näher und bot den beiden Granatsteine, die er gesammelt hatte, zum Kauf an. Der Jüngere lehnte mit einer kurzen Kopfbewegung ab, ohne ein Wort zu sagen. Dabei habe er böse geschaut, sagte der Hüterbub später.
Dominikushütte
Unterwegs prüfte Morduch Halsmann seine Barschaft, um zu sehen, wieviel österreichisches Geld sie noch besaßen. Er hatte fünfzig Schilling, zwei Zwanzigschillingnoten und eine Zehnschillingnote. Das reiche für beide, sagte er zu Philipp. Auf dem Weg ins Tal kamen ihnen ein paar Wanderer entgegen, bei deren Näherkommen der Jüngere jedesmal rasch seinen Gummimantel überwarf, weil er es offenbar für unschicklich hielt, den Fremden mit entblößtem Oberkörper gegenüberzutreten. Philipp war todmüde und trottete nur noch apathisch und gleichgültig hinter dem Vater her, der weiter ein scharfes Tempo einschlug, um in Mayrhofen den letzten Zug nach Jenbach zu erreichen. Kurz nach zwei Uhr kamen sie zur Dominikushütte. Von hier waren es noch eineinhalb Stunden bis zum Breitlahner.
Auf der Terrasse vor der Hütte saßen Gäste, die beobachteten, daß der jüngere der beiden Wanderer bei ihrem Anblick in den Mantel schlüpfte. Einigen fiel auf, daß der Ältere den Rucksack trug, was ihnen ungehörig erschien: ein kräftiger junger Mann, der seinen älteren Begleiter den Rucksack tragen ließ? Unter den Gästen auf der Terrasse waren auch die Bergsteiger Karl Nettermann und Max Schneider, die Vater und Sohn Halsmann schon auf der Berliner Hütte gesehen und vor ihnen die Tour übers Schönbichlerhorn gemacht hatten.
»Schau, da kommen die zwei Juden von der Berliner Hütte«, sagte Schneider zu Nettermann.
ZWEITES KAPITEL
Marianne Hofer war in der Nähe der Wesendlealpe beim Beerenklauben, als Philipp Halsmann auf sie zustürmte. Zuerst verstand sie nicht gleich, was der Fremde wollte: Er stammelte außer Atem etwas in einer Sprache, die sie nicht kannte, und packte sie schließlich heftig am Arm. Über dem nackten Oberkörper trug er bloß einen offenen Regenmantel. Endlich begriff sie: Sein Vater war abgestürzt. Er brauchte Hilfe. Einen Arzt. Ob denn hier kein Mann sei? Anscheinend traute er der jungen Frau nicht zu, daß sie selber wirksam helfen könne. Marianne Hofer war Sennerin auf der Wesendlealpe und hatte schon oft mit Bergunfällen zu tun gehabt. Sie fragte, ob der Abgestürzte noch lebe. Das konnte der junge Mann nicht mit Sicherheit sagen, aber er meinte, es sei wohl noch Leben in ihm gewesen, als er ihn verließ, um Hilfe zu holen.
Marianne Hofer verständigte zuerst ihren Bruder, den Hirten Alois Riederer, der etwas weiter talauswärts beim Holzarbeiten war. Philipp Halsmann drängte sie, zum Breitlahner zu laufen und einen Arzt zu rufen. Er selber machte sich mit Riederer eilig auf den Rückweg zur Unfallstelle.
Etwa eine Viertelstunde, nachdem Morduch und Philipp Halsmann die Dominikushütte passiert hatten, brachen zwei junge Frauen von dort auf: Maria Rauch und Maria Ossana, die in der Berliner Hütte als Kellnerinnen beschäftigt waren, wo sie die beiden Halsmanns auch gesehen hatten. Sie schlugen ebenfalls den Weg zum Breitlahner ein. Zehn Minuten später folgten ihnen ein unbekanntes Paar und einige Zeit darauf noch Karl Nettermann und Max Schneider. Der etwa einen Meter breite Saumweg von der Dominikushütte zum Breitlahner, der über dem Zamserbach dahinlief, wurde an diesem Tag viel frequentiert.
Gendarmeriebeamte aus Mayrhofen versuchten später, die Identität des unbekannten Paares zu eruieren, das am 10. September 1928 auf dem Weg von der Dominikushütte von mehreren Menschen gesehen worden war. Sie durchforsteten die Fremdenbücher von Gasthöfen und Hütten und fanden tatsächlich die Namen einiger Paare, die zunächst in Frage zu kommen schienen, aber nach eingehender Befragung dann doch wieder ausschieden — letztlich verliefen alle Nachforschungen im Sand.
Maria Rauch und Maria Ossana waren etwa eine Viertelstunde unterwegs, als sie an einer seichten Stelle des Baches den reglosen Körper eines Mannes entdeckten, der im rechten Winkel zum Bachbett im Wasser lag, den Kopf schon fast am Ufer, die Arme am Körper anliegend. Kopf und Oberkörper lagen in einer kleinen Bucht, die der Bach hier bildete, die Unterschenkel wurden von der Strömung hin und her gespült. Obwohl der Weg etwa fünfzehn Meter über dem Bach dahinfiihrte, konnten sie deutlich erkennen, daß der Kopf tiefe Wunden aufwies. Maria Ossana sagte in der Untersuchung mit Bestimmtheit aus, das Gesicht des Toten habe im Wasser gelegen und nur der Hinterkopf habe herausgeschaut. Maria Rauch konnte das nicht mit Sicherheit bestätigen. An der Kleidung erkannten sie den älteren Wanderer, den sie mit seinem Begleiter zuerst in der Berliner Hütte und dann vor der Dominikushütte gesehen hatten; der Junge war nirgends zu sehen. Das erschien den Frauen unheimlich, und sie beschleunigten ihre Schritte. Ein paar Minuten später kamen ihnen Alois Riederer und Philipp Halsmann entgegen, die wortlos an ihnen vorbeirannten.
Alois Riederer erreichte die Unglücksstelle vor Philipp Halsmann. Er sagte aus, er habe den Körper eher parallel zum Ufer liegend gefunden. Auf dem Bauch. Die Arme weit ausgestreckt, wie gekreuzigt. Der Kopf war zur Hälfte unter Wasser. Wenn der Mann nicht schon durch den Absturz den Tod gefunden hat, dann muß er ertrunken sein, dachte der Hirte, als er eilig über die mit Geröll und flachen Felsen durchsetzte Böschung zum Bach hinunterstieg. Links und rechts von der Absturzstelle war der Hang dicht mit Erlen, Birken und Stauden bewachsen, die einen Stürzenden aufgefangen hätten. Nur an dem Hangstück oberhalb des Verunglückten hatte ein Erdrutsch den nackten Boden freigelegt.
Wieviel Zeit war zwischen der unheimlichen Entdeckung der beiden Frauen und dem Eintreffen Riederers bei dem Mann im Bach verstrichen? Ein paar Minuten. Drei? Fünf? Ganz genau wurde das nie festgestellt. Die Behörden gaben sich allerdings auch keine besondere Mühe, es zu eruieren, wahrscheinlich weil sie es für unwichtig hielten.
Als Riederer bei Morduch Halsmann ankam, stellte er fest, daß dieser tot war. Der Hinterkopf wies schreckliche Wunden auf, und das Gesicht lag im seichten Wasser auf einem weißen Tuch — später stellte sich heraus, daß es sich dabei um Philipps Hemd handelte, auf das er den Kopf seines Vaters gebettet hatte. Auf dem Rücken trug der Tote einen kleinen Rucksack und an einem Riemen um den Hals ein Fernglas. Riederer hob den Kopf an: Auch das Gesicht war blutverschmiert, obwohl es im Bach gelegen hatte. Das ruhige Wasser, in dem der Körper lag, war rötlich, vermutlich vom Blut. Der Hirte nahm dem Toten Rucksack und Fernglas ab.
Philipp Halsmann traf kurze Zeit später ein. Er war durch die vorangegangenen Strapazen und die Aufregung erschöpft und am Rand seiner Kräfte. Er fragte, ob der Vater noch lebe, was Riederer verneinte. Gemeinsam zogen sie die Leiche so weit heraus, daß nur mehr die Füße bis zu den Knöcheln im Wasser waren. Als Riederer wieder hinaufstieg, trat er an der Kante zur Böschung eine der Steinplatten heraus, die dort lose zu einer niedrigen Mauer übereinandergeschichtet waren, um den Weg vor dem Abrutschen zu bewahren. Der Hirte lief zur Dominikushütte, von wo er Hilfe und eine Tragbahre holen wollte; der Sohn blieb beim toten Vater zurück. Philipp gab später zu Protokoll, er habe noch nie zuvor eine Leiche gesehen, weshalb er gar nicht mehr hinschauen konnte.
Auf dem Weg zur Hütte traf Riederer Max Schneider und Karl Nettermann, die er von dem Unfall verständigte. Nettermann meinte, das müßten sie unbedingt sehen, worauf sie zur Absturzstelle liefen, wo sie zuerst nur die Leiche unten am Bach sahen. Nach einer Weile entdeckten sie Philipp, der reglos auf einem Stein neben dem Toten saß, den Kopf auf die Arme gestützt. Sie riefen ihm zu, er solle zu ihnen hinaufkommen.
Karl Nettermann ließ sich von Halsmann den Hergang des Unglücks schildern. Bei der Gendarmerie gab er am nächsten Tag an, Philipp habe gesagt, er sei hinter dem Vater gegangen, und dieser sei plötzlich mit einem leisen Aufschrei rücklings den zum Bach führenden steilen Hang hinuntergestürzt.
Schneider gab eine andere Version zu Protokoll. Ihm habe der Sohn des Verunglückten berichtet, er sei ein paar Meter vor seinem Vater gegangen, als er plötzlich einen leisen Schrei hörte, worauf er sich umdrehte und gerade noch sah, wie der Vater rücklings vom Weg stürzte. Übereinstimmend sagten sie aus, Philipp Halsmann sei sehr erregt gewesen, habe gebrochen deutsch gesprochen und immer wieder »Bosche, bosche!« gerufen, was sie nicht verstanden hätten.
Als ihn Nettermann fragte, an welcher Stelle der Vater abgestürzt sei, schaute sich Philipp suchend um, und als er den Stein entdeckte, den Riederer aus der Stützmauer getreten hatte, zeigte er auf die Stelle. Dort sei es geschehen. Er flehte die beiden an, die Leiche des Vaters zu bergen. Nettermann stieg hinunter, um den Toten mit Hilfe seines Kletterseiles zum Weg hochzuziehen. Auf einer kleinen Sandbank neben der Leiche entdeckte er eine offene Brieftasche und einige Papiere, deren Schrift durch das Wasser verwischt war. Geld sah er keines. Er steckte die Papiere in die Brieftasche und diese in den kleinen Rucksack, der bei der Leiche lag. Nettermann stellte fest, daß der Rucksack geradezu von Blut durchtränkt war, das ihm schon ganz »sulzig« erschien. Er trug den Rucksack zum Weg hoch und wollte gerade damit beginnen, die Leiche mit dem Seil ganz aus dem Wasser zu ziehen, als ihm einfiel, daß es vielleicht besser sei, sie vor dem Eintreffen der Behörden nicht von der Stelle zu bewegen. Er sagte daher zu Philipp, die Leiche sei ihm zu schwer. In der Zwischenzeit war Riederer von der Dominikushütte zurückgekehrt, ohne Trage, weil es dort keine gab. Max Schneider nannte das einen Skandal, der in die Zeitung gebracht werden müsse. Philipp sagte immer wieder, er müsse seine Mutter benachrichtigen, und machte sich schließlich in Begleitung Riederers auf den Weg zum Breitlahner, wo es das nächste Telephon gab, das allerdings nur bis sechs Uhr abends in Betrieb war. Nettermann und Schneider blieben beim Toten zurück.
Der Wirt der Dominikushütte, Josef Eder, war von Riederer vom Unglück in Kenntnis gesetzt worden. Als Riederer nach einer Tragbahre verlangte, fragte Eder, wozu die gebraucht werde. Ein Herr sei abgestürzt und müsse nun fortgetragen werden, erklärte Riederer, er sei nämlich schon tot. In Gottes Namen, rief Eder, wie sei denn das zugegangen, habe ihn etwa der Schlag getroffen? Das wisse er nicht, gab Riederer zur Antwort, er könne nur sagen, daß der Verunglückte den Kopf ganz zerschlagen habe. Da werde es wohl besser sein, wenn er selber nachsehe, erklärte Eder. Und obwohl sich der Hüttenwirt bei einem Sturz ein Bein gebrochen hatte und immer noch an zwei Stöcken ging, machte er sich sofort auf den Weg zur Unglücksstelle. Als Begleitung nahm er seinen Hund mit, eine Schäferhündin namens Hedi, von der Eder behauptete, sie sei eine Kreuzung zwischen einem Wolf und einer Schäferhündin. Trotzdem schickte ihm seine Frau die Kellnerin Anna Wiedner hinterher, weil sie befand, ein Unglück reiche gerade, schließlich hatte ihr Mann noch ein Bein im Gips.
Als Eder an die Unfallstelle kam, äußerte er sofort Zweifel an der Unfallversion. An dieser Stelle könne man gar nicht abstürzen, versicherte er. Seine Bedenken gründeten wohl nicht zuletzt darin, daß er als Wirt der Dominikushütte für den Zustand des Saumweges verantwortlich war, und um den stand es nachweislich nicht zum besten. Als man im Sommer 1928 damit begann, einen neuen Weg von der Dominikushütte zum Friesenbergkar anzulegen, wo ein neues Schutzhaus errichtet werden sollte, wurden Forderungen laut, bei dieser Gelegenheit auch gleich den Weg von der Dominikushütte zum Breitlahner in Ordnung zu bringen, der sich »in einem jeder Beschreibung Hohn sprechenden Zustand befindet«, wie eine Lokalzeitung nur wenige Tage vor dem Unglück vermerkt hatte. Der Weg bilde »geradezu eine Lebensgefahr für die Passanten«. Tatsächlich war zwei Wochen zuvor ein Jagdgast des Fürsten Auersperg unweit der Stelle, an der Morduch Halsmann den Tod fand, mit seinem Reitpferd vom schmalen Pfad abgekommen: Der Reiter hatte sich im letzten Moment durch einen Sprung retten können, doch das Roß war in die reißenden Fluten gestürzt und auf der Stelle tot gewesen. Am Tag des Unglücks lag das Pferd immer noch im Wildbach, allerdings ohne Kopf — den hatte ein Jäger auf Geheiß des fürstlichen Forstverwalters abgeschnitten, weil er aus dem Wasser ragte und angeblich mit seinen glotzenden Augen einen grausigen Anblick bot. Warum ein kopfloser Kadaver ein wesentlich erfreulicheres Bild bieten sollte, wurde nicht gesagt.
Eder ließ sich die angebliche Absturzstelle zeigen und untersuchte die Böschung, konnte jedoch keine Abdrücke entdecken, wie sie ein stürzender Körper hinterlassen mußte. Auch Blut war an den Steinen in der Böschung keines zu sehen. Das könne er nicht enträtseln, sagte der Hüttenwirt zu Nettermann, der den Hüttenwirt auf das seltsame Verhalten seines Hundes aufmerksam machte: Hedi schnüffelte mit eingezogenem Schwanz aufgeregt an einer Stelle am Weg herum. Als Eder den Hund wegzerrte und mit einem Stock im Gras stocherte, entdeckte er Blutspritzer, und als er das Erdreich aufwühlte, kam immer mehr Blut zum Vorschein. Die Erde war darüber hinaus ganz vertreten, und es fanden sich zahlreiche Schuhabdrücke, gerade so, als habe jemand versucht, eine Blutlache zu verscharren. Unterhalb der Stützmauer waren die Erlenstauden bis in Kniehöhe mit Blut bespritzt.
Josef Eder war der erste, der Nettermann gegenüber den Verdacht äußerte, hier sei kein Unglück geschehen, sondern eine Bluttat: »Holla, das ist etwas ganz anderes als ein Absturz. Ob der ihn nicht angeschossen hat? Vielleicht finden wir noch einen Revolver!«
Die drei Männer setzten, unterstützt von der Wolfshündin, die Suche fort. Sie entdeckten eine blutige Schleifspur im Gras, die von der vertretenen Stelle weg zum Rand der Böschung führte.
Es hat ausgeschaut, als habe man ein abgestochenes Schwein darübergeschleift, sagte Eder bei der ersten Befragung durch Untersuchungsrichter Wilhelm Kasperer, der den Hüttenwirt als überaus gesprächig und temperamentvoll bezeichnete, weshalb er es sich ersparte, alles zu notieren, was dieser sagte. Den drastischen Vergleich mit dem geschlachteten Schwein, den Eder dann auch vor Gericht wiederholte, nahm Kasperer allerdings zu Protokoll.
Nach eifriger Suche fand Eder unter einem Grasbüschel einen handtellergroßen, blutigen Stein, an dem etwas klebte, was er und seine Helfer für Haare hielten. Daneben waren im Gras kleine weiße Teilchen auszumachen. Knochensplitter? Gehirnpartikel? Nachher wurde kritisiert, die drei Amateurdetektive hätten bei ihrem Herumstöbern möglicherweise wichtige Spuren übersehen oder gar zerstört.
Später, auf seiner Hütte, in der Familie und vor Freunden, sollte Eder dann eine etwas abweichende Version vom Fund des blutigen Steines erzählen. Demnach hatte nicht er den Stein entdeckt, sondern die Hündin Hedi, die ihren Fund nach Hundeart nicht mehr herausrücken wollte und ihren Herrn beinahe gebissen hätte, als er ihr diesen gewaltsam entriß. Vielleicht waren Eder Zweifel gekommen, ob die Gendarmen den Einsatz seiner Hündin gutheißen würden, weshalb er sich selber zum Finder ernannte? Die Hündin wurde jedenfalls Jahre nach dem Vorfall von Unbekannten vergiftet. Sie war eines Tages plötzlich verschwunden und wurde erst nach langem Suchen tot und mit Schaum vor dem Maul bei einem Stadel gefunden.
Auf dem Weg zum Breitlahner begegnete Philipp einer Gruppe mit einer Trage: die von Marianne Hofer alarmierten Männer, Jäger und Treiber, die nach einer Jagd des Fürsten Auersperg im Breitlahner eingekehrt waren. Es war eine kleine Expedition, die vom Alpengasthof zur Unfallstelle aufbrach: der Hirt Alois Riederer und seine Schwester Marianne Hofer, sieben Treiber, der Arzt Dr. Roland Rainer, der an der Jagd des Fürsten teilgenommen hatte, und der Wirt vom Furtschaglhaus, Alfons Hörhager. Als Philipp die Trage sah, fragte er die Männer, ob die für seinen Vater bestimmt sei. Sie bejahten. Sie kämen zu spät, sagte er, schloß sich jedoch der Bergungsmannschaft an und ging wieder zurück zur Unfallstelle.
Dort hatte inzwischen Josef Eder das Kommando übernommen. Er gab Anweisung, die Leiche mit Zweigen und Farnen zu bedecken und dem jungen Halsmann nichts von der Blutspur und dem Stein zu erzählen. Wenn er zur Leiche seines Vaters wolle, müßten sie ihn daran hindern und sagen, der Mann mit den zwei Stöcken habe es verboten. Falls er fragen sollte, wer dieser Mann sei, sollten sie sagen, das bleibe geheim.
Halsmann bestand darauf, die Leiche zum Weg hinaufzuschaffen, doch Eder lehnte das ab. »Ich verbiete das. Es ist in Tirol Sitte, daß eine Leiche so lange liegenbleiben muß, bis eine Kommission eintrifft.«
Wer Eder denn sei, daß er das verbieten könne, fragte Philipp betroffen.
»Ich bin ein Geheimer, und wer ich bin, werden Sie schon noch beizeiten erfahren«, antwortete der Hüttenwirt, der seine Rolle als geheimer Bergpolizist mit Überzeugung spielte.
Ob er ihn etwa verdächtige, den Vater vom Weg gestoßen zu haben, empörte sich Philipp. Er könne doch nicht ewig hier bleiben, er müsse seine Mutter verständigen, die in Jenbach auf ihre Rückkehr warte. Eder wollte Halsmann von der Unglücksstelle, die er längst für einen Tatort hielt, weg haben und drängte ihn, zum Breitlahner zu gehen. Das Telephon dort sei nur bis um sechs Uhr in Betrieb, dann beende das Telephonfräulein in Mayrhofen seinen Dienst, er solle sich also beeilen. Zwei Treibern befahl er, dem »angeblichen Sohn« als Aufpasser zu folgen und ihn im Gasthof festzuhalten. Außerdem sollten sie die Gendarmerie verständigen. Einem der Bewacher gab er den blutbeschmierten Rucksack mit.
Der Untersuchungsrichter fragte später die Zeugen, ob sie am jungen Halsmann Blutspuren bemerkt hätten. Keiner hatte welche gesehen, obwohl sie ihn genau gemustert hatten. Karl Nettermann erinnerte sich, daß Philipp nur einen Mantel trug, den er ständig zuhielt, vielleicht weil ihm kalt war.
Bisher hatten sich nur Laien an der Unglücksstelle zu schaffen gemacht. Der Sohn des Toten, Philipp Halsmann, der Hirte Alois Riederer, die beiden Touristen Karl Nettermann, Lokomotivheizer in Mürzzuschlag, und Max Schneider, Buchhandlungsgehilfe aus Leipzig, der Wirt der Dominikushütte, Josef Eder, und nicht zuletzt seine Hündin Hedi. Dr. Roland Rainer, Sprengelarzt in Fügen im Zillertal, ein begeisterter Jäger und Alpinist, war der erste Experte. Als er die blutige Schleifspur sah, meinte er, die sei »etwas ganz G’spaßiges«. Dann ordnete er an, die Blutspuren vorsichtig mit Kotzen abzudecken. Nach kurzem Augenschein kehrte die Expedition wieder zum Breitlahner zurück. Die Leiche blieb am Bach, mit dem Hirten Riederer als Wache.
Obwohl der Zamsergrund sehr abgelegen war — selbst der zwei Gehstunden talauswärts liegende Weiler Ginzling war erst ab 1930 mit dem Postautobus erreichbar, vorher war die schmale Schotterstraße nur mit dem Motorrad passierbar —, verbreitete sich die Nachricht von dem Unglück in Windeseile. In den Tagen danach wurde im ganzen Zillertal über den Todessturz in den Zamserbach geredet, obwohl tragische Ereignisse in den Bergen keine Seltenheit waren. Doch noch war es eine lokale Tragödie, die kein solches Aufsehen erregte wie etwa das schreckliche Autounglück in Italien, von dem am 10. September 1928 alle Tiroler Zeitungen groß berichteten: Beim Rennen um den Großen Preis von Monza hatte der gefeierte italienische Fahrer Emilio Materassi bei einer Geschwindigkeit von annähernd 200 Stundenkilometern auf der geraden Strecke unmittelbar vor der Tribüne die Herrschaft über seinen Talbot-Rennwagen verloren, war über die Bahn hinausgeschossen und in die Zuschauer gerast. Der Wagen hatte förmlich eine blutige Schneise in die dichte Menge gerissen. Es gab zahlreiche Verletzte und 27 Tote, unter denen sich auch der Lenker des Unglückswagens befand.
Gegen 17 Uhr traf die Expedition wieder im Gasthof Breitlahner ein, wo Philipp Halsmann von einem zufällig als Urlaubsgast anwesenden Münchner Kriminalkommissar durchsucht wurde. Halsmann mußte seine Taschen leeren, in denen sich jedoch nichts fand, was als Waffe geeignet gewesen wäre. In der linken Außentasche des graubraunen Kleppermantels, den Philipp nach wie vor über dem nackten Oberkörper trug — sein einziges Hemd war beim Toten geblieben —, waren ein kleines Stück Seife, in Papier gewickelt, zwei graubraune Herrensocken, zwei Sockenhalter und ein Stück von einem Schuhband; in der rechten Außentasche zwei weiße Taschentücher, eines davon gebraucht. Der deutsche Kriminalbeamte untersuchte den Verdächtigen und seine Kleidung auch auf Blutspuren, fand jedoch keine. Nach der Untersuchung reichte er Philipp die Hand.
Der blutige Rucksack wurde dem Breitlahnerwirt Wilhelm Eder, einem Bruder von Josef Eder von der Dominikushütte, zur Aufbewahrung übergeben, der ihn im Telephonzimmer abstellte. Bei einer flüchtigen Untersuchung sah er an der Außenseite des Rucksacks einen großen Blutfleck, der schon eingetrocknet war. Auch seine Frau Rosa besah sich das Blut am Rucksack genau. Wenn es noch feucht gewesen wäre, so sagte sie später, hätte sie den Männern niemals gestattet, den Rucksack ins Zimmer zu stellen.
Um 17.30 Uhr verständigte Wilhelm Eder telephonisch den Gendarmerieposten in Mayrhofen. Daß der Posten Mayrhofen über einen eigenen Anschluß verfügte, war keineswegs selbstverständlich. Von den insgesamt 109 Gendarmerieposten, die es 1928 in Tirol gab, besaßen nur 41 Telephon. In der ersten Meldung hieß es, ein Mann russischer Nationalität sei an einer sonst ungefährlichen Stelle tödlich abgestürzt. Nach Ansicht des zufällig in Breitlahner anwesenden Arztes Dr. Roland Rainer aus Fügen sei nicht auszuschließen, daß es sich um ein Verbrechen handle, weshalb nach Meinung des Arztes, der das wohl am besten beurteilen könne, »eine Gerichtskommission notwendig werden dürfte«. Das Unglück sei vom Sohn des Toten gemeldet worden, der übrigens selber als Täter in Frage komme.
Der Gastwirt wurde von den Gendarmen beauftragt, dafür zu sorgen, daß die Leiche nicht von der Stelle bewegt werde, und den verdächtigen Sohn bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten.
Nach der Untersuchung durch den Münchner Kriminalbeamten wurde Philipp Halsmann in die Gaststube geführt, wo die Auerspergschen Jäger und ihre Gehilfen am Stammtisch saßen. Die Stube war mit Zirbenholz vertäfelt, und an den Wänden hingen Reh- und Gamskrickel, auch ein ausgestopftes Murmeltier thronte auf einem kleinen, mit trockenem Moos dekorierten Brett und schaute aus braunen Glasaugen auf die Gäste hinunter. Philipp, der immer noch den Gummimantel über dem nackten Oberkörper trug, wurde aufgefordert, sich zur angeheiterten Gesellschaft zu setzen, die Anweisung erhielt, ihn zu bewachen. Wie er später berichtete, durfte er den Tisch nicht verlassen, wurde grob behandelt und von Zeit zu Zeit grundlos angebrüllt. So verbrachte er geschlagene fünf Stunden in der verrauchten, lauten Stube, umringt von nach Tabak und Alkohol riechenden Menschen, die noch dazu einen Dialekt sprachen, von dem er kaum ein Wort verstand. Gegen 23 Uhr kamen endlich die Gendarmen aus Mayrhofen: Revierinspektor Franz Eicher, der Postenkommandant, Revierinspektor Johann Weiler und Rayonsinspektor August Feistmantel. Sie gingen mit ihm in einen Nebenraum, wo sie zunächst seine Personalien aufnahmen. Philipp Halsmann, gebürtig aus Riga, Lettland, Student an der Mechanischen Abteilung der Technischen Hochschule in Dresden, legitimiert mit einem gültigen lettischen Reisepaß. Der Tote sei sein Vater, Morduch Max Halsmann, Zahnarzt in Riga. Dann wurde er von Revierinspektor Weiler durchsucht. Der Beamte fand weder am Körper noch an der Kleidung Blutspuren. Einer der Beamten nahm ihm den Photoapparat ab.
Bei dieser ersten Vernehmung gab Philipp folgende Schilderung des Hergangs zu Protokoll:
»Bis zur Dominikushütte ging ich hinter meinem Vater und nachher vor ihm. Ungefähr eine Viertelstunde von der Dominikushütte auf dem Wege gegen Breitlahner geschah um ca. 14.30 h das Unglück. Ich war ca. 5 bis 12 Meter voraus, als ich einen kurzen Aufschrei meines Vaters hörte. Als ich mich nach ihm umsah, sah ich ihn gerade rücklings über den Weg fallen, und schon lag er unten im Bachbett. Ich ging sofort zur Stelle zurück, wo der Absturz erfolgte, bzw. einige Schritte weiter, und stieg dann schräg zum Bach ab, wo der Vater lag. Schon nach 2 bis 5 Minuten war ich dort. Der Vater lag auf dem Bauche mit dem Gesichte im Wasser. Sein Kopf war voll Löcher, aus denen das Blut rann. Den Rucksack hatte er noch am Rücken und mein Hemd zwischen den Trägern durchgezogen. Hemd und Rucksack waren voll Blut. Als ich den Kopf aufhob und etwas zur Seite drehte, bemerkte ich, daß der Vater noch atmete und die Finger bewegte. Ich versuchte mit aller Anstrengung, ihn so weit aus dem Wasser zu ziehen, daß er wenigstens nicht ersticken sollte. Den Kopf konnte ich etwas auf die Seite aus dem Wasser drehen; ganz aus dem Wasser brachte ich den Körper nicht, weil er mir zu schwer war.«
Postenkommandant Eicher forderte Halsmann auf, seine Entfernung vom abstürzenden Vater im Vergleich zur Länge des Zimmers zu beschreiben, in dem die Vernehmung stattfand (das Zimmer maß 4,5 Meter). Der Verdächtige sagte, die Entfernung habe vermutlich etwas mehr als Zimmerlänge betragen.
Als Eicher ihn fragte, ob der Vater einen größeren Geldbetrag mitgeführt habe, antwortete Philipp, in einer Geheimtasche in der Hose habe er etwa tausend Reichsmark gehabt, außerdem eine Geldbörse mit fünfzig Schilling, die im Rucksack war. Eicher zeigte ihm den Rucksack, in dem sich tatsächlich eine schwarze Geldbörse fand, die allerdings leer war. Philipp sagte, die fünfzig Schilling müßten aber noch da sein. Eicher war es unangenehm, daß die Börse leer war, weil er befürchten mußte, einer der einheimischen Helfer oder gar ein Beamter könnte in Verdacht geraten, das Geld entwendet zu haben. Schließlich wollte der Postenkommandant noch wissen, ob der Tote versichert war. Das wußte Philipp nicht. Später stellte sich heraus, daß sein Vater keine Lebensversicherung abgeschlossen hatte.
Insgesamt waren seine Aussagen sehr belastend für Philipp Halsmann, der, in Unkenntnis der Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuteten, hartnäckig an der Unfallversion festhielt. Nach Abschluß der Vernehmung wurde er »wegen des dringenden Verdachtes des Mordes an seinem Vater namens Morduch (Max) Halsmann, Zahnarzt in Riga« verhaftet und in das Zimmer Nummer 30 im zweiten Stock des Gasthofes gebracht, das nach Norden auf einen Schuppen schaute. Revierinspektor Weiler wurde abkommandiert, zur Bewachung die Nacht im selben Zimmer zu verbringen. Weiler sagte später aus, Halsmann sei verhältnismäßig gefaßt gewesen. Er klagte immer nur, wie schrecklich das Unglück sei, auch sagte er, es sei kein Dritter dabei gewesen. Für Weilers Meinung über den Fall interessierte er sich nicht, dafür umso mehr für dessen Ausrüstung: Er wollte die Schließketten sehen, die der Gendarm bei sich hatte, und ließ sich den Inhalt seiner Patrouillentasche zeigen. Der Verdächtige schlief ruhig.
Am späten Nachmittag des 10. September war der Gendarmeriebeamte Otto Moser, vom Hochfeiler kommend, im Furtschaglhaus eingetroffen, wo er durch einen Boten vom Unfall verständigt wurde. Moser, ein besonders im Gebirgsdienst ausgebildeter Beamter, der sich amtlich »Gendarmeriehochalpinist« nennen durfte, hatte eine vierzehnstündige Diensttour hinter sich und war vor Müdigkeit außerstande, weiterzugehen.
Er brach früh am Morgen des nächsten Tages auf und eilte ins Tal. Unterwegs traf er den zwölfjährigen Hüterbuben von der Schlegeisalm, Alois Graus, der dem Beamten von seiner Begegnung mit den beiden Fremden erzählte, von denen der eine später verunglückt war. Er sei hinter ihnen hergegangen, habe sich aber nicht an sie herangetraut, weil sie lautstark gestritten hätten. Besonders der junge Mann habe dabei heftig mit den Armen herumgefuchtelt. Er habe sich vor ihm gefürchtet, sagte der Hüterbub.
Die Beamten Eicher und Feistmantel gingen am Morgen des 11. September vom Breitlahner zum Tatort (inzwischen sprach keiner mehr von einer Unfallstelle). Die Leiche lag so, wie man sie zurückgelassen hatte, auf dem Bauch, bedeckt mit Farnen, die Füße bis zu den Knöcheln im Wasser. Sie war bekleidet mit violettgestreiftem Hemd, weichem weißen Umlegekragen, kurzer weißer Unterhose, karierter Knickerbockerhose, violettgestreiften Strümpfen, grauen Socken, braunen Bergschuhen und braunem Pullover.
In einem in der Hose eingenähten Leinensäckchen fanden sie einen Geldbetrag von 1060 Reichsmark und einen Reisepaß, lautend auf Morduch Halsmann, Zahnarzt in Riga, und in der Hosentasche eine kleine braune Geldbörse mit 2,80 Schilling. Die Leiche wies am rechten Hinterhaupt ein hühnereigroßes tiefes Loch und auf der Stirn, zwei Zentimeter über der Nasenwurzel, eine sieben Zentimeter lange und zwei Zentimeter breite klaffende Wunde auf. Bei beiden Wunden war der Knochen durchgeschlagen. An der Schädeldecke stellten sie weitere kleinere Wunden fest. Die übrigen Körperteile untersuchten sie nicht, weil es dazu nötig gewesen wäre, die Leiche zu entkleiden. Das wollten sie der Gerichtskommission überlassen, die sich schon auf dem Weg ins Zillertal befand.
Im Bericht des Gendarmeriepostenkommandos Mayrhofen an das Landesgericht in Innsbruck vom 13. September 1928 wurden die ersten Eindrücke festgehalten: