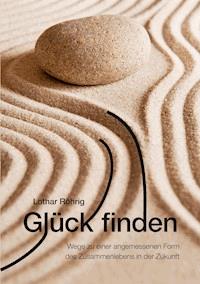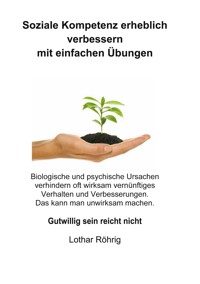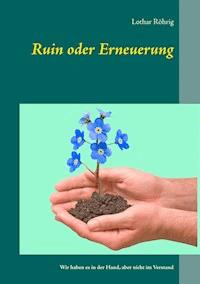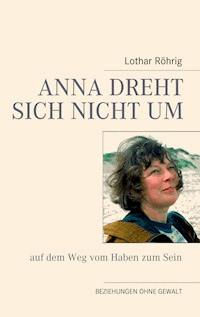
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte von Anna, jedoch auch eine praktische Anleitung über individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für moderne Menschen. Anna ist eine moderne, intelligente Frau. Sie führt ein „normales“ Leben, bis sie erkennt, dass ihre persönliche Entwicklung stagniert und die Veränderungen der Gesellschaft ihr zu viel Kopfzerbrechen bereiten. Energiegeladen und hartnäckig beschäftigt sie sich mit aktuellen Problemen des Zusammenlebens und der persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten. In vielen Einzelschritten entwickelt sie sich weiter bis zu einer unbekannten Qualität. Bewundert und hoch geachtet wird sie ein nachahmenswertes Modell und ein Vorbild für nahezu alle Bekannten. Sie hinterlässt in ihrer Familie und in der Arbeitswelt ein Muster, das ein menschengerechteres Zusammenleben ohne Gewalt möglich macht. Anna lädt ein, zu suchen, zu spüren und mitzumachen. Eine neue Form des Zusammenlebens wird möglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Okay, dann benehmen wir uns eben wie Primaten!
Einfluss gibt es auch im Beruf
Das Dominanzstreben ist angeboren!
Politiker machen das nicht anders.
Gewaltfreiheit?
Du bist ok, dein Verhalten aber nicht!
Gibt es dann noch erforderliche Reste?
Wo stehen wir?
Peters Idee, sich selbst zu erkennen!
Brief eines unbekannten Studenten
Okay, dann benehmen wir uns eben wie Primaten!
Anna steht verärgert im Wohnzimmer und schimpft in Richtung ihres Mannes: „Okay, dann benehmen wir uns eben wie Primaten.“
„Soll das heißen, ich verhalte mich wie ein Affe, oder wie meinst du das jetzt wieder?“, erregt sich Hans unangemessen laut.
„Ja genau, das meine ich. Wenn wir immer nur unsere Machtkämpfe austragen, unterscheiden wir uns doch nicht von unseren Verwandten.“
„Weißt du überhaupt, wie Affen sich verhalten?“
„Ja natürlich, genau wie du eben!“
Jetzt ist er beleidigt und sagt vorläufig nichts mehr, ihr geht es genauso. Es hat wieder einmal „funktioniert“. Sie weiß genau, jetzt werden sie sich für einige Stunden anschweigen. Diese Situation ist typisch. Nachher tut es beiden leid, aber immer wieder geschieht so etwas. Aus einer harmlosen Situation entsteht Streit, das Klima wird vergiftet. Die in den ersten Jahren ihrer Ehe vorherrschende Harmonie ist nicht mehr vorhanden. Klar, sie lieben sich immer noch, aber etwas hat sich verändert. Hans ist nicht mehr so aufmerksam wie früher, belehrt sie häufig über alltägliche Dinge und kritisiert ihr Verhalten. Das war früher anders. Es trifft sie jedes Mal tief in ihrem Innern. Diese kleinen Wunden und Schmerzen vergiften ihr Gefühl und machen sie unsicher und unzufrieden. Zurzeit wird ihre Unzufrieden noch verstärkt. Mit viel Mühen hatte sie sich in den letzten Jahren auf einen neuen Weg begeben. Ziel ist eine Loslösung von der üblichen fremdgesteuerten Konsum- und passiven Habenphilosophie. Dazu hatte sie schon erfolgreich die Bedeutung von Handy und PC und andere Dinge des Besitzes eingeschränkt und sich ein gutes Stück weit befreit. Sie spürt genau ein Nachlassen der Abhängigkeit, eine Verringerung einer gewissen Unersättlichkeit und Entmündigung. Alles hat sich verbessert. Nun will sie sich dem produktiven Schwerpunkt „Sein“ und der Entfaltung eigner Fähigkeiten nähern mit Selbstsein und Selbstwirksamkeit. Dazu hat sie die schönsten Gedanken und Einzelheiten parat. Es stört sie sehr und lässt sie verzweifeln, dass ihr diese großen Schritte einigermaßen gelingen, aber die alltäglichen Kleinigkeiten in Beziehungen, in der Kommunikation, im Streit und bei Kränkungen nicht wirklich gut funktionieren. Sie spürt deutlich, dass sie das so nicht will. Ihr ist vollkommen klar, dass sie mit den Alltagsdingen beginnen muss und dass es sonst nicht wirklich weiter geht. Deshalb soll das vorgezogen werden. Außerdem wird Hans auf das Thema Primatenverhalten zurückkommen. Er wird sich wie immer informieren und sich mit ihr darüber austauschen wollen. Sie will dann nicht unwissend, möglicherweise gekränkt sein. Sie möchte nicht wieder belehrt werden und informiert sich auch über das Verhalten von Primaten. Sie liest:
Wie verhalten sich Primaten? Primaten bevorzugen kleine Gruppen. Die Mitglieder der Gruppe, im Schnitt bis zu 10, bilden sogenannte Rangreihen, also Affe 1 bis Affe 10. Das heißt, dass sie sich sowohl ihrer Stellung in der Rangfolge als auch der Position der höher gestellten Gruppenmitglieder bewusst sind. Streit gibt es sehr selten und wenn nur in Rangnähe. Es genügt eine Drohung, um klarzumachen, wer höher steht. Normalerweise halten sich alle an die einmal festgelegte Reihenfolge. Das Ergebnis ist eine Aggressionslosigkeit für eine bestimmte Zeit und in der aktuellen Situation eine genaue Gewaltkontrolle. Die Regeln werden eingehalten.
Je höher aber der Rang ist, um den gekämpft wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer neuen Auseinandersetzung. Dabei kommt es jedoch sehr selten zu einem körperlichen Angriff, da die Verletzungsgefahr ein zu hohes Risiko für den angestrebten Erfolg bedeutet, nämlich die eigenen Gene weiterzugeben, also für die Genfitness. Drohungen, Imponiergehabe und Zurechtweisungen reichen daher normalerweise aus und verhindern das in den meisten Fällen. Themen der Auseinandersetzungen sind Futter oder Fortpflanzung. Dieses soziale Verhalten zeigen auch andere Lebewesen, wie z.B. die Haushühner. Mit einer Art Hackordnung sorgen sie für geregelte Abläufe.
Anna denkt: „Das ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit mir und den Menschen zu tun, insbesondere mit Hans und mir? Welche Verhaltensweisen sind gemeint? Bei uns geht es nicht bloß um Genfitness, sondern um Lebensplanung. Und natürlich auch darum, wer aktuell Recht hat.“ Sie liest weiter:
Der Großteil der Menschen lebt ebenfalls in solchen Rangordnungen. Nahrung zu sichern und Gene weiterzugeben ist zwar nach wie vor wichtig, doch das genügt dem modernen Menschen nicht mehr. Er sucht ständig nach Möglichkeiten, um in den ersten Rängen mitzuspielen.
Das Ergebnis ist eine unüberschaubare Zahl von anderen Rangreihen, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und auf der Arbeit. Dadurch entstehen neue Fragen. Wer sieht am besten aus? Wer wird vom Chef am meisten geachtet? Wer kann sich am meisten erlauben? Wer ist der Attraktivste, der Coolste? Jeder ist frei darin, sich Rangreihen einzubilden. Diese müssen nicht unbedingt der Realität entsprechen. Es genügt, daran zu glauben. Völlig unsinnig wird es dadurch, dass diese Rangreihen nicht mit den Mitmenschen abgestimmt werden. Anders als in der Natur wissen die Mitmenschen jedoch häufig nicht, um welche Ränge es gerade geht, kennen das Thema nicht und können sich aus diesem Grund nicht darauf sinnvoll einstellen. Missverständnisse, Kränkungen und vor allem Aggressionen nehmen somit automatisch zu. Oft ist den Streitenden nicht einmal bewusst, warum es gerade „knallt.“ Die natürlichen Vorteile haben sich für die menschliche Rasse in massive Nachteile verwandelt.
Das ist auch in Annas Ehe ähnlich. Sie ist nun schon zwei Jahre verheiratet. Die ersten Monate waren extrem schön, sie hatten viel Spaß und konnten das Zusammensein sehr genießen. Ihre Situation war so erfüllend, wie sie es sich es immer vorgestellt hatte.
Doch ohne erkennbaren Grund verschlechterte sich die Situation immer mehr: Häufig kam es nun zu Streit wegen Kleinigkeiten. Im Nachhinein versteht Anna dann nicht, warum sie sich wegen solcher Unwichtigkeiten überhaupt streiten konnte.
Einmal ist es die Zahnpastatube, die Hans immer in der Mitte zusammendrückt und damit verunstaltet, ein andermal die Abstimmung für das Wochenende. Beide werfen sich gegenseitig vor, bestimmen zu wollen oder mit allem unzufrieden zu sein. Sie versteht nicht, warum die schöne Zeit von einer getrübten abgelöst wird.
Sie kann sich noch gut an die Zeit des Kennenlernens erinnern. Da waren auch schon Kleinigkeiten, die sie jeweils am anderen nicht unbedingt mochten, aber das war ohne jede Bedeutung. Damals war alles schön. Das Große und Ganze stimmte.
Jetzt bekommen diese ehemals unwichtigen Kleinigkeiten eine immer größere Bedeutung. Es ist so, als würde man eine Lupe zu Hilfe nehmen, um möglichst alles genau mitzubekommen und um alles groß und bedeutend wahrzunehmen. Aus Unwichtigem wird langsam Unerträgliches:
„Wie häufig habe ich dich schon gebeten, deine Socken nicht auf den Boden zu werfen? Bekommst du das gar nicht mit?“
„Du hast vielleicht Probleme, du hast wohl Langeweile. Du solltest mal meine Arbeit machen.“
Besonders nervig findet sie, wenn Hans sie belehren will, wenn er ihr erklärt, wie sie alles richtig machen sollte. Ihr Ton ändert sich dann sofort und wird feindselig.
Die Versuche, den Partner zu belehren, auch zu drohen und verbale Gewalt anzuwenden, zu dominieren, zu sagen, was anders gemacht werden soll, nehmen auf beiden Seiten zu. Sie vernichten langsam aber sicher die Reste der Zuneigung.
„Dafür ist die Beziehung zu wertvoll und die Liebe zu schön und zu erfüllend“, denkt sie. Die nächsten Wochen verbringt Anna nun häufig damit, nach Lösungen zu suchen. Bestätigungen und allgemeine Ratschläge findet sie genug. Hans meint, dass ihre Situation normal sei, dass es anderen auch so gehe. Es gebe eben immer Missverständnisse, häufig ohne jede Absicht. Um das zu bekräftigen, erzählt er dieses Beispiel:
Zwei junge Männer leihen sich ein Cabrio und fahren fröhlich einen Berg hinauf. Ihnen kommt eine attraktive Blondine ebenfalls in einem Cabrio entgegen. Hocherfreut zeigen die beiden ihre Kontaktfreudigkeit. Als sie auf gleicher Höhe sind, schreit die Frau: „Schweine!“
Beide sind entsetzt, erschrocken und anschließend sehr verärgert. Sie unterhalten sich und schimpfen, was sie doch für eine Schlampe sei. Sie biegen um die nächste Kurve und verunglücken, als sie in eine Rotte von Schweinen hineinrasen.
Haben sie damit den Grund für die Verschlechterung in ihrer Ehe gefunden? Handelt es sich lediglich um ein Kommunikationsproblem?
Hans meint scherzhaft: „Wenn die Frau sich klar ausgedrückt hätte, wäre das nicht passiert.“
Annas Stimmung schlägt um, und sie schreit ihn an: „Das ist typisch, du meinst auch immer, dass die anderen Schuld haben.“
Wieder ist die Stimmung vergiftet, beide sind erschrocken, entsetzt und haben hinterher ein schlechtes Gewissen. Sie sind traurig. Warum muss das immer so sein? Gibt es denn keine Lösung?
Anna will so nicht weitermachen. Mit anderen darüber zu reden ist ihr peinlich. Sie weiß nicht, an wem oder an was es liegt. Sie liest alles, was sie über dieses Thema finden kann. Doch sie findet keine für sich anwendbare Lösung. Allgemeine Ratschläge helfen ihr nicht. Langsam sinkt ihr Mut, und ihr Wille, etwas zu ändern, schwindet. Diese Entwicklung macht sie noch unglücklicher und verzweifelter. Ängstlich denkt sie: „Geht alles so zu Ende? Soll das so weitergehen? Werden wir uns vielleicht auch bald trennen wie unsere Freunde?“ Das will sie nicht.
Eine völlig unerwartete Änderung tritt bei einer Feier ein. Viele Bekannte und Verwandte sind zu einer Hochzeitsfeier versammelt. Anwesend ist auch Peter, ein guter Freund aus Studienzeiten. Sofort verstehen sie sich so gut wie früher. Beide freuen sich und unterhalten sich vertieft und angeregt. Mit vielen guten Gefühlen erinnern sie sich an gemeinsame Erlebnisse, lachen häufig und können die alten Geschichten gar nicht genug ausschmücken. Doch nach einiger Zeit geht ihnen der Erinnerungsstoff aus, und die Gegenwart bekommt mehr Bedeutung. Peter ist mittlerweile Therapeut geworden.
Innerlich bewegt und von einem warmen, sicheren Gefühl geleitet, entschließt Anna sich, ihr Problem zu schildern. Peter hört still zu, lächelt zwischendurch, als würde er die Inhalte gut kennen. Nach einigen Nachfragen sagt er: „Das ist heute sehr häufig bei Paaren so. Die Problematik ist bekannt und ausführlich untersucht. Veränderungen sind möglich, erfordern jedoch zunächst einige Kenntnisse über das dahinterliegende Beziehungssystem und anschließend viel disziplinierte Arbeit.“
Erschreckt denkt Anna: „Erst lernen und dann noch viel arbeiten?“
Peter fährt fort: „Dann kann daraus wieder eine erfüllende Beziehung und eine außergewöhnliche Tiefe erwachsen, sogar häufig tiefer und besser als zuvor.“
Natürlich will Anna mehr wissen und die notwendige Arbeit gern investieren. Dazu ist sie jetzt bereit, ist neugierig und voller neuer Hoffnung und vereinbart mit Peter gleich einen ersten Gesprächstermin, an dem zunächst Ursachen und Zusammenhänge geklärt werden sollten. Er erklärt:
Der Wunsch nach einer erfüllenden Partnerschaft ist zutiefst menschlich, psychisch notwendig und basiert auf einer sehr persönlichen Vorstellung von einer solchen Wunschbeziehung. Dieses Idealbild ist natürlich nicht bei allen Menschen gleich. Möglicherweise haben die Partner ganz unterschiedliche Vorstellungen. Solche Unterschiede genügen für ungewollte Missverständnisse, Enttäuschung, Frust und Verärgerung.
Das will Anna nun genauer wissen und fragt: „Wie kann ich das denn mit Hans bearbeiten?“ Peter lacht und sagt: „Ihr müsst darüber sprechen!“
„Aber das tun wir sehr häufig, und es endet beinahe immer in Streit.“
Peter schlägt vor, sie solle einmal so mit ihm sprechen, als sei er Hans. Anna fängt nach kurzem Zögern an und schildert, was Hans ihrer Meinung nach falsch macht, was sie sich anders wünscht und wie es für sie richtig wäre.
Peter alias Hans relativiert, schwächt ab, rechtfertigt sich und trägt anschließend ähnliche Dinge vor, die ihm nicht passen. Anna verliert etwas Farbe aus dem Gesicht, wird sauer und um einiges lauter: „Siehst du, es ist genau wie immer, du weißt alles besser!“
Peter bricht das Rollenspiel ab und fragt: „Was ist denn da gerade passiert?“
„Du hast genau wie Hans reagiert.“
„Ja, ja, aber was habt ihr gemacht?“
Es dauert nicht lange, dann ist Anna klar, dass sie sich gegenseitig Vorwürfe gemacht hatten und nicht aufeinander eingegangen waren. Jeder hatte nur seine eigenen Sachen bearbeitet. So kann das natürlich nicht funktionieren.
Anna erkennt auch ziemlich schnell, wie das geändert werden kann. Sie könnten beispielsweise ihre Kommunikation verbessern1, mit Hans zusammen solche Gespräche erlernen oder mit therapeutischer Hilfe Veränderungen herbeiführen. Natürlich bedeutet das viel Arbeit.
„Du kannst in Ruhe deine nächsten Schritte überlegen und dich entscheiden. Du kannst mit Hans sprechen und versuchen, ihn zum Mitmachen zu bewegen. Vorher solltest du dir etwas Wissen über Beziehungsarten und über die verschiedenen Vorstellungen von erfüllender Liebe aneignen“, sagt Peter und erklärt weiter:
Bei einem Versuch, die Unterschiede zwischen den Vorstellungen von Liebe und Beziehung bei Männern und Frauen herauszufinden, stellten sich relativ unabhängige Bereiche heraus, nämlich fünf unterschiedliche Sprachen der Liebe2.
Lob und Anerkennung
Zweisamkeit – die Zeit mit dir
Geschenke, die von Herzen kommen
Hilfsbereitschaft
Zärtlichkeit
Erste Anwendungen zeigen, dass diese fünf Bereiche von Männern und Frauen sehr verschieden wichtig genommen werden. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrung und erworbenen Haltung haben Ehepartner häufig unterschiedliche Vorlieben, Schwerpunkte und Erwartungen. Wenn sie das voneinander nicht wissen, ist eine Erfüllung der Beziehung auch bei guter Absicht gar nicht möglich. Sie reden, leben und kommunizieren mehr oder weniger aneinander vorbei, ärgern und enttäuschen sich gegenseitig. Nicht selten kommen dann die ersten Zweifel über die Liebe auf. Zuerst müssen wir deshalb in Erfahrung bringen, was unserem Partner wichtig ist. Wenn man wirklich Nähe und Tiefe in einer Beziehung herstellen will, muss man die Bedürfnisse des anderen gut kennen lernen. Man kann Wut, Aggression oder Enttäuschung und Trauer aus der Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber als Teil der bisherigen Lebensgeschichte bewusst akzeptieren. So war es eben bisher. Liebe führt kein Buch über die Missetaten des Partners. Vergebung ist deshalb kein Gefühl, sie ist eine bewusste heilsame Entscheidung. Wenn wir einander lieben wollen, müssen wir zunächst wissen, was der andere benötigt und sich wünscht.
Anna ist bereit, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Peter gibt ihr einen Fragebogen3 mit. „Wenn ihr beide den ausgefüllt habt, könnt ihr eure persönlichen Schwerpunkte erkennen. Dann müsst ihr nur noch darüber sprechen, aber nicht über das, was früher war, sondern darüber, was ihr aktuell unter Liebe versteht und was ihr konkret in der nächsten Zeit tun könnt.“ Anna verspricht, mit konkreten Ergebnissen wiederzukommen und bedankt sich, innerlich aufgewühlt und voller Hoffnung.
Ihre Angst, Hans könnte nicht mitmachen, ist völlig unbegründet. Sehr zügig füllen sie schon am nächsten Abend den Fragebogen aus und betrachten gemeinsam die Ergebnisse. Es macht Hans sogar Spaß.
Peter hatte Recht, sie haben ziemlich verschiedene Vorstellungen von einer liebevollen Beziehung. Hans hat einen deutlichen Schwerpunkt bei Lob/Anerkennung und bei Zärtlichkeit, sie bei Gemeinsamkeit, Zärtlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also sind sie doch sehr unterschiedlich in ihren Erwartungen. Nur Zärtlichkeit ist für beide anscheinend gleich wichtig. Als sie darüber diskutieren, was sie beide hier mehr und besser machen könnten, stellt sich zusätzlich heraus, dass Anna dabei auf mehr Körperkontakt, Streicheln und Wärme Wert legt, Hans aber sehr stark auf Sex fokussiert ist.
In den nächsten Tagen brauchen sie mehrere Versuche, bis sie eine gemeinsame Formel finden, die sie erfolgreich ausprobieren. Als sie die anderen, noch fehlenden Bereiche mit einbeziehen, findet ihre Ehe zu einer anderen, aber ähnlich tiefen Erfüllung zurück, wie es in den ersten Monaten war.
Anna ist sehr dankbar, berichtete Peter von dem tollen Erfolg und willigte ein, einen kleinen Erfolgsbericht mit den konkreten Vereinbarungen zu verfassen:
Wir haben zunächst eine Liste angelegt mit den Wünschen und Schwerpunkten von uns beiden. Vorgenommen haben wir uns auf die individuellen Wünsche des Partners genauer einzugehen, täglich Zeit für einen Gedankenaustausch einzuhalten, in dem ein bis drei Erlebnisse des Tages und die damit verbundenen Gefühle ausgetauscht werden und einmal in der Woche, am Mittwoch, wenn wir in die Sauna gehen, darüber zu sprechen, wie es uns gelungen ist, alles einzuhalten oder was noch zu verbessern wäre. So können wir dann unsere Erfolge sehen und weiter bearbeiten. Andere Themen sind dann nicht zugelassen, weil sie ablenken.
Peter spart wegen dieser Fortschritte nicht mit Lob. Er findet die gefundenen Punkte ausgesprochen gelungen und vielversprechend. Er meint, wenn sie diese Absprachen einhalten, könne so schnell nichts mehr passieren. Anna hingegen, natürlich einigermaßen stolz auf das Geleistete, fragt hoch motiviert trotzdem nach mehr. So ist sie, einmal Feuer gefangen, will sie das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Peter beschwichtigt, doch er kennt Anna gut genug von früher. Sie würde sowieso nicht locker lassen, so war sie schon immer. Also ergänzt er die bisherigen Arbeitsschritte mit einem neuen Thema, das gut dazu passen könnte. „Da ihr das alles so gut hinbekommt, könntet ihr noch jeweils eine Liste anlegen von den Vorzügen des anderen und auch darüber sprechen.“
Anna findet das erst nach einigem Nachdenken gut. Beschwingt und getragen von den schönen Erfolgen wird die Liste aber schon beim nächsten Saunaabend erstellt und mit den schönsten Gefühlen gegenseitig vorgestellt. Auch der darauf folgende Liebesabend ist von einer so erfüllenden Tiefe, dass Anna noch am nächsten Tag, wenn sie daran denkt, den Freudentränen nahe ist.
„Streit, Enttäuschung, Wut und Aggression haben nun ein Ende. Das Ziel unserer Liebe ist nicht, nur die eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, sondern zum Wohlergehen des Partners beizutragen. Das tut auch mir gut, das spüre ich genau. Ich tue dann auch etwas für mich und verschenke etwas von mir und meinem Leben. Wichtig ist Zuwendung, Wachsamkeit und ungeteilte Aufmerksamkeit.“
Glück ist, zu lieben! Geliebt zu werden ist selbstverständlich auch angenehm und wichtig. Die Wirkung ist aber eine andere. Es macht eher zufrieden, was auch nicht unwichtig ist, aber lieben macht vermutlich glücklicher.
Es verstreichen einige Monate voller Harmonie und Nähe. Privat steht alles zum Besten. Sie fühlt sich voller Energie und Tatendrang. „So kann es bleiben“, denkt sie. Ihre Bekannten bekommen das Stimmungshoch mit und wissen nicht, ob sie neidisch oder misstrauisch sein sollen.
Zu dieser Zeit weiß Anna allerdings noch nicht, was noch alles passieren wird. Denn so wird es nicht bleiben.
Es ist erstaunlich, wie deutlich sie jetzt ihre alten Verhaltensweisen in der Vergangenheit sieht. Da gab es unnötigen Ärger, Kränkungen mit Wut, verbaler Gewalt und Aggression. Sie denkt häufig, wie unnötig das alles war und wie wenig das zum Menschen als „Krone der Schöpfung“ passt. Sie erinnert sich an den vergangenen Streit, bei dem sie Hans beschuldigt hatte, sich wie ein Primat zu benehmen. Diese alten Verhaltensweisen fallen ihr jetzt sehr stark in ihrer Umgebung auf. Sie tauchen an allen Stellen auf. Unglaublich, dass das so häufig und so krass vorkommt. Warum sind die Menschen nur so?
Die zuvor gewonnene Erkenntnis, dass Glück mit Liebesfähigkeit verbunden ist, hat bei ihr eine neue Einstellung zu anderen Menschen verursacht. Sie ist nun grundsätzlich bereit, anderen liebevoller entgegenzutreten. Umso schmerzhafter ist jetzt die Beobachtung der Realität, die Erkenntnis, wie schwer es werden wird. Missverständnisse und Streit sind so etwas wie der Normalfall.
Einfluss gibt es auch im Beruf
Besonders fällt es in ihrem Beruf auf. Primatenverhalten kommt häufig vor, und die Natur mit ihren Rangkämpfen kann sehr dominant sein. Der Mensch kann nur mit viel Mühe und Zielstrebigkeit über seine Kultur und Erziehung Verbesserungen und für Menschen tauglichere Verhaltensweisen erlangen. Es geht also um den „normalen“ Gegensatz zwischen Natur und Kultur oder um Biologie und solidarische Fürsorge, letztlich um menschenwürdiges und menschengerechtes Verhalten.
Erst gestern hatte Anna ein dazu passendes Erlebnis. Sie diskutierte am Rande des Schulhofes in ihrer Rolle als Sozialarbeiterin der Stadt mit dem Kontakt- und Bezirksbeamten der Polizei und mit dem Schulleiter über einen unangenehmen Vorfall. Zwei Schüler hatten einen anderen zusammengeschlagen und auf dem Boden liegend mit Fußtritten bearbeitet. Andere Schüler versuchten vergeblich zu schlichten. Erst der herbeigeeilte Sportlehrer konnte die Sache beenden. Einer der „ausgeflippten“ Schüler war so aggressiv, dass er wie von Sinnen um sich schlug und auch den Lehrer angriff. Erst nach ca. zehn Minuten konnte er sich auf ein Normalmaß beruhigen.
„Es kommt immer häufiger vor, dass Grenzen nicht mehr eingehalten werden“, meinte Anna. „Ja, da ist ein kühler Kopf, Autorität und Macht notwendig, wie hier z.B. durch den Sportlehrer“, bekräftigte der Schulleiter. „Leider nimmt diese Gewalt immer weiter zu“, sorgte sich der Polizeibeamte und schüttelte missbilligend den Kopf. „Das ist alles für mich ziemlich hoffnungslos. Selbst der kürzlich gegründete ‚Runde Tisch gegen Gewalt‘ hat praktisch so gut wie nichts erreichen können.“
Nach einer kurzen Pause voller Ratlosigkeit meinte Anna: „Die ansteigende Gewalt in unserer Gesellschaft beunruhigt mich auch sehr. Ich habe Bedenken, dass sich alles in eine gefährliche Richtung entwickelt.“
„Das sehen wir hier in der Schule auch so“, bekräftigte der Schulleiter. „Wir schicken den Eltern jedes neuen Schülers deshalb eine Art Vertrag, in dem wir auf gewaltlose Erziehung bestehen.“
Anna wollte ruhig bleiben, sie spürte aber deutlich, dass sie immer wütender wurde. „Erziehung ohne Gewalt gibt es eigentlich gar nicht, das ist eine typische Verharmlosung!“ Das klang nicht so friedfertig, wie sie beabsichtigt hatte. Bevor der Schulleiter aber etwas verärgert antworten konnte, nutzte der Polizist die Gelegenheit zur Beschwichtigung und schlug vor: „In den Gesprächen, die ich mitbekomme, wird über Gewalt, Macht und Aggression sehr unterschiedlich diskutiert. Die verschiedenen Worte werden ungleich benutzt. Ich glaube, vielen ist nicht klar, wie sich die Inhalte hinter den Worten unterscheiden und welche Besonderheiten jeweils vorliegen und beachtet werden müssten. Das erschwert eine sinnvolle Diskussion und verhindert vor allem praktikable Lösungsansätze. Häufig wird so aneinander vorbei geredet. Wir sollten hier vielleicht für mehr Klarheit und Eindeutigkeit sorgen.“
Anna stimmte zu. Um sich zu verstehen, müssen die Begrifflichkeiten klar sein. Sie dachte einen Moment nach und überprüfte, was sie über diese Begriffe wusste. Sie erkannte, dass sie die Bedeutungen auch nicht klar unterscheiden konnte. Wie es ihre Art ist, sucht sie zuhause nach einer Unterlage, die das klärt.
Macht bezeichnet lediglich ein Potential, eine Möglichkeit, Einfluss auszuüben. Das kann mit Geld zu tun haben, mit Größe oder körperlicher Stärke. Auch gute Beziehungen bieten Machtmöglichkeiten. So können einzelne Menschen Macht haben, aber auch Organisationen, wie die Polizei, Konzerne und Staaten. Diese Macht muss nicht tatsächlich vorhanden sein. Es genügt, wenn andere daran glauben. Macht macht nichts, wenn sie nicht genutzt wird. Es hält andere Menschen allerdings in einem gewissen Umfang von Provokationen ab. Einen mächtigen Gegner attackiert man so schnell nicht. Gewalt in diesem Sinne ist aber ein aktives Verhalten. Sie wird benutzt, um zu beeinflussen und Wirkung auszulösen. Ziel solcher Gewalt ist, andere zum Unterlassen oder zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Sie kommt extrem häufig vor, stellt aber nur eine kleinere Teilmenge der Macht dar (siehe Skizze).
Wiederum ein kleinerer Teil dieser Gewalt tritt in Form der Aggression auf. Sie hat ähnlichen Inhalt. Das Ziel ist aber jetzt neben Verhaltensbeeinflussung, einen Kampf zu gewinnen, zu dominieren, den anderen zu unterwerfen, zu verletzen oder zu schädigen.4
Aggression ist meistens gemeint, wenn von zu viel „Gewalt“ geredet wird. Das verschleiert die tatsächlichen Ziele und verharmlost die Motive. Die große Menge an Gewalt und Aggressionen in der heutigen Zeit wird leider unterschätzt. Mittlerweile ist der größte Teil unserer Sprache gewaltorientiert oder sogar aggressiv. Das drückt sich besonders in unserer „normalen“ Alltagssprache aus. Möglicherweise fällt es nicht auf, weil wir damit aufgewachsen sind und uns daran gewöhnt haben. Erst bei genauem Hinsehen und Analysieren bekommt man einen Schreck, wie viel Gewalt tatsächlich enthalten ist. Es ist die Gewalt der Eltern, die ihre Kinder zu bestimmtem Verhalten anhalten. Es sind die Schulen, die Schülern vorschreiben, was zu tun ist. Polizei, Finanzamt, Vorgesetzte, Eheleute, alle wenden in diesem Sinne Gewalt an. Selbst wenn jemand festgehalten wird, um vor einem herannahenden Auto beschützt zu werden, ist das eine Form der Gewaltanwendung.
Aber bereits hier wird deutlich: Gewalt kann auch etwas Gutes bewirken, einen Nutzen für die betroffenen Personen haben. Ist es schlimm, wenn ich meine kleine Tochter gegen ihren Willen zwinge, eine Zahnspange zu tragen? Sie wird mir das für längere Zeit möglicherweise sehr übel nehmen, um vielleicht nach Jahren genau dafür Dankbarkeit zu empfinden.
Es scheint also Gewaltanwendung zu geben, die akzeptiert werden kann. Daher gibt es gute und schlechte, legale und illegale Gewalt. Lehrer z.B. dürfen und sollen für Ordnung sorgen und gegen den Willen der Schüler Hausaufgaben aufgeben und Zensuren verteilen, das ist aus heutiger Kultursicht legale Gewaltanwendung.
Anna erkennt, dass bei diesen Definitionen die Menge der Gewalt ungeheuer groß ist. Besonders trifft sie der Gedanke, dass jede Erziehung mit Gewalt verbunden ist. Mit einigem Schrecken wird ihr klar, dass Widerstand der Kinder gegen solche Versuche völlig normal sein muss, dass nur die Erzieher ihn als Ungehorsam, Uneinsichtigkeit und Störung empfinden, also auch hier ein Missverständnis. Möglicherweise sind die Kinder bloß gesund und verhalten sich natürlich.
Das Thema kam damals auch in ihrer Ausbildung vor. Sie hatte sich sogar ein Buch über gewaltfreie Erziehung5 gekauft, es aber nur angelesen. Damals hatte es keinerlei Bedeutung für sie gehabt. Die Fachleute hatten sich zum Teil sogar darüber lustig gemacht.
Nun aber erkennt sie Zusammenhänge an vielen Stellen des Alltags. Die Zeit ist wohl jetzt erst reif für neue Einsichten. Allerdings dürfte es sehr schwierig werden, andere davon zu überzeugen. Sie weiß, die Menschen sind auf diesem Gebiet nur schwerlich zu beeinflussen. Ermahnungen und Appelle bringen nichts. Manchmal reagieren sie aber auf besonders gute Modelle und Vorbilder. Anna achtet deshalb sehr auf ihr eigenes Verhalten. Die Menschen in ihrer Umgebung jedoch ändern ihr Verhalten so schnell nicht.
Leider ist es ja so, dass man nur das sehen kann, was man kennt, und das mit der unnötigen und überflüssigen Gewalt erkennt sie erst jetzt. Doch wenn sie es anderen erzählen oder zeigen will, stößt sie auf sehr wenig Interesse. Nicht nur auf der Straße, in der Schule oder innerhalb ihrer Arbeit ist so schnell keiner bereit, Konsequenzen zu ziehen und irgendetwas zu ändern. In nahezu allen Beziehungen sieht sie unnötige Gewalt. Immerhin ist das häufig bloß auf die Sprache beschränkt. Sogar beim „Runden Tisch gegen Gewalt“, an dem sie regelmäßig teilnimmt, ist es nicht anders. Auch hier herrscht oft ein gewalttätiger Ton des Besserwissens oder der Gleichgültigkeit, der andere verletzen kann. So krass hat sie das früher nicht wahrgenommen, diese Dimension nicht bemerkt.
Deshalb wundert es sie nicht, dass sie auch innerhalb ihrer eigenen Partnerschaft diese verunglückte Form der Kommunikation bemerkt. Dort tut es ab sofort sogar immer mehr weh. Immer öfter fallen ihr die vielen Gespräche ohne Inhalt oder mit völlig unnötigem Dominanzverhalten und Gewaltversuchen auf. Von Monat zu Monat wird sie empfindlicher gegen unnötige und unsinnige Gewalt in der Kommunikation. Sie reagiert darauf nicht mehr wie alle Mitmenschen, sondern ist sehr schnell entsetzt, traurig und abweisend. Sie sucht dann eine größere Distanz. Das passt aber nicht zu ihren Aufgaben, irritiert ihre Bekannten und lässt ihren Mann manchmal verzweifeln. Er glaubt fest an eine weibliche Überempfindlichkeit und versucht ihr das auszureden.
Aber was ist „ausreden“? Es ist nichts anderes, als sich über einen anderen Menschen zu stellen, es besser zu wissen und jemanden verändern zu wollen, und damit ist es auch eine Form von Gewalt.
Die Bekannten sind mittlerweile eher verunsichert. Manche meinen, sie wäre „schwieriger“ geworden. Was macht man mit schwierigen Menschen? Man versucht, sie zu meiden. Dabei hat sie doch nur eine Sehnsucht nach wirklicher Nähe, nach Wertschätzung und Akzeptanz.
Annas Stimmung schwankt in aktuellen Fällen zwischen Gleichmut, Traurigkeit und Verzweiflung. Ihr Leben leidet zeitweise sehr darunter. Seit ihr die Gewalt in der Kommunikation auffällt, ist es nicht mehr so einfach wie früher. Gefühlsmäßig ist es sogar viel schwieriger geworden, obwohl sie genau weiß, dass sich vieles zum Besseren entwickelt hat. Das erschöpft sie sehr. In ruhigen Stunden denkt sie traurig an ihre alten Lebenspläne und schönen Träume und vermisst diese Dinge umso schmerzlicher. Manchmal glaubt sie, wie durch einen Schleier Anfänge von neuen Wegen zu sehen. Da ist etwas, aber sie kann die Bilder nicht scharf stellen und den dünnen Nebel lichten. Das ist natürlich genauso frustrierend. Halt gibt ihr in dieser Zeit ihre gut funktionierende Beziehung zu Hans. Wenn es mit ihm geht, müsste es doch auch außerhalb funktionieren. Aber wie? Anna ist ratlos.
Da liest sie eine Anzeige in der Tageszeitung. Es soll ein Vortrag über zunehmende Gewalt stattfinden. Ihr Mann Hans will nicht mitgehen. Er teilt ihre Begeisterung überhaupt nicht: „Das zieht dich doch nur noch mehr runter. An normaler Gewalt kann man nichts verändern!“ Ihrer Freundin Petra ist es auch nicht wichtig genug. Etwas verunsichert, aber voller Hoffnung auf neue Erkenntnisse, geht sie allein.
Der Redner, ein hoher Polizeibeamter, klärt zu ihrem Erstaunen zuerst die Begriffe „Macht“, „Gewalt“ und „Aggression“, stellt dann die Frage, die sie zur Genüge schon viele Male selbst beantwortet hat: Benötigt Erziehung Gewalt und Aggression? Er referiert:
Die Polizei soll die Staatsgewalt